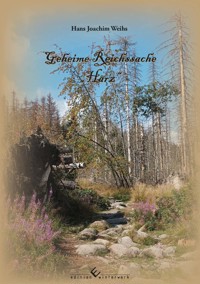
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition winterwork
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rolf und sein Freund Horst arbeiten als Jugendliche bei einem Talsperrenbau im Ostharz. Bei Grabungen stoßen sie auf eine Metallkiste mit der Aufschrift "Geheime Reichssache". Sie vermuten Schätze in der Kiste. Weil diese zu sperrig ist, um sie gleich mitzunehmen, schaffen sie ihren Fund in eine Höhle und verstecken ihn unter Geröll. Doch ehe sie die Kiste mit Werkzeug öffnen können, wird die Höhle verschlossen. Jahrzehnte später – Rolf und Horst sind inzwischen Rentner – ergibt sich die Möglichkeit, den vermuteten Schatz zu bergen. Mit der Unterstützung von Rolfs Enkel und dessen Freundin Silke treten die beiden Senioren mit einem angejahrten Barkas die Fahrt zu der Höhle an. Vor Ort stellen sie fest, dass das Tor noch immer verschlossen ist. Als Rolf und seine Begleiter nach dem Schlüssel forschen, müssen sie zunächst die anliegende Gemeinde bei einem wichtigen Anliegen unterstützen. Schließlich wird die Höhle, die auch als Cannabisplantage genutzt wurde, geöffnet. Rolf und Horst können die Kiste in ihren Besitz bringen. Wenig später wird sie ihnen gestohlen. Die daraufhin einsetzende Verfolgungsjagd endet bei der Polizei, wo auch das Geheimnis der "Geheimen Reichssache" gelüftet wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. Verwendung oder Verbreitung durch unautorisierte Dritte in allen gedruckten, audiovisuellen und akustischen Medien ist untersagt. Die Textrechte verbleiben beim Autor, dessen Einverständnis zur Veröffentlichung hier vorliegt. Für Satz- und Druckfehler keine Haftung.
Impressum
Hans Joachim Weihs
»Geheime Reichssache Harz«
edition winterwork | Carl-Zeiss-Str. 3 | 04451 Borsdorf
www.edition-winterwork.de
© 2025 edition winterwork
Alle Rechte vorbehalten.
Satz: edition winterwork
Umschlag: edition winterwork
Druck/E-BOOK: winterwork Borsdorf
ISBN Druck 978-3-98913-149-1
ISBN E-BOOK 978-3-98913-161-3
Hans Joachim Weihs
Geheime Reichssache Harz
edition winterwork
Kapitel 1
Wie jeden Montag hatte ich am Tischchen in der Fensterecke unseres Seniorenklubs Platz genommen. Das Schachspiel war bereits vor mir aufgebaut, nun wartete ich auf meinen Freund und ehemaligen Arbeitskollegen Horst Wiegand, damit wir unser wöchentliches Turnier beginnen konnten.
Dass ich mich mit dem Schachspiel angefreundet hatte, war reiner Zufall. Während meiner Lehrzeit als Schlosser organisierte unser Lehrer für Fachrechnen einen Schachzirkel. Meiner Meinung nach war diese Beschäftigung etwas für Hochgeistige, die nicht wussten, was sie sonst mit ihrer Freizeit anfangen sollten. Doch der Lehrer verstand es, Interesse an dem Spiel zu wecken. Und so besuchte ich voller Neugier einen dieser Nachmittage. Ich stellte fest, dass Schach durchaus spannend sein konnte, wenn man erst einmal die Regeln und damit die Handhabung der Figuren beherrschte. Es ähnelte auch ein bisschen meiner alltäglichen Arbeit, bei der ich genauso viel tüfteln musste, um es zu einer ordentlichen Lösung zu bringen.
Meinen Banknachbarn Horst konnte ich damals ebenfalls bewegen, an dem Schachzirkel teilzunehmen, und so hatte ich einen Partner, der nun, nachdem wir uns über einen Zeitraum von vielen Jahren aus den Augen verloren hatten, wieder mit mir am Brett saß, allerdings nicht mehr als Lehrling, sondern als grauhaariger Rentner. Wie es sich für uns gehörte, trafen wir uns dazu im Seniorenklub.
Hier in diesen Räumen fühlte ich mich wohl, es herrschte eine ruhige Atmosphäre. Es gab Kaffee, Kuchen, und wer wollte, konnte Bockwurst oder eine Boulette bekommen; selbst der Genuss von Flaschenbier war möglich.
Und wenn sich jemand, wie mein Freund Horst es tat, einen Flachmann mit Hochprozentigem mitbrachte, wurde darüber hinweggesehen.
Die pummlige Leiterin des Seniorenklubs passte wie eine Glucke auf, dass es ihren Besuchern gut ging. Unter ihrer Leitung wurden deshalb sehr ansprechende Veranstaltungen durchgeführt.
Einmal sollte ein Star früherer Tage in unserem Klubraum auftreten. Meine Frau Ruth, die unbedingt mitwollte, hatte den Sänger schmelzender Titel einst sehr verehrt. Sie zog ihr flottes braunes Kostüm an und ging zum Friseur. So groß war der Raum, in dem der von ihr Angehimmelte auftreten würde, nicht, also war ein Kontakt auf Tuchfühlung durchaus möglich.
Als es so weit war und wir uns in froher Erwartung vor der kleinen Bühne versammelt hatten, verkündete die Leiterin, der Sänger könne nicht kommen. Er liege im Krankenhaus und sei nicht einmal in der Lage zu telefonieren.
Wir tauschten verständnisvolle Blicke und jedem von uns war klar, dass es nicht gut um ihn stand, aber na ja, er war eben unsere Altersklasse, da brauchte es keine weiteren Erklärungen. An seiner Stelle trat die zierliche und grazile Sängerin Julia Baxen auf. Früher hatte sie Säle gefüllt, diesmal sollte es unser Klubraum sein.
Sie brachte eine mächtige Apparatur zu ihrer Unterstützung mit. Diese ersetzte wohl die fehlende Kapelle, denn sie sang Halbplayback, wie es so schön hieß. Uns störte das nicht. Hauptsache, Julia Baxen war da! Meine Frau wirkte beim Anblick der einstigen Schlagerprinzessin mehr als zufrieden. Wie sich an diesem Tag gezeigt hatte, schien die Agentur „Rentner singen für Rentner“ immer eine Reserve in petto zu haben.
Am heutigen Nachmittag erfolgte jedoch keine Veranstaltung. Unsere gesamte Aufmerksamkeit galt dem Schachspiel – oder, um es genauer zu formulieren, dem Schwatz zweier alter Männer, die während ihres Gespräches versuchten, eine Schachpartie durchzuführen.
Wenn Horst und ich früher durchaus ausdauernde Schachspieler gewesen waren, fanden zermürbende Zweikämpfe mit anstrengendem Grübeln und quälendem Stöhnen bezüglich der Entscheidung, wie der nächste Zug auszusehen hatte, heute nicht mehr statt. Uns ging es in erster Linie um Unterhaltung. Dabei bestand nach wie vor Interesse an den großen Ereignissen in der Welt dieses Brettspiels. Einfluss auf unsere spielerische Leistung hatte dies jedoch nicht.
Die Kiebitze und Schachexperten unter den Besuchern bemerkten recht bald unsere begrenzten Fähigkeiten und behelligten uns deshalb nicht mehr mit gut gemeinten Hinweisen. Nur an der Wandtafel machten sie gelegentlich ihre Späßchen, indem sie in großen Buchstaben „Rolf Bartel und Horst Wiegand heute großes Schachturnier“ darauf schrieben. Daneben malten sie ein lachendes Mondgesicht. Na gut, sollten sie ihren Spaß haben.
Wir hatten währenddessen unsere Ruhe und konnten bei einer Tasse Kaffee gemütlich den Nachmittag am Schachbrett verbringen.
Heute hatte ich ein Heftchen mit den Spielen von Boris Spasski und Bobby Fischer von 1972 in Reykjavik mitgebracht. Damals, wenn man dieses Match um die Weltmeisterschaft verfolgt hatte, hatte es den Anschein erweckt, die beiden Kontrahenten machten dieses Duell mit ihrer Selbstdarstellung zu einer Showveranstaltung zweier Schachgiganten. Fischer mit seinem theatralischen Hin-und-her-Gehen vor Beginn, seinem verspäteten Anreisen, Spasski mit seinem Gehabe, denn er demonstrierte eine eiserne Ruhe. Die Meister belauerten sich, jeder Zug zeugte von Genialität, in der Schachwelt dargestellt als das Duell des Jahrhunderts.
Das Turnier war in die Schachgeschichte eingegangen und ich war der Ansicht, die im Heftchen abgedruckten Vorlagen könnten Horst und mir als Abwechslung dienen.
Durch die Glastür am Eingang zum Klub sah ich meinen Freund bereits kommen. Gestützt auf seinen Rollator kam er auf den Eingang zu, stellte sein Gefährt im Flur ab und betrat, immer noch etwas gebeugt, den Klubraum. Horst war etwa einen Meter achtzig groß und von kräftiger Statur, aber seit er diesen Rollator benutzte, wirkte es so, als wäre er krumm gewachsen. Das Fahrgerät zwang die Nutzer nach unten und sie sahen dabei immerfort auf die Erde. Gerade so, als wäre der Rollator ein Hilfsmittel auf dem Weg in die Ewigkeit.
Wenn einer alt ist, dachte ich, muss er eben einiges in Kauf nehmen und seine körperlichen Veränderungen akzeptieren. Bei Horst und mir ließ sich gut der Vergleich anstellen, wie unterschiedlich sich der Lauf der Zeit an jedem von uns bemerkbar machte. Horst hatte nach wie vor volles Haar, mir war es schon seit Langem abhandengekommen. Eine Brille benötigte mein Freund nicht, während ich seit vielen Jahren eine Sehhilfe brauchte. Mit den Jahren hatte ich mir einen respektablen Bauchansatz angefuttert. Horst hingegen war relativ schlank geblieben, wenn auch durch das Fortbewegungsgerät eingeknickt im Gang. Einzig die vergleichbare Größe hatte bei uns Bestand, wobei Horst ohne Rollator stehen musste, damit dies erkennbar war.
So hatte jeder seine eigenen Veränderungen hinzunehmen.
Die Zeit war ein Wesen, das stets mit den Menschen mitging und seine Gaben an jedermann verteilte. Niemanden vergaß sie. Ständig arbeitete sie daran, den Menschen in seinem fortschreitenden Alter weiter zu formen und zu verändern. Ein Modellierer und Maler gleichermaßen, nur dass die Zeit nicht bestrebt war, höchste Harmonie und Vollendung zu erzielen. Bei jedem sprach sie vor, ohne dass sie darum gebeten wurde. Ablehnen konnte man sie nicht und Wünsche wurden nicht berücksichtigt, schließlich gab es keinen Empfänger – Adresse unbekannt.
Wenn einer nun meinte, er wolle sein volles Haar behalten, dafür aber zwei Zähne opfern, oder er wolle die Beweglichkeit seiner Beine erhalten, dafür aber eine Brille tragen, dann musste er erkennen, dass mit der Zeit kein Handel möglich war. Sie entschied allein und der Mensch konnte nichts weiter tun, als die ihn treffenden Zeichen anzunehmen und damit so gut wie möglich zu leben.
Das tat ich im Grunde schon lange. Auch Horst hatte seine Gehunterstützung akzeptiert und empfand sie als nützlich. Ich tröstete mich damit, dass mein wachsender Bauchumfang von meiner Frau als gutes Zeichen für ihre Kochkünste und ihr leckeres Backwerk empfunden wurde und die Brille meine eigenwillige Nase optisch ein wenig begradigte.
So konnten Horst und ich trotz unserer kleinen Veränderungen in Ruhe unseren Tag verbringen und wie heute hier sitzen, um ganz geruhsam unseren Nachmittag zu gestalten.
Bis mein Altkollege zu mir kam, dauerte es eine Weile, denn die anderen Besucher des Seniorenklubs wollten von ihm ebenso willkommen geheißen werden wie ich.
Die herzliche Umarmung unserer Leiterin, die einen zur Begrüßung ganz eng an ihren üppigen Körper drückte, gestaltete sich jedes Mal zu einem besonders einfühlsamen Höhepunkt.
Endlich hatte Horst es bis zu unsere Ecke geschafft. Tief ausatmend ließ er sich in den Sessel fallen und verschnaufte erst einmal.
Als ich merkte, dass er spielbereit war, reichte ich ihm mein Heftchen mit den weltmeisterlichen Zügen. Er winkte ab und schob die Broschüre zu mir zurück. Seine Missachtung ärgerte mich und ich bedachte ihn mit einem missbilligenden Blick.
Doch Horst achtete gar nicht auf mich. Ehe ich etwas sagen konnte, kramte er ein zusammengelegtes Zeitungsblatt aus der Jackentasche, entfaltete es sorgfältig und legte es vor mir auf den Tisch. Wichtigtuerisch sah er mich an, neigte den Kopf nach vorn, als wollte er mir etwas sagen, was außer mir niemand hören sollte, und flüsterte verschwörerisch: „Wir müssen unsere Kiste rausholen, sonst wird es gar nischt mehr.“
Soweit es mein Bauchansatz zuließ, beugte ich mich zu ihm herüber, damit er mir Näheres erläutern konnte. Doch er zog nur seine buschigen Augenbrauen bedeutungsvoll nach oben und deutete ohne weitere Erklärung auf die Zeitung, auf der ich ein mit Rotstift umrandetes Kästchen bemerkte. Eine Nachricht des „Brockenkuriers“ wurde damit hervorgehoben. Sie war als Bekanntmachung der Landesregierung aufgeführt und lautete:
Wiederholt drangen sogenannte „Schatzsucher“ in Stollen und Höhlen des Harzgebirges ein, um vermeintliche Schätze zu finden, die dort angeblich im Zweiten Weltkrieg eingelagert wurden. Insbesondere geht es hier um Gerüchte, die einen Zug betreffen, der Gemälde und Kunstwerke aus „Carinhall“, dem Wohnsitz des Reichsmarschalls Göring bei Berlin, geladen haben sollte. Aufgrund der anhaltenden Fliegerangriffe konnte der Transport im Frühjahr 1945 nicht weiter in den Süden gelangen und wurde deshalb Hörensagen zufolge in die ausgebauten Bergkammern verbracht.
Um diese in dem Berg eingelagerten Gegenstände zu finden, sind immer wieder Personen unterwegs. Bei ihren Grabungen wurden jedoch verschiedentlich Schatzsucher durch herabfallendes Gestein verletzt. Nunmehr kam es sogar zu einem Todesfall.
Die Landesregierung sieht sich deshalb veranlasst, die Zugänge in den Berg so zu verschließen, dass sie nicht mehr begehbar sind. Eine Nutzung einzelner Abschnitte durch Betriebe oder Organisationen ist damit beendet. Alle eingestellten Materialien sind ab sofort zu entfernen. Die Zugänge zu den Stollen und Höhlen, die bisher von den Nutzern verschlossen wurden, sind zu öffnen und geöffnet zu lassen. Dies ist erforderlich, um eine umgehende Begehung dieser Bereiche zu ermöglichen.
Das Bergbauamt wird eine technische Untersuchung aller Stollen und Höhlen vornehmen und gegebenenfalls vorhandene Hinterlassenschaften sichern. Die Arbeiten der Behörde beginnen am 14.08., sie dauern voraussichtlich bis zum 19.08. an. Danach werden alle Öffnungen vermauert.
Nachdem ich die Nachricht gelesen hatte, musste ich den Inhalt erst einmal verdauen.
Ich lehnte mich zurück, in meinem Kopf wirbelte es. Fast hatten wir unsere versteckte Kiste abgeschrieben. Jetzt, mehr als fünfzig Jahre nachdem wir sie dort im Harz verbuddelt hatten, schien sich die Möglichkeit zu ergeben, ihrer doch noch habhaft zu werden.
„Rolf, wir haben dort auch was abgestellt!“, drang Horst auf mich ein. „Wir sind nun genauso aufgefordert, es zu holen. Wozu sonst haben wir uns die Mühe gemacht, unseren Fund verschwinden zu lassen? Da sehen wir endlich, was in dem Blechding eigentlich drin ist. Also los!“, meinte er beinahe befehlerisch. Um die Wirksamkeit seiner Worte zu unterstreichen, schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch, dass es laut hallte und sich alle im Raum zu uns umdrehten. Ich zeigte auf das Schachbrett, um anzudeuten, dass es an dem Spieleifer läge, was natürlich albern wirkte, denn wir hatten noch keinen einzigen Zug gemacht.
Horst schien das alles nicht zu stören. „Habe die Zeitung erst jetzt in die Hand bekommen“, schimpfte er ein wenig verärgert, „aber heut’ ist Dienstag, und wenn wir vielleicht schon morgen losfahren könnten, hätten wir noch genügend Zeit. Am Montag nächster Woche ist der Vierzehnte, da kommt die Behörde, und bis dahin bleiben uns fünf Tage. Eigentlich“, er holte tief Luft und machte eine ausholende Handbewegung, um anzudeuten, wie schnell alles erledigt werden könnte, „brauchen wir nur ein schwaches Stündchen.“ Er lächelte mich triumphierend an, als hätte er ein Match gewonnen. „Jetzt, wo alles geöffnet werden muss, kommen wir in die Höhle. Wir müssen uns auf den Weg machen!“ Er lachte. „Und die haben damals gedacht, alles gefunden zu haben, ha, ha, aber die Kiste ist ihnen entgangen, die holen wir uns jetzt!“ Er klatschte vor Eifer in die Hände und tat gerade so, als würden sich in unserem versteckten Kasten Reste des Nibelungenschatzes befinden. Schließlich steckte er mich mit seiner Euphorie an und ich überlegte, wie wir am schnellsten in das Harzdorf gelangen konnten, um uns in die Höhle zu begeben, in der wir vor fünfzig Jahren unsere Metallkiste mit der Aufschrift „Geheime Reichssache“ versteckt hatten. Endlich schien sich die Möglichkeit zu ergeben, sie aus der Spalte, in die wir sie gelegt hatten, wieder herauszubefördern. Wie oft hatten wir geklagt, dass unser Schatz für immer verloren sei. Doch irgendwann schien unser wehleidiges Gesäusel an das Schicksalsohr gedrungen zu sein, und nach einem halben Jahrhundert hatte die Zeit mit uns scheinbar doch noch ein Einsehen und schenkte uns fünf Tage, damit wir ein Vorhaben aus der Jugend zu Ende bringen konnten. Wieder winkte ein Abenteuer, wenn auch ein altersgerechtes. Das Ziel war nicht weit entfernt und arbeiten mussten wir auch nicht.
Natürlich trank Horst auf diese für uns erfreuliche Zeitungsinformation einen Schluck Klaren aus seinem mitgeführten Flachmann. Den Genuss dieses geistigen Getränks hatte er sich irgendwann angewöhnt, wobei er sich den Schluck stets zu Anlässen genehmigte, die aus heiterem Himmel im Laufe des Tages auftreten konnten und es seiner Meinung nach verdienten, begossen zu werden. Die Pressenachricht schien jedenfalls ein solcher Anlass zu sein.
Kapitel 2
Als Horst nun auf mich eindrang, wurden Erinnerungen wach.
Damals, nach Beendigung der Schlosserlehre, als wir schon einige Zeit in unserem Lehrbetrieb arbeiteten, erzählte Horst, der immer alles mitbekam, dass gerade Arbeiter für den Talsperrenbau im Harz gesucht wurden. Unter anderem wurden auch Schlosser gebraucht. Der Lohn war für uns als Jungfacharbeiter sehr anständig.
Horst und ich fanden das Angebot interessant, und dann auch noch eine Baustelle mitten im Wald! Rundherum erst einmal nichts, nur in einiger Entfernung ein paar Orte ringsum. Vielleicht lief uns da nicht nur die Brockenhexe über den Weg, sondern auch die eine oder andere Dorfschöne.
Es roch nach Abenteuer, und so machten wir uns auf in den grünen Harz.
Wie es sich für eine Talsperre gehörte, befand sich die Baustelle tief in einem Bergeinschnitt, an deren Hängen sich der Wald erstreckte. Dieser zog sich bis zu unserer Unterkunft in unmittelbarer Nähe der Baustelle. Ein schöner Anblick, wenn man aus der Türe trat oder aus dem Fenster sah. Ein Urlaubsblick, nur waren wir nicht zum Erholen, sondern zum Arbeiten da.
Die Arbeitsaufnahme erwies sich als ernüchternd. Die Baracken, in denen wir wohnten, waren zugig und die Ausstattung beschränkte sich auf das Allernotwendigste. Hatten wir erwartet, abends in unserem Zimmer Radio hören zu können, wurden wir enttäuscht. Auch Werkzeuge gab es nicht in ausreichender Menge. Ständig wurde das wenige, das vorhanden war, hin und her geborgt: „Habt ihr noch einen Bohrer übrig?“ „Klar, könnt ihr haben. Und wir brauchen gerade einen ordentlichen Vorschlaghammer, wie sieht es da bei euch aus?“
Natürlich mussten wir bedenken, dass der große Krieg nachwirkte. Da war an Material im Überfluss nicht zu denken.
Leider schien sich der Mangel auch auf das Essen auszuwirken. Erbsen, Linsen, Bohnen gab es wohl, doch Fleisch war rar. Auf der gesamten Baustelle war das laut herausgeblasene Ergebnis dieser Ernährung zu vernehmen.
Aber letztendlich waren wir jung, und einen Spaß gab es immer, zumal sich die Meister und Brigadiers durchaus als umgänglich erwiesen und manchen Schabernack mit Gelassenheit ertrugen.
Das mit den Brigaden war so eine sozialistische Erfindung. Mehrere Arbeitsgruppen wurden zu sogenannten „Brigaden“ zusammengefasst, an deren Spitze ein Vorarbeiter, auch „Brigadier“ genannt, stand. Mir war es egal, wie sie sich nannten, ich nahm es einfach so hin. Hauptsache, die Arbeitsatmosphäre stimmte.
Und dann um uns herum dieser dichte Wald. Nur einige Schritte brauchte man hineinzugehen, schon umfing einen diese unglaubliche Ruhe, die von den Bäumen ausging. Kein Lärm von Baumaschinen drang bis hierher, keine Rufe der Kollegen. All dies prallte an dem grünen Schirm ab. Dann war da noch der unvergessliche Geruch von Harz, Gräsern und Blumen. Oft blieb ich für einen Augenblick stehen und holte tief Luft, um die Düfte in mich aufzunehmen.
Als Großstädter genoss ich diese Möglichkeit, mitten in der Natur zu sein. Dazu gehörte das Vogelgezwitscher, das besonders in der Frühe zu hören war. Schnell hatte ich erkannt, dass die Vögel nicht alle gleichzeitig mit ihrem Gesang anfingen. Jeder hatte seine eigene Zeit, in der er seinen ersten Ton von sich gab. Womöglich diente es dazu, dass die verschiedenen Arten mit ihrer Gesangseinlage die Partnersuche andeuteten oder den Artgenossen klarmachen wollten: „Dies ist mein Revier!“ Es konnte aber auch sein, dass jede Art für sich ein eigenes Zeitfenster beanspruchte, um zu zeigen: „Hier sind wir!“
Tagsüber zwitscherten die Vögel lustig durcheinander. Amsel, Meise oder Rotkehlchen konnten wir schon bald ziemlich gut heraushören. Doch unsere Aufmerksamkeit galt vor allem den Rufen des Kuckucks, hieß es doch, er würde mit der Anzahl seiner Rufe das Lebensalter des Zählenden vorausbestimmen.
Der Vogel mit dieser wundersamen Eigenschaft verärgerte uns jedoch. Einige Male kam er auf über dreißig Rufe. Das hieß, wir würden mit unseren derzeit erreichten Jahren gerade mal fünfzig werden. Das erschien uns recht ärmlich. Oft kam es sogar vor, dass er nur zehn oder fünfzehn Mal anschlug. Dann schimpften wir über seine Faulheit und zählten seine Rufe nicht mehr mit.
Allmählich nahmen wir über den Wald hinaus unsere Umgebung mehr in den Blick. Dörfer in unmittelbarer Nähe gab es kaum. Die nächste Ortschaft war Hochstieg, dreihundert Einwohner, vier Straßen, zwei Gassen, die Menschen arbeiteten beim Forst, dem Sägewerk, einige in der Stadt. Auch Bergbau gab es. Neben „Guten Tag“ hörte man noch oft den alten Bergmannsgruß „Glück auf!“, ein Zeichen jahrhundertelanger Tradition. Einige Dorfbewohner betätigten sich wie wir beim Bau der Talsperre, andere bewirtschafteten ihre Wiesen, auf denen sie Kühe, Ziegen und Schafe hielten. Wieder andere besaßen Felder weiter unterhalb, die zu den Gemarkungen anderer Gemeinden gehörten. Größere Landwirtschaften gab es nicht, dazu war der Boden hier in der Höhe zu karg.
Die Einwohner erwiesen sich uns Bauarbeitern gegenüber als sehr freundlich und ließen sich gern erzählen, wo wir herkamen und was uns dazu veranlasst hatte, beim Bau der Talsperre mitzuhelfen. Für die Gemeinde erwies sich der Zustrom der Bauarbeiter als nützlich, wurde doch der kleine Laden jetzt besser beliefert, was die Menschen sehr zu schätzen wussten.
Im Ort – das erkundeten wir bald – gab es eine Gaststätte. Einmal im Monat spielte eine Dreimannkapelle zum Tanz auf. Da konnten wir sehen, dass es an jüngeren Burschen mangelte. Viele Männer des Dorfes waren im Krieg gefallen und kurz vor Kriegsende hatten die Nazis noch die Fünfzehn- und Sechzehnjährigen zur Verteidigung der Festung „Harz“ geholt. Nur wenige von ihnen waren zurückgekehrt. So waren wir beim Tanz gern gesehen. Selbst diejenigen von uns mit wenig Tanzerfahrung hatten angesichts des Jungmännermangels gute Chancen.
Dann waren da noch andere Ereignisse, bei denen es sich als vorteilhaft erwies, wenn eine Anzahl flotter Burschen mit dabei war: die Sonnenwendfeier zum Beispiel, ebenso wie die Walpurgisnacht. Wie ich feststellte, zündeten die Einheimischen bei solchen Höhepunkten immer ein großes Feuer an. Und wenn kein besonderer Anlass gefeiert wurde, wurde immerhin ein Holzstoß für ein Harzfeuer angebrannt. Dies war jederzeit möglich. Es reichte, wenn jemand den Anlass dazu gab.
Hier in dieser Gegend schien man das Beisammensein mit Flammen zu lieben. Noch während ich den tieferen Sinn zu ergründen suchte, wurde ich in das Feuerspiel mit einbezogen und erhielt sogleich die Antwort auf meine Grübeleien.
Bezüglich der brennenden Hölzer wurde jedem Mutigen einiges an Sportlichkeit abverlangt. Ein Sprung über die Feuerflammen, ohne sich die Hose zu versengen oder gar in die Glut zu treten, war Pflicht. Wer sich den Sprung nicht zutraute, brauchte gar nicht erst zu kommen. Die Mädchen würden die Zurückhaltung bemerken und ein Durchfallen bei dieser Männlichkeitsprobe konnte nicht riskiert werden. Es war ein bisschen wie in der Tierwelt, wo die männlichen Vertreter ihrer Gattung sich besonders anstrengen mussten, um vor den Weibchen zu bestehen.
Ich wollte mich zuerst zurückhalten und mir das bunte Treiben in Ruhe ansehen. Als ich jedoch mitbekam, wie die Mädchen so schauten und wie sie Rufe des Bewunderns ausstießen, wenn einer der Burschen besonders hoch sprang, spornte es mich an, es auch einmal zu versuchen. Also nahm ich allen Mut zusammen, und schon stand ich vor dem Feuerstoß.
Als ich dort so stand, kam er mir auf einmal viel größer vor, als ich ihn aus meiner sitzenden Position wahrgenommen hatte, und ich bekam Herzklopfen. Doch es war zu spät und es galt, keine Schwäche zu zeigen.
Wie ich es bei den einheimischen Jungen verfolgt hatte, musste Anlauf genommen und der richtige Moment für den Absprung gefunden werden. So nahm ich einige Meter Anlauf, um mich dann mit aller Kraft vom Boden abzustoßen. Deutlich spürte ich die Hitze der Glut an den Füßen, doch der Schwung half mir über die Flammen hinweg. Beifall ertönte und ich klopfte mir auf die Schulter, weil ich es gewagt hatte, den Sprung anzugehen. Jetzt gehörte ich zur Harzer Dorfjugend. Anerkennende Rufe belohnten meinen Mut.
Der Abend ging weiter und nach einer kurzen Pause kamen die Paare an die Reihe. Besonderer Beifall galt denen, die es schafften, händchenhaltend über das Feuer zu springen. Das gelang nur wenigen, und die wiederum wurden mit lauten Bravorufen bedacht. Gleichzeitig galt der gemeinsame Sprung, ohne die Hände zu lösen, als eine Art gegenseitiges Versprechen.
Eine Freundin hatte ich nicht, so kam Paarhüpfen für mich nicht infrage und ich brauchte mir über die Anforderungen für das Springen zu zweit keine Gedanken zu machen.
Mit dem Springen der Paare ging auch die Zeit am Feuer zu Ende. Die letzten Glutnester wurden zugeschüttet und in der nun herrschenden Dunkelheit machten wir uns auf den Weg ins Dorf.
Als ich in den Schein der ersten Lampe der Dorfbeleuchtung trat, hörte ich plötzlich eine Mädchenstimme neben mir mit gespieltem Erstaunen sagen: „Oh, oh, doch nicht hoch genug gesprungen, junger Mann!“ Die Schwarzhaarige, die ich neben mir erblickte, zeigte auf mein linkes Hosenbein. Jetzt sah ich es auch: Ganz unten am Saum war ein angesengter brauner Fleck. Eine der Flammen musste mich doch erwischt haben. „Das nächste Mal mehr anstrengen“, fuhr die Schwarzhaarige mit einem spöttischen Unterton fort. Ich ärgerte mich. So eine Blamage, wo ich doch gerade der Weiblichkeit zu imponieren gedachte! Ich wollte dem Mädchen etwas erwidern, aber sie war bereits im Dunkeln verschwunden.
Horst tröstete mich. „Du warst gut, und wenn das Mädchen was gesehen hat, wer weiß, ob du ihr überhaupt noch einmal begegnest.“ Er winkte ab und damit war die Angelegenheit für mich erledigt.
Dennoch hielt ich die Augen offen, um mich zu verbandeln. Ich war jung und eine hübsche Harzerin, die würde mir schon passen. Außerdem konnte ich dann auch den Paarsprung probieren.
Die Gelegenheit zu einem Kennenlernen ergab sich unerwartet, als ich einmal bei der Buchhaltung vorstellig wurde, weil ich glaubte, meine Überstunden wären nicht richtig berücksichtigt worden. Ich gelangte an eine ganz junge Buchhalterin, die, wie ich mitbekam, gerade ihre Lehre beendet hatte. Sie erklärte mir den Lohnstreifen und wies mir nach, dass richtig gerechnet worden war.
Über das Ergebnis ihrer Erläuterungen ärgerte ich mich, denn wenn alles stimmte, konnte ich ja gleich wieder gehen. Aber diese Schlanke mit den großen Augen, dem glatten Gesicht und den langen schwarzen Haaren gefiel mir, und so gab ich mich recht naiv und ließ mir alles noch einmal darlegen. Beim Hin-und-her-Reichen des Papiers gelang es mir, ihre Hand zu streifen, was sie allerdings wenig zu beeindrucken schien.
Als ich mir die Abrechnung zum dritten Mal erläutern lassen wollte, stand sie auf. „Wir sind hier auf Arbeit und nicht in der Nachhilfe“, sagte sie und war bemüht, ihre Worte trotz ihrer Jugendlichkeit mit einer gewissen Strenge vorzubringen.
„Vielleicht könnten wir nach der Arbeit noch mal darüber sprechen“, antwortete ich und blinzelte ihr vielsagend zu. Ich wusste, dass das schon fast frech war, aber ich dachte: Mehr als „Nein“ sagen kann sie nicht. Sie bemerkte erst gar nichts, sah nur spöttisch auf mich herab. „Ist denn die Hose wieder in Ordnung?“, erkundigte sie sich mit einem ironischen Unterton und verschwand mit ihren Akten, ohne sich noch einmal zu mir umzudrehen.
Das hatte mir gerade noch gefehlt: Das war das Mädchen vom Feuersprung! Doch trotz meines nicht ganz vollkommenen Sprungs schien ihr Blick nicht völlig abweisend gewesen zu sein, weshalb ich beschloss, noch nicht aufzugeben.
Bald wusste ich mehr über sie. Das Mädchen hieß Ingrid und wohnte in Hochstieg. Jetzt ging es nur noch darum, sie auf dem Heimweg ganz unauffällig abzupassen.
Das war gar nicht so einfach, denn mein Feierabend konnte nicht genau eingeplant werden. Er hing oft davon ab, wann die Materiallieferungen kamen und ob noch ein Reparaturfall eintrat. Sobald es passte, lief ich aber in den Ort.
Ich hatte darüber nachgedacht, wo es am günstigsten wäre, Ingrid zu treffen, und war zu dem Schluss gekommen, der beste Platz befände sich am Konsum. Einkaufen musste jeder mal. Der Konsum befand sich am anderen Ende des Dorfes. Abwartend positionierte ich mich vor dem Laden. Um nicht nur herumzustehen, kaufte ich gelegentlich etwas ein.
Der Konsum war nicht groß, und viel bot er nicht an. Allmählich musste ich Fantasie entwickeln, was ich da eigentlich noch kaufen wollte.
Als ich wieder einmal vor der Verkaufseinrichtung stand und unschlüssig hineinsah, hörte ich hinter mir eine Stimme: „Kann ich helfen?“ Und da stand sie und lächelte gar nicht spöttisch, sondern fröhlich, als würde sie sich freuen, mich zu treffen. Ich griff nach ihrer Hand und trug ihre Einkaufstasche bis zum elterlichen Wohnhaus.
Nachdem es mir noch einige Male gelungen war, sie als Taschenträger zu begleiten, kam auch bald der Abend, an dem wir zur Musik der Dreimannkapelle tanzten.
Und einige Zeit später, als wieder ein Harzfeuer brannte, saßen wir mit den anderen Jugendlichen im Kreis. Schlehenwein machte die Runde, und da trat schon der erste Springer an die Flammen, ein kurzer Anlauf, und hopp, geschafft! Der Zweite folgte, auch ihm gelang die Mutprobe.
Das Einzelspringen schien nicht so schwer zu sein, doch dann folgte das erste Paar, das sich traute. Die beiden nahmen einen kurzen Anlauf, aber über dem Feuer lösten sich ihre Hände und die beiden konnten von Glück reden, nicht im Feuer gelandet zu sein. Wahrscheinlich hatte der Schwung nicht ausgereicht. Jedenfalls galt der Sprung nicht.
Jetzt zupfte Ingrid an meinem Ärmel. „Komm!“, forderte sie mich auf. „Wir schaffen es!“ Im selben Moment zog sie mich in Richtung der Flammen. Ganz wohl war mir nicht, aber Ingrid glühte förmlich vor Anspannung. So entfernte ich mich mit ihr ein paar Meter von dem brennenden Reisighaufen. Dann nahm ich sie bei der Hand, rief „Jetzt!“, und wir liefen auf das Feuer zu. Ich nahm mir fest vor, sie nicht loszulassen. Und dann sprangen wir. Es war nur ein kurzer Moment, und ich hielt förmlich die Luft an vor Anstrengung, da landeten wir schon mit geschlossenen Händen auf der anderen Seite des Feuers. Ganz leicht schien es auf einmal gewesen zu sein, als hätten wir von irgendwoher noch einen kleinen Anschubser bekommen. Dann standen wir da und lachten vor Erleichterung. Alle, die uns bei unserem Feuersprung zugesehen hatten, klatschten Beifall.
Plötzlich umarmte mich Ingrid und gab mir einen Kuss, ganz öffentlich vor allen anderen. So etwas hatte sie noch nie getan. „Nun gehören wir zusammen“, sagte sie voller Inbrunst. „Die Flammen haben uns miteinander verbunden.“ Sie drückte mich wieder und wir saßen noch eine ganze Weile mit den anderen am Feuer.
Natürlich war mir der Harzer Brauch bekannt, aber ich hielt ihn eben für einen Brauch. Ingrid jedoch war völlig beseelt und ihre Stimmung übertrug sich auf mich. Wir pressten uns aneinander, bis wir unserer Gefühle nicht mehr Herr waren.
Während die Versuche am Feuer weitergingen und dem selbst gegorenen Wein immer mehr zugesprochen wurde, schlichen wir in den Wald, der nicht weit von unserem Abendfestplatz entfernt war. Die Dämmerung ging bereits in Dunkelheit über. Auch der Mond machte sich rar, weshalb im Wald völlige Dunkelheit herrschte.
Als wir schließlich eine Lichtung erreicht hatten, setzten wir uns ins weiche Moos. Ich fühlte mich umhüllt von diesem vielschichtig angenehmen Geruch nach Holz und Tannennadeln, wie man ihn nur im Wald empfand.
Ich umarmte Ingrid, drückte sie an mich und küsste sie, so oft ich nur konnte, als wollte ich die Tage nachholen, an denen ich mich das noch nicht getraut hatte. Dabei wurde mein Verlangen nach ihren Körper immer stärker.
Auf einmal flüsterte sie: „Zieh mich aus, aber ganz langsam, und küss mich weiter, überall. Ich möchte dich fühlen, auf jedem Zentimeter meiner Haut. Lass dir Zeit!“
Und ich fing an, sie ganz zärtlich zuerst an ihren Füßen zu küssen, dann entlang ihrer Beine, über die Innenseite ihrer Oberschenkel bis hinauf zum Becken. Mit meinen Lippen umkreiste ich zärtlich ihre Brüste, bis sich unsere Münder begegneten.
So sehr es mich drängte, ich genoss es, wie sich dieses unbestimmte Gefühl einer nie gekannten lustvollen Wärme in meinem Innersten ausbreitete und immer stärker wurde, dass ich glaubte zu zerschmelzen.
Eng umschlungen blieben wir schließlich liegen und schliefen ein.
Als wir wieder aufwachten, begrüßten die Vögel bereits mit lautem Gezwitscher den neuen Tag. Ein Specht hämmerte gerade so, als wollte er mit seiner Emsigkeit beweisen, wie fleißig er sei.
Ingrid schaute von unserer Lichtung hinauf zum Brocken. Ich hatte schon mitbekommen, dass für die Menschen hier im Harz der Morgen mit einem Blick zum Brockengipfel begann, so als wollten sie nachsehen, ob er noch da wäre.
Dieser Berg mit seinen 1141 Metern Höhe, das Wahrzeichen dieses Gebietes und der besondere Stolz der Menschen, die in seiner Nähe wohnten, diente auch für Wettervorhersagen. Hingen die Wolken tief oder löste sich der Nebel nicht auf, ließ sich eigentlich immer genau ergründen, wie es um das Wetter am laufenden Tag bestellt war.
„Heute wird es schön.“ Ingrid lachte fröhlich und gab mir einen langen Kuss.
„Da können wir ja noch eine Weile bleiben“, erwiderte ich und umarmte sie. „Das Gebrabbel, wenn wir zu spät zur Arbeit kommen, halten wir aus.“
Doch Ingrid wand sich aus meinen Armen und schüttelte den Kopf. Rasch zog sie sich an, und ehe ich sie noch einmal küssen konnte, war sie fort.
So trollte ich mich zu unserer Unterkunft.
Mein Zimmerkumpel Horst stand bereits angezogen in der Tür. „Beeil dich!“, mahnte er. „Wenn du nicht pünktlich bist, nörgelt der Brigadier die ganze Schicht.“
Als ich mich umzog, begann Horst laut zu lachen. „Wie siehst du denn aus?“, prustete er. „Der ganze Rücken rot bis runter zu den Arschbacken.“
„Das war die Rote Waldameise“, wies ich ihn ärgerlich zurecht.
„Oh!“ Er tat erstaunt. „Ich wusste gar nicht, dass die Rote Waldameise nachtaktiv ist.“ Er kicherte vor sich hin, als hätte ich ihm mit dem Anblick meines Rückens einen tollen Spaß bereitet. „Bei dir wird es wohl die Ameisenkönigin gewesen sein“, amüsierte er sich und machte sich auf zur Baustelle.
Im Arbeitsablauf gab es wieder das Übliche. Ein Mischer musste repariert werden. Er stand jedoch nicht unmittelbar an der Baustelle, sondern in unserer „Abstellkammer“, wie wir sie nannten. Dabei handelte es sich um eine etwa drei Meter hohe und fünf Meter breite Höhle im Berghang. Wir nutzten sie, um verschiedenes Gerät unterzubringen, vor allem wenn Gewitter oder Regenfälle angekündigt wurden und wir die eine oder andere Maschine im Trockenen wissen wollten oder wenn einiges an Technik für eine Weile nicht gebraucht wurde.
Dieser Hohlraum lag oberhalb unseres Lagers, erreichbar über einen schmalen Weg, der hinauf zu einer am Berghang befindlichen Ebene führte. Von dort aus gelangte man unmittelbar in die Höhle. Sie lag in der Gemarkung der Gemeinde Hochstieg, die, wie es hieß, aus irgendwelchen Gründen erst nach langen Verhandlungen bereit gewesen war, die Nutzung abzugeben.
Unser Bauleiter hatte eine Zeichnung angefertigt, wie der zur Verfügung stehende Raum zu nutzen sei. Jeder wusste, wo welche Maschine hingehörte, denn es musste beachtet werden, dass unser Unterbringungsraum von etwa zehn Metern Länge durch eine Leine begrenzt wurde, die als Absperrung diente. Daran hingen zwei ungefähr fünfzig mal fünfzig Zentimeter große Schilder. Auf dem einen stand in schwarzer Blockschrift: „Vorsicht Steinschlag, bei Weitergehen Lebensgefahr!“ Für Leichtfertige, die diese Warnung nicht ernst nahmen, befand sich zur Unterstreichung des Hinweises auf dem zweiten Schild das Bildnis eines Mannes, der sich mit über den Kopf erhobenen Händen vor herabfallenden Steinen zu schützen versuchte. Sein Gesichtsausdruck war so jämmerlich, als hätten ihn bereits die ersten Brocken getroffen. Ein wahrlich unmittelbar auf den Betrachter einwirkendes Werk, das einem die Gefahren im Berg überdeutlich bewusst machte. Deshalb wurde von allen Kollegen die Begrenzung strikt beachtet. Der hintere Teil des Hohlraumes verengte sich ohnehin und war nur schwer einsehbar.
Von der Höhle aus gelangte man über einen kurzen, geradeaus verlaufenden Fußweg direkt ins Dorf. Abzweigend auf der anderen Seite lag an unserem Stellraum eine schmale Straße. Die Konturen des Berges spiegelten sich in ihrem Verlauf wider. Wir waren bei unseren Erkundungen diese kleine Straße schon entlanggegangen. Sie endete an einem riesigen Stollensystem. Dort befanden sich ein Gleisanschluss und die Reste eines Gebäudes, das angesichts der verbliebenen Einrichtung dazu gedient haben musste, die ankommenden Züge auf die vorhandenen Abstellgleise zu dirigieren.
Wie wir wussten, befanden sich in diesen unterirdischen Gewölben Fabrikanlagen zur Herstellung von Teilen der V2, der sogenannten Vergeltungswaffe, mit der die Naziführung den Feind in die Knie zwingen wollte. KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter mussten unter elendigen Bedingungen in diesen Arbeitshöhlen schuften. Die Bauteile der V2 wurden dann weiter zu der in den Stollen des Kohnsteins bei Nordhausen befindlichen Endfertigung gebracht. Von dort wäre laut Hörensagen sogar Wernher von Braun gekommen, um diese Produktionsstätte zu besichtigen.
Zur Aufrechterhaltung der Kriegsproduktion bedurfte es einer fortlaufenden Materialbelieferung, die durch Zugtransporte abgesichert wurde.
Schon damals kamen Gerüchte auf, dass mit den Zügen für die Raketenproduktion auch andere Ladungen anrollten. Dies resultierte daraus, dass zum Ende des Krieges mit dem Heranrücken der Roten Armee auf Berlin die Naziführung Züge mit verschiedenen Wertsachen und geheimen Unterlagen beladen auf die Fahrt nach Bayern brachte, um die Fracht vor der Sowjetarmee in Sicherheit zu bringen. Dabei gab es durch das Vordringen der Alliierten vom Westen und dem Zurückweichen der Wehrmacht im Osten für die Zugfahrt in südliche Richtung nur die Möglichkeit, die Strecken über Magdeburg entlang des Harzgebirges zu nehmen. Ein enger Schlauch an noch nicht besetztem Reichsgebiet, das für die Züge auf den noch zur Verfügung stehenden Gleistrassen genutzt werden konnte. Militär galt es zu transportieren, Munition, Waffen. Dazu die Materialien der Naziführung aus der Reichshauptstadt. Auch Hermann Göring ließ seine zusammengeraubte Kunstsammlung von seinem Landsitz „Carinhall“ nördlich von Berlin angesichts der herannahenden Front im Sonderzug nach Bayern schaffen.
Diese noch aktive Fahrstrecke blieb den feindlichen Luftstreitkräften nicht verborgen, und so konzentrierten sie ihre Luftangriffe auf diesen zusammengedrückten Bereich des Ostharzgebietes, um jede noch vorhandene Bewegungsmöglichkeit deutscher Truppen über die Verkehrswege zu unterbinden.





























