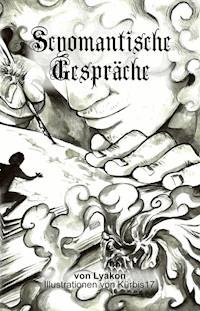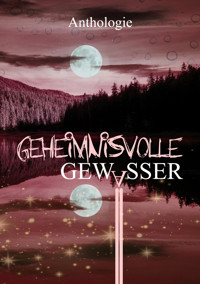
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Shadodex - Verlag der Schatten
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gruselgeschichten über verlassene Orte
- Sprache: Deutsch
Sie wirken harmlos. Wie ganz gewöhnliche Gewässer. Und doch sind ihre Bewohner manchmal ganz und gar nicht normal. Egal, ob es versteckt gelegene Seen sind, Tümpel, Weiher, Teiche, das Meer oder gar der Inhalt einer Teetasse, einige Gewässer bergen fantastische Wesen. Manche davon sind harmloser, als man denkt, sind vielleicht auch nur Gehilfen, einige sind aber gefährlich und man sollte sie besser nicht provozieren. Neugierig geworden? Dann lasst euch überraschen, welche Wesen die einzelnen Gewässer versuchen zu verbergen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Geheimnisvolle
Gewaesser
Anthologie
Alle Rechte vorbehalten.
Das Buchcover darf zur Darstellung des Buches unter
Hinweis auf den Verlag jederzeit frei verwendet werden.
Eine anderweitige Vervielfältigung des Coverbilds ist nur mit Zustimmung des Verlags möglich.
Die Namen und Handlungen sind frei erfunden. Evtl. Namensgleichheiten oder Handlungsähnlichkeiten sind zufällig.
www.verlag-der-schatten.de
Erste Auflage 2025
© Coverbilder: depositphotos pellinni, jonnysek,
ELIZABETHPOLIASHENKO
Covergestaltung: Verlag der Schatten
© Bilder: depositphotos aleksask (See mit Tannenspiegelung), kelifamily (See mit Insel),
Ukususha (Abgetaucht), [email protected] (Höhle der Seepferdchen), BIKTOP (Kräns Leben), lkpro (Last Man Standing), [email protected] (Wellenstrom), fedotovalora (Schugraschluck), iggy74 (Höhle im Moor), Faraoshka (Teich im Wald),
Patryk_Kosmider (Paraplui-Teich), [email protected] (Das Etwas),
pavelvero (Die Ungesehenen)
Wikipedia (Blanke Helle)
BIF (Gosausee, Teetasse, Stein am Gosausee), Eve Grass (Honigtopf)
Lektorat: Verlag der Schatten
©Shadodex – Verlag der Schatten, Bettina Ickelsheimer-Förster,
Ruhefeld 16/1, 74594 Kreßberg-Mariäkappel
ISBN: 978-3-98528-049-0
Sie wirken harmlos.
Wie ganz gewöhnliche Gewässer.
Und doch sind ihre Bewohner manchmal
ganz und gar nicht normal.
Egal, ob es versteckt gelegene Seen sind, Tümpel, Weiher, Teiche, das Meer oder gar der Inhalt einer Teetasse, einige Gewässer bergen
fantastische Wesen. Manche davon sind harmloser, als man denkt, sind vielleicht auch nur Gehilfen, einige sind aber gefährlich und man
sollte sie besser nicht provozieren.
Neugierig geworden? Dann lasst euch überraschen, welche Wesen die einzelnen Gewässer versuchen zu verbergen.
Inhalt
Lyakon: Blanke Helle
Bastian Wysoglad: Abgetaucht
Sophia Rosenberger: Tea Time
Katrin Holzapfel: Die Höhle der Seepferdchen
Dennis Puplicks: Kräns Leben
Kat L. Jennings: Last Man Standing
Kurt B. Wolf: Wellenstrom
Sophie Fendel: Der Schugraschluck
Melanie Schlämann: Die Höhle im Moor
Susanne Simon: Der Teich im Wald
Monika Grasl: Das Geheimnis des Parapluie-Teichs
Piet Woudenberg: Das Etwas
Sabine D. Jacob: Die Ungesehenen
Eve Grass: Der Honigtopf
Lyakon: Blanke Helle
Leere neben mir. Sie war weg. Wo sie sonst lag, erahnte ich im blauen Licht des Radioweckers eine zerknüllte Bettdecke. Kälte erfüllte das Zimmer, welche ihren Ursprung nicht alleine in der kühlen Märznacht außerhalb meiner Wände fand.
Draußen erklang das Zwitschern der ersten Vögel, die das Nahen der Sonne feierten. Was lief falsch mit diesen Viechern? Buchfinken beginnen – wie ich in einer Tierdoku gelernt hatte – zehn Minuten vor Sonnenaufgang mit ihrem Gesang, Gartenrotschwänze gar achtzig Minuten vorher. Das war doch unnormal. Wie vermochte eine Kreatur, so früh schon derart ausgelassen zu sein? Dazu noch komplett ohne Kaffee?
Einst, und in Momenten wie diesen erschien es zu einer Zeit gewesen zu sein, als sich die Erde gerade erst aus Sternenstaub formte, war ich mit ihr bis in die Morgenstunden durch die Clubs Berlins gezogen. Wenn irgendwo Bachata oder Kizomba getanzt wurde, waren wir mit am Start. Doch das waren jüngere Versionen unserer selbst. Durchdrungen von der unbändigen Vitalität der Jugend. In den Studentenzeiten wähnten wir, dass die Party ewig weitergehe. Feiern, bis der Tag anbricht, und dann zum Ausnüchtern in die erste Vorlesung. Wie sollten wir ahnen, dass der gnadenlose Strom der Zeit, gleich einem Fluss, der felsiges Ufer auswäscht, unsere Lebenskraft langsam, aber sicher fortträgt. Da half kein Arganöl, Retinolserum, Hyaluronkonzentrat und was auch immer sie sonst noch im Badezimmer stehen hatte. Mitunter war mir, als beträte ich das Labor eines Alchemisten, wenn ich die vielen Tiegelchen, Pipettenflaschen und Tuben auf der Badezimmerablage erblickte. Doch keines der Mittelchen hatte vermocht, den Fluss der Zeit zu stoppen.
Verdammt, wann hielten die Vögel den Schnabel? Die Hälfte, welche nicht in der Grünanlage des Alboinplatzes lebte, besaß eine Unterkunft in den Nistkästen auf dem Friedhof Eythstraße. Mietfrei trotz der angespannten Wohnungslage in Berlin. Existierte in Anbetracht dieses Vorteils kein Gebot gegen das Stören der Totenruhe? Vogel müsste man sein. Rumfliegen, keine Miete zahlen und das kostenlose Essen aus den Meisenknödeln auf den Balkonen der Senioren picken.
Ich fiel mehr aus dem Bett, als dass ich aufstand. Ohne eine große Tasse Kaffee mit Milch und fünf Löffeln Zucker war ich zu nichts zu gebrauchen.
»Da steht der Löffel doch fast drin«, hatte sie mir immer an den Kopf geworfen, wenn ich mir einen frischen Bohnenkaffee zubereitete.
»Ich mag meinen Morgenkaffee halt wie dich – heiß und überaus süß.« Was für eine abgedroschene Phrase, aber sie hatte stets gelacht.
Auf dem Weg zur Küche passierte ich das Wohnzimmer, das von einem großen Exemplar der Gattung Bos verstellt wurde. Wohnraum war teuer, ich keine Kohlmeise und der Raum daher eher klein. Ohne das Sofa und den Fernseher hätte man ihn wohl für einen Flur gehalten.
Wir hatten immer von einem eigenen Loft mit großer Bibliothek sowie einem nussbraunen Chesterfieldsofa geträumt, welches zum Relaxen und Lesen einlud. Gleichwohl fehlte dazu das Geld – und nun auch sie.
»Du musst studieren, um es mal besser als wir zu haben«, hatten meine Eltern gesagt. Vielleicht hätten sie präziser sein sollen.
Ich hatte mich ob meiner Interessen für ein Kunstgeschichtsstudium entschieden. Leider kam mir erst viel später ein Spruch Bismarcks zu Ohren: »Die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt.«
Dreizehn Jahre Studium hatten mich nicht wirklich aus der Abhängigkeit von den Zuwendungen meiner Eltern befreit. Diese überwiesen mir jeden Monat dreihundert Euro, damit ich – ein Mann in der Mitte seiner Dreißiger – über die Runden kam. Mit einem Bachelor der Kunstgeschichte ließ sich auf dem Arbeitsmarkt nichts reißen, sodass ich einen Master angeschlossen hatte, der sich seit sechs Jahren in einer ewigen Warteschlange befand.
So hatten sie und meine Eltern für unser Auskommen gesorgt, während ich mich um den Haushalt kümmerte. Wobei sie dann doch das Kochen übernommen hatte, da ich frisches Gemüse mied wie katholische Priester einen Stripclub.
In der Küche angelangt, gab ich Wasser in den Tank der Kaffeemaschine, befüllte den Filter mit Kaffeepulver und schaltete die Maschine ein. Brummend nahm das Gerät seine Arbeit auf.
»Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Er riecht nach – Sieg.« Was für Lieutenant Colonel Kilgore ein brennendes Gemisch aus Benzin und Verdickungsmittel war, stellte für mich Kaffee dar. Ein Tag, der nicht mit einer Tasse schwarzen Goldes mit einem Schuss Milch anfing, war ein verlorener Tag.
Der würzig-fruchtige Geruch von frisch gebrühtem Kaffee flutete die Wohnung. Ich nahm die porzellanene Zuckerdose mit Goldrand und Blumendekor – sie hatte das Teil auf irgendeinem Flohmarkt gefunden – aus dem Schrank. Der nächste Griff galt der Kühlschranktür.
Scheiße. Keine Milch. Kaffee ohne Milch war wie Fugu-Sashimi, zubereitet von einem Koch mit Schüttellähmung – so was führte nur ein kompletter Vollpfosten seinem Verdauungstrakt zu.
Was nun?
Wohnzimmer!
Seltsamer Gedanke, doch vor dem ersten Kaffee stotterte mein Hirn im Leerlauf.
Ich nahm ein Glas, begab mich einen Raum weiter und stockte ob der prächtigen nachtschwarzen Kuh mit den armlangen gebogenen Hörnern.
Eine eigene Milchquelle.
Ich hatte noch nie ein Tier gemolken, gleichwohl, wie schwer mochte es sein. Das hatten Bauern über Jahrtausende ohne Studium hinbekommen. Obgleich heute Agrarwissenschaft durchaus einen anerkannten Studiengang darstellte – seltsam, wie sich die Zeiten änderten.
Sei’s drum, ohne Milch im Kaffee würde ich definitiv nicht in den Morgen starten.
»Würde ich nicht probieren«, raunte das Rindvieh.
»Ich brauche Milch!«, protestierte ich lautstark.
»Kann sein, aber nicht von mir.«
»Siehst du noch eine Kuh?«
Das Rind seufzte. »Ich sehe hier überhaupt keine Kuh.«
»Klar, du schaust ja zu mir …«, setzte ich an.
»Und erblicke ein Rindvieh. Junge, ich bin ein Stier und wenn du auch nur versuchst, mich zu melken, ramme ich dir meine Hörner bis zum Anschlag in den Leib.«
Ich wägte die Optionen ab. Ein Blick unter das Rind offenbarte mir das Fehlen eines Euters, wie ich es von der lila Kuh der Milka-Werbung kannte.
»Bist du pervers oder was?« Die Stimme des Stiers grollte gleich einem Sommergewitter. »Glotz mir noch mal auf mein Gemächt und …«
»Du durchbohrst mich mit deinen Hörnern«, unterbrach ich ihn. »Wo bekomme ich jetzt Milch her?«
»Du wohnst fünf Minuten von Kaufland entfernt.« Der Stier schüttelte den Kopf. »Wie faul kann man sein? Lässt du dir alles von Amazon bis an die Haustür liefern?«
»Nicht alles.«
Der Kopf des Stiers legte sich schräg. Eisseeaugen musterten mich. Ihr Blick schnitt sich tief in meinen Verstand, offenbarten mit der kühlen Präzision eines Skalpells jeden Gedanken.
»Das Prime-Abo muss sich doch lohnen«, keuchte ich.
Das Maul des Rinds verzog sich zu etwas, das ich als Lächeln identifizierte. Der Skalpellblick zog sich zurück.
Ich atmete auf. »Was haben wir überhaupt für einen Wochentag? Hat Kaufland geöffnet?«
»Es ist Dienstag, gleich ist es sieben Uhr. Dann macht der Laden auf.«
Ich zog mich an, nahm meine Jacke, steckte mir eine Zigarette gegen den Stress an und verließ die Wohnung.
»Das macht 120 Euro.«
»Ich will doch nur eine Packung Vollmilch.«
»Mag sein, das macht trotzdem 120 Euro.«
Der Mann in der Ordnungsamt-Jacke wies diesen Vin-Diesel-Blick auf, der mich davon abhielt, mit ihm zu diskutieren. Sie hätte ihn vielleicht überreden können, es bei einer Verwarnung zu belassen, aber sie war fort und würde nicht wiederkommen. Ich stand hier und neben mir lag der Kippenstummel auf dem Boden, den ich fallen lassen hatte.
»Ist schon ziemlich teuer«, murrte ich, kramte nichtsdestotrotz den Geldbeutel aus der Jackentasche hervor.
»Ich mache die Preise nicht.« Der Mann tippte mit dem rechten Zeigefinger gegen die Brusttasche der Jacke, aus der ein Büchlein lugte. »Wir vom Ordnungsamt stehen für Recht und Ordnung. Hier ist niedergeschrieben, für welches Vergehen welche Strafe angesetzt wird. In diesem Buch ist alles niedergeschrieben, was die öffentliche Ordnung stört. Und was geschrieben steht, muss durchgesetzt werden.« Das Funkeln in seinen Augen mochte einem Tomás de Torquemada oder Heinrich Kramer gut zu Gesicht gestanden haben. »Das ist ein Stadtpark und keine Müllhalde. Ein Zigarettenfilter benötigt bis zu fünfzehn Jahre, um vollständig zu verrotten. Und wir reden jetzt nicht von den Giften, die darin gefangen sind und bei der Zersetzung ausgewaschen werden. Der Alboinplatz gilt als Gartendenkmal und verdient dementsprechend einen besonderen Schutz.« Sein rechter Arm vollführte einen Halbkreis in der Luft und hielt mich an, den Blick über meine Umwelt schweifen zu lassen.
Jetzt wohnte ich bereits seit zehn Jahren in der Gegend und trotzdem war mir die riesige Skulptur bisher nicht aufgefallen. »Scheißvieh!«, entfuhr es mir.
»Das ist ein Werk des Bildhauers Paul Mersmann, der diese im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für arbeitslose Künstler im Jahr 1934 entwarf. Aber so was ist Ihnen natürlich egal. Kunst und Kultur interessieren heute ja niemanden mehr.«
»Ich bin Kunsthistoriker mit abgeschlossenem Bachelor!«
Seine Augen verengten sich. So ganz schien er mir diese Aussage nicht zu glauben.
»Mir geht es auch jetzt nicht um diese Stierskulptur, sondern eher um das Rindvieh, welches mich Milch holen geschickt hat.« Das Zusammenziehen seiner Augenbrauen ermahnte mich, zu schweigen. Wenn ich ihm vom Stier im Wohnzimmer erzählen würde, würde ich heute nicht mehr zum Kaufland kommen. Ich öffnete meinen Geldbeutel, wohl wissend, dass dort gähnende Leere herrschte. »Nehmen Sie Karte?«
Der Mann zog ein mobiles EC-Kartenlesegerät aus einer Gürteltasche. »Wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit.«
»Du hast die Milch?«, fragte der Stier.
»Ja. Und ein paar Zuckerwürfel. Die magst du doch.«
Er schnaufte. »Das sind Pferde. Die Huftiere ohne Hörner, auf denen Reiter sitzen.«
»Ihr seid das mit den Salzlecksteinen?«
»Nicht nur wir. Die werden auch von Pferden, Schafen, Ziegen und sogar Wildtieren gerne angenommen.«
»Wusste ich nicht.« Ich ging in die Küche, nahm eine große Kaffeetasse aus dem Schrank und goss ein. Ein Schuss Milch folgte wie auch fünf Löffel Zucker. »Ähm, soll ich dir eine Schale Salz rüberbringen?«
»Nicht nötig. Ich bin geschäftlich hier.«
»Geschäftlich?« Was mochte ein Stier für ein Geschäft betreiben. Mit Milch handelte er definitiv nicht, sonst hätte er mich wohl kaum bis zum Kaufland laufen lassen.
»Ja, aber wir müssen noch auf meinen Bruder warten, bevor wir loslegen können. Der wilde Hengst ist gerade auf einem seiner amourösen Abenteuer.«
»Wurde er adoptiert?«
»Wer?«
»Na dein Bruder.«
Der Stier schüttelte den Kopf. »Wovon redest du?«
»Na dem wilden Hengst. Du bist Rind, er ist Pferd, da stimmt doch was in der Abstammung nicht.«
Ein Schnaufen ertönte. »Der treibt es wie ein wilder Hengst, ist aber ein Stier.«
»Mag er Zuckerwürfel?«
Die Augen meines Besuchers verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Willst du sterben?«
Ein lautes Krachen ertönte aus dem Schlafzimmer, gefolgt von einer Schimpftirade, welche mich die Drohung vergessen ließ.
»Verdammter Schweinepups, ich bin definitiv zu alt für diesen Scheiß. Ich habe Kaninchenbaue gesehen, die deutlich geräumiger waren.« Holz splitterte. »Rainer? Bist du schon hier? Rainer!«
Neben mir erklang ein Seufzen. »Dankmar, was ist los?«
»Ich hänge fest.«
Der Wohnzimmerstier schloss die Augen. »Typisch Dankmar«, flüsterte er. Lauter rief er: »Dann befreie dich.«
»Geht nicht.«
Ich strebte jenem Zimmer entgegen, welches vor nicht allzu langer Zeit mein Schlafzimmer gewesen war. Doch ohne Bett – der Lattenrost hatte unter dem Gewicht eines ausgewachsenen Stiers nachgegeben – und mit einem Kleiderschrank, in dem die Hörner des Tiers steckten, waren zwei der Möbel, welche dem Raum seine Funktion verliehen, nicht mehr nutzbar. Konnte man ein Zimmer ohne Bett und Schrank überhaupt Schlafzimmer nennen? Gab es da Regeln für? Möglicherweise stand so was in einem schlauen Büchlein, wie es der Typ vom Ordnungsamt besaß.
Der Kopf des schwarzen Ungetüms ruckte hin und her. Holz splitterte erneut, der Stier war stur, die Türscharniere nachgiebig. Die Tür hing nun aufgespießt vor dem Schädel meines Besuchers, der die Augen verdrehte, um zu mir zu schielen. »Rainer, ist er das?«
»Ja, das ist er.«
»Sieht nicht gerade besonders aus.«
»Was hast du erwartet?«
»Na ja, jemanden, der etwas priesterlicher ist.«
»Seit tausend Jahren gibt es hier keine Priester mehr.«
»Klar gibt es hier Priester«, warf ich ein. »In der Röblingstraße befindet sich die katholische Sankt Fidelis Kirche.«
»Warum fängt der jetzt mit katholischen Kirchen an?«, fragte jener, der Dankmar hieß.
»Keine Ahnung«, antwortete sein Bruder.
»Der ist nicht besonders helle«, mutmaßte Dankmar.
»Sagt jemand, der eine Kleiderschranktür vor der Fresse kleben hat«, entgegnete ich.
Rainer lachte. »Recht gesprochen, Junge.«
Dankmar schnaufte. »Hast du ihm erklärt, was morgen startet?«
»Lass ihn erst mal seinen Kaffee trinken. Der ist noch nicht ganz fit. Danach können wir loslegen.«
»Womit?« Die Unterhaltung der beiden schwarzen Stiere war als eher kryptisch zu bezeichnen. Ich benötigte mehr Informationen.
»Den Unterweisungen in Feldarbeit«, warf Rainer ein.
»Feldarbeit?«
»Feldarbeit«, bestätigte Dankmar.
Klar, was sollten zwei Stiere, von denen einer mit den Hörnern eine Schranktür vor sich hertrug, auch sonst von mir wollen. »Ich soll Bauer werden.«
Rainer nickte. »Du hast im Moment keinen Job.«
»Ich bin gerade dabei, mein Kunstgeschichtsstudium zu beenden.«
»Und du lebst von den Zuwendungen deiner Familie«, warf Dankmar ein. »Hört sich für mich nicht so an, als ob du einen echten Job besitzt.«
»Und du bist wohl von Beruf Schranktürträger – was verdient man denn da so?«
»Da hat er nun wieder recht.« Falls jemals infrage stand, ob Stiere lachen können, so bestätigte Rainers Reaktion das Vorhandensein dieser Fähigkeit bei Bovinen.
»Ich bin kein Türträger!« Dankmars Nackenmuskeln spannten sich. Die Sturheit des Stiers siegte über die Tür. Einzig ein etwa tellergroßes Stück Holz blieb als Mahnmal auf den Untergang des Schranks auf dem linken Horn zurück. »Und du sollst kein Bauer werden.«
»Aber du hast gesagt, dass ihr mich für Feldarbeit benötigt.« Ob Feldarbeit bei Stieren eine andere Bedeutung besaß? So wie der bestimmte Artikel DIE im Deutschen ganz harmlos war, während er im Englischen Leichen hinterließ.
»Als Priester.«
»Als Priester?«
»Korrekt.«
»Ich bin vor zwei Jahren aus der Kirche ausge…«, begann ich.
»Nicht diese Kirche«, unterbrach mich Rainer. »Du wirst eine etwas andere Art von Priester.«
»Einer, der Feldarbeit vollbringt?«, mutmaßte ich.
»Ja«, bestätigte Dankmar. »Du musst zweimal im Jahr pflügen und die Saat ausbringen.«
»Pflügen und die Saat ausbringen?«
»Korrekt. Im Frühjahr unterstützt dich Rainer, im Herbst unterstütze ich dich.«
»Beim Pflügen?«
»Der ist nicht ganz so helle«, wandte sich Dankmar an Rainer.
»Sie hat ihn ausgewählt.«
Ausgewählt?
»Nur mal so am Rande, ich wurde für diese Arbeit ausgewählt? Von wem?«
Dankmar schnaufte. »Bist du taub? Von ihr.«
»Ach, alles klar. Jetzt ist es natürlich vollkommen verständlich. Wenn ich von IHR ausgewählt wurde, kann ich den Job gar nicht ablehnen.«
Dankmar warf einen Blick zu Rainer. »Er wird vernünftig.«
»Nur noch eine Kleinigkeit. Wer ist SIE?«
»Na die Herrscherin von Helheim.«
»Ah, klar. Und SIE hat mich ausgewählt. Wann beginnt mein Job?«
»Morgen früh um sieben Uhr«, erklärte Dankmar. »Wir wollten uns heute nur vorstellen und dich einweisen. Den Pflug und den Sommerweizen bringt Rainer mit.«
»Und du bringst im Herbst Pflug und Winterweizen mit.«
»Exakt.« Dankmar nickte mir zu. »Dann machen wir uns mal auf den Weg. Denk dran, nicht zu lange aufzubleiben. Morgen wird ein anstrengender Tag.«
Die Stiere verloren an Substanz, ähnelten Nebelleibern, welche vom Licht der Deckenlampen vertrieben wurden – inklusive des Fragments meines Schranks, das noch auf Dankmars Horn aufgespießt war.
»Sie müssen es hier ja echt wild getrieben haben.« Der Handwerker im Blaumann grinste breit. »Habe schon einige zerstörte Betten gesehen, aber einen Kleiderschrank hat noch niemand während der Schlafzimmeraction zerlegt. Ihre Frau muss ja ein echt wildes Biest sein.«
»Sie ist tot.«
Mein Gegenüber erbleichte. »Ähm, also, ja, ähm.«
»Verkehrsunfall vor drei Monaten. Ein Raser hat sie in der Nacht auf dem Fußgängerüberweg übersehen.«
»Oh, das tut mir leid.« Der Mann schien etwas zu seinen Füßen zu suchen. »Ich wollte, also, na ja.« Er stockte.
Ich kannte Momente wie diese zur Genüge. Seit ihrem Tod begannen Gespräche entweder mit einem »Wie geht’s dir?« – Was sollte ich darauf antworten? Sie war tot und ich war alleine. – oder meine Gesprächspartner wollten schnellstmöglich einen Ausweg aus der Unterhaltung finden – gerade so, als wäre mein Verlust ansteckend und würde auf sie überspringen.
»Es ist okay.« War es nicht, aber was sollte ich anderes sagen. »Sie nehmen wie abgesprochen die alten Möbel mit?«
Was auch immer eben noch auf dem Boden gelegen hatte, war verschwunden. Der Blick des Handwerkers suchte den meinen.
»Klar, das haben wir so ausgemacht. Der Schrank und das Bett aus der Möbelbörse sind unten im Laster.« Er stockte. »Die Entsorgungsgebühren für dieses Schlachtfeld hier vergessen wir.«
Eine moderne Art des Ablasshandels. Erlassene Gebühren gegen das Gefühl der Schuld. Dabei hatte nicht er sie überfahren.
»Vielen Dank.« Das eingeübte Lächeln, eine Maske, um es dem Umfeld leichter zu machen, erschien auf meinen Zügen. »Möchten Sie einen Kaffee?«
»Gerne! Mit Milch und Zucker bitte.«
»Wie auch sonst. Schwarzen Kaffee trinken nur Psychopathen.«
»Das haben Sie sich jetzt ausgedacht.«
»Mitnichten. Ist das Ergebnis einer Studie der Uni Innsbruck. Menschen, welche ihren Kaffee schwarz trinken und bittere Aromen mögen, sind meist psychopathisch, egoistisch, manipulativ und sadistisch.«
»Kein Scheiß?«
»Kein Scheiß!« Ich begab mich auf den Weg in die Küche. »Wie viele Löffel Zucker?«
»Nach dem, was Sie eben gesagt haben, sollte ich jetzt wohl sagen: So viele, wie reinpassen. Würden mich süße Aromen nett, zuvorkommend und liebenswürdig machen?«
Aus der Maske wurde ein echtes Lächeln. »Sie sind ganz okay, wie Sie sind. Wie viele Löffel sollen es sein?«
»Zwei. Alles darüber hinaus ist mir zu süß.«
»Nur zwei? Ich hoffe, dass gleich nicht alles mit Plastikfolie ausgelegt ist, wenn ich ins Schlafzimmer komme.«
»Die Szene aus ›American Psycho‹?«
»Genug Werkzeug haben Sie mitgebracht.«
»Aber keine Axt. Die liegt noch im Wagen.«
Ich betrat das Schlafzimmer. »Wie heißen Sie eigentlich?«
»Reiner.«
»Reiner?«
»Ja, kommt aus dem Althochdeutschen, bedeutet so viel wie Ratgeber.«
»Sie wissen nicht zufällig, was Dankmar bedeutet?«
»Klar doch. Berühmter Denker.«
Ein lautes Lachen brach sich seinen Weg in die Freiheit. »Sie verarschen mich.«
»Nein, das ist ebenfalls ein althochdeutscher Name. Ich bin Mitglied von Odins Raben. Wir präsentieren uns auf Mittelaltermärkten als nordische Krieger.«
»Sie werden mir nicht glauben, aber heute steckte ein berühmter Denker mit seinen Hörnern in meinem Schlafzimmerschrank fest.«
»Mit seinen Hörnern?«
»Er war ein Stier.«
»Mit Namen Dankmar.«
»Und sein Bruder hieß Rainer.«
»Der hat wahrscheinlich das Bett zerstört.«
»Nein, das mit dem Bett war ebenfalls Dankmar. Rainer stand heute Morgen im Wohnzimmer und hat mich zum Kaufland Milch holen geschickt. Und morgen soll ich pflügen.« Ich musste wie ein Wahnsinniger anmuten.
»Zwei Stiere, genau wie in der Sage.« Reiner nickte.
Mein Lachen verstummte. »Welche Sage?«
»Na die von der Blanke Helle. Sie kennen den See draußen im Park?«
»Klar. Und heute habe ich den steinernen Stier dort gesehen. Aber von welcher Sage sprechen Sie?«
»Du!«
»Was?«
»Ich bin Reiner. Also du.«
»Okay, von welcher Sage sprichst du?«
»Na die vom Priester von der Blanke Helle.«
Priester und Stiere? Es wurde interessant. »Zeit für eine Pause im Wohnzimmer. Ich würde gerne die Geschichte hören.«
Wir setzten uns auf die Couch. Reiner nahm einen Schluck Kaffee, stellte die Tasse auf dem Beistelltisch ab und lehnte sich zurück. »Einst war der See dort draußen ein Heiligtum von Hel, der nordischen Göttin des Todes. An seinen Ufern lebte in einer Hütte ein alter Priester, welcher den Toten durch den See den Übergang nach Helheim ermöglichte. Zweimal im Jahr, jeweils im Frühling wie auch im Herbst, sandte die Göttin dem Priester einen Stier, der vor einen Pflug gespannt das Ufer umgrub, sodass ausgesät werden konnte. Dieses Ritual schenkte der gesamten Region Fruchtbarkeit und Wohlstand.«
Ich lehnte mich vor. Dankmar hatte ebenfalls von der Aussaat im Frühling wie auch im Herbst gesprochen.
»Als der Priester schon sehr alt war und er die Kälte des Todes in seinen Knochen spürte, verirrte sich ein christlicher Mönch an den See. Mochten sie in Alter und Herkunft auch unterschiedlich sein, so vereinte sie doch der gemeinsame Glaube an höhere Mächte. So bat der Alte den Jungen, die Riten am Heiligtum fortzuführen, wenn die Göttin ihn nach Helheim rief.«
»Aber der Mönch war doch Christ. Hat er sich darauf eingelassen?«
»Er hat. Aber sein Versprechen war flüchtig wie Morgennebel. Kaum war der Alte verstorben, da hatte der Mönch seinen Schwur vergessen. Als der Tag des Pflügens kam, zeigte er keine Anstalten, den Ritus durchzuführen. Doch niemand betrügt ungestraft die Göttin des Todes. Zwei Stiere erschienen am Ufer des Sees.«
»Rainer und Dankmar.«
»Also gut, nennen wir sie Rainer und Dankmar. Die beiden erschienen, jeweils einen Pflug hinter sich gespannt, und zogen tiefe Furchen um den See. Mit jeder Umrundung begann das Wasser stärker zu brodeln. Mag Helheim eine eisige Ödnis sein, so brennt Hels Zorn heißer als die Feuer Muspellsheims. Kaum hatten die Stiere ihre letzte Runde vollendet, da verschlang der See den eidbrecherischen Mönch mitsamt der Hütte.«
Ich lehnte mich zurück. Berlin gehörte zu den drei am höchsten verschuldeten Bundesländern Deutschlands. Kein Wunder, wenn der Zorn der Göttin noch immer auf dem Landstrich lag.
»Und dir sind die beiden Stiere erschienen?«
»Ja.«
»Krass. Was wollten sie?«
»Dass ich morgen früh das Ufer des Sees pflüge.«
Ob ich das Fenster aufreißen und die Musikanlage auf volle Leistung stellen sollte? Die Gartenrotschwänze wären bestimmt überrascht, wenn heute ich sie vor dem Sonnenaufgang aus dem Schlummer reißen würde.
Ich stand in der Küche, kochte Kaffee, goss diesen in einen Thermobecher, gab fünf Teelöffel Zucker sowie Milch hinzu und machte mich bereit, das Haus zu verlassen.
Ein Krachen ertönte aus dem Schlafzimmer. Ich seufzte. »Dankmar, da passt du nicht rein.«
»Verdammte Scheiße, ich bin es, Rainer. Warum steht hier ein Bett rum?«
»Weil ich irgendwo schlafen muss.«
»Aber mein Bruder hat es gestern kaputt gemacht.«
»Habe mir ein neues gekauft.«
»Ähm, ist da Garantie drauf? Vielleicht auch auf dem Kleiderschrank? Könnte sein, dass ich da mit den Hörnern festhänge.«
Stiere aus dem Totenreich konnten echt nervig sein. »Was willst du?«
»Dich wecken.«
»Bin wach.«
»Das sehe ich.«
»Echt? Ich glaube eher, dass du ein Brett vor dem Kopf hast. Oder besser gesagt eine Schranktür.«
Aus dem Schlafzimmer erscholl ein tierisches Lachen. »Der ist gut. Bereit zu pflügen?«
»Klar.«
Ich verließ die Wohnung, ohne nach Rainer zu sehen. So wie er erschienen war, würde er wohl auch wieder verschwinden.
»Was soll das?« Der Mann in der Ordnungsamt-Jacke, heute mit dem Mister-Bean- statt Vin-Diesel-Blick, musterte die umgepflügte Wiese um den See.
»Ich pflanze Sommerweizen.«
»Sie tun was?«
»Weizen pflanzen.«
»Das geht nicht.«
Ich hielt inne. »Warum?«
Die Haltung des Mannes straffte sich. »Weil es verboten ist.«
»Und das steht in Ihrem schlauen Buch da.« Ich deutete auf die Brusttasche.
»Genau.«
»Können Sie mir die Passage vorlesen, wo steht, dass das Umpflügen von Grünflächen und Aussäen von Getreide verboten ist?«
Der Ordnungsamtsmitarbeiter zog das Büchlein hervor, schlug das Inhaltsverzeichnis auf und ließ seinen Blick über die Seiten schweifen.
»Schon fündig geworden?«, fragte ich.
»Hab’s gleich.« Hektisch blätterte er in seinem Buch hin und her.
»So lange säe ich mal weiter. Habe heute Nachmittag noch was vor.«
Korn um Korn fiel in die Erde, während der Mann auf der Bank mit jeder verstreichenden Sekunde nervöser wurde.
Ein letzter Griff in den Beutel, ein letzter Wurf und der Weizen war ausgebracht. Blieb nur noch eins zu tun. »Wenn in dem Buch alles niedergeschrieben ist, was die öffentliche Ordnung stört, würde dies doch bedeuten, dass alles, was darin nicht verzeichnet ist, keine Störung der Ordnung darstellt.«
Gestern noch ein Torquemada-Verschnitt, wirkte mein Gegenüber heute verloren. Sein so geliebtes Regelbuch bebte in zitternden Händen.
»Irgendwo hier muss etwas stehen. Das kann nicht sein. Man darf doch nicht einfach so einen Park umpflügen. Wo kommen wir denn da hin.«
»Nehmen Sie sich Zeit.« Ich ließ meinen Blick über das Tagwerk schweifen. Seltsame Befriedigung lag im Anblick der umgepflügten Erde. Gestern noch hätte ich kaum für möglich gehalten, wie gut körperliche Aktivität mir tat.
Vom nahen Friedhof drang das Pfeifen der Vögel zu mir herüber.
»Entschuldigung, ich wollte eben nicht stören, aber wo muss ich hin?«
Kaum war der Mann vom Ordnungsamt, kontinuierlich den Kopf schüttelnd, davongeeilt, da riss mich eine Stimme aus meiner Kontemplation. Vor mir stand ein semitransparenter Greis in einem schwarzen Anzug. »Wie meinen?«
»Da war ein Sog, der mich von dort drüben hergeführt hat.« Er deutete auf den nahen Friedhof Eythstraße. »Manche von uns liegen schon sehr lange dort, aber nichts passiert. Kein leuchtender Tunnel in die nächste Welt, keine Auferstehung. Doch als Sie eben den Park gepflügt haben, da haben wir eine Erschütterung im Gewebe der Realität gespürt. Irgendwas hat sich verändert. Irgendwo hat sich für uns ein Durchgang geöffnet. Hätten Sie eine Idee, wo diese Tür ins nächste Reich sein könnte?«
Mein Blick wanderte zum See, der still vor mir lag. Die Blanke Helle, das Heiligtum der Hel und mit den Mächten Helheims verbunden.
»Einfach durch den See hindurch und schon sind Sie in der nächsten Welt.«
»Danke.« Der Tote wandte sich zum Gehen, hielt dann jedoch inne. »Was erwartet mich dort drüben?«
Ich lächelte. »Das ist ein Geheimnis, welches Sie selbst ergründen müssen.«
»Wie sieht es denn hier aus?« Sie stand in der Schlafzimmertür, ein Lächeln auf den Lippen.
»Du?« Träumte ich?
Sie stürmte auf mich zu, ihre Arme umschlangen mich, pressten mich fest an sie. Ich roch den Duft von Jasmin, welchen sie so sehr liebte. »Wäre dir ein Stier im Schlafzimmer lieber?«
Ich schüttelte den Kopf, Tränen in den Augen. »Aber wie?«
»Tore kann man in zwei Richtungen durchschreiten. Jedenfalls wenn zwei Stiere bei Hel ein gutes Wort für dich einlegen.« Sie wischte mir die Tränen von den Wangen und presste mir einen Kuss auf die Lippen.
Lyakon widmet sich in den Leiwener Wäldern der Totenbeschwörung und dem Verfassen skurriler Fantasy- und Gruselgeschichten mit historischem Einschlag. Zwischen Spukgestalten und schrägem Humor entstehen Texte, die gleichermaßen zum Schaudern und Schmunzeln einladen. Bei Shadodex erschien u. a. seine Kurzgeschichtensammlung »Scyomantische Gespräche«.
Mehr Infos unter: www.lyakon.de
Bastian Wysoglad: Abgetaucht
Es gibt Städte, große und kleine. Und es gibt Dörfer. Man unterscheidet sie von den Städten anhand ihrer Bebauung, des Straßennetzes, der Einwohnerzahl … vor allem aber erkennt man sie an den Kindern und Jugendlichen – an ihrer zu Freundschaft geneigten Art, ihrer Offenheit gegenüber anderen Menschen und ihrer Einstellung zur Welt. Ihr Leben ist nicht so eingefahren und getaktet wie das der Stadtkinder. Ich bin ein Dorfkind, und dies ist meine Geschichte. Ich erwarte nicht, dass Sie sie mir glauben; aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass kleine Orte Dinge verbergen, von denen die moderne Schnelllebigkeit der Welt keine Vorstellung hat. Ich möchte Ihnen von einem solchen Ort und seinem Geheimnis erzählen. Es wird mir nicht leichtfallen, aus Gründen, die sich während der Geschichte ergeben. Und obwohl inzwischen zwanzig Jahre vergangen sind, ist dies die Geschichte eines Dorfkindes.
Als Jugendlicher war ich in einer Clique. Außer mir wohnten alle seit ihrer Geburt in Schlemen – ein kleines Dorf südlich von Dresden, ein alter Bestandteil der Gemeinde Radebeul und seit jeher für die unmittelbare Wasserquelle, die Elbe, bekannt. Nur ich war mit meinen Eltern erst 1998 aus Dresden hinzugezogen. Damals war ich elf Jahre alt. Doch hätte man nicht von der Tatsache gewusst, wäre es nicht aufgefallen, weil mich die Gruppe in einer Art und Weise aufgenommen hatte, dass ich mich fragte, ob wir uns von früher kannten. Und wir alle waren froh, dass es so war; wir fragten uns, ohne darüber zu sprechen, wie wir uns wohl entwickelt hätten, wären wir in der Großstadt zehn Kilometer weiter nördlich aufgewachsen, wo der Verkehrslärm keine Tages- und die Jugendlichen keine Ruhezeiten kannten.
Nun, heute weiß ich, dass uns eine schreckliche Sache erspart geblieben wäre.
Aber alles der Reihe nach. Wie ich schon sagte, zog meine Familie erst später aus Dresden nach Schlemen, weshalb ich mich noch gut daran erinnern kann, wie ich den Anschluss, der später nicht mehr wegzudenken war, gefunden hatte. Vor allem aber weiß ich eines: Wir waren eine Gruppe, unzertrennlich, die Gedanken der anderen lesend und uns immer (na gut, fast immer) einig. Hin und wieder liefen uns andere Dorfbewohner über den Weg, und dann waren wir die Ersten, die den Mund öffneten, um zu grüßen. Die Gesichter der Leute, besonders von den älteren Damen, waren manchmal erstaunlich überrascht, das können Sie sich nicht vorstellen, aber nicht ohne Freude. Kaum waren sie dann um die nächste Hausecke verschwunden, ließen wir unseren Ton wieder anschwellen, der von allem anderen als Höflichkeit gesegnet war, von dem aber jeder wusste, wie er ihn aufzunehmen hatte. Eine Sache, die, denke ich, Stadtkinder mit einem größeren Hauch Empörung geschluckt hätten. Aber wir verstanden uns einfach. Das hat eine Gruppe von Dorfkindern so an sich, besonders wenn alle im selben Ort leben.
Eine wichtige Sache gäbe es da noch zu erwähnen, die uns Dorfbewohner von den Straßenhockern unterscheidet: Unsere nie erschöpfende Motivation, die nie einsetzende Trägheit – denn wir sind ständig unterwegs und geraten nicht in das Loch der Stubenhocker, welches jeder solche einmal durchlebt, spätestens wenn der erste Schnee die letzten Blätter auf den Bürgersteigen bedeckt. Wir haben uns oft gefragt, wie heutige Jugendliche in unserem damaligen Alter ihren Drang nach Erlebnissen überwinden; immerhin muss jeder einmal den Wunsch verspüren, aus seinen vier Wänden zu kommen und etwas zu erleben, von dem er berichten kann.
Jedenfalls dachten wir das.
Ich gebe zu, dass Schlemen nicht der beste Ort ist, um seinen Wünschen nach Abenteuern gerecht zu werden – mit einer Rutsche und einer Schaukel für Kleinkinder (… na schön, und einem Briefkasten) ist da nicht viel zu machen –, doch es schien uns von Anfang an vorherbestimmt, dass wir irgendwann das Ortsschild von Schlemen übertreten würden, um uns nach neuen Anreizen umzusehen.
Und es hatte funktioniert.
Wenn ich diesen Tag auch seit Jahren zu vergessen versuche.
Unsere Clique, die ich zu Beginn erwähnt hatte, trug den offiziellen Titel »Die Schlemener Dorfbande«. Wir hatten keine Ausweise oder Visitenkarten oder einen ähnlichen Quatsch, weil wir der Meinung waren, dass uns ohnehin jeder kannte – je kleiner die Nachbarschaft, umso größer die Plapperwerke. In einem kleinen Dorf weiß jeder über die Geheimnisse des anderen Bescheid, ohne dass der Betreffende ahnt, dass andere über seine Geheimnisse Bescheid wissen, so wie wir wussten, dass Herr Hänsel im Sommer vor drei Jahren von Marks Mutter auf seiner Terrasse auf der Palmenstraße beim Masturbieren erwischt wurde, als sie ihm ein Paket bringen wollte, das die Post versehentlich bei ihr abgelegt hatte. Oder dass sich in dem alten Haus der Benders, welches schon seit Jahren leer stand, einst ein Mord zugetragen hatte (genau genommen war es ein Doppelmord, denn der Besitzer hatte seine Frau zuerst vergewaltigt, sie erschossen und sich dann selbst ein tödliches Gesöff zusammengemixt, welches er neben ihr liegend ausgetrunken hatte). Wir waren uns natürlich im Klaren, dass man über uns und einige unserer Mätzchen Bescheid wusste. Und über uns selbst – über Alexander Berghold, Morten Biesold, Tom Kriegel und mich.
Alex war der Älteste von uns vieren und besuchte mit siebzehn Jahren die elfte Klasse des Goethe-Gymnasiums in Langewitz. Er war sozusagen unsere Führungsposition, und wie es schien, wollte er die nach seinem Abitur behalten. »Sobald ich Lehramt studiert habe, bestimme ich endlich selber, wann die Kinder ihr Zeug einpacken«, hatte er uns oft vermittelt.
Tom war der Jüngste und ging ebenfalls aufs Gymnasium, allerdings auf ein christliches in Dresden, da seine Eltern katholisch waren.
Morton und ich waren im gleichen Alter, doch unser Bildungsgang ließ höchstens einen Realschulabschluss an der Oberschule in Langewitz zu. Zu dem Zeitpunkt, als der Schrecken passierte, gingen wir in die neunte Klasse. Wir wollten beide Schriftsteller werden, und nun sieht es so aus, als könnte es bei mir tatsächlich funktionieren, doch wer weiß, wem ich das Geschriebene zeigen werde – ob ich es überhaupt jemandem zeige –, aus Angst, die Leute könnten mich verspotten und üblere Gerüchte über mich verbreiten als zu unserer Zeit in Schlemen.
Ich sagte bereits, dass wir eines Tages Schlemen verließen … Das stimmte auch, allerdings gingen wir kaum weiter als ein paar hundert Meter in den angrenzenden Wald. Es war ein heißer Tag im Juli des Jahres 2003, und wir brauchten alle mal eine Erfrischung. Wir besaßen zwar einen Pool in unserem nicht bescheidenen Garten, doch es war nicht gerade abenteuerlich, wenn unsere Eltern dabei auf der Terrasse saßen und zusahen, wie wir im Wasser herumalberten und planschten, und wir ständig auf der Hut sein mussten, nicht von ihnen geschimpft zu werden, wenn hin und wieder ein paar Spritzer über den Beckenrand schwappten und die Feuertonne auf der angrenzenden Wiese bespritzten. In unserem Alter wollten wir für uns sein, unbeobachtet und frei und … unabhängig.
Und uns allen brannte ein ganz bestimmter Wunsch unter den Nägeln: Wir wollten den Steinbruch auf dem Berg besuchen.
Wir hatten nie darüber gesprochen, doch alle wussten wir, dass er existierte, weil wir als Kinder mit unseren Eltern dort spazieren waren, als es etwas kühler war. Und da wir auch wussten, dass wir alle dieselben Gedankengänge hegten, bedurfte es an jenem Tag nicht vieler Worte, zu vereinbaren, unsere Badesachen zu packen und uns auf den Weg nach oben zu machen. Wir planten, bis zur Dunkelheit dort zu bleiben, um den Abenteuereffekt zu erhöhen, zumindest aber bis zur Dämmerung. Doch als wir loszogen, stach uns die Hitze noch mit ihrer vollen Kraft in den Rücken und verbrannte unsere Nacken. Wir wussten, es würde eine herrliche Belohnung werden, nachdem wir uns erst einmal durch die Hitze gequält hatten, die mit jedem Schritt nach oben anzusteigen schien. Unsere T-Shirts durchnässten, sodass wir befürchteten, einen Kälteschock zu erleiden, wenn wir in die Frische des von den Steinen gekühlten Wassers eintauchen würden.
Auf halbem Weg durch die Sträucher (anfangs hielt der Schatten des Waldes die Hitze noch in Schach, doch nach kurzer Zeit war auch der machtlos) hielt Morten mich am Arm fest und sagte: »Können wir nicht eine Pause machen? Ich sterbe gleich.« Er wickelte die Flasche Ginger Ale aus seinem Handtuch und begann den Deckel aufzuschrauben.
Ich hätte seinem Wunsch gern zugestimmt, da auch mich die Hitze nahezu betrunken machte, doch Alex kam mir zuvor. »Nur noch ein Stückchen, ihr Luschen. Dann könnt ihr eure Ärsche im Wasser wälzen, und heute Abend könnt ihr euch darauf ordentlich einen runterholen.«
»Du darfst ihn mir gerne auf der Stelle lutschen, wenn wir jetzt anhalten und ich etwas trinken darf«, gab Morten zurück.
Doch Alex reagierte nicht auf ihn.
»Fick deine Mum.«
Wir quälten uns weiter durch die sengende Hitze, stiegen über knackendes Unterholz. Irgendwo über uns gab ein Kuckuck seine routinemäßigen Töne von sich, Amseln raschelten in den Büschen neben uns. Ich pflückte eine Heidelbeere von einem der Sträucher neben dem Weg. Kurz darauf tat Tom es mir gleich. Ein kleiner Trost, auch wenn wir alle nur an das Wasser dachten, das schon bald unsere Haut mit einem erfrischenden Schleier umhüllen würde.
»Jetzt … seid ihr am Arsch«, keuchte Morten. »Der Fuchsbandwurm wird sich in euren dünnen Gedärmen vermehren, und dann werden sie gemeinsam euer Inneres zerfressen.«
»Wenn das heute Abend die letzte Aktion meines Lebens ist, komme ich damit klar«, erwiderte ich und versuchte mich an einem Lächeln. Mein Gesicht musste glühen und die Haut unter dem ausbrechenden Schweiß schwimmen.
Wir hatten unsere Handys dabei (wir alle besaßen Modelle des Nokia 8310 aus dem Jahr 2001, ein weiteres, wenn auch unbrauchbares Merkmal, das uns alle verband), doch keiner machte sich die Mühe, zwischendurch nach der Uhrzeit zu sehen, aber ich vermutete, es müsse so gegen siebzehn Uhr sein.
Vor uns bäumte sich ein Berg von Brennnesseln auf, und zu der Hitze gesellte sich nun das ekelhafte Stechen ihrer Blätter. Vorsichtig kämpften wir uns durch die Lücken hindurch, während hin und wieder einer aufschrie.
Irgendwo neben uns raschelte es.
Wir zuckten zusammen, an unseren Stirnen und Beinen lief Schweiß hinab. Auch Alex bremste seinen Schritt.
Aus einem Heidelbeerstrauch schnellte ein Eichhörnchen und hielt vor unseren Füßen inne. Im Chor keuchten wir alle erleichtert auf.
»Niedlich«, jubelte Tom und grinste uns an.
Meine Badesachen hatte ich in einen kleinen Rucksack gestopft, der mir einmal gepasst hatte, als ich das letzte Mal mit einem gebrochenen Bein im Kinderwagen saß, doch ich dachte mir, dass er für diesen Zweck reichte. Ich hatte mir außerdem ein Basecap von Adidas eingepackt, für den Fall, dass die Sonne doch ihren Weg durch die Bäume fände – was nun der Fall zu sein schien –, und kramte es jetzt hervor, weshalb ich meinen Schritt etwas verzögern musste und Alex sofort wieder zu meckern begann. Doch ich achtete nicht auf ihn oder sah es so, wie ich es sonst immer sah – wie es jeder sah, wenn wir uns in der Gruppe gegenseitig Beleidigungen zuriefen.
Benommen setzten wir unseren Weg fort und wichen weiter den Brennnesseln aus. Ich dachte wieder an den Steinbruch, das kühle Wasser darin, eine Stelle, wo nie die brennende Hitze der Julisonne hinkam, und bei dem Gedanken schien sich meine Körpertemperatur zu erhöhen. Ich versuchte an etwas anderes zu denken und dachte an unsere Eltern und daran, was sie wohl sagen würden … Sie wussten natürlich darüber Bescheid, wohin wir wollten, doch dachten sie auch an alles, was wir dort vorhatten? Ein Gedanke, mit dem ein Jugendlicher nun mal spielte, wenn er an einem Steinbruch stand und aufs Wasser hinabblickte? Es gab natürlich noch weitere Gründe für uns, diese besondere Stelle im Wald zu besuchen, als nur unseren Bevormundenten auszuweichen, doch wussten sie es auch? Zwar waren wir keine kleinen Kinder mehr, und scheinbar fühlten sich alle dazu bereit, doch sie würden noch lange in der Stellung sein, uns Verbote zu erteilen.
Solange du deine Füße unter unserem Tisch hast, Charlie …
Wie ich es hasste, wenn sie das sagten.
Vor uns beschleunigte Alex seinen Schritt; hätten wir sein Gesicht gesehen, hätten wir sofort gewusst, was Sache war. So verzögerte sich unsere Freude um ungefähr vier Sekunden.
Alex zog sich sein durchweichtes T-Shirt vom Leib und wirbelte damit in der Luft herum, dann drehte er es zusammen wie einen riesigen Lappen und wrang es aus. Er ging ein paar Schritte, warf es neben sich zwischen zwei Sträucher und ließ sich daneben sinken. Zuerst sah der Rest von uns sich in die Augen, die Gesichter glühend rot wie Feuerbälle, und fragte sich, was zur Hölle der Junge vorhatte. Erst konnte er von seiner Wanderung durch die drückende Hitze offenbar nicht genug bekommen, und nun fläzte er sich einfach so ins Gebüsch, hinein in all die Zecken und Käfer und Wühlmäuse und …
Dann sahen wir es. Wir sahen es alle gleichzeitig. Wir sahen uns selbst ungefähr fünf Meter tiefer auf dem Wasser; verschwommen standen wir nebeneinander, die Münder aufgerissen, erfreut und schockiert zugleich. Bald darauf tauchte auch Alex ein Stück hinter uns auf und führte wellige Bewegungen auf einem schwarzen Untergrund aus.
Der Weg endete hier abrupt, und an seine Stelle trat wie aus dem Nichts der Steinbruch, den wir vor Jahren einmal besucht und seitdem nie mehr zu Gesicht bekommen hatten. Unbekannt, vergessen, abgelegen lag er da zwischen Bäumen und Sträuchern und Büschen … das Wasser in der Schlucht der Jahrzehnte alten Steine gefangen – und alles, was sich in dem Wasser befand.
Bei dem Gedanken lief mir ein Schauer über den Rücken und kühlte den Bereich meiner Wirbelsäule, von Schweiß getränkt, etwas ab, und ich glaubte zu sehen, dass es Morten und Tom in diesem Moment ähnlich erging.
Alex starrte hypnotisiert auf das Wasser und betrachtete sein schwingendes, sich verzerrendes Spiegelbild. Auch ich erlebte eine Welle der Spannung, als ich meines betrachtete: Es war, als könnte ich an der Stelle, wo die Oberfläche die Spiegelung meines Körpers zurückwarf, in die Unendlichkeit hinuntersehen (oder wenigstens bis zum Grund des Steinbruchs, und ich glaubte, dass das sehr, sehr tief war) und dabei mein Schicksal, meine verborgenen Ängste und Schwächen und Träume erkunden wie Taucher den Grund eines Sees.
Dennoch war es nur ein Steinbruch. Nicht groß, vielleicht die Fläche eines halben Quadratkilometers. Die Ränder wiesen ungefähr dieselbe Länge auf, doch wir befanden uns auf dem breitesten Stück. Daneben verliefen die Ränder trapezförmig in Richtung des anderen Ufers, und die Steine streckten sich in die Höhe, als hätte einst ein Riese diese Mauer errichtet. In der Richtung löste sich die Dichte der Bäume und ließ die Sonne in der Mitte des Sees das Wasser blassgolden erstrahlen. Bald würde nur noch ein schwacher Streifen davon zu sehen sein.
»Seht mal«, sagte Alex. Wir drehten uns kurz zu ihm um; sein Gesicht war nach wie vor starr auf das Wasser gerichtet, doch sein Finger zeigte auf eine Stelle unter uns, welche steilkantig in die Tiefe fiel. »Da steckt ein Seil in der Wand. Dort können wir uns wieder nach oben hangeln. Hier ist es auch nicht allzu hoch, vielleicht zwei, drei Meter.«
Wir betrachteten alle die Stelle, auf die er zeigte, und tatsächlich ragte da ein Strick aus der Granitwand und reichte bis hinunter ins Wasser. Äußerlich wirkte das Seil abgewetzt und nicht besonders stabil – wer weiß, wie lange es da schon rumhing. Aber daran konnten wir uns tatsächlich wieder nach oben hangeln.
Nach oben.
Nicht nach unten.
Doch wir wussten, wie wir hinunterkamen. O ja, das wussten wir alle. Mit reiner Dorflogik, ohne es zu erwähnen. Aus dem Drang nach einem Erlebnis, irgendeinem Erlebnis.
Aus unserer Entfernung konnten wir die Höhe am anderen Ufer nur schätzen, aber für eine grobe Vermutung reichte es. Keiner sprach darüber. Alle waren beeindruckt von der Ausstrahlung des Wassers unter uns. Es schien viel mächtiger zu sein, als wir es uns vorgestellt hatten.
Wir sahen, dass der Pfad doch nicht hier endete, sondern stattdessen scharf nach links abbog, und auf diesem Weg würden wir ans andere Ufer gelangen.
Auch diese Strecke war von einer Vielzahl an Büschen und Sträuchern gesäumt, teilweise vertrocknet, teilweise vor Leben sprießend. Wieder zwängten wir uns durch enges Gestrüpp, handelten uns Kratzer ein, deren Schmerz die Hitze sofort verdrängte. Inzwischen hatten alle ihre Oberteile von den Körpern gezogen, und das Sonnenlicht verlieh dem Schweiß auf unserer Haut einen stechenden Glanz. Rechts von uns schrumpfte die Fläche des Wassers zu einem kleinen Trapez, doch wir sahen nicht hinunter und konzentrierten uns stattdessen auf den Weg.
Schließlich machte die Strecke eine Biegung nach rechts, und wir mussten über Steine klettern. Wir halfen und hievten uns gegenseitig nach oben. Morten war der Kleinste von uns. Alex ging nicht mehr voraus; er stemmte Mortens Hintern von unten eine höhere Stufe hinauf. »Wenn du furzt, lasse ich dich fallen, also denk nicht mal dran.«
»Wenn ich es doch tue, brich dir keinen Zacken aus der Krone.«
Kurz darauf erreichten wir die Spitze der Felswand und gleichzeitig die höchste Stelle des Berges. Wir sahen hinunter und rissen die Münder auf. Für einen kurzen Moment erwartete ich, dass der Zeitpunkt gekommen war, an dem die Ersten sich abwandten und ausstiegen, sagten, dass die anderen sie am Arsch lecken könnten. Aber keiner sprach ein Wort, was mir die Bestätigung gab, dass nicht einer mit dem Gedanken an einen Rückzieher spielte. Auch fiel mir auf, dass ich eigentlich nicht wirklich daran gedacht hatte, doch der Gedanke war aufgeblitzt und hatte mich gleich wieder verlassen. Wir waren eine Gruppe, die Schlemener Dorfbande, und somit sahen wir uns als eine Person: entweder alle oder keiner.
Wir sahen an der Felswand hinunter – hinunter in eine riesige Schlucht, mit schwarzem Wasser gefüllt. Fünfzehn Meter, vielleicht zwanzig. Ein weiterer Aspekt über den eigenartigen Hauch von Steinbrüchen, den ich bereits erwähnt hatte. Das Wissen, nicht auf den Grund blicken zu können, sondern nur in schwarzes Wasser, welches klar, jedoch aufgrund der Tiefe unberechenbar war; die Kälte, die vom anderen Ende jener Tiefe emporkroch, zusammen mit der ewigen Dunkelheit. Und doch war es nur Wasser; nichts Tödliches, solange man schwimmen konnte.
Von dieser Höhe waren unsere Spiegelbilder nicht mehr zu erkennen. Und obwohl da nichts zu sehen war, konnte keiner die Augen von der stillen Oberfläche lassen.
Dann zerriss etwas diese Stille. Am Ufer rechts von uns spritzte ein Schwarm Fische – wahrscheinlich Plötzen und Rotfedern – auseinander, und ihnen folgte ein größerer Schatten. Ein Hecht. Das war mein erster Gedanke. Und tatsächlich sah ich kurz darauf den länglich dünnen Schatten: Er war riesig. Vielleicht ein altes Exemplar, das schon viel Nahrung in diesem See gefunden hatte. Es erfreute mich, zu wissen, dass der Fischbestand üppig war. Auch die anderen blickten gedankenverloren auf diese Stelle. Dann klangen die Wellen ab, und das Wasser verwandelte sich wieder in eine dunkle Scheibe. Es war sauber, trotz des Laubes, das hier auf den Weg gerieselt war.
Im Herbst wird es wohl schlimmer aussehen, dachte ich.
Kaum hatte sich das Wasser unter uns beruhigt, raschelte es hinter uns erneut. Wir drehten uns um. Wieder nur ein Eichhörnchen. Oder war es womöglich das Eichhörnchen? Konnte es uns bis hierher gefolgt sein? Das konnte es in jedem Fall, doch aus welchem Antrieb heraus? Schweigend kamen wir zu dem Schluss, dass es an der Macht dieses Steinbruchs liegen musste, die er auf andere Lebewesen auszustrahlen schien.
»Ich hoffe, du hast deine Badehose schon zu Hause angezogen, Alex«, sagte Morten. »Unser Freund hier würde ihn nicht sehen wollen.«
Daraufhin brachen wir alle in Gelächter aus, und das löste schließlich die Magie unserer Blicke, und wir warfen unsere Sachen beiseite – das, was wir noch trugen, und das waren nur unsere Klamotten. Rucksäcke samt Handtüchern hatten wir am anderen Ufer abgelegt, ebenfalls ohne darüber zu sprechen.
Wir standen an der Kante des Steinbruchs. Unsere Zehen ragten ein winziges Stück über den äußeren Vorsprung. Aus der Ferne erkannten wir das Seil als dünne Schnur an der gegenüberliegenden Felswand.
Wir sprangen alle gleichzeitig. Kein Eins-zwei-drei oder Drei-zwei-eins. Plötzlich flogen wir durch die Luft nach unten, mit dem Kopf voran. Ich wusste – und wahrscheinlich wussten es auch die anderen –, dass es völlig wahnsinnig war, doch wenn ich ins Wasser sprang, musste ich einfach sehen, worauf ich zuflog. Wäre ich mit den Füßen zuerst gesprungen, wäre ich blind gewesen.
Gerade hatten wir noch stumm und bewegungslos und fasziniert nebeneinandergestanden und uns schließlich, alle in einer Reihe, kopfüber fallen lassen, wohlwissend, dass ein Stein nahe am Ufer unser Leben ausblasen könnte. Die Chancen dafür waren nicht gering, denn wir kannten den Steinbruch ebenso wenig wie ein gewöhnlicher Zivilist einen Fuchsbau von innen.
Ach was, dachte ich, ein einzelnes Blatt hätte uns das Licht auslöschen, unseren Bauch aufschlitzen können, während unsere Freunde verzweifelt versucht hätten, unsere schwimmenden Eingeweide aus dem Wasser zu angeln.
All diese Gedanken kamen mir während des Sprungs, während dieser fünfzehn bis zwanzig Meter – es dauerte vier oder fünf Sekunden, dann war mein gesamter Körper unter Wasser. Ich hatte keine Ahnung, wie tief ich absank, doch mein Trommelfell begann zu drücken und zu schmerzen, und ich spürte die plötzliche Kälteschicht unter Wasser. Ich hatte davon gehört – ich glaube, es nennt sich Sommerschichtung: Unten ist das Wasser aufgrund des mangelnden Sonnenlichts kalt, oben wird es von der Sonne gewärmt und strahlt die gespeicherte Wärme auf Badende aus.
Ich hörte auf zu sinken. Schwebte regungslos im Wasser. Ich öffnete die Augen. Sah die verschwommene Wasserdecke, die von oben auf meinen Schädel drückte; ansonsten war alles schwarz oder zumindest dunkelbraun. Im Steinbruch war das Wasser dichter als in anderen Seen und hatte somit eine höhere Auftriebskraft. In der Stille lauschte ich meinem Herzschlag, der sich verlangsamt hatte.
Poch – poch – poch – poch …
Dann spürte ich, wie ich nach oben gedrückt wurde, zuerst langsam, dann immer schneller. Irgendwann war es nicht mehr schnell genug. Ich rang nach Luft. Meine Lungen zogen sich zusammen, pressten und pumpten, mein Herz trommelte mit voller Kraft in meiner Brust. Ich zuckte mit den Beinen, strampelte mit den Bewegungen eines Fahrradfahrers, verlor aber nicht meine Gleichmäßigkeit.
Auf dem Weg nach oben sah ich den schwachen Glanz des einfallenden Sonnenstrahls, er wurde stärker und stärker, und bald war er so nahe, dass er mich zu blenden schien. Meine Beine wurden weich, und ich wusste, wenn ich nicht sofort Luft würde einatmen können, würde ich mein Bewusstsein verlieren. Das Wasser rauschte in meinen Ohren, nahm einen hohen Ton an. Ich benutzte meine Arme; mit jedem Schwimmzug glaubte ich, die Oberfläche gleich zu berühren, die frische Luft des Schattens atmen zu können, doch jedes Mal benötigte ich einen weiteren. Und noch einen. Und noch einen. Ich konnte meinen Körper schon deutlich erkennen, den Umriss jedes einzelnen Gliedes.
Dann, als ich meine Sinne schwinden spürte, als sich mein Herzschlag verlangsamte, sogen meine Lungen wieder Luft ein. Ich schnappte hektisch nach diesem kostbaren Element, und in dem Augenblick erschien mir nichts wertvoller. Eine Brise umspülte mein Gesicht. Ich atmete langsamer und drehte mich um.
Von mir ging ein Kreis sich vergrößernder Wellen aus … doch von den anderen konnte ich niemanden sehen. Ich blinzelte mir etwas Wasser aus den Augen. Die Oberfläche war, abgesehen von meinen eigenen Erzeugnissen, glatt wie eine Scheibe. Eine getönte Scheibe, durch die man nicht hindurchsehen konnte. Ich bemerkte, dass ich mich mitten in dem einzigen Sonnenstrahl befand, den die Öffnung zwischen den Bäumen durchließ; auch das Licht begann sich zu ziehen und allmählich zu verblassen, ein Zeichen, dass die Zeit seit unserer Ankunft ein ganzes Stück fortgeschritten sein musste. War der Abend wirklich schon angebrochen? Im Sommer ließ sich das generell schlecht sagen.
Ich drehte mich wieder nach meinen Freunden um, doch nichts rührte sich. Außer …
Neben mir platschte es, und Alex’ Kopf schoss aus der Dunkelheit des Sees.
»Und mitten drauf!«, rief er und packte mich an den Schultern.
Ich schrie auf. »Verpiss dich bloß!«
Kurz danach tauchten auch die Köpfe der anderen auf und bildeten ebenfalls Wellenkreise um sich herum.
»We will take you higher«, sangen die anderen wild platschend neben mir und klatschten mir auf die feuchte Schulter, während ich weiterhin wild keuchte.
Schließlich erholte ich mich, und wir begannen in Richtung des anderen Ufers zu schwimmen, aber nur langsam.
»Nun«, sagte ich, »sieht aus, als hätten wir’s überlebt. Aber ich muss schon sagen, wir haben wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Oder eben alle Fische im Teich.«
Wir lachten alle gleichzeitig und spuckten Wassertropfen vor unseren Gesichtern her.
Tom sagte: »Hört auf, ich kriege noch Seitenstechen.«
»Wo holt ihr überhaupt die ganze Luft her?«, wollte ich wissen.
»Welche Luft? Wir brauchen keine Luft. Ach, wusstest du es noch nicht? Wir sind die letzten Abwandlungen der Fische, und wir können sowohl unter als auch über Wasser atmen.«
Ungefähr in der Mitte des Steinbruchs machten wir halt und sahen die Wände der tiefen Schlucht empor.
»Von dort sind wir gesprungen?«, fragte Morten. »Das haben wir nicht wirklich getan, oder?«
»Du hast es getan, Mort. Glaubst du es nun? Wenn du es schaffst, von dieser Klippe zu springen, kannst du dir auch von einem Eichhörnchen einen blasen lassen.«
»Witzig.«
Alex steckte seinen Kopf ins Wasser und tauchte wieder auf. »Nicht übel. Aber nichts für kleine Kinder wie euch, würde ich sagen.«
»Was hast du gesehen?«, fragte ich.
»Nichts. Genau das ist es. Nur Schwarz. Kaum zu glauben, dass in dieser Dunkelheit etwas leben kann.«
Mir war seine Antwort bereits klar gewesen. Ich selbst hatte meinen Kopf einmal in einen Steinbruchsee gesteckt – in einen anderen, nicht zu vergleichen mit diesem Geheimnis, in dem wir schwammen – und erinnerte mich an die Leere vor meinen Augen, die eigentlich gar nicht so leer war, denn konnte reine Leere einem Menschen einen solchen Schreck einjagen, wie ich ihn damals verspürt hatte? Es war diese Schwärze, die einen panisch machte, die einen Steinbruchsee vom besten Frei- und Waldbad der Welt unterschied, in denen man zumindest den Boden ausmachen konnte, und mochte der See noch so tief sein. In einem gewöhnlichen Gewässer waren immer irgendwelche Farben im Spiel, je nachdem, wie die Wasserqualität war – grün, bräunlich, violett, türkis. In einem Steinbruchsee aber war es einfach nur schwarz. Schwarz, weil die Steine ringsherum kein Licht erzeugen konnten … oder nicht wollten. Dieser Gedanke machte mir erneut Angst, jagte mir aber keinen Schauer über den Rücken, da meine Haut immer noch kühl war. Ich hatte mich an die Temperatur des Wassers gewöhnt, die oben etwas wärmer war, es war dennoch erfrischend. Angenehm erfrischend.
Etwa fünfzig Meter vor dem anderen Ufer stoppten wir. Wir alle hatten die Sache heil überstanden, konnten es aber immer noch nicht richtig glauben, konnten uns nicht vorstellen, wie vier Menschen gleichzeitig ein solches Glück haben konnten.
Das ist nicht wahr. Nur ein Mensch hatte Glück. Wir sind die Schlemener Dorfbande, und wenn einer diese Geschichte überlebt, dann tun es alle.