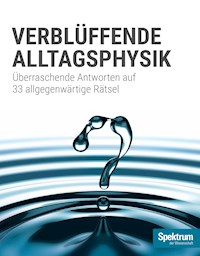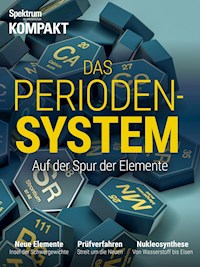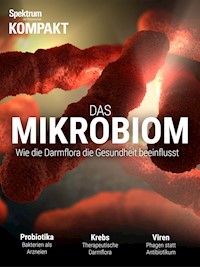5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Spektrum der Wissenschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gehirn&Geist Dossier
- Sprache: Deutsch
Heute schon gedacht? Cogito ergo sum – ich denke, also bin ich. Diese Erkenntnis des französischen Philosophen René Descartes (1596–1650) war einst der Sorge über einen bösartigen Dämon entsprungen, von dem er glaubte, dass er Sinne und Wahrnehmung irreführe. Descartes beruhigte sich mit der Feststellung: "Er täusche mich, so viel er kann, niemals wird er jedoch fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei." Der Grundsatz hat es längst aus dem Kreis der Denker und Gelehrten ins bürgerliche Wohnzimmer geschafft und ziert als Alltagsweisheit Küchenbretter, Wandtattoos und T-Shirts. Allerdings sagt er nichts darüber aus, wie wir eigentlich denken. Was passiert im Gehirn, wenn wir uns einer Empfindung bewusst werden? Und wie gelingt es uns, diese Eindrücke in Worte zu fassen? Dank innovativer Methoden gewinnen Neuroforscher immer neue Erkenntnisse zu solchen Fragen. Einige der wichtigsten sind in diesem Heft versammelt. Wussten Sie etwa, dass unsere Nase für manche Gerüche empfindlicher ist als die von Hunden (S. 18)? Viele Experten halten sie sogar für das meistunterschätzte Sinnesorgan! Und haben Sie schon einmal von einem Bewusstseinsmessgerät gehört? Was nach einer esoterischen Spielerei klingt, könnte bald schon zur Grundausstattung von Krankenhäusern gehören. Mit dem Verfahren lässt sich erstaunlich zuverlässig feststellen, ob ein Patient, der regungslos daliegt, noch bewusst erleben kann (S. 32). Zu guter Letzt möchte ich Sie auf einen Artikel hinweisen, der eine besondere Leistung des Gehirns hervorhebt: das Vergessen (S. 56). Was die meisten von uns wohl eher als lästiges Defizit empfinden, ist eine essenzielle Fähigkeit unseres Gedächtnisses. Ohne sie könnten wir nicht abstrakt denken und Wichtiges nicht von Unwichtigem unterscheiden. Eine dennoch unvergessliche Lektüre wünscht Ihnen Anna von Hopfgarten, Redaktion Gehirn&Geist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
EDITORIAL
Heute schon gedacht?
Anna von Hopffgarten
RessortleiterinHirnforschung
Cogito ergo sum – ich denke, also bin ich. Diese Erkenntnis des französischen Philosophen René Descartes (1596–1650) war einst der Sorge über einen bösartigen Dämon entsprungen, von dem er glaubte, dass er Sinne und Wahrnehmung irreführe. Descartes beruhigte sich mit der Feststellung: »Er täusche mich, so viel er kann, niemals wird er jedoch fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei.« Der Grundsatz hat es längst aus dem Kreis der Denker und Gelehrten ins bürgerliche Wohnzimmer geschafft und ziert als Alltagsweisheit Küchenbretter, Wandtattoos und T-Shirts.
Allerdings sagt er nichts darüber aus, wie wir eigentlich denken. Was passiert im Gehirn, wenn wir uns einer Empfindung bewusst werden? Und wie gelingt es uns, diese Eindrücke in Worte zu fassen? Dank innovativer Methoden gewinnen Neuroforscher immer neue Erkenntnisse zu solchen Fragen. Einige der wichtigsten sind in diesem Heft versammelt.
Wussten Sie etwa, dass unsere Nase für manche Gerüche empfindlicher ist als die von Hunden (S. 18)? Viele Experten halten sie sogar für das meistunterschätzte Sinnesorgan! Und haben Sie schon einmal von einem Bewusstseinsmessgerät gehört? Was nach einer esoterischen Spielerei klingt, könnte bald schon zur Grundausstattung von Krankenhäusern gehören. Mit dem Verfahren lässt sich erstaunlich zuverlässig feststellen, ob ein Patient, der regungslos daliegt, noch bewusst erleben kann (S. 32).
Zu guter Letzt möchte ich Sie auf einen Artikel hinweisen, der eine besondere Leistung des Gehirns hervorhebt: das Vergessen (S. 56). Was die meisten von uns wohl eher als lästiges Defizit empfinden, ist eine essenzielle Fähigkeit unseres Gedächtnisses. Ohne sie könnten wir nicht abstrakt denken und Wichtiges nicht von Unwichtigem unterscheiden.
Eine dennoch unvergessliche Lektüre wünscht Ihnen
IN DIESER AUSGABE
Editorial
Wahrnehmen
Das Geheimnis der Fingerspitzen
Unser Tastsinn ist ständig aktiv – meist ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Er ermöglicht es uns, die eigenen Bewegungen zu justieren und sogar Gefühle zu übermitteln.
Von Joachim Retzbach
Infografik
Von der Berührung zur Empfindung
Wie lösen taktile Reize eine bewusste Empfindung aus?
Das Sehen durchschaut
Die Neurobiologen David Hubel und Torsten Wiesel erhielten 1981 den Nobelpreis für ihre Erkenntnisse darüber, wie das Gehirn Seheindrücke verarbeitet. Die Geschichte einer wahrhaft visionären Forschungsarbeit.
Von Susana Martinez-Conde und Stephen L. Macknik
Nasentier Mensch
Lange Zeit hielten Wissenschaftler den menschlichen Geruchssinn für unterentwickelt. Sie haben sich getäuscht! Manche Gerüche erschnüffeln wir sogar besser als Hunde.
Von Frank Luerweg
Denken
Im Takt des Bewusstseins
Es ist eines der großen Rätsel der Geistesgeschichte: Wie kommt es dazu, dass wir uns und unsere Umwelt bewusst wahrnehmen? Offenbar ist unser Erleben das Ergebnis von Teamarbeit – einer fein austarierten Kommunikation zwischen Nervenzellen unterschiedlicher Hirnregionen.
Von Andreas K. Engel
Der Bewusstseinsdetektor
Immer wieder stehen Ärzte vor der schwierigen Frage, ob ein Patient, der völlig teilnahmslos daliegt, nicht doch noch Gedanken und Gefühle hat. Ein neues Verfahren erlaubt es, den Grad des Bewusstseins erstaunlich zuverlässig zu messen.
Von Christof Koch
Nur eine Kopfgeburt
Embodiment-Forscher bezweifeln zunehmend, dass unser Bewusstsein einzig und allein dem Gehirn entspringt. Vielmehr scheint sich der gesamte Körper am Aufbau des Ich-Gefühls zu beteiligen.
Von Christian Wolf
Erinnern
Das Gedächtnisnetz
Das Gehirn ist ein Massenspeicher – unzählige Erlebnisse bleiben über Jahrzehnte im Gedächtnis verankert. Jedoch speichert es diese nie isoliert ab. Forscher haben entdeckt, wie die Nervenzellen Erinnerungen zu einem Gesamtbild verknüpfen.
Von Alcino J. Silva
Infografik
Der lange Weg zur Erinnerung
Wir behalten bloß solche Ereignisse im Gedächtnis, die einen Neuigkeitswert besitzen. Dabei durchwandern sie verschiedene Verarbeitungsebenen im Gehirn.
Warum wir vergessen
Nur wer vergisst, kann Unwichtiges von Wichtigem trennen, abstrakt denken und Probleme lösen. Darüber hinaus hilft der lange unterschätzte Mechanismus sogar beim Erinnern.
Von Martin Korte
Sprechen
Wir verstehen uns!
Was geht beim Alltagsplausch im Kopf vor? Laut Neurolinguisten gleichen sich unsere Hirnaktivitäten in verblüffender Weise einander an, sobald wir miteinander reden.
Von Ruth Berger
Ein neues Bild der Sprache
Der amerikanische Linguist Noam Chomsky prägte mit seiner Theorie über die Universalgrammatik jahrzehntelang die Sprachwissenschaften. Doch seine Ideen darüber, wie Kleinkinder ihre Muttersprache lernen, erweisen sich als überholt.
Von Paul Ibbotson und Michael Tomasello
Konversation im Kopf
Neurowissenschaftler ergründen, wie Menschen mit sich selbst sprechen. Ihre Erkenntnisse liefern Einblicke in die verborgene Arbeitsweise unseres Gehirns.
Von Charles Fernyhough
Das formbare Gehirn
Selbst ist das Hirn
Mit jeder Erfahrung organisieren sich die neuronalen Netzwerke im Gehirn neu. Nach und nach verändert sich unser Denkorgan dabei sogar anatomisch. Wissenschaftler erforschen diese »neuronale Plastizität« an Musikern und Profisportlern.
Von Lutz Jäncke
Das Gehirn neu verdrahten
Das Gehirn von Erwachsenen gilt als weniger flexibel als das kindliche. Mediziner versuchen, es mit neuen Verfahren wieder plastisch und offen für längst abgeschlossene Lernvorgänge zu machen.
Von Takao K. Hensch
Bücher
Den Blick über den Tellerrand wagen
Ein Appell an Psychotherapeuten und Neurowissenschaftler, voneinander zu lernen
Ursprung des Glücks
Verständliche Einführung für neurowissenschaftliche Laien
Gut, dass wir darüber geredet haben
Zwölf Erkundungen unseres Bewusstseins
Newsletter
Lassen Sie sich jeden Monat über Themen und Autoren der neuesten Ausgabe von »Gehirn&Geist« informieren! Wir halten Sie gern per E-Mail auf dem Laufenden – natürlich kostenlos. Registrierung unter:
www.spektrum.de/gug-newsletter
WAHRNEHMEN
Das Geheimnis der Fingerspitzen
TASTSINN Ob wir gehen, uns hinsetzen, etwas greifen oder spüren – stets verlassen wir uns auf den Tastsinn. Erst langsam beginnen Wissenschaftler zu verstehen, wie wichtig taktile Erfahrungen für unser Leben sind.
VON JOACHIM RETZBACH
UNSER AUTOR
Joachim Retzbach ist promovierter Psychologe und Wissenschaftsjournalist in Wiesbaden. Seine Finger hält er mit dem Zupfen an Basssaiten auf Trab. Fürs Tippen im Zehnfingersystem hat es aber noch nicht gereicht.
Auf einen Blick: Die Welt erfassen
1 Viele Studien demonstrieren die Macht der Berührungen im Alltag: Sie machen die Empfänger hilfsbereiter und spendabler.
2 Taktile Reize stellen sogar eine Art eigene Sprache dar. Mit ihrer Hilfe können wir anderen gegenüber erstaunlich präzise unsere Gefühle ausdrücken.
3 Das Tastsinnessystem beruht auf einer Vielzahl verschiedener Rezeptortypen in der Haut und im Körper. Wie genau diese neuronal verschaltet sind, wird derzeit noch erforscht.
Die Instruktion scheint denkbar einfach: Die Versuchsperson soll ein Streichholz aus der Schachtel nehmen und anzünden. Nach fünf Sekunden ist die Aufgabe erledigt. Doch nun erhöht der Versuchsleiter den Schwierigkeitsgrad. Er injiziert mit einer feinen Nadel ein Betäubungsmittel in Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Die Substanz blockiert die Tastsinneszellen auf den Fingerspitzen der Probandin. Beim zweiten Versuch stellt sie sich ziemlich unbeholfen an. Immer wieder rutschen ihr die Hölzchen aus der Hand. Erst eine halbe Minute später gelingt es ihr endlich, eines in Brand zu setzen.
Die Szene stammt aus einem Video des schwedischen Psychologen Roland Johansson, das im Jahr 1979 zu einem einzigen Zweck entstand: Es sollte demonstrieren, wie wichtig Berührungsempfindungen für viele alltägliche Handlungen sind – meist, ohne dass wir uns dessen bewusst wären.
Der Tastsinn ist unser entwicklungsgeschichtlich ältester Sinn, die Haut unser größtes Sinnesorgan. Fast 20 Prozent des Körpergewichts entfallen auf sie. In jeder Sekunde melden Millionen von Sinneszellen – ihre genaue Zahl ist noch unbekannt –, ob wir festen Boden unter den Füßen haben, ob Wind durch unser Haar streicht oder unsere Fingerspitze gerade auf einen Knopf gedrückt hat. Nur daher wissen wir überhaupt, wo unser Körper endet und die Umwelt anfängt.
»Für jede kleine Bewegung brauchen wir die Rückmeldung der Tastzellen in der Haut und aus dem Körper«, sagt Martin Grunwald. »Ohne diese Information können Sie weder stehen, sitzen, essen noch sonst etwas tun.« Der Psychologe leitet das Haptik-Labor an der Universität Leipzig, das einzige Institut in Europa, das sich ganz der Erforschung des Tastsinns verschrieben hat.
Wissenschaftler haben das menschliche Hör- und Sehvermögen in den vergangenen Jahrzehnten stetig besser verstanden, bis in kleinste Details der neuronalen Verarbeitung. Beim Tastsinn hingegen steht man noch ganz am Anfang. Dabei deuten viele Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Bedeutung des Greifens und Fühlens für unser Leben bislang dramatisch unterschätzt wurde. Sie beeinflussen nicht nur, wie gut wir uns im Alltag zurechtfinden, sondern dienen auch der Kommunikation mit unseren Mitmenschen und scheinen sogar eng mit unserer psychischen und körperlichen Gesundheit zusammenzuhängen.
Fühlprobe mit der Zunge
Wie zentral der Tastsinn für unser Leben ist, zeigt sich bereits im Mutterleib. Ein Embryo fühlt seine Umgebung, bevor er die ersten Geräusche hört oder Helligkeit wahrnimmt. Babys eignen sich die Welt mit Hilfe des Tastsinns an: Sie nehmen alles Neue erst einmal in den Mund, um zu fühlen, womit sie es zu tun haben. »Mund und Hände sind unsere sensibelsten Tastorgane«, erklärt Martin Grunwald. »Sie sind daher optimal für diese Exploration geeignet.«
Der Tastsinn ist eigentli2ch ein ganzes System von Sinnen. Nicht nur überall auf der Haut, sondern auch in Muskeln, Sehnen, sogar in Organen sitzen verschiedene, hoch spezialisierte Zellen, die zum Beispiel auf leichten oder auf starken Druck reagieren, auf Schmerzreize, Vibration, Dehnung oder Temperatur – und das alles außerordentlich empfindlich. »Wenn Sie auf Ihre Fingerkuppe pusten, spüren Sie den Luftzug, obwohl das mikroskopisch kleine Schwingungen auf Ihrer Haut sind«, sagt Hannes Saal von der University of Sheffield. Der Kognitionswissenschaftler interessiert sich unter anderem dafür, wie die vielen verschiedenen Tastsinneszellen zusammenarbeiten.
Kooperierende Tastzellen
Lange gingen Forscher davon aus, dass jeder Rezeptortyp in der Haut für einen oder maximal zwei Aspekte der taktilen Wahrnehmung zuständig ist. Die Merkel-Zellen etwa registrieren lang andauernden Druck, die Vater-Pacini-Körperchen springen auf Vibrationen an und melden diese umgehend ans Gehirn (siehe »Von der Berührung zur Empfindung«, S. 12/13). Gemeinsam mit Sliman Bensmaia von der University of Chicago veröffentlichte Saal 2014 allerdings eine Arbeit, in der er neuere Studien zusammenfasste und die eine andere Sicht auf die Arbeitsweise des Tastsinns nahelegt: Demnach arbeiten für jede taktile Empfindung stets mehrere Arten von Rezeptoren zusammen.
Spüren wir etwa eine Vibration auf dem Oberarm, sind dafür nicht nur die Nervenimpulse aus den Vater-Pacini-Körperchen verantwortlich, sondern auch die der Meissner-Körperchen, die eigentlich auf Druckveränderungen spezialisiert sind. Im Gehirn wird der Input mehrerer Zelltypen miteinander verrechnet. »Physiologisch gesehen ist der Tastsinn nicht so langweilig, wie man lange angenommen hat«, meint Saal. Als Nächstes gelte es zu klären, wie genau die verschiedenen Rezeptoren zusammenarbeiten und wo ihre Informationen ausgewertet werden.
Andere Aspekte des Tastsinns sind ebenfalls komplexer als gedacht. So sitzt das sprichwörtliche Fingerspitzengefühl nicht nur in den Fingerkuppen, erklärt Saal. Wenn wir etwas ertasten, Blindenschrift etwa oder die geriffelte Oberfläche einer Kordhose, setzen sich die Vibrationen aus den Fingerspitzen bis zur Handfläche fort. Auch dort erfassen Sensoren noch winzige Schwingungen – und diese Information nutzen wir, um das befühlte Objekt noch genauer zu analysieren. »Bei einer Berührung der Fingerkuppen wird die ganze Hand stimuliert«, sagt Saal. »Das Gehirn vergleicht die Reize von unterschiedlichen Hautstellen und teilt uns dann zum Beispiel mit, dass der Kontakt auf der Fingerspitze stattgefunden haben muss.«
Der Tastsinn ist also äußerst sensibel. Im Vergleich etwa zum Sehen lässt er uns die Umgebung jedoch nur unmittelbar erfahren. »Wir müssen uns einem Gegenstand auf Armlänge nähern, um herauszufinden, ob er sich warm oder kalt anfühlt«, sagt der Neurowissenschaftler Hubert Dinse von der Ruhr-Universität Bochum. Dieser Nachteil werde aber dadurch ausgeglichen, dass der Tastsinn extrem zuverlässig arbeite. »Es gibt eine Fülle an optischen Täuschungen, das Auge lässt sich leicht überlisten. Taktile Illusionen sind dagegen nur sehr wenige bekannt«, so Dinse.
Komplexe Augen, wie etwa Wirbeltiere sie besitzen, sind evolutionär erst zu einem Zeitpunkt aufgetreten, als es eine Art von Tastsinn schon hunderte Millionen Jahre lang gegeben haben muss. Beim Auge entsteht das Bild unserer Umwelt aus vergleichsweise wenigen Informationen auf der Netzhaut. Aus einfachen Helligkeitsunterschieden in drei verschiedenen Bereichen des Farbspektrums formen sich in unserem Kopf Objekte, Tiefenwahrnehmung und sogar Bewegungen. Das geschieht durch nachträgliche, komplizierte Berechnungen im visuellen Kortex – der deshalb im Gehirn viel Platz beansprucht. Dieses System ist fehleranfällig, das begünstigt optische Illusionen. Der Tastsinn hingegen basiert auf der Vielzahl der verschiedenen Rezeptoren, die im ganzen Körper verteilt sind. Ihre Signale sind spezifisch; sie zu verarbeiten, verbraucht im Gehirn weit weniger Kapazität. Man könnte sagen, der Tastsinn ist der ehrlichste, bodenständigste unter unseren Sinnen.
Als solcher ist er auch für menschliche Beziehungen enorm wichtig. Nicht umsonst kommt das Wort Kontakt vom lateinischen »contingere« – berühren. Sei es ein freundlicher Händedruck, ein aufmunterndes Schulterklopfen, ein Griff an den Arm, um jemandes Aufmerksamkeit zu erhalten, oder ein sanftes Streichen über die Wange: Immer mehr Studien demonstrieren die Macht solcher kleinen Berührungen im Alltag.
So stimmt etwa ein beiläufiges Anfassen am Oberarm – sofern es in der jeweiligen Situation kulturell angemessen ist – den Empfänger hilfsbereiter und wohlwollender. In einer Studie willigten Passanten eher ein, eine Petition zu unterschreiben oder einen Fragebogen auszufüllen, nachdem der Fragesteller ihnen kurz die Hand auf den Arm gelegt hatte. Zwei solcher Berührungen scheinen den Effekt sogar zu verstärken. Andere Forscher fragten Fremde auf der Straße nach dem Weg, bedankten sich und berührten einige Personen dabei kurz am Arm. Beim Weggehen ließen sie dann vermeintlich unabsichtlich etwas fallen. Wer zuvor angefasst wurde, eilte öfter und schneller zur Hilfe. Dies komme offenbar daher, spekulieren die Wissenschaftler, dass eine leichte Berührung am Arm Nähe, Wärme und Zuneigung signalisiert.
Auf diese nonverbalen Zeichen reagieren bereits Kinder. Schüler zum Beispiel sind eher dazu bereit, eine Aufgabe an der Tafel vorzurechnen, wenn sie der Lehrer bei der Aufforderung sanft am Arm berührt. Und in einer Studie aus dem Jahr 2014 stellte die Psychologin Julia Leonard Vier- bis Fünfjährige auf eine Geduldsprobe: Sie legte ein paar Süßigkeiten unter einen Becher und bat die Kinder, nicht davon zu naschen, während sie kurz im Raum nebenan sei – wie beim bekannten Marshmallow-Test. Wenn die jungen Probanden es nicht mehr aushielten, durften sie eine Glocke läuten, um die Versuchsleiterin wieder herbeizurufen. Kinder, die während der Instruktion sanft am Rücken berührt wurden, warteten im Schnitt zwei Minuten länger mit dem Griff zur Glocke als jene, die rein verbal zum Verzicht aufgefordert worden waren.
Leonard, die mittlerweile am Massachusetts Institute of Technology forscht, folgert daraus, dass eine kurze Berührung eine warmherzige Atmosphäre schaffen kann, die nicht nur die Hilfsbereitschaft von Kindern erhöht, sondern auch ihre Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regulieren.
Bei Erwachsenen lässt sich der Effekt von Berührungen sogar wirtschaftlich ausnutzen. Als Klassiker gilt eine Studie des US-amerikanischen Psychologen Christopher Wetzel und seiner Kollegin April Crusco aus dem Jahr 1984. Sie hatten beobachtet, dass Kellnerinnen mehr Trinkgeld erhalten, wenn sie beim Kassieren die Kunden beiläufig an der Schulter oder auf der Handfläche berühren. Die Forscher tauften das Phänomen »Midas-Berührung«, in Anlehnung an den sagenhaften König Midas, der alles, was er anfasste, in Gold verwandelte.
Taktile Entscheidungshilfe
Spätere Studien bestätigten diese Beobachtung. So trinken die Besucher einer Bar insgesamt mehr Alkohol, wenn die Kellnerin ihnen während der ersten Bestellung kurz die Hand auf die Schulter legt. Restaurantgäste folgen bereitwilliger der Empfehlung des Kellners, wenn dieser sie dabei berührt. Einkäufer im Supermarkt lassen sich von einem kurzen taktilen Reiz eher dazu verleiten, einen neuen Snack zu probieren und anschließend in den Wagen zu legen. Und wenn Verkäufer die Kunden eines Buchladens während der Begrüßung leicht am Oberarm berühren, verbringen diese daraufhin mehr Zeit im Laden, geben mehr Geld aus und bewerten das Geschäft anschließend positiver als Kunden, die zwar ebenfalls persönlich, aber ohne Körperkontakt empfangen werden.
Allerdings finden sich in den meisten dieser Studien typische Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Männer wie Frauen sprechen offenbar besser auf eine kurze Berührung an, wenn diese von einer Frau ausgeht. Und Frauen lassen sich insgesamt leichter von solchen taktilen Reizen beeinflussen.
Selbst eine stark ritualisierte Berührung wie das Händeschütteln kann beeinflussen, wie sich andere uns gegenüber verhalten. Wirtschaftsforscher um Juliana Schroeder, damals an der University of Chicago, zeigten 2014, dass sich Studenten in einer Verhandlungsübung kooperativer verhielten und offener über ihre Präferenzen sprachen, wenn sie sich vorher die Hand gegeben hatten.
Jüngste Befunde zeigen, dass der Tastsinn sogar eine noch weiter gehende Rolle in der Kommunikation hat. 2006 ergab eine Studie des Psychologen Matthew Hertenstein, dass Menschen allein anhand einer kurzen Berührung verschiedene Gefühlszustände erkennen können. Hertenstein und seine Kollegen der DePauw University in der Nähe von Indianapolis setzten je zwei einander unbekannte Versuchspersonen gegenüber, getrennt durch einen Sichtschutz. Durch eine Öffnung sollte dann einer den anderen am Unterarm berühren und dabei jeweils eine bestimmte Emotion vermitteln.
Tatsächlich erkannten die Empfänger Wut, Angst, Ekel, Zuneigung, Dankbarkeit und Mitgefühl oft richtig. Die Genauigkeit lag dabei zwischen 48 und 83 Prozent – eine vergleichbare Leistung wie beim Einschätzen von Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken oder der Stimmlage. Bei Wut beispielsweise quetschten die Probanden den Arm des anderen oder rüttelten daran. Ekel hingegen, eine etwas komplexere Emotion, versuchten manche durch Wegschubsen des Arms zu signalisieren. Eine Folgestudie aus dem Jahr 2009 ergab, dass Freude und Trauer ebenfalls durch eine leichte Berührung des Arms meist korrekt erkannt werden.
Auch hier spielte das Geschlecht eine Rolle. So wurde etwa Ärger öfter als solcher erkannt, wenn entweder der Sender oder der Empfänger der taktilen Botschaft ein Mann war. Um Mitleid per Berührung zu übermitteln, brauchte es dagegen mindestens eine Frau im Tandem. Und Freude rein taktil mitzuteilen, gelang zumindest in diesen Studien nur zwei Frauen untereinander. Ob solche Unterschiede in der nonverbalen Verständigung angeboren oder erlernt sind, ist noch ungewiss.
Taktile Reize können also selbst unter Fremden wie eine eigene Sprache eingesetzt werden, um verschiedene Emotionen zu kommunizieren. Und unter Menschen, die sich vertraut sind, vermögen sie noch mehr. 2014 baten Forscher um den französischen Kognitionswissenschaftler Jean-Luc Schwartz junge Pärchen, sich an einem Tisch gegenüberzusetzen. Apparate zeichneten verschiedene Körperfunktionen auf; zwei Trennwände sorgten dafür, dass die Partner sich nicht sehen konnten. Dann sollten beide an ein bestimmtes Ereignis aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit denken. Mal durften sie dabei die Hand des anderen zwischen den beiden Trennwänden berühren, mal nicht. Mit erstaunlichem Effekt: Nur wenn die beiden Partner sich anfassen durften, näherten sich beim gemeinsamen Erinnern auch die Messkurven für ihre Hautleitfähigkeit und ihre Pulsratenvariabilität einander an. Berührungen verbinden uns also so stark mit anderen, dass sie mitunter selbst physiologische Vorgänge in Einklang bringen.
Cremig oder flockig?
Da der Tastsinn offenbar ohne Umweg auf unsere Gefühle wirkt, überrascht es nicht, dass haptische Erfahrungen längst den Verkauf von Produkten ankurbeln sollen. Vor allem finanzstarke Industriezweige wie die Automobilbranche investieren große Summen, um herauszufinden, welche Tasterlebnisse ihre Produkte beim Käufer auslösen: Wie muss sich ein Lenkrad anfühlen, um hochwertig und solide zu wirken? Wie ein Schaltknüppel oder ein Drehregler? »An so einem Knopf in der Mittelkonsole kann man schon mal ein Jahr lang arbeiten«, sagt Hubert Dinse.
Und auch die Lebensmittelindustrie hat entdeckt, dass nicht nur das Auge mitisst, sondern ebenfalls der Tastsinn – schließlich sind Mund und Lippen besonders dicht mit taktilen Sensoren bestückt. Firmen tüfteln daher nicht mehr nur den Geschmack ihrer Produkte im Labor aus, sie wollen auch optimieren, wie diese sich im Mund anfühlen. Zu Martin Grunwald kommen Lebensmittelhersteller, um herauszufinden, wie ein Jogurt beschaffen sein muss, damit er dem Verbraucher gefällt. Sein Team fand bereits einige kulturelle Unterschiede. Deutsche Esser mögen ihren Jogurt beispielsweise eher cremig, Franzosen bevorzugen ihn etwas flockiger. Deshalb passen große Konzerne ihre Lebensmittel für den jeweiligen Markt an. Auch die Oberflächen bestimmter Produktverpackungen unterscheiden sich von Land zu Land, weil die Konsumenten verschiedene haptische Vorlieben haben. Details dieser Industrieforschung bleiben natürlich geheim.
Ein Produkt, das besonders häufig angefasst wird, wurde ebenfalls aufwändig für die Fingerspitzen optimiert: das Smartphone. Obwohl der Touchscreen die Berührung im Namen trägt, geht mit dieser technologischen Entwicklung laut Grunwald eine Verarmung haptischer Reize einher. »Das ist nur glattes Glas – für die Finger absolut langweilig. Der Rest ist Optik.«
Der Psychologe ist davon überzeugt, dass Kleinkinder für eine gesunde Entwicklung nicht zu viele rein virtuelle Erlebnisse haben sollten. »Um die äußere Welt zu begreifen, muss man sie sich handgreiflich aneignen«, so Grunwald. Streifzüge durch die Natur oder Spiele mit anderen bringen im echten Leben eine reichhaltigere sensorische Erfahrung mit sich als auf dem Bildschirm, da sie genauso Geruchs-, Tast- und Bewegungssinn ansprechen.
Immerhin: Auch an der haptischen Qualität von Bildschirmen wird schon gearbeitet. Es gibt erste Displays, die bei Bedarf mit Hilfe einer Flüssigkeit kleine Dellen auf die Oberfläche zaubern. An diesen plötzlich auftauchenden und wieder verschwindenden Knöpfen können sich die Fingerspitzen im Zusammenspiel mit dem Auge besser orientieren.
Andere Forscher gehen noch weiter und wollen zwischenmenschliche Berührungen in die digitale Welt übertragen. Etwa mit Hilfe einer Jacke für Kinder, die Umarmungen simuliert. Wenn die Eltern auf Geschäftsreise sind, können sie einen Teddybären umarmen, der mit Sensoren bestückt ist. Die Daten werden über das Internet an das Kleidungsstück des Kindes übertragen. Im Shirt füllen sich dann Luftkammern, was beim Sprössling das Gefühl hervorrufen soll, umarmt zu werden. Eine andere Variante sind Ringe, die ebenfalls über das Internet »verbunden« sind. Wird einer von ihnen angefasst, vibriert das Gegenstück, das sich zum Beispiel an der Hand des Partners befindet. Das taktile Signal soll sagen: Ich denke gerade an dich.
Für manche mag die Idee, echte Berührungen durch technische Geräte zu ersetzen, eine absurde Vorstellung sein. Aber vielleicht bringt die Zukunft immerhin eine Wiederentdeckung des Tastsinns in einer stark visuell dominierten Welt.
Berührungen für eine gute Entwicklung
Kaiser Friedrich II. soll im 13. Jahrhundert ein grausames Experiment angeordnet haben: Um herauszufinden, was die menschliche Ursprache ist, ließ er Säuglinge völlig isoliert aufwachsen. Sie erhielten zwar Nahrung, wurden aber weder angesprochen noch berührt. Nach kurzer Zeit starben die Kinder, da ihnen menschliche Zuwendung fehlte. Ob die Geschichte wahr ist oder nur üble Nachrede von Zeitgenossen, denen Friedrichs naturwissenschaftliches Interesse suspekt war, ist unklar.
Neuzeitliche Experimente an Ratten brachten jedoch ähnliche Ergebnisse: Ohne Körperkontakt gehen die Nager ein. Es reicht dagegen aus, dass ein menschlicher Pfleger sie regelmäßig mit einer Bürste striegelt. »Taktile Erfahrungen sind für alle Säugetiere überlebenswichtig«, sagt der Haptikforscher Martin Grunwald. »Wir brauchen sie zur körperlichen und sozialen Entwicklung.«
Wie wohltuend Berührungen für die Kleinsten sind, zeigt die Forschung zu Babymassagen: Frühchen, die regelmäßig massiert werden, haben einen geringeren Pegel des Stresshormons Kortisol, weinen weniger und holen Entwicklungsdefizite schneller auf. Leidet die Mutter an postpartaler Depression, können solche Massagen dabei helfen, eine bessere Bindung zum Baby aufzubauen. Und noch im Schulalter profitieren selbst Kinder, die Berührungen eher ablehnen – was etwa auf manche mit ADHS oder Autismus zutrifft –, von regelmäßigen Massagen. Sie lernen leichter und können sich im Unterricht besser konzentrieren.
Nicht zuletzt helfen Berührungen dabei, ein gesundes Körperselbstbild zu entwickeln, wie es Patientinnen mit Essstörungen meistens fehlt. Martin Grunwald hat einen Therapieansatz für Magersüchtige entwickelt, bei dem die Betroffenen regelmäßig in maßgeschneiderte Neoprenanzüge schlüpfen. Die Berührungszellen in der Haut registrieren einen konstanten, sanften Druck, der sich bei jeder Bewegung ein wenig verändert – mit dem Effekt, dass die Patientinnen mit der Zeit ein realistischeres Bild ihrer Körperproportionen bekommen.
Den schwindenden Tastsinn erhalten
Genau wie das Hör- oder Sehvermögen lässt auch der Tastsinn im Alter bisweilen dramatisch nach: Kanten und Umrisse werden schlechter ertastet, die allgemeine Feinmotorik leidet. Doch es gibt kein technisches Hilfsmittel, das analog zu Brille oder Hörgerät das Gespür in den Fingerspitzen verbessern würde. Der Bochumer Neurowissenschaftler Hubert Dinse fand allerdings heraus, dass sich der Tastsinn selbst im hohen Alter noch trainieren lässt.