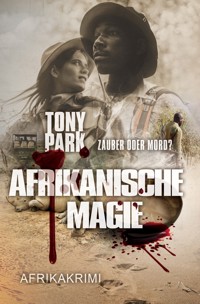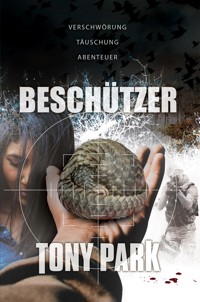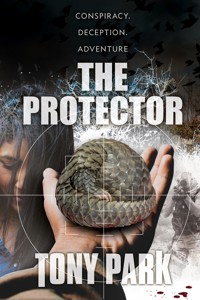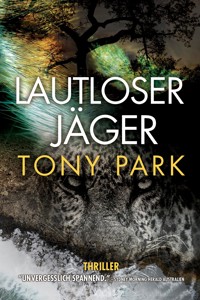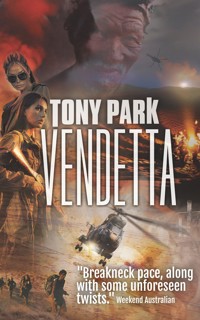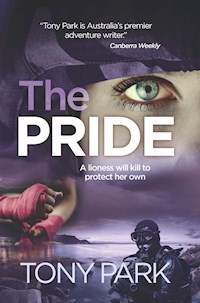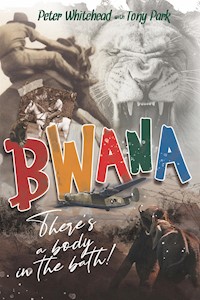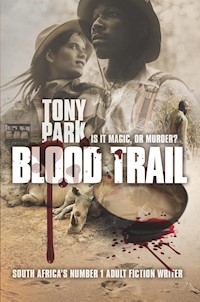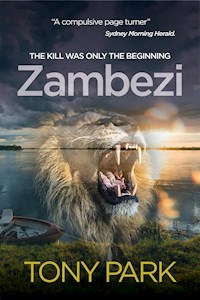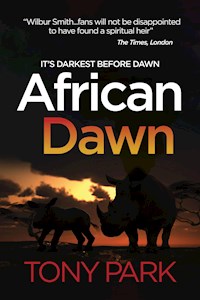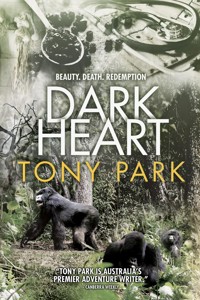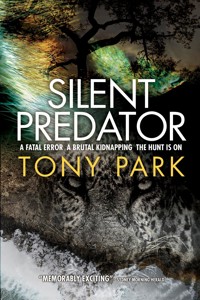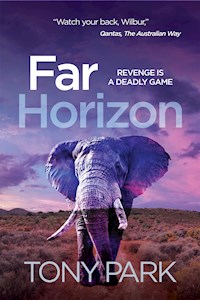6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ingwe Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein nahezu vergessener afrikanischer Krieg. Ein verschwundener Schatz, für den es sich zu töten lohnt. Verstrickte Beziehungen über Völkergrenzen hinaus.
Deutsch-Südwestafrika, heutiges Namibia, 1906: Der australische Pferdehändler Cyril Blake wird von den Soldaten des deutschen Kaisers kaltblütig hingerichtet.
Sydney in der Gegenwart: Blakes Urgrossneffe, der kürzlich verwitwete Nick Eatwell, wird von der südafrikanischen Journalistin Susan Vidler, die über den mysteriösen Tod seines Vorfahren nachforscht, kontaktiert.
Fasziniert von der unbekannten Familiengeschichte und ihrem Bezug zur aktuellen internationalen Politik, sucht und findet Nick ein langverschollenes Manuskript. Darin wird berichtet, wie Blake, nachdem er im Zweiten Burenkrieg kämpfte, in Südafrika blieb und sich dem Volk der Nama bei dessen Aufstand gegen die herrschenden Deutschen in Deutsch-Südwestafrika anschloss.
Fast gleichzeitig stösst in München die Historikerin Anja Berghoff, die über den Ursprung der wilden ‘Geisterpferde’ Namibias forscht, auf interessante Briefe der irisch-deutschen Spionin Claire Martin, die mit Blake eine Affäre hatte.
Als sich die Wege von Nick und Anja kreuzen, jagen sie auf den Spuren einer Legende durch das südliche Afrika.
Aber sie sind nicht allein - auch jemand anderes jagt die Geister der Vergangenheit und ist versessen nach Hinweisen auf den verborgenen Schatz, für den es sich zu töten lohnt.
‘Geister der Vergangenheit’ basiert auf historischen Fakten und einer wahren Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
GEISTER DER VERGANGENHEIT
TONY PARK
Übersetzt vonMAYA VON DACH
INHALT
Autor
Weitere Titel von Tony Park
Der Zweite Burenkrieg und die Geschichte von Deutsch-Südwestafrika (heutiges Namibia)
Einleitung
Prolog
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
ZWEITER TEIL
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Epilog
Historische Anmerkungen und Dank
AUTOR
Tony Park wurde 1964 geboren und wuchs in den westlichen Vororten von Sydney auf. Er arbeitete als Zeitungsreporter, Pressesprecher, Werbeberater und freier Autor. Während 34 Jahren diente er als Reservist in der australischen Armee, davon im Jahr 2002 sechs Monate als Offizier für öffentliche Angelegenheiten in Afghanistan. Er und seine Frau Nicola leben je zur Hälfte in Australien und im südlichen Afrika. Tony Park ist Autor zahlreicher weiterer Romane, die in Afrika spielen.
www.tonypark.net
WEITERE TITEL VON TONY PARK
Far Horizon
Zambezi
African Sky (Deutsche Übersetzung: Afrikanischer Himmel)
Safari
Silent Predator
Ivory
The Delta (Deutsche Übersetzung: Okavango)
African Dawn
Dark Heart
The Prey
The Hunter
An Empty Coast
Red Earth
The Cull
Captive
Scent of Fear
Blood Trail
The Pride
Part of the Pride (In Deutsch: Der Löwenflüsterer), mit Kevin Richardson
War Dogs, mit Shane Bryant
The Grey Man, mit John Curtis
The Lost Battlefield of Kokoda, mit Brian Freeman
Walking Wounded, mit Brian Freeman
Courage Under Fire mit Daniel Keighran VC
No One Left Behind mit Keith Payne VC
Bwana, There’s a Body in the Bath! mit Peter Whitehead
Rhino War mit Major General Johan Jooste
Erstveröffentlichung von "GHOSTS OF THE PAST" 2019 bei Macmillan von Pan Macmillan Australia Pty Ltd
Urheberrecht © Tony Park 2019
Das moralische Recht des Autors, als Autor dieses Werkes identifiziert zu werden, wurde geltend gemacht.
Veröffentlichung dieser Ausgabe im Ingwe-Verlag, 2023.
Alle Rechte vorbehalten. Es ist weder natürlichen noch juristischen Personen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln gestattet, Teile dieses Buches ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers
elektronisch oder mechanisch zu fotokopieren, aufzuzeichnen, scannen oder durch beliebige Informations-, Speicher- und Abrufsysteme (einschliesslich Google, Amazon oder ähnliche Organisationen), zu reproduzieren oder zu übertragen.
Dieses Werk ist Fiktion. Alle in diesem Roman erwähnten Charaktere, Institutionen und Organisationen sind vom Autor erfunden, jegliche Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder ihrem Verhalten ist zufällig und unbeabsichtigt.
Geister der Vergangenheit
Epub: 9781922825087
POD: 9781922825094
DEUTSCHE ÜBERSETZUNG MAYA VON DACH
Erstellt mit Vellum
Für Nicola
und
Edward Lionel Presgrave
Soldat, Rebell, Australier
1881 – 1905
DER ZWEITE BURENKRIEG UND DIE GESCHICHTE VON DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA (HEUTIGES NAMIBIA)
1883 Adolf Lüderitz, ein Kaufmann aus Bremen, Deutschland, gründet an der Atlantikküste Afrikas einen Handelsposten in Angra Pequeña, (später Lüderitz Bay genannt).
1884 Lüderitz bittet um Schutz gegen die britische Expansion, Deutsch-Südwestafrika wird proklamiert.
1899 Ausbruch des Zweiten Burenkriegs zwischen den Burenrepubliken Oranje-Freistaat und Südafrikanische Republik/Transvaal und dem britischen Empire.
1902 Der Zweite Burenkrieg endet mit einem britischen Sieg.
1904 Das Volk der Herero in Deutsch-Südwestafrika erhebt sich gegen Deutschland, um gegen die ungerechte Land- und Arbeitspolitik zu protestieren. Einige Nama-Stämme stellen sich zunächst auf die Seite Deutschlands, schliessen sich dann aber den Herero an. Zehntausende Nama und Herero sterben in Konzentrationslagern an Hunger, Krankheiten und Erschöpfung von Zwangsarbeit.
1907 Der bewaffnete Konflikt zwischen Deutschland und den Nama und Herero endet.
1914 Ausbruch des Ersten Weltkriegs, Südafrika fällt auf Befehl Grossbritanniens in Deutsch-Südwestafrika ein.
1915 Deutsche Truppen kapitulieren in Deutsch-Südwestafrika.
1920 Südafrika erhält ein Mandat über Südwestafrika.
1990 Deutsch Südwestafrika erlangt nach langwierigen Kämpfen die Unabhängigkeit und wird in ›Namibia‹ umbenannt.
2004 Deutschland entschuldigt sich für den Tod von Herero und Nama während des ›Völkermords‹ von 1904-07, schliesst aber eine Entschädigung aus.
2011 Die Schädel von zwanzig Herero und Nama, die während des Völkermords zu Forschungszwecken entwendet wurden, werden aus einem Museum in Deutschland nach Namibia zurückgebracht.
2018 Die Völker der Herero und der Nama erheben vor dem US-Bundesgericht eine Sammelklage gegen die deutsche Regierung und fordern Wiedergutmachung für den Völkermord.
2021 Die Regierungen Deutschlands und Namibias erzielen nach insgesamt sechs Jahre dauernden Gesprächen um eine Wiedergutmachung für den deutschen Völkermord an den Herero und Nama eine erste Einigung: Deutschland anerkennt den Völkermord, entschuldigt sich und will 1,1 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe leisten. Es gibt jedoch auch Kritik am Abkommen.
EINLEITUNG
1915, im Städtchen Aus in Südwestafrika, ehemals deutsche Kolonie, jetzt Protektorat der Union Südafrikas und des Britischen Empire
Diese Geschichte handelt von Afrika und der Liebe – und ist somit doppelt traurig.
Mein Name ist Peter Kohl. Ich bin hier der Lagerarzt und versorge mehr als 1500 meiner deutschen Mitgefangenen. Bevor der Konflikt in Europa begann und sich wie ein Buschfeuer nach Afrika ausbreitete, war ich Arzt und Landwirt. Ich will in diesem Bericht ehrlich sein: Ich habe den zweiten Beruf mehr geliebt.
In Afrika habe ich viel zu viel Blutvergiessen gesehen. Kein Wunder bevorzuge ich die Gesellschaft von Pferden und Rindern gegenüber der von Menschen. Doch ist es eine Ironie, dass ich hier wie eines meiner früheren Nutztiere eingepfercht bin.
Als ich ein freier Mann war, waren der zierliche Springbock, die muskulöse Oryx-Antilope und die schlauen, auf sie lauernden Raubtiere, meine Nachbarn. Tiere und Menschen mussten sich vor dem Wüstenlöwen sowie der braunen und der gefleckten Hyäne in Acht nehmen, aber wir kannten und respektierten unsere Feinde. Ich vermisse diese einfacheren Zeiten.
In Kriegszeiten versucht jede Seite, die andere zu dämonisieren. So werden die südafrikanischen Soldaten, die auf Geheiss ihrer britischen Herren in diese Kolonie einmarschiert sind, bald damit beginnen, Beweise für die Verfehlungen Deutschlands als Kolonialmacht zu sammeln. Gegenstand ihrer Untersuchungen wird der letzte Krieg sein, der hier, in dieser Ecke Afrikas, geführt wurde. In diesem bekämpften wir Deutschen unsere Nachbarn, die Herero und die Nama, die die Kühnheit besassen, sich gegen den Kaiser aufzulehnen und für ihre Rechte zu kämpfen. Obwohl dieser Konflikt vor neun Jahren endete, kann ich mich an die Ereignisse erinnern, als wären sie gestern geschehen.
Ich schreibe diesen Bericht, weil ich sicher bin, dass ich vor Gericht gestellt werde, weil ich im Jahr 1906 einen Mann ermordete. Obwohl ich nicht möchte, dass diese Geschichte veröffentlicht wird, muss ich sie erzählen. Nicht, um rachsüchtigen Ermittlern zu dienen, sondern um den betroffenen Menschen und des Seelenfriedens ihrer Familien willen.
In Afrika scheinen die Stammeskriege nie enden zu wollen. Vor dem Feldzug gegen die Herero und die Nama haben sich zwischen 1899 und 1902 jenseits der Grenze die weissen Stämme – die Briten und die afrikanischen Buren – gegenseitig umgebracht. Und genau dort, in Südafrika, liegt der Ursprung meiner Geschichte. Ich beginne diese Erzählung jedoch an ihrem Ende: Im Jahr 1906, als ich von meinen Vorgesetzten beauftragt wurde, einen Mann zu töten, der mit meiner Frau geschlafen hatte.
PROLOG
1906, IN DER WÜSTE SÜDLICH DER KLIPDAM FARM, DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA
Sein Blut versickerte ebenso schnell im roten Sand, wie es floss. Sobald die Löwen sein Fleisch verschlungen und die Hyänen seine Knochen zwischen ihren Kiefern zermahlen hätten, gäbe es keinen Beweis mehr dafür, dass er je hier gewesen war oder überhaupt jemals gelebt hatte.
Das Wenige, das von ihm übrigbliebe, würde der Sand unter sich begraben und alle Spuren verwischen. Nur noch klare, vom Wind gezeichnete Wellen wären auf der Oberfläche der Düne zu sehen.
Er versuchte zu sprechen, doch seine Zunge war geschwollen und die Lippen rissig. Die Worte wollten nicht kommen. Vielleicht entrang sich seiner Kehle ein Laut, vielleicht auch nicht.
»Claire …«
Cyril Blake kroch. Hand vor Hand. Die groben Körner füllten sein Hemd, fanden ihren Weg in seinen Mund, seine Hose, seine Wunde, überallhin. Der Sand verbrannte seine Handflächen. Unter Qualen schaffte er es bis zur messerscharfen Kante der Düne. Er blickte darüber hinaus. Rettung war keine in Sicht, nur ein leerer Weitblick mit ein paar Tieren. Wie eine Kreuzotter glitt er auf die andere Seite, wo er sich halb rutschend, halb rollend den Abhang hinunterfallen liess.
Hinter sich hörte er das Wiehern eines Pferdes und das in deutscher Sprache gebrüllte Kommando eines Offiziers.
Er hatte die lange Nacht und die Kälte zähneklappernd überlebt. Irgendwann lösten Halluzinationen die Schmerzen der Wunde in seinem Bauch ab. Wenn er es jemals nach Australien schaffte, würde ihm niemand glauben, dass der kälteste Ort, an dem er je gewesen war, in einer afrikanischen Wüste lag.
Jetzt erdrückte ihn die Hitze des Tages und Fliegen bevölkerten das Loch in seinem Bauch.
Blake blinzelte den Sand aus den Augen. Das trockene Flussbett, dem er am Vortag bis hierhin gefolgt war, erstreckte sich unter ihm weiter bis zur Grenze. Südafrika lag nur ein paar Dünen entfernt, was in seinem Zustand eine Unendlichkeit bedeutete. Er hatte diesen Ort zuerst verflucht und mit jeder Faser seiner Existenz gehasst, später aber geschworen, ihn nie wieder zu verlassen. Er war von ihm eingesogen, verzaubert, berauscht und gefangen genommen worden. Besessen, wie die Huren und Bergleute mit ihren eingesunkenen Augen, vom Rauch in den Höhlen der Chinesen.
Afrika.
Oryx-Antilopen, von den Buren Gemsböcke genannt, zogen durchs Tal und knabberten am spröden Gras, das dank der spärlichen Feuchtigkeit im Flussbett wuchs. Eine Herde von fünfzig Pferden, immer noch Nase an Schwanz gebunden, trabte verwirrt dem sterbenden Wasserlauf entlang und trieb die stattlichen Antilopen in den Galopp. Er hatte die Pferde auf Claires Bitte hin nach Deutsch-Südwestafrika gebracht, um den Aufstand zu unterstützen. Seine Mission war gescheitert. Nun würde er Claire nie wiedersehen. Er hoffte, jemand habe den Anstand, die Pferde zu befreien, damit sie die Schrecken des Krieges nicht erleben mussten. Vielleicht käme der Mann, der auf ihn geschossen hatte, zurück und holte die Pferde. Er hatte Blake dem Tod überlassen und war nach Klipdam geritten, zweifellos um das auf Blake ausgesetzte Kopfgeld zu kassieren.
Bei der Erinnerung an Claire brachte Blake ein halbes Lächeln zustande, das die Haut seiner Lippen noch stärker aufplatzen liess. Der Schweiss drang in die neugeschaffene Ritze und stach qualvoll. Er erinnerte sich an den nektarähnlichen Geschmack ihres Mundes.
Ein Schatten schützte ihn einen Moment vor der stechenden Sonne. Er blickte auf und sah einen Mann über sich stehen.
»Claire …«
»Halten Sie die Klappe«, befahl der deutsche Offizier.
Blake versuchte, sich herumzudrehen, aber bei der Bewegung schossen Schmerzen durch seinen Körper. Er liess sich auf den Rücken fallen und blinzelte in die Sonne.
»Sprechen Sie ihren Namen nicht aus!« Sein Englisch war nahezu perfekt. Blake wusste, dass Peter Kohl ein guter Mann war, ein Arzt. Wie Blake selbst, war der Offizier dazu überredet worden, eine Uniform anzuziehen, um ein Reich zu verteidigen und einen bösen Feind zu besiegen, der es wagte, sich gegen die Krone zu erheben.
Völliger Blödsinn.
Blake wusste, warum der Offizier gekommen war. Er sollte sicherstellen, dass die blutige Aufgabe ordnungsgemäss erledigt war. So waren die Deutschen. Alles musste perfekt, vorschriftsgemäss, vollständig und mit einer Schleife versehen sein, selbst Morde. Du Preez, der Mann, der die Kugel abgefeuert hatte, um ihn zu töten, hielt sich nicht an solche Vorschriften. Du Preez wollte Blake verbluten und langsam unter der Sonne verdorren lassen, weil er dachte, er habe das verdient.
»Claire ...« hustete er.
»Es reicht!« Spucke sprühte aus Peters Mund und sein sonnengerötetes Gesicht verfärbte sich noch dunkler. Der Arzt holte tief Luft und unterdrückte das Zittern in der Hand, die die 65-Millimeter-Pistole der Marke Roth-Sauer 7 hielt. Er zwang sich zur Ruhe, räusperte sich und sprach mit lauter, klarer Stimme. »Cyril Blake, Sie sind der Spionage, der Unterstützung des Nama-Volkes und des Verbrechers Jakob Morengo bei der bewaffneten Rebellion gegen die rechtmässige Regierung von Deutsch-Südwestafrika schuldig.«
»Bitte, sagen … sagen Sie es mir einfach, Peter«, brachte Blake hervor.
Der Offizier blinzelte und Blake fragte sich, ob dieser Mann weinte, der, wenn er nicht in seiner schweissgetränkten Landespolizeiuniform und seinen abgewetzten Kavallerieschuhen dastand, kranke Kinder behandelte und sich um gebrochene Arme kümmerte.
»Sie ist tot«, sagte er mit lauter, aber zitternder Stimme.
Blake schloss die Augen. »Wie?«
»Ertrunken. Sie war nur wegen Ihnen auf dem Boot. Sie wartete lange auf Sie, Blake, bis sie schliesslich ging. Sie haben meine Frau zu einer Spionin gegen ihr eigenes Volk gemacht und sie entehrt.«
Blake spürte, wie Tränen kommen wollten, aber sein Körper war wohl zu ausgebrannt und seine Augen blieben trocken. Sein Kopf schwirrte. Nicht einmal ein erleichternder Augenblick der Trauer wurde ihm gegönnt.
»Sie … Sie haben gesehen, was auf der Haifischinsel und an der Eisenbahnlinie, die Ihr Volk baut mit unschuldigen Frauen und Kindern passiert. Sie nennen sich Arzt und tragen trotzdem diese Uniform?«
Peter wandte den Blick ab. Wäre Blake nicht nahezu tot gewesen und hätte er die Kraft dazu gehabt, hätte er sich auf ihn gestürzt, aber das war unmöglich.
»Sie sind doch nicht gekommen, um mich zusammenzuflicken und ins Gefängnis von Keetmanshoop zu bringen, oder Peter?«, fragte Blake.
»Nein«, sagte Dr. Peter Kohl, laut genug, dass die wartenden deutschen Soldaten seine Stimme über die Dünen hinweg hörten, »ich bin gekommen, um Sie zu töten.«
Der Arzt zielte sorgfältig, dann feuerte er seine Pistole ab.
ERSTER TEIL
1
NORTH SYDNEY, AUSTRALIEN, IN DER GEGENWART
Während Nick Eatwell im olympischen Schwimmbad von North Sydney die achtzehnte Runde drehte, fielen die ersten Regentropfen auf seinen Rücken. Er ärgerte sich, weil er für den Rückweg ins Büro keinen Regenschirm mitgenommen hatte.
Es erinnerte ihn an ein Erlebnis, das Jill und er vor ein paar Jahrzehnten, als sie noch nicht lange verheiratet gewesen waren, bei einem Ausflug aufs Land hatten. Damals herrschte eine jahrelange Dürre, doch plötzlich hatte es einen Schauer gegeben. Fette Tropfen hatten den Staub auf der Windschutzscheibe verschmiert. Auf der Brücke des Geländewagens vor ihnen staunte ein Hütehund, der noch nie Regen erlebt hatte, über die mysteriöse Flüssigkeit, die ihn berieselte und versuchte die Tropfen durch Kratzen zu verscheuchen. Genauso überraschend war Jills Tod für Nick gekommen, als sie vor acht Monaten an Brustkrebs gestorben war.
Er konzentrierte sich darauf, sich im Becken zu orientieren und anhand der geschwommenen Runden zu schätzen, wie spät es war. Er versuchte, durch die langweilige Wiederholung und die körperliche Anstrengung seine Trauer zu verdrängen. Die Mittagspause reichte noch aus, um eine heisse Dusche zu nehmen, sich umzuziehen und vor zwei Uhr im Büro zu sein. Der Regen wurde stärker, er würde auf dem Rückweg nass werden.
Nick beendete sein Programm und verliess das Schwimmbad. Er schaute auf die Uhr und beschloss, dem Regen zu trotzen. Er lief die Strasse gegenüber dem Bahnhof von Milsons Point hinauf und hüpfte von einer Markise zur nächsten. Der steife Gegenwind, der durch die künstliche Schlucht aus Wohnungen und Bürogebäuden heulte, verlangsamte sein Vorankommen und trieb ihm stechende Regentropfen ins Gesicht. Als er das Büro schliesslich erreichte, waren sein Hemd und seine Hose völlig durchnässt. Er stieg in den Aufzug und die Frau neben ihm schüttelte den Kopf. Er sah genauso aus, wie er sich fühlte: erbärmlich.
Die Türen des Fahrstuhls öffneten sich vor dem Büro von Chapman Public Relations. Die Jungen, die sich dauernd über Stress beklagten und sich, wenn er es wagte, ihre Apostrophe zu korrigieren, beschwerten, er mobbe sie, sassen alle mit gesenktem Kopf am Pult. Man hörte das Klappern von Tastaturen und das Murmeln dringender Gespräche. Jessica, die jung genug war, um seine Tochter zu sein, schaute immer wieder auf die Uhr. Er kam selbst an guten Tagen nicht besonders gern zur Arbeit. Er hatte den Journalismus verlassen, um mehr Geld zu verdienen und die Hypothek früher abzuzahlen. Er hoffte, sich und Jill so ein besseres Leben zu ermöglichen und mehr reisen zu können. Noch bevor Jill starb, hatte er den Schritt bereut. Die Arbeit langweilte ihn und er hatte erkannt, dass Glück nicht gleichbedeutend mit einem grösseren Bankguthaben war.
»Hallo, Nick«, begrüsste ihn Pippa Chapman, die Inhaberin der Firma, die aus ihrem Büro kam und ihn auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz abfing. »Ich habe dich gesucht. Ich bin froh, dass du da draussen nicht ertrunken bist. Hast du eine Minute Zeit?«
Nick war fast immer der Erste, der nach Pippa das Büro betrat und oft der Letzte, der es verliess. Jetzt war er drei Minuten zu spät. Pippa war noch keine fünfunddreissig Jahre alt. Sie hatte immer Stellen in der Werbebranche gehabt und konnte stolz sein auf die Beratungsfirma, die sie aufgebaut hatte. Im Stillen nannte er sie ›pocket rocket‹, Taschenrakete. Er arbeitete früher bei einer Zeitung, die sich im digitalen Zeitalter nur schwer über Wasser halten konnte und war dort – als vergleichsweise alter Journalist – ihr Hauptansprechpartner gewesen. Bei einer der Entlassungsrunden hatte sie ihn mitgenommen. Er war ihr etwas schuldig und sie liess es ihn nie vergessen.
Nick folgte ihr in ihr Büro. An einem sonnigen Tag konnte der Anblick des glitzernden Hafens die Stimmung heben, aber heute widerspiegelte das Wasser nur den trüben Himmel und das triste Grau der Harbour Bridge.
Pippa blieb stehen, den Blick eher nach draussen als auf ihn gerichtet. »Wir haben die Fliesenfirma verloren.«
Nick zuckte mit den Schultern. »Typisches Kleinkunden-Syndrom: Die ganze Welt fordern, dauernd jammern und nur Peanuts zahlen. Wir sind ohne sie besser dran.«
Pippa drehte sich um. Ihr Gesicht verriet ihm, dass er das Falsche gesagt hatte. »Du hast leicht reden, Nick, du musst hier nicht die Löhne zahlen. Der Geschäftsführer sagt, du habest ihn beleidigt.«
Nick breitete seine Hände aus. »Ich habe ihm gesagt, dass ich kein vertrocknetes Sandwich verkaufen könne.«
»Er hat ein brandneues Produkt auf den Markt gebracht.«
»Ja.« Nick nickte. »Und wollte, dass wir ihn ins Frühstücksfernsehen bringen.«
»Du hast es nicht einmal probiert, Nick.«
Er holte tief Luft. »Ich versuchte, ihm beizubringen, dass wir etwas Spannendes daraus machen müssten. Ein wenig Panikmache vielleicht, dass Metalldächer bei starkem Wind gefährlich seien oder dass Ziegel besser für die Umwelt sind oder so einen Mist.«
Pippa richtete sich auf und stemmte die Hände in die Hüften. »Du bist nicht mehr mit dem Herzen dabei, Nick.«
»In Dachziegeln? Meinst du?«
»Das war mein erster Auftrag, als ich mich selbständig gemacht habe, Nick. Die Dachziegel haben mir geholfen, dieses Geschäft aufzubauen und dir einen Job zu geben.« Pippa holte tief Luft, bevor sie fortfuhr: »Nick, wir alle wissen, was für ein schreckliches Jahr das für dich war.«
Aber, dachte er, wollte sie sagen, der Tod deiner Frau ist kein Grund, unhöflich zu Kunden zu sein. Und es stimmte natürlich, dass er weder Grund noch Recht hatte, bezüglich der Kunden, für die er arbeitete, wählerisch zu sein. Pippa verwaltete die Firmen- und Führungsangelegenheiten einiger grosser Unternehmen, die momentan Budgetkürzungen vornehmen mussten. Sie konnte es sich nicht leisten, ihre kleineren Kunden links liegen zu lassen. Aber der Mann, der die Fliesenfirma leitete, mochte ihn nicht und verhielt sich unverschämt und fordernd. Er fragte ständig, warum Pippa bei den Kundentreffen nicht dabei war. Der Vorwurf war unangemessen, aber Nick konnte ihn verstehen: Wer hätte nicht lieber eine kluge, attraktive Frau, die sagte, was man hören wollte, als einen ausgebrannten Fünfzigjährigen, der einem die Meinung sagte.
»Es tut mir leid, Nick.«
»Es geht mir besser, Pippa«, sagte er, obwohl er sich dessen nicht sicher war.
»Das mit Jill tut mir wirklich leid, Nick, ist aber nicht der Grund, warum ich mich soeben entschuldigt habe.«
Einen kurzen Moment lang verstand er nicht. »Was ist es dann? Was hast du falsch gemacht?«
»Ich ...«
»Pip, bitte.« Sein Herz begann zu hämmern. »Es tut mir leid. Ich gehe zum Fliesenmann zurück. Ich werde betteln und ihn zurückholen, um uns etwas Zeit zu verschaffen.«
Sie lächelte ihn traurig an und schüttelte langsam den Kopf. »Nick, es tut mir leid. Ich habe heute Morgen auch den Autoauftrag verloren. Wir wussten schon seit Jahren, dass die Fabriken in Australien geschlossen würden, und jetzt ist es passiert. Selbst wenn ich den Auftrag für die Kacheln zurückbekomme, muss ich die Firma verkleinern.«
Er spürte ein Ziehen in der Brust und fragte sich kurz, ob es der Beginn eines Herzinfarkts sei, was aber nicht der Fall war. Vielleicht hätte sie sonst Mitleid mit ihm und würde ihre Entscheidung rückgängig machen.
»Von der ganzen Bande«, fuhr sie kaum hörbar fort, »hast du die meiste Erfahrung und es wird dir am leichtesten fallen, einen anderen Job zu finden. Falls es dich tröstet: Du bist nicht die einzige Person, mit der ich heute Nachmittag sprechen muss. Es tut mir leid, Nick, du bist mir zu hochkarätig. Ich kann mir dich nicht mehr leisten.«
»Wann?«, fragte er. »Du kannst dir eine Kündigungsfrist von ein paar Wochen ausrechnen, wenn du willst. Ich zahle dir alles, was dir zusteht.«
Bestenfalls ein paar Wochen, dachte er, plus den angesammelten Urlaub, den er noch nicht genommen hatte. Er nickte, drehte sich um und begann, Pippas Büro zu verlassen.
»Nick ... vielleicht ergibt sich ja ein freier Auftrag, vielleicht bekomme ich einen neuen Kunden.«
Er nickte, blickte aber nicht zu ihr zurück. Er ging zu seinem Schreibtisch. Er spürte die Augen der jungen Kollegen im Rücken und klappte seinen Laptop auf. Er versuchte, sich auf die halbfertige Medienmitteilung für den Kunden einer Werbefirma zu konzentrieren. Irgendetwas über eine neue, erfahrungsbasierte Marketingkampagne, was auch immer das heissen mochte.
Nick schwankte zwischen Anflügen von Wut und Selbstmitleid. Am liebsten wäre er aufgestanden und in Pippas Büro gegangen, um ihr zu erklären, warum sie ihn, seine Kontakte und seine Erfahrung brauche, aber er konnte es auch aus ihrer Sicht sehen. Sein Fachwissen und seine Erfahrung waren für Pippa eine Zeit lang von unschätzbarem Wert gewesen, aber jetzt war er ein teures Maul, das sie aus einem schrumpfenden Topf füttern musste. Er musste selbst zugeben, dass er nicht gut darin war, neue Aufträge an Land zu ziehen. Nick war Journalist, kein Verkäufer und das wussten alle.
Unfähig, sich zu konzentrieren und nicht bereit, einem seiner jugendlichen Kollegen die Genugtuung zu geben, ihn davonlaufen zu sehen, überprüfte er seinen Posteingang.
Er fand die E-Mail von jemand unbekanntem, doch in der Betreffzeile stand etwas, das ein Werbemann nicht ignorieren konnte: Gesucht Nicholas Eatwell – Journalistin braucht Hilfe bei einer Story. Nick öffnete die E-Mail und stellte fest, dass die Absenderadresse auf ›co.za‹ endete.
* * *
Sehr geehrter Herr Eatwell,
Mein Name ist Susan Vidler, Sie kennen mich nicht. Ich bin eine freiberufliche südafrikanische Journalistin, die sich zu Urlaubs- und Geschäftszwecken in Australien aufhält. Ich recherchiere für die Reportage über einen Australier, der 1902, während des Zweiten Burenkriegs, in einer Einheit namens ›Steinaeckers Reiter‹ diente. Später, 1906, nahm er an einer Revolte gegen die deutsche Kolonie Südwestafrika, das heutige Namibia, teil. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass Sie möglicherweise der letzte überlebende Verwandte dieses Mannes, Sergeant Cyril John Blake, sind. Wenn Sie der Sohn der verstorbenen Denis und Ruth Eatwell sind, sind Sie der Mann, den ich suche. Wenn ja, möchte ich gerne wissen, ob Sie irgendwelche Dokumente oder andere Informationen über Sergeant Blake haben, die Sie mir allenfalls zur Verfügung stellen könnten.
Ich danke Ihnen im Voraus,
Susan Vidler
* * *
Wer auch immer diese Frau war, sie hatte gut recherchiert, denn seine verstorbenen Eltern hiessen Denis und Ruth. Die Frau gab eine australische Handynummer an. Dankbar für eine Ablenkung von dem, was gerade passiert war, rief er sie an, doch der Anruf ging sofort auf die Sprachbox. Er hinterliess eine Nachricht, in der er sagte, er sei der Mann, den sie suche und seine Nummer angab.
Er beendete den Anruf und schaute auf die Uhr. Drei Stunden, bis er in die Kneipe gehen und sich betrinken konnte. Wenigstens hatte er jetzt einen anderen Grund dafür als Jill, sagte er sich.
2
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND, IN DER GEGENWART
Anja Berghoff schaute von ihrem Schreibtisch in der Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität aus dem Fenster und sah blauen Himmel. Es war das, was man in München einen warmen Sommertag nennt, und es hätte Anja gefallen, draussen in einem Park zu sitzen. Doch Anja wünschte sich, noch weiter weg zu sein. In Namibia.
In diesem Land war sie geboren. Doch 1990 waren ihre Eltern aus Angst vor der Vergeltung durch die neue Regierung der Südwestafrikanischen Volksorganisation geflohen. Nach den von den Vereinten Nationen überwachten Wahlen und dem Übergang zur Mehrheitsregierung, hatte sich die SWAPO als grossmütig erwiesen. Dennoch weigerte sich ihr Vater, der namibisch-deutscher Abstammung war, zurückzukehren und starb mit der Behauptung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Anja sah das anders. Im Alter von zehn Jahren war sie aus Afrika verschleppt worden. Sie war gerade alt genug, um den Verlust von Freunden zu betrauern und die Schönheit des trockenen, aber bezaubernden Landes zu schätzen. Sie wäre lieber in Namibia erwachsen geworden. Deutschland war das Gegenteil von ihrem Geburtsland: kalt, nass, grün und berechenbar. Zu Beginn hatte sie es gehasst.
Natürlich hatte sie mit der Zeit gelernt, ihr europäisches Leben zu schätzen, aber so beeindruckend die Schlösser, Flüsse, Schneefelder und das satte Gras Deutschlands auch waren, sie hielten dem Vergleich mit Namibia nicht stand. Dafür fehlte ihr zu viel: Der afrikanische Nachthimmel voller Sterne, der Anblick eines Gepards, der sich durch das trockene, goldene Gras an seine Beute heranpirscht oder die gespensterhafte Erscheinung eines vom weissen Sand bestäubten Elefanten, der aus der Dunkelheit auf der geheimnisvollen Leinwand eines beleuchteten Wasserlochs der Etosha auftaucht.
Anja liebte die Landschaften und die Tierwelt Namibias und nur die Geschichte des Landes faszinierte sie stärker. Sie forschte für ihren Magisterabschluss in Geschichte und schrieb ihre Abschlussarbeit über die Ursprünge einer weiteren Natursehenswürdigkeit Namibias: Die Wildpferde der Namib-Wüste, die manchmal auch als Geisterpferde bezeichnet wurden.
Durch die Verkettung seltsamer Zufälle stiess sie auf ehemals streng vertrauliche Geheimdienstdokumente, die sie elektronisch von den nationalen Archiven erhielt. Es handelte sich dabei um Kopien von Briefen einer zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in Südafrika stationierten Spionin. Interessant für Anja war, dass die Agentin, Claire Martin, genau wie sie selbst in der damaligen kaiserlichen Kolonie ›Deutsch-Südwestafrika‹, also dem heutigen Namibia, gelebt hatte.
Claire Martins Lebensgeschichte las sich wie das Drehbuch eines Films. Sie war als Tochter eines irischen Vaters und einer hochgeborenen preussischen Mutter in Deutschland geboren. Ihr Vater war aus Irland geflohen, nachdem er sich 1867 am Aufstand der Fenianer gegen die Briten beteiligte. Danach diente er auf der preussischen Seite im Deutsch-Französischen Krieg. Mit der Witwe eines preussischen Kameraden verheiratet, zog er mit seiner Familie nach Amerika, wo er auf den Goldfeldern in Kalifornien sein Glück zu machen versuchte. Als dies nicht gelang brachte er seine Frau und seine Tochter zuerst nach Südafrika und in den 1890er Jahren über die Grenze nach Deutsch-Südwestafrika. Dort heiratete Claire den Besitzer einer deutschen Reederei, der aber bankrottging und sich das Leben nahm.
Anja interessierte sich besonders für Claire Martins späteres Leben als Pferdezüchterin in Südwestafrika. Sie und ihr zweiter Mann, Peter Kohl, besassen dort um 1906 mehrere Farmen und ein Pferdegestüt. Doch Claires frühe Berichte über ihre Zeit als Spionin für den Kaiser im Jahr 1902 boten eine faszinierende Lektüre. Als Frau, die fliessend Deutsch und Englisch sprach, musste sie eine ungewöhnliche und äusserst wertvolle Agentin gewesen sein. In Claires Briefen fand sich kein direkter Bezug zu Anjas Nachforschungen über den Ursprung der Wüstenpferde. Dennoch setzte sich in Anja die Theorie fest, dass während Claires Zeit als Spionin in Südafrika etwas passiert war, das ihr späteres Leben in der deutschen Kolonie jenseits der Grenze stark beeinflusste.
Anja sah, dass Carla, die Bibliothekarin, aus ihrer Mittagspause zurückgekehrt war. Sie liess ihre Notizen und ihren Laptop zurück, ging zur Ausleihtheke und fragte, ob die von ihr bestellten Bücher zurückgegeben wurden und nun erhältlich seien.
»Ja, Anja, ich habe sie hier für Sie.« Carla griff unter den Tresen und schob ihr die Bücher zu. »Was sagten Sie, ist das Thema ihrer Recherche?«
»Die Wüstenpferde von Namibia«, erklärte Anja. »Die meisten Leute glauben, dass sie von Militärpferden abstammen, die während des Ersten Weltkriegs entkamen oder freigelassen wurden. Ich arbeite an einer neuen Theorie, die sagt, dass die Kerngruppe der Pferde, von denen die heutigen Tiere abstammen, schon einige Zeit vorher in die Wüste kam. Mehr verrate ich Ihnen nicht dazu, denn das ist sehr heikel.«
Carla rollte die Augen. »Kein Grund so kratzbürstig zu sein.«
Anja runzelte die Stirn. Sie wurde nicht zum ersten Mal mit diesem Wort beschrieben. Anjas Mutter sagte immer, sie brauche mehr Freunde und Carla war nett und hilfsbereit.
Sie öffnete den Mund, um sich zu entschuldigen, als ein junger Mann an den Tresen trat und um Unterstützung bat. Bestimmt auch ein Student, so wie seine zerrissenen Jeans und sein olivgrüner Bundeswehrparka aussahen. Carla wandte sich von Anja ab, nahm einen Stapel Ausdrucke in die Hand und reichte sie ihm.
Anja bedankte sich bei der Bibliothekarin, nahm die Bücher und ging zu ihrem Schreibtisch zurück, wo sie den nächsten Brief auswählte. Er enthielt einen weiteren Bericht aus den letzten Monaten des Zweiten Burenkrieges, datiert 1902. In den Briefen wurde immer deutlicher, dass Claire Martin nicht nur in Südafrika war, um für Deutschland Informationen über den Verlauf des Krieges zu sammeln – was an sich schon faszinierend war. Zusätzlich schien sie eine Art verdeckten Waffenhandel zwischen Deutschland und den Buren zu ermöglichen. Dies bot die einzige Möglichkeit, in diesem Krieg, in dem die Briten die Oberhand hatten, das Blatt in letzter Minute zu wenden.
Der Brief war, wie die anderen, an den deutschen Marine-Nachrichtendienst adressiert und über die kaiserliche Botschaft im neutralen Portugiesisch-Ostafrika gesendet worden.
Am vierzehnten des Monats traf ich mich im Flachland des östlichen Teils von Transvaal in einem verlassenen Handelsposten am Ufer des Sabie-Flusses mit Kommandant Nathaniel Belvedere. Er ist der Kommandeur eines Bataillons von Amerikanern, die für die Buren gegen die Briten kämpfen. Sie nennen sich die ›George Washington Volunteers‹. Viele von ihnen sind irischer Abstammung und hegen einen tiefsitzenden Hass gegen die Briten.
Belvedere und die Truppe seiner Amerikaner gehörten zu den Buren, die Präsident Paul Krüger bewachten, als er 1900 Pretoria und Südafrika mit dem Zug verliess. Belvedere, ehemaliger leitender Angestellter einer Goldminengesellschaft in Transvaal, war ein enger Vertrauter des Präsidenten und mein Ansprechpartner für den Waffenverkauf. Nachdem wir uns kennengelernt hatten, teilte er mir mit, dass er das Geld nicht bei sich habe, aber wisse, wo sich genügend davon befinde, um die Transaktion abzuschliessen.
Ich muss noch in Erfahrung bringen, wo sich sein Geld befindet.
Anja legte den Brief weg und schlug eines der Bücher auf, die Carla ihr gerade gegeben hatte. Es handelte sich um eine deutschsprachige Publikation über ausländische Freiwillige, die bei den Burenstreitkräften gedient hatten. Es gab eine ganze Reihe von ihnen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Irland, Holland, Frankreich, Schweden und den USA. Anja blätterte im Inhaltsverzeichnis und fand den Namen Belvedere. Auf der angegebenen Seite fand sie das Foto eines Mannes mit langem blondem Haar, einem hängenden Schnurrbart und einem spitzen Bart. Er stand in steifer Pose und runzelte die Stirn, aber in seinen Augen entdeckte Anja ein Lächeln. Colonel Nathaniel Belvedere sah unbestreitbar gut aus und erinnerte an eine Figur aus dem amerikanischen Wilden Westen. Die wenigen Bilder, die sie von Claire Martin gesehen hatte, sagten Anja, dass auch sie attraktiv gewesen war. Anja überlegte, was für eine Beziehung die beiden aufgebaut hatten.
In Anjas Leben gab es schon seit vier Jahren niemanden mehr, auch nicht in Hinsicht auf Gefühle. Sie hatte fünf Jahre lang mit einem Mann zusammengelebt, der aber ihren Kinderwunsch nicht geteilt hatte. Schliesslich verliess er sie. Sie war jetzt fast vierzig und obwohl es ihr schwerfiel, hatte sie sich schon fast damit abgefunden, dass sie keinen Mann finden und kein Kind bekommen würde. Vielleicht hatte ihre Mutter recht und sie hatte sich nicht genug Mühe gegeben, aber trotz ihrer Sehnsucht nach einer eigenen Familie hatte sich Anja immer mehr an ihren eigenen Raum und ihr freies Leben gewöhnt, welches sie glücklich zwischen Namibia und Deutschland aufteilte.
Vielleicht, so sagte sie sich zum vielleicht tausendsten Mal, traf sie in Namibia einen intelligenten, finanziell abgesicherten Safari-Guide, der während ihrer regelmässigen Besuche gern mit ihr dort lebte. Sie verdrängte den Gedanken aus ihrem Kopf und kehrte stattdessen in die Welt von Claire Martin und dem amerikanischen Offizier zurück.
3
1902, AM FLUSS SABIE, IM OSTEN VON TRANSVAAL, SÜDAFRIKA
Claire nahm ihren breitkrempigen Reiterhut ab, als Nathaniel mit einem Colt .45 Revolver in der Hand die Tür des Farmhauses öffnete. Er grinste und steckte die Pistole wieder in seinen Gürtel. »Ma’am.«
Im Haus war es angenehm warm und Nathaniel nahm ihr den Mantel ab. Im Tiefland von Transvaal war es bedeutend wärmer als in Pretoria, das im Hochland lag, und von wo aus sie zwei Tage zuvor losgeritten war. Der Mai war sonnig und klar gewesen, doch nun gehörte der Sommerregen der Vergangenheit an und die Nächte begannen, kühl zu werden. In der Feuerstelle knisterten gemütlich die Flammen.
Nathaniel trat einen Schritt zurück und seine Augen machten sich unverhohlen und besitzergreifend wieder mit ihrem Körper vertraut. Claire machte einen Schritt auf ihn zuund küsste ihn.
»Bis auf einen Mann, Christiaan, der von den Ställen aus Wache hält, sind wir allein«, flüsterte er ihr ins Ohr, während er mit ihr einen Flur entlang und durch eine Tür zu einem Himmelbett ging. Das Gebäude aus Pfählen und Dagga, einem Gemisch aus Holz und Lehm und mit einem Stroh gedeckt, war einst das Haus eines portugiesischen Händlers, der in einem zweiten Gebäude seinen Laden eingerichtet hatte. Das Anwesen lag an einer der Routen, die von den Goldfeldern weiter oben am Graben nach Lourenço Marques, der Hauptstadt Portugiesisch-Ostafrikas und ihrem Hafen in der Delagoa-Bucht, etwa zweihundertfünfzig Kilometer weiter östlich, führten. »Christiaan schaut in die andere Richtung.«
Claire mochte den Amerikaner und wusste, dass er in sie vernarrt war. Als er über ihr lag, griff sie nach seiner Pistole, die sich in ihren Bauch bohrte. Sie schob sie heraus und legte sie auf den Nachttisch.
»Jetzt bin ich dran.« Er küsste sich an ihrem Mieder hinunter, kniete sich auf den Boden und hob ihre Röcke an. »Ich weiss, irgendwo hier drin.«
Claire legte den Kopf zurück und genoss das Gefühl seiner Finger, die langsam über ihre Wollstrümpfe bis zur nackten Haut ihrer Oberschenkel glitten. Nathaniel fand den Taschen-Derringer, den sie dort in der Schlaufe eines massgeschneiderten Lederstrumpfbandes aufbewahrte. Er zog ihn heraus und als sie über ihre Brüste hinunterblickte, musste sie lachen. Wie ein Hund, der einen Knochen hält, hatte erdie winzige Pistole zwischen seinen glänzenden, weissen Zähnen. Er nahm die Pistole aus seinem Mund und legte sie neben seine auf den Nachttisch. Er senkte seinen Kopf wieder.
Sie hielt sich mit beiden Händen an den Pfosten am Kopfende des Bettes fest, ihr Griff wurde fester und ihre Hüften wogten, als Nathaniel die unter ihrem Unterrock verborgenen Liebkosungen fortsetzte. Sie war zu sittsam, ihn zu fragen, wo er sein Repertoire gelernt hatte, aber er war eindeutig ein bereitwilliger und gelehrter Schüler gewesen. Claire versuchte, sich auf das Ziel zu konzentrieren, das sie sich gesetzt hatte: Herauszufinden, wo die Buren die Beute versteckt hatten, mit der sie ihre Waffen bezahlen wollten. Das war nicht einfach. Weder fähig noch willig, die totale Kontrolle zu behalten, schnappte Claire nach Luft und schauderte. Zufrieden, dass er seine Mission erfüllt hatte, stieg Nathaniel zurück auf das Bett und legte sich zu ihr. Er küsste sie und als sie wieder zu Atem gekommen war, rollte sie ihn auf den Rücken. Als beide gesättigt waren, wickelte der nackte Nathaniel sie in ein Laken und führte sie zurück zum Herd. Er schob einen chinesisch bedruckten Paravent beiseite hinter dem sich eine Badewanne aus Messing verbarg. Er füllte Wasser aus einer Kupferkanne nach.
»Ich dachte schon, du würdest nie kommen«, sagte er.
Claire sah seine Zigarrenkiste auf dem Kaminsims. Sie öffnete sie, nahm eine Zigarre heraus, zündete sie mit einer Flamme aus dem Kamin an und zog an ihr. Claire reichte sie Nathaniel, liess ihr Laken fallen und glitt in die Badewanne.
»Das ist Glück«, sagte sie und griff nach der Seife.
Er ging zu einem seitlichen Stehtisch und entkorkte eine Flasche Whiskey. Er schenkte grosszügig in zwei Gläser ein und kam zu ihr.
Claire nahm ihren Drink und die Zigarre, zog noch einmal daran und blies den Rauch ins Glas. Sie lehnte sich im Wasser zurück, nippte an dem rauchigen Gebräu und liess sich davon wärmen. Nathaniel genoss die Hitze des Feuers in seinem Rücken, nahm seinen Drink, bückte sich dann nach ihrem Laken und band es sich um.
»Schade, ich habe die Aussicht genossen.«
»Sie sind unverbesserlich, Miss Martin.«
»Vielen Dank, Colonel«, sagte sie mit der englischen Entsprechung seines Ranges und reichte ihm die Zigarre zurück. »Sag mir, Nathaniel, warum genau bist du in Südafrika und kämpfst für die Buren?«
Er zuckte mit den Schultern. »Viele meiner Jungs sind Iren. Sie haben noch eine persönliche Rechnung mit den Briten offen. Ich, ich bin Geschäftsmann.«
»Ich hätte angenommen, dass ein Geschäftsmann und Uitlander kein Interesse daran hat, sich auf die Seite von Transvaal und des Freistaats zu stellen?« Claire wusste, dass einer der Gründe, warum die beiden Burenrepubliken gegen Grossbritannien in den Krieg gezogen waren, darin bestand, dass Präsident Paul Krüger den britischen und anderen ausländischen Minenarbeitern das Wahlrecht verweigert hatte, um die Kontrolle der Afrikaner über die von den Buren ausgeschiedenen Gebiete zu behalten.
Er lächelte. »Mir war es lieber, zu versuchen, Veränderungen innerhalb der Südafrikanischen Republik herbeizuführen, als dass ein Grosser – in diesem Fall Grossbritannien – dem Kleinen seinen Willen aufzwingt.«
»Die Bilanz deines Washingtoner Bataillons zeigt, dass du sowohl etwas vom Soldatentum als auch vom Geschäft verstehst«, sagte sie. In der Tat wusste Claire eine ganze Menge über Nathaniel Belvedere, doch war es ihre Aufgabe, ihn zum Reden zu bringen.
»Meinen ersten Mann, einen Yankee, habe ich getötet, als ich sechzehn war. Seither habe ich das eine oder andere gelernt. Dennoch habe ich gehofft, nie wieder einen Krieg zu erleben. Die Buren sind grosse Kämpfer, aber ich fürchte, ich werde auch diesmal auf der Verliererseite stehen.«
Claire versuchte, Nathaniels Alter zu schätzen. Er war wohl in den Fünfzigern, aber in bemerkenswert guter Form.
»Du hast für den Erhalt der Sklaverei in Amerika gekämpft, etwas, das die zivilisierte Welt, die Briten, verboten haben. Ist das deine Vorstellung davon, für den ›kleinen Mann‹ einzutreten?«
»Ha!« Nathaniel atmete aus und nahm einen weiteren Schluck. »Wenn du gesehen hast, wie die Briten diesen Krieg führen, wirst du deine Meinung über die Zivilisation ändern, kleine Dame. Aber nein, ich war kein Plantagenbesitzer und die Sklaverei ist mir so oder so scheissegal. Ich war in diesem Krieg, weil der Norden versuchte, die Wirtschaft des Südens zu ersticken. Als ich bis vor drei Jahren hier in Südafrika eine Goldmine betrieb, hatte ich den Eindruck, dass die Engländer dasselbe mit dem alten Paul Krüger und seinen Leuten vorhatten.«
Mit einiger Mühe ignorierte sie seine Bemerkung über die ›kleine Dame‹. Seine Anstrengung von vor einer halben Stunde hatte ihm etwas Spielraum verschafft, doch es gab noch viel zu tun. Sie hob ein Bein und wies auf die Zehen. »Meine Füsse sind wund von meinen neuen Reitstiefeln.«
Nathaniel stellte sein Getränk auf den Kaminsims, steckte sich die Zigarre zwischen die Lippen und nahm ihren tropfenden und seifigen Fuss in die Hand. Als er begann, ihn zu massieren schloss sie ihre Augen in echter Verzückung.
»Und du, Claire, warum bist du wirklich hier? Hasst du die Briten? Hast du eine Rechnung zu begleichen, wie meine irischen Jungs?«
Sie wog ab, wie viel sie ihm sagen sollte. Sie musste einerseits ein Geschäft mit Nathaniel abschliessen, nämlich die Bezahlung für die Waffen, die sie an die Buren geliefert hatte, erhalten, sondern andererseits auch sein Vertrauen gewinnen, damit er ihr verriet, wo die Geldquelle lag. »Geld«, gab Claire zurück, da sie wusste, dass eine gute Lüge, immer auf der Wahrheit basiert.
»Die Wurzel allen Glücks.«
Sie lächelte, hielt aber die Augen geschlossen, als er mit ihrem anderen Fuss begann. Daran könnte sie sich gewöhnen, beschloss sie.
»Du kämpfst also, damit du mehr Geld verdienen kannst, wenn du in den Bergbau zurückkehrst.«
»Das mag sein. Aber was hast du davon, wenn du deutsche Artillerie an die Buren verkaufst?«
»Es ist das Schiff meines verstorbenen Mannes, das die Geschütze nach Portugiesisch-Ostafrika transportiert und es wäre mein Schiff gewesen, wenn die Bank es nicht zurückgefordert hätte. Er betrieb eine kleine Reederei, aber er hat sich übernommen. Ausserdem hatte er ein schreckliches Problem mit dem Glücksspiel – und teuren Mätressen, wie sich herausstellte. Er brachte sich um, bevor ich es für ihn tun konnte und hinterliess mir einen Haufen Schulden.«
»Du bist also ins Waffengeschäft eingestiegen, um das Schiff zurückzukaufen?«
Sie lachte und hoffte, dass es natürlich klang. »Mein Anteil wird nicht so hoch sein, wenn ich euch Kanonen verkaufe. Nein, ich hoffe, ich werde genug verdienen, um in Deutsch-Südwestafrika ein Stück Land kaufen zu können. Ich will eine Farm mit Pferden. Ich mag weder die Briten – mein Vater war Ire, ein Fenianer –, noch die Art und Weise, wie sie diesen Krieg führen. Das Land meiner Mutter hingegen, Deutschland, hat meinem Vater eine Heimat gegeben. Dafür leiste ich gern meinen Teil für den Kaiser.«
»Deinen Beitrag? Wie kommt es, dass eine Frau, die so fähig ist wie du, ein illegales Waffengeschäft aushandelt?«
Sie lächelte und hob eine Augenbraue. »Ich habe Freunde in hohen Positionen und in den Docks. Fritz Krupp ist eine Art entfernter Cousin.«
»Aha«, sagte Nathaniel. Sie brauchte ihm nicht zu sagen, dass Fritz Krupp ein Vermögen mit der Entwicklung und Herstellung schwerer Waffen und Kriegsschiffe verdient hatte, die er sowohl an die kaiserliche Regierung als auch an viele ausländische Kunden verkaufte. »Ich kannte einige Admirale und als ich mich anbot, dem Oberkommando der Marine Berichte über den Fortgang des Krieges hier in Südafrika zu schicken sagte niemand: Mach dir keine Mühe, du dummes Mädchen. Als ich Wind davon bekam, dass die Buren mehr Artillerie bräuchten, dachte ich, ich könnte mich als eine Art von Vermittlerin betätigen.«
»Du bist alles andere als ein dummes Mädchen, Claire und die Deutschen waren klug, dein Angebot anzunehmen. Unsere britischen Feinde sind so eingefahren, dass sie wahrscheinlich nicht einmal auf die Idee kämen, dass eine Frau eine Spionin sein könnte.«
Claire lächelte kurz zum Dank für das Kompliment, unterschätzte ihren Feind aber nicht. » Es gibt einige am kaiserlichen Hof, in der Regierung und in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, denen es lieber wäre, wenn die Buren gewinnen würden und die so verrückt sind, zu glauben, dass eine Lieferung von Artillerie in letzter Minute den Tag retten könnte.«
Nathaniel hob die Augenbrauen. »Du glaubst nicht, dass es das wird?«
Sie zuckte mit den Schultern. Sie hatten sich schon zweimal getroffen, um die Logistik des Geschäfts zu organisieren und bei ihrem letzten Treffen hatte Claire sich von Nathaniel verführen lassen. Nach ihrer Begegnung hatte er ihr anvertraut, dass er zwar den Buren gegenüber loyal war, aber insgeheim bezweifelte, dass sie die Briten Dank einer Verstärkung mit Waffen oder Männern besiegen könnten.
»Nicht mehr als du«, sagte sie. »Aber es war nicht schwer, meine familiären Beziehungen zu nutzen, um eine Lieferung von 77-Millimeter-Feldkanonen des Typs FK-96, die für die deutsche Schutztruppe in Windhoek bestimmt waren, nach Lourenço Marques umzuleiten, wo sie derzeit auf dich und deine Leute warten. Fritz hat das Geschäft als familiären Gefallen direkt mit mir gemacht, es gibt also keinen offiziellen Papierkram. Ich werde mir einen Teil des Geldes nehmen und es wird hoffentlich reichen, um die Schulden meines verstorbenen Mannes zu begleichen. Der Rest des Geldes wird auf das Privatkonto meines lieben Cousins in Capri, in Italien, gehen, der dort eine Villa besitzt. Dann werde ich mich von der Schifffahrt verabschieden und mir eine kleine Farm in Südwestafrika kaufen.« ›Eher die halbe Kolonie‹, dachte sie bei sich.
Nathaniel stiess einen Seufzer aus und sie spürte, wie der Druck seiner Finger nachliess. »Es geht dir also wirklich nur ums Geld.«
Sie öffnete die Augen und merkte, dass sie ihn falsch eingeschätzt hatte. Auch wenn er desillusioniert war und sich dem Kampf gegen die Briten aus wirtschaftlichen Gründen angeschlossen hatte, war er im Herzen ein Idealist und Romantiker. Claire hatte nicht angenommen, dass sie sein Herz gewinnen müsse – sie hatte ihm bereits ihren Körper geschenkt.
In Wirklichkeit hatte sie schon bevor sie das Waffengeschäft aushandelte, zugestimmt, für die Deutschen zu spionieren. Der Grund dafür lag bei etwas Anderem, das sie erlebt hatte.
Claire sah ihm in die Augen. Sie musste an seine sentimentale Seite appellieren. »Ich habe eine Freundin – hatte eine Freundin, sollte ich sagen. Als meine Familie zu Beginn des Goldrauschs in Südafrika lebte, war Wilma wie eine Schwester für mich. Sie lernte einen jungen Mann kennen, einen Bauern und sie heirateten. Als der Krieg gegen die Engländer ausbrach, schloss sich ihr Mann einer Kommandoeinheit der Buren an. Wilma war gerade mit ihrem ersten Kind schwanger als britische Kolonialtruppen ihre Farm überfielen, abfackelten, die Hunde abschlachteten und das Vieh mitnahmen. Wilma wurde in ein Konzentrationslager gebracht. Verstehst du, was ich meine?«
»Ja.«
»Wilma schrieb mir und schaffte es, eine der Wachen zu bestechen, um den Brief herauszubekommen. Sie erzählte mir, dass sie das Kind im Lager bekommen hatte, einen kleinen Jungen namens Piet. Sie berichtete mir von den Schrecken, dem Mangel an sauberem Wasser und anständigem Essen, von Ruhr, Masern und anderen Krankheiten. Wilma fragte mich, ob ich versuchen würde, der Welt mitzuteilen, was hier in Südafrika vor sich ging. Ich schrieb Briefe an alle, die mir einfielen, nahm Kontakt zu Zeitungen auf und beschloss, Wilma zu besuchen und eine Petition für ihre Freilassung einzureichen.«
»Und?«
»Und als ich im Lager ankam, waren Wilma und Piet bereits tot. Das Kind starb bei der grossen Masernepidemie im letzten Jahr und kurz darauf wurde Wilmas Mann im Kampf getötet. Ich weiss nicht, ob jemand wirklich an einem gebrochenen Herzen sterben kann, aber vielleicht hat Wilma einfach aufgegeben. Ich kam gerade noch rechtzeitig für ihre Beerdigung.« Nathaniel nahm ihre Hand in seine und schaute ihr in die Augen. Sie sah die Kriegsmüdigkeit in den seinen und noch etwas anderes, Weicheres.
Claire wechselte das Thema und fragte leise: »Ist meine Bezahlung für die Artillerie da, Nathaniel?«
Er wandte den Blick ab. »Nein, aber ich weiss, wo sie ist.«
»Sag es mir. Vielleicht können wir Zeit sparen, zusammen dorthin gehen und es holen.«
Er schüttelte den Kopf, wandte seinen Blick aber wieder ihr zu und liess sich von ihrem erneuten Lächeln anstecken. Noch einmal sank er auf die Knie und seine Hand bewegte sich in die Badewanne und unter das Wasser.
Sie legte ihre Hand auf seine. »Sag mir wenigstens, dass es genug ist, um die Kosten für die Waffen zu decken, Nathaniel.«
Er grinste. »Oh, Claire, es ist mehr als genug da, um ein paar Kanonen zu bezahlen, vertrau mir.«
»Sag es mir, bitte« gurrte sie erneut, dann schloss sie wieder die Augen und räkelte sich mit dem Kopf über die hohe Rückenlehne aus Metall. Sie zog ihre Hand weg. »Ist es weit weg?«
»Nahe. Weniger als einen Tagesritt von hier. Was lang währt, wird endlich gut, meine Liebe.«
»Oh, Nathaniel, es macht mir nichts aus, zu warten.«
Ihr Körper versteifte sich und ihre Beine streckten sich über den Wannenrand, als das Vergnügen wieder von ihrem Körper Besitz ergriff. Als es nachliess und ihr Atem sich beruhigt hatte, öffnete sie die Augen und sah, dass er sie anstarrte.
»Claire ...«
»Ja?«
»Du hast recht. Ich glaube nicht, dass die Buren eine Chance haben, zu gewinnen, selbst wenn sie deine Waffen bekommen.«
»Ich auch nicht«, bestätigte sie.
»Ehrlich gesagt habe ich den Krieg satt. Ich habe ein Dutzend guter amerikanischer Jungs verloren, als ich versuchte, den Standort des Goldes, mit dem sie deine Waffen bezahlen wollten, geheim zu halten.« Er fuhr sich mit der Hand durch sein langes Haar und wandte den Blick von ihr ab.
Sie nickte, sagte aber nichts. Nathaniel hatte ihr beim letzten Mal erzählt, dass seine Freiwilligen-Truppe von einem abtrünnigen Kommando der Buren in einen Hinterhalt gelockt worden war. Deren Anführer, ein alter Bandit namens Hermanus, hatte den Kampf für die Sache aufgegeben und es sich zum Ziel gesetzt, das Versteck der Goldreserven der ehemaligen Republik zu finden.
Nathaniel und seine Männer waren mit leeren Wagen auf dem Rückweg von einer Goldlieferung, als ihre ehemaligen Kameraden sie überfielen. Nur Nathaniel und Christiaan konnten entkommen.
Er dachte über etwas nach, über dasselbe wie sie, hoffte sie, aber sie musste es erst von ihm hören.
»Mit dem Gold, Claire, sogar nur einem Teil davon, könnten wir für immer verschwinden. Niemand würde es je finden. Ich bin wahrscheinlich die letzte lebende Person, die weiss, wo es ist, denn Christiaan stand in der Nähe des Verstecks Wache und ist nicht hineingegangen.«
Hinein? Ihre Gedanken überschlugen sich: Befand sich das Gold in einem Gebäude? Oder in einer Höhle, einem alten Minenschacht? Ihr Herz schlug schneller. Sie beobachtete ihn aufmerksam und fragte sich, ob sie ihre finanziellen Motive übertrieben hatte und er ihr eine Falle stellte. Doch sie erkannte, dass auch er den Atem anhielt, vielleicht um zu sehen, was sie darüber dachte. Claire hatte genug Andeutungen gemacht, dass es ihr um das Geld ging, aber nicht gesagt, dass sie es in Betracht zöge, das Geschäft aufzugeben und einfach das Gold zu stehlen. Alles. »Fahr fort.«
Er grinste sie an. »Ich weiss, wo das Gold ist, Claire und ich habe die einzige Karte, die es gibt.«
* * *
Anja streckte sich an ihrem Pult in der Universitätsbibliothek und las die nächste Seite des Briefs.
Mir wurde klar, dass Kommandant Belvedere ein kriminelles Unternehmen vorschlug, bei dem wir beide uns mit einem Teil oder der Gesamtheit der Goldreserven von Präsident Krüger davonmachen sollten. Natürlich würde ich nichts dergleichen dulden, aber da dieser Mann kriminelle Neigungen zeigte, tat ich, als ob ich seinem Plan zustimmte und hoffte, er würde mir den Aufenthaltsort des Goldes verraten.
Mein Auftrag war klar: Die strategischen Interessen Deutschlands heimlich zu fördern und dafür zu sorgen, dass die Rüstungsgüter zu den Truppen gelangten, für die sie bestimmt waren.
Kommandant Belvedere bot mir für den Abend ein angemessenes Quartier auf dem Handelsposten an. Schon vor dem Morgengrauen wurde ich geweckt.
Die Sammlung von Claires Briefen an ihre Spionagemeister war nicht vollständig. Das Reichsarchiv befand sich in Berlin und viele der Unterlagen waren verbrannt, als das Gebäude, wie ein Grossteil der Stadt, während des Zweiten Weltkriegs bombardiert wurde.
In diesem Teil des Berichts fand sich ein Hinweis auf Waffen. Claire war Teil eines Komplotts, bei dem es darum ging, die Buren mit Artilleriewaffen zu versorgen.
Anja hatte mittlerweile fast alle ihre Briefe gelesen und wenn sie nicht bald einen Hinweis darauf fand, dass Pferde in die Wüste des Nachbarlandes entlassen wurden, blieben ihre Nachforschungen der letzten Wochen nicht mehr als ein faszinierender Umweg und eine Sackgasse.
Kommandant Belvederes Pferd wieherte neben dem Fenster und liess ihn Gefahr wittern. Er befürchtete einen Überfall vor der Morgendämmerung – eine bei den britischen Kolonialtruppen beliebte Taktik – und bestand darauf, dass ich das Bauernhaus verliess und durch die Dunkelheit zum Gipfel eines nahegelegenen Hügels ritt. Er sagte, dass er später, wenn alles sicher sei, zu mir stosse und gab mir seinen Colt.
Ich zog schnell die Herren-Reitkleider an, die ich zur Tarnung bei meinen spärlichen Habseligkeiten trug, verliess das Haus so leise wie möglich und ging zum Stall. Ich fand Belvederes Burenwache, Christiaan, schlafend, weckte ihn unsanft und befahl ihm, sich im Haus des Händlers zu melden. Der Mann schaffte es, ungesehen zum Haus zu gelangen, aber als ich aus der Stalltür schaute, sah ich Männer, die sich in der Dunkelheit näherten. Aus Angst, gesehen zu werden, wenn ich ein Pferd herausnähme, verliess ich das Gebäude zu Fuss und versteckte mich im Gebüsch.
4
NORTH SYDNEY, AUSTRALIEN, IN DER GEGENWART
Der Nachmittag zog sich quälend in die Länge und Nick verliess die Arbeit erst um viertel vor fünf.
Es war ihm egal. Er hatte keinen Job mehr.
Susan Vidler, die Südafrikanerin, von der er eine E-Mail erhielt, rief ihn kurz nach dem Absenden seiner Nachricht zurück. Sie sagte, es sei kein Problem, sich mit ihm irgendwann nach drei Uhr im Commodore Hotel in North Sydney zu treffen. Er hielt es für besser, sich mit einer Fremden zu unterhalten und vielleicht etwas über einen seiner Vorfahren zu erfahren, als in die Wohnung zurückzugehen, alte Fotos von Jill und sich durchzusehen und bis zur Bewusstlosigkeit zu trinken.
Das Commodore war ein beliebtes Lokal und er war früh losgefahren, um sicher zu sein, dass er einen Tisch bekam, bevor die übliche Meute es füllte, die nach der Arbeit kam. Er nahm die Treppe von der Blues Point Road zur Veranda hinauf, bestellte sich an der Bar ein Bier und suchte sich einen Sitzplatz.
Er zog sein Handy heraus und checkte Facebook und die E-Mails.
»Nick?«
Er blickte auf und sah in ein sehr hübsches, von glattem blondem Haar umrahmtes Gesicht.
»Ja, Susan, richtig?«
»Howzit?« Sie streckte eine Hand aus.
Nick stand auf. »Hi.«
»Da habe ich aber gut geraten«, sagte sie.
»Darf ich Ihnen einen Drink anbieten?«
»Das wäre lekker, wunderbar, danke. Sauvignon blanc?«
»Kommt sofort.« Nick ging zur Bar und dachte, dass heute wenigstens etwas nicht schiefging.
Er kehrte an den Tisch zurück. Susan sass mit zurückgeschobenem Stuhl und gekreuzten Beinen unter einem kurzen schwarzen Rock da. »Danke.«
»Schön Sie kennenzulernen«, sagte er und nippte an seinem Bier.
»Gleichfalls. Ich bin froh, dass wir uns treffen können. Ich muss sagen, es war ein ziemlicher Aufwand, Sie aufzuspüren.«
»Nun, ich glaube, ich habe noch nie etwas über diesen Verwandten gehört, für den Sie sich interessieren. Wie war noch einmal sein Name?«
»Blake«, sagte sie. »Sergeant Cyril Blake. Er, oder besser gesagt, sein Deckname, Edward Prestwich, wird in einem Buch über die Geschichte Namibias erwähnt.«
»Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Sie sagten etwas über diesen Mann, der in Deutsch-Südwestafrika diente? Das ist doch das heutige Namibia, oder?«
»Ja.«
»Aber Australier haben nie dort gekämpft, soviel ich weiss.«
Susan lehnte sich, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, ein wenig vor. Ihr Gesicht wurde lebhaft und er bemerkte zum ersten Mal das fast durchscheinende Blau ihrer Augen.
»Da haben Sie Recht, aber Cyril Blake landete 1906 in Deutsch-Südwestafrika. Dort kämpfte er mit den Nama, die sich zusammen mit den Herero gegen die deutsche Kolonialregierung erhoben.«
»Warum hat Blake sich ihnen angeschlossen?«
»Das ist eine der Fragen, auf die ich eine Antwort zu finden versuche. Es könnte sein, dass er mit ihrer Sache sympathisierte oder einen Grund hatte, die Deutschen nicht zu mögen. Es war sicherlich nicht Blakes Krieg. Allerdings scheint er auch ein geschäftliches Interesse an all dem gehabt zu haben.«
»Geschäftlich?«
Sie nippte an ihrem Wein und nickte. »Blake war Pferdehändler. Pferde waren auf beiden Seiten sehr knapp und es gibt Hinweise darauf, dass Blake Pferde an die Nama verkaufte. Offenbar gab es einen regen grenzüberschreitenden Handel zwischen der britisch kontrollierten Kapkolonie, einem Teil des heutigen Südafrika, und Deutsch-Südwestafrika.«
Nick war sowohl von der Geschichte als auch von Susan fasziniert. Sie war vielleicht zehn Jahre jünger als er, also keine grossäugige Jungreporterin direkt von der Universität und auf der Jagd nach ihrer ersten grossen Story. Er warf einen Blick auf ihre linke Hand. Sie trug keinen Ehering. Eine Vision von Jill liess Nick lächeln. Sie hatte ihr geblümtes Kopftuch umgebunden und sagte ihm, er solle sich eine neue Frau suchen, wenn sie weg sei. Sie versuchte, einen Scherz daraus zu machen, indem sie ihm lachend sagte, er solle mindestens ein Jahr warten. Trotzdem hatte er ein schlechtes Gewissen, weil er Susan prüfend betrachtete.
Er räusperte sich. »Also, wie haben Sie mich gefunden? Mit einer Online-Suche?«
»Ja und nein. Ich kannte den Namen Ihres Urgrossonkels durch andere historische Nachforschungen und fand seine Einberufung für den Burenkrieg online beim australischen Nationalarchiv. In seinen Papieren war seine Mutter als nächste Angehörige aufgeführt. Ich machte sie ausfindig und fand über sie die Geburtsurkunden der beiden Brüder Ihres Urgrossonkels.«
»Ich erinnere mich, dass meine Tante mütterlicherseits mir einmal von drei Brüdern auf ihrer Seite der Familie erzählt hatte, die in den Krieg zogen. Einer starb im Ersten Weltkrieg in Frankreich, einer, mein Urgrossvater, diente in Palästina in der leichten Kavallerie. Der dritte muss also Cyril gewesen sein.«
Susan nickte. »Ich habe die Heiratsurkunde Ihrer Grosseltern online beim Zivilstandsregister von New South Wales gefunden. Dann stöberte ich die Geburts- und Heiratsurkunde Ihrer Grossmutter auf.«
»Beeindruckend«, sagte Nick.
Susan lächelte, nahm einen Schluck von ihrem Wein und hob eine Handfläche. »Nach dieser Zeit wurde es schwieriger. Aufgrund von Datenschutzgesetzen kann man online weder Geburtsurkunden von Personen, die vor weniger als hundert Jahren in New South Wales geboren wurden, noch Heiratsurkunden aus den letzten fünfzig Jahren finden. Also habe ich ›Trove‹ durchsucht, wo gerade alte australische Zeitungen mit optischer Zeichenerkennung gescannt werden. Dort habe ich eine Erwähnung Ihrer Grosseltern gefunden. Sie sind in einer Heiratsanzeige als die Eltern der Braut aufgeführt: Von ihrer Mutter, Ruth.«
»Erstaunlich.«
»Sie oder ein anderer Nachkomme von Blake waren schwieriger zu finden. Bei der Suche nach weiteren Hinweisen bin ich aber auf eine Website namens ›Ryerson Index‹ gestossen, die von der ›Sydney Dead Persons Society‹ aufgeschaltet wird ...«
»Das ist nicht Ihr Ernst.«
Susan nickte. »Doch, doch. Dort findet man weit zurückreichende Todesanzeigen aus dem Daily Telegraph und dem Sydney Morning Herald und darunter fand ich die Ihres Vaters, Denis Eatwell. Mein herzliches Beileid.«
»Er hatte ein gutes, langes Leben.« Im Gegensatz zu Jill. Er wurde das Schuldgefühl, mit Susan in einem Pub zu sitzen, nicht los, war aber beeindruckt von dem Aufwand, den sie betrieben hatte, um ihn zu finden.
»So haben Sie mich also gefunden, alles über das Internet?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, am Ende hat mir das Schicksal unter die Arme gegriffen. Der Ryerson-Index listet nur den Namen und das Datum der Anzeige auf, den Text aber nicht und Trove ist nicht in der Lage, die Zeitungen aus der Zeit, in der Ihr Vater starb, zu scannen. Ich musste sogar persönlich in die Staatsbibliothek von New South Wales gehen und die Ausgabe des Sydney Morning Herald mit der Todesanzeige Ihres Vaters auf Mikrofilm nachschlagen.«
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Sind Sie eigens dafür nach Sydney geflogen?«
Sie lachte. »Nein, ich hatte vor, Freunde zu besuchen. Da meine Nachforschungen mich nach Sydney führen, scheint es wohl irgendwie vorherbestimmt zu sein oder so. In der Todesanzeige, die ich vor ein paar Tagen gefunden habe, sind Sie als Denis’ einziger Überlebender aufgeführt. Danach war die Spurensuche nicht mehr so spannend – ich habe mich an das gute alte Facebook gewandt. Es gibt nicht viele australische Nick Eatwells. Als ich herausfand, dass Sie nicht in Westaustralien leben, habe ich Ihnen eine E-Mail geschickt und hier sind wir nun.«
»Das ist an sich schon eine tolle Geschichte, aber, verzeihen Sie mir, glauben Sie wirklich, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat – wenn man bedenkt, dass ich nicht viel über diesen Typen weiss? Und wird irgendjemand eine historische Reportage über all das bringen?«
»Die Geschichte ist aktueller, als Sie wahrscheinlich denken«, erklärte sie. »Auch wenn der Aufstand mehr als hundert Jahre zurückliegt, hat er noch heute Auswirkungen auf Afrika und Deutschland. Seit langem gibt es Forderungen aus Namibia, dass die deutsche Regierung eine Entschädigung zahlen solle. Die Deutschen besiegten die Herero und Nama nicht nur im Kampf, sondern errichteten auch ein Netz von Konzentrationslagern, in denen Zehntausende von Menschen an Hunger und Krankheiten sowie bei der Zwangsarbeit starben. Das schlimmste Lager befand sich auf der Haifischinsel an der Atlantikküste, wo Schreckliches geschah. Häftlinge von der Insel wurden unter anderem beim Bau einer Eisenbahnlinie, die vom Hafen von Lüderitz bis zur Stadt Keetmanshoop führte, eingesetzt und mussten sich buchstäblich zu Tode schuften.«
»Und was denken Sie darüber?«
Susan zuckte mit den Schultern. »Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass die Menschen in einem fortschrittlichen, liberalen Land wie Deutschland für die Taten des Kaiserregimes vor einem Jahrhundert zur Verantwortung gezogen werden sollten, kann aber auch den Standpunkt der Einheimischen verstehen. Auf jeden Fall wird eine knallharte Geschichte, die zeigt, wie abscheulich die Deutschen damals gehandelt haben, in beiden Ländern auf Interesse stossen. Sie könnte bei den Medien sowohl als Neuigkeit wie auch als Sonderbericht gefragt sein.«
»Hmm«, brummte Nick, nicht ganz überzeugt. »Die Tatsache, dass ein Australier in diesem Krieg gekämpft hat, wird in Deutschland wohl kaum grosse Reaktionen auslösen.«