
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Durch einen mysteriösen Brief wird Chantal in einen Albtraum hineingezogen, der ihr ganzes Leben verändert. Sie begegnet einem jungen Piraten, der sehr viel mehr von ihr will, als nur ihre Mithilfe bei einem Racheakt. Chantals Leben erfährt eine aufregende und beängstigende Kehrtwendung, als sie das Schiff betritt, das in eine neue Zukunft fährt. Trotz seiner Sucht nach Rache und seinem boshaftem Leben, schafft Chantal es, sein Herz zu gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich möchte mich bei Brigitte für ihre unendliche Geduld als Lektorin und bei Davina Hoff als Titelbild bedanken.
Inhaltsverzeichnis
Amerika, 18.Jh.
Kalifornien 1876
London 1889
London 1891
Amerika, 18.Jh.
Das Waisenkind Chantal Events reift zu einer jungen bildschönen Frau heran, die durch einen skrupellosen Plan nach Amerika gelockt wird.
Auf hoher See lernt sie den gefühlskalten Piraten Trey kennen, der sie nicht nur entführt, sondern auch ihr Herz stiehlt.
Nach langen Kämpfen um Gerechtigkeit siegt am Ende die Liebe.
Die einst entführte schönste Frau der Meere wird nun zum Retter der verletzten Piratenseele.
Kalifornien 1876
Ich schaue aus meinem Fenster und atme die frische Luft ein. Bewundere das Morgenrot, warme Luft strömt durch mein Zimmer, die den süßen Frühling mit sich bringt. Das Haus, in dem ich lebe, wirkte mit seiner unglaublichen Größe und der weißen Fassade fehl am Platz, inmitten der Wildnis.
Es grenzt direkt an die Plantagen meines Vaters, die sich soweit das Auge reicht, über das flache Land erstrecken. Der Fluss und der dichte Wald ringsherum bieten mir den idealen Spielplatz.
Um meinem Vater auf den Plantagen helfen zu können, suche ich mir alte schlichte Kleidung heraus. Ein Leinenhemd, die schwarze Lederhose und meine Stiefel, das sollte reichen. So ein schöner Morgen, ich fühle mich einfach wunderbar und hungrig.
Wie immer nehme ich drei Stufen auf einmal die Treppe hinunter, um in die Küche meiner Mutter zu gelangen. Mitten auf der Treppe vernehme ich jedoch dumpfe Stimmen, die von unten zu kommen scheinen. Als ich stehen bleibe, höre ich deutlich laute unbekannte Stimmen, die sehr aggressiv klingen und die mir fremd sind.
Statt in die Küche zu hasten, gehe ich ganz leise und schaue durch den Türspalt, konzentriere mich voll und ganz auf das Gespräch.
Da ist eine eisige Stimme, die mich erschaudern lässt.
Mein Vater, der auch in der Küche ist, sagt etwas sehr Unverständliches.
Etwas weiter links sehe ich ihn dann auch, Panik lässt mich erstarren. Mein Vater kniet auf dem Küchenboden, er ist auf dem Rücken gefesselt und ein alter Lappen steckt in seinem Mund. Meine Mutter kniet daneben und ich bemerke erst jetzt, dass sie unentwegt schluchzt.
Ich bin wie gelähmt, meine Brust hebt und senkt sich heftig unter meinem hämmernden Herz. Panische Angst durchströmt meinen Körper.
Ein Mann tritt vor meine Eltern, er ist groß und von imposanter Erscheinung.
Er trägt einen dunkelblauen Anzug und weiße Schuhe. Dazu hat er einen passenden weißen Handstock und es sieht so aus, als hätte dieser Mann eine Beinprothese. Ich sehe sein Gesicht nur von der Seite und das wirkt ziemlich finster. Sein leicht graumeliertes Haar und diese grauen Augen jagen mir einen kalten Schauer über den Rücken. Was will er hier? Was will er von meinen Eltern?
Ruckartig werde ich aus meinen Gedanken gerissen, als ich eine schnelle Bewegung wahrnehme. Etwas fällt zu Boden und meine Mutter kreischt.
Es ist mein Vater, er liegt auf dem Boden, unter seinem Körper erstreckt sich eine große Blutlache.
Stocksteif stehe ich da, mir stockt der Atem, ich will nicht glauben, was ich da gerade sehe.
Meine Mutter wird am Haar gepackt, jemand wickelte es sich um die Hand und biegt ihren Kopf nach hinten.
Das Entsetzen spricht Bände in ihren Augen, ihren wundervollen vertrauten Augen, die ich so sehr an ihr liebe. Ein Augenblick lang sieht sie mich an, dann schreit sie auf und ihr Gesicht erstarrt. Ihr Hals ist bis zur Hälfte durchtrennt, das Blut schießt über den Boden und auch aus ihrem Mund.
Der Mann grinst dabei, als würde dieser Anblick ihm große Freude bereiten.
Es vergehen nur Sekunden, in denen mein Herz stirbt. Aber es erscheint mir wie eine Ewigkeit, als meine Mutter wie in Zeitlupe zu Boden fällt, um neben ihrem Mann Platz zu nehmen.
Durch den Aufschlag ihres Körpers dröhnt es in meinem Kopf, meine Gedanken überschlagen sich, mein Herz rast.
Ich reiße die Küchentür ganz auf und schreie so laut ich kann:
“Nein!!!!!“ aus Leibeskräften.
Zwei Männer, die ich vorher noch gar nicht bemerkt habe, schauen mich entsetzt an.
Der Mann mit dem Messer in der Hand lächelt mich an und sagt:
“Fangt den Jungen“.
Die zwei Männer zögern nur kurz und ich begreife.
Panische Angst treibt mich dazu, blitzschnell um mein Leben zu laufen.
Ich renne durch den langen Korridor, dann durch das Wohnzimmer, dicht gefolgt von den beiden, die mich zum Mörder meiner Eltern bringen wollen. Dann stürze ich durch die Seitentür hinaus in die Freiheit. Die Männer sind immer noch hinter mir her, mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich laufe blindlings über die Plantage, Blätter und feine Zweige peitschen mir durchs Gesicht. Mein Körper brennt, doch die schiere Angst treibt mich weiter und weiter. Nach ungefähr einer Stunde Laufen, als wäre der Leibhaftige hinter mir her, kann ich einfach nicht mehr. Völlig erschöpft sinke ich auf einen Felsen, dessen kalter Stein mein Gesicht kühlt.
Ich lausche ob mich noch jemand verfolgt, doch das einzige, was ich höre ist mein eigener Pulsschlag und mein heftiges Atmen. Mein kleines Herz schlägt mir bis zum Hals, mein Gesicht verzieht sich schmerzhaft.
Der kleine Bach neben mir plätschert vor sich hin, Vögel zwitschern lustig umher.
Ich schaue hinauf in die Baumkronen, die den Tag verdunkeln. Die Sonne trifft den Boden nur an wenigen Stellen, sodass der Wald auf einmal ganz unheimlich wirkt. Mein Gehirn schaltet sich so langsam wieder ein, das Grauen der letzten Stunde erscheint mir in Fetzen, wie in einer Endlosschleife. Ich kann meine Gedanken kaum sortieren, kaum glauben was geschehen sein soll. Mein Vater und meine über alle geliebte Mutter tot?
Das ganze Blut und das Entsetzen in den blauen Augen meiner Mutter. Ich sehe ihre weiße vornehme Haut, die übersät ist mit rotem Blut. Der Geruch des metallisch riechenden Blutes steigt mir in die Nase und ich fange an zu weinen.
Wieso hat dieser Mann meine Eltern so grausam getötet?
Ich schlage mich selbst, schlage mir immer wieder auf die Brust, um den Schmerz den ich empfinde zu bändigen. Krampfhaft denke ich nach, mein Gesicht verzerrt sich vor lauter Kummer. Ich schreie und weine, bin kaum noch dazu im Stande Luft zu holen.
Ich bewunderte meinen Vater so sehr, er war ein starker gutmütiger Mann.
Er liebte meine Mutter mehr als alles andere auf dieser Welt. Sie glich einem Engel mit dem goldblonden Haar. Ihrem lieblichen Lächeln, dass sie ihm immer wieder schenkte. Meine Herzschmerzen werden unerträglich, ich muss würgen. Laut schreie ich in den Wald hinein, ich bin doch noch klein und brauche meine Eltern. Ich fühle mich völlig hilflos, habe panische Angst, was soll ich jetzt tun?
Plötzlich überkommt mich das Gefühl verfolgt zu werden und ich renne los in die Wildnis.
Der Wille zu Leben treibt mich an, gibt mir die Kraft zu laufen. Meine Traurigkeit wandelt sich so langsam in Wut um und meine Tränen versiegen. Dieses Gesicht mit dem teuflischen Grinsen werde ich niemals vergessen, in meinem Herz macht sich Hass breit, so wie ich ihn nie zuvor gespürt habe.
Ich weiß genau, dass ich eines Tages zurückkommen werde um diesen Mann zu töten.
Doch dafür muss ich jetzt leben, darf mich nicht erwischen lassen.
In diesem Zustand laufe ich bis zur Stadtgrenze und hoffe, dass ich dort eine Lösung finden werde. Ich spüre, dass ich hier wegmuss, denn sie werden mich suchen. Der grausame Mann wird auch mich töten wollen, weil ich als Zeuge unmöglich weiterleben kann.
Ich durchquere die Stadt und stehe nun am Anfang des Hafens. Ich bin dreizehn Jahre alt, ärmlich gekleidet, habe kein Geld in der Tasche und bin auf der Flucht. Die Lage in der ich mich befinde scheint aussichtslos, ich muss hier aber unbedingt schnell weg. Aber wohin soll ich zu Fuß gehen, ohne dass man mich bald finden wird?
Es ist ein großer Hafen, in dem buntes Treiben herrscht. Die Spelunken sind auch tagsüber voller betrunkener Matrosen, die nur darauf warten, auf einem der Schiffe anzuheuern. Überall stehen Pferdewagen, Karren und andere Transportmittel bereit, um die Verladung von Land zu Schiff zu beschleunigen. Der Markt, der direkt am Pier liegt, wird von Händlern beherrscht. Hier werden die unterschiedlichsten Dinge aus den verschiedensten Ländern angeboten. Es ist ein Umschlagplatz für jedermann, somit laut, hektisch und gefährlich. Denn hier leben Menschen aus allen Himmelsrichtungen, die egal auf welche Art und Weise das schnelle Geld machen wollen.
Eine riesige Karre rattert über das schöne Kopfsteinpflaster und reißt mich aus meinen Gedanken. Ich sehe mich um, bemerke vor einem der vielen Anlegestellen einen alten Mann, der an einem riesigen Schreibtisch sitzt. Dort stehen einige Männer in einer Reihe und ich frage mich was da los ist. Der Mann, der am Tisch sitzt, ist sehr klein und rundlich, sieht mit seinem weißen Haar und der etwas zu großen Nase sehr freundlich aus. An seinem Tisch staut sich eine lange Reihe von Matrosen. Die anheuern wollen, um ihren monatlichen Lohn zu verdienen. Junge Bauern, die einfach nur dem Ländlichen entfliehen wollen und Abenteuerliche, die es in die weite Welt zieht. Ich bemerke, dass der kleine Mann am Tisch viele Männer am Tisch weiterschickt und mit dem Kopf schüttelt. Einige bleiben am Tisch stehen und füllen etwas aus. Für diejenigen, die nicht schreiben können, schreibt der kleine Mann. Ich weiß nicht wie mich so viel Mut packt, aber ich weiß genau, dass dieser Weg der einzige ist, um den Mördern meiner Eltern zu entkommen. Schnell gehe ich hinüber und stelle mich hinten in der Reihe an. Die Sonne steht hoch, es ist sehr heiß und das warten in der glühenden Hitze benebelt meine Gedanken zusätzlich.
Nervös trete ich von einem Bein auf das andere, schaue mich ständig um, habe Angst von diesen Mördern erwischt zu werden.
Vor einigen Stunden verlor ich meine Eltern, ich zwinge mich, nicht darüber nach zu denken. Mein Wunsch zu leben wächst fast bis ins Unermessliche, denn ich will nur noch eines und das ist Rache.
Die ganze Zeit denke ich darüber nach, was ich denn gleich sagen soll. Meinen vollen Namen werde ich auf keinen Fall nennen, damit ich meine Fährte verwischen und mich niemand verfolgen kann. Als ich mich wieder daran erinnere, was so eben geschehen ist, schnürt es mir den Hals zu, ich drohe zu weinen. Doch ich reiß mich zusammen, ich will mir vor all diesen Menschen keine Blöße geben. Außerdem muss ich auf dieses Schiff, ermahne mich, den Tränen nicht nachzugeben. Lord Harris von Hampshire, so ist mein Name.
Als ich vor dem kleinen Mann stehe, sage ich einfach nur „Trey“, so wie mein Vater mich immer liebevoll nannte.
Der kleine dicke Mann schaut mich misstrauisch an und fragt:
„Na? Wie alt bist du denn wohl?“ „Sechzehn Jahre“, lüge ich.
„Na, ja etwas schmächtig bist du noch, aber wir brauchen noch unbedingt einen Schiffsjungen. Heute ist dein Glückstag, aber sag mal, du reißt ja wohl nicht gerade von deinen
Eltern aus, oder was treibt dich hierher?“
Das tut weh, mein ganzer Körper spannt sich an und ich platze einfach mit der Sprache heraus.
„Nein ich laufe nicht davon, meine Eltern sind tot und nun, weil ich hier niemanden mehr habe, will ich auf dieses verdammte Schiff und hier weg.“
Das Leid spricht wohl Bände aus meinen Augen, der kleine dicke Mann reicht mir ein Blatt Papier und eine Feder.
„Schreibe hier dein Alter auf, deine Schiffskenntnisse und den Ort, an dem du dir vorgenommen hast von Bord zu gehen, falls du schreiben kannst.“
Ich zögere nicht eine Sekunde, ergreife die Feder und schreibe alles auf. Der alte Mann beobachtet mich dabei aufmerksam und denkt sich, dass ich wohl viel durchgemacht haben muss. Als Namen nenne ich nur Trey, Schiffserfahrungen habe ich so einige, denn ich fuhr viele Male mit meinem Vater zur See. Ich kann lesen, schreiben, bin gebildet, kann Reparaturen am Schiff durchführen und überhaupt bin ich schon jetzt hervorragend im Fechten. Ich blicke auf und gebe das beschriebene Blatt ab.
“Was soll ich jetzt tun?“
Der alte Mann schaut mir tief in die Augen.
Noch nie zuvor hat er in dem Gesicht eines jungen Mannes so viel Leid gesehen.
„Geh an Bord und melde dich bei einem kleinen dunkelhäutigen Mexikaner. Er heißt Diego, du wirst dir mit ihm eine Kajüte teilen. Ihr seid beide für die Reinigung und das Helfen in der Küche zuständig“.
Wehmütig drehe ich mich um und schaue ein letztes Mal zurück.
Dort, weit hinter den Plantagen liegen meine Eltern, tot, im eigenen Blut schwimmend.
Ich möchte am liebsten zurück, sie retten, meine Mutter vom Boden heben. Sie in die Arme nehmen, ihr zuflüstern, dass alles wieder gut werden wird.
Doch ich kann nicht, jetzt musste ich gehen.
Ohne zu wissen was mit meinen Eltern geschehen wird. Wann man sie finden wird und ob sie ein anständiges Begräbnis bekommen werden.
Eines weiß ich jedoch gewiss, ich werde zurückkehren, um den Mann zu finden, der mein Leben zerstört hat.
Meine Eltern rächen, um mit mir selber Frieden schließen zu können.
Als ich an Bord gehe, weiß ich nicht, dass diese die längste Reise meines Lebens werden wird.
London 1889
Es war ein düsterer Sonntagmorgen, als ich in der Kirche auf meinen Knien hockte und der Andacht lauschte. Mir flossen keine Tränen mehr über die Wangen, zu viele hatte ich bereits vergossen. Ich versank in Gedanken und erinnerte sich an meine Mutter, wie streng sie war und doch so gerecht. Ihre feste Hand verwies mich immer wieder in meine Schranken, wenn ich einmal von ihren wichtigen Anstandsregeln abwich.
Sie war immer bemüht aus mir eine echte Dame zu machen, die ich ja auch schließlich geworden bin. Wobei mir nur gelegentlich die nötige Disziplin fehlte. Ständig zappelte ich herum, wenn es angebracht war still zu sitzen, und immer wieder wurde ich von meiner Mutter beim Tratschen mit anderen Mädchen in meinem Alter erwischt.
Seit einem halben Jahr nun trug ich ein Korsett und Kleider, die hochgeschlossen waren, das ist hier ab einem gewissen Alter so üblich.
Mein Vater hingegen war viel gelassener, er sagte der Kleiderordnung, den Umgangsformen usw. zwar zu, aber er sah die kleinen Fehler, die ich machte, nicht. Er ließ mir jede nur erdenkliche Freiheit, die im Rahmen der Gesellschaft zugelassen war. Er machte Ausflüge mit mir und überhaupt verbrachte er viel Zeit damit, mich zu bilden. Wir spielten unter anderem oft Schach, ritten aus und sogar das Fechten brachte er mir bei. Meine Mutter hielt davon wenig, dass eine Dame mit einem Degen auf jemand anderes einschlug. Also blieben die meisten Fechtstunden geheim und meine Mutter wurde von meiner abenteuerlichen Wildheit verschont.
Mein geliebter Vater, den ich über alles liebte.
Ich erinnere mich noch genau daran wie alles anfing, es war Ende Oktober und die Regentage in London nahmen zusehend zu. Es wurde immer kälter, was ja eigentlich auch ganz normal war. Das Problem war allerdings in diesem Winter, dass zu viele neue Menschen in die Stadt gekommen waren, es zu wenig Arbeit und Unterkünfte gab. Die Kanalisation, die sowieso völlig veraltet und marode erschien, war nicht umfangreich genug. Es regnete unentwegt, die Wassermassen waren einfach zu viel und die Abflüsse schwappten an einigen Stellen über. In den Straßenrinnen schwammen Fäkalien und Parasiten verbreiteten sich in Windeseile. Es dauerte nicht lange und die ersten Krankheiten streiften umher, am schlimmsten war der Typhus.
Er breitete sich aus wie ein riesiger Waldbrand. Die obdachlosen Menschen fielen in den Straßen zu Boden und starben.
Es waren zu viele, der Boden war gefroren und es fiel den Menschen schwer, die Leichen zu begraben.
Die nicht erkrankt und nicht zu schwach waren, wollten nicht helfen, aus Angst sich anzustecken. Es war grauenhaft, die Krankenhäuser waren überfüllt und das Personal völlig erschöpft. Jeder versuchte, sich fern von den anderen zu halten, um sich nicht anzustecken. Die Menschen blieben aus Angst zu Hause und es schlich sich eine gewisse Anonymität ein.
Man versuchte die Situation zu retten, verbrannte Leichen und räucherte Wohnungen aus. Überall lag der Geruch von Verwesung und verbranntem Fleisch in der Luft.
Auch meine Eltern wurden krank, ich pflegte sie die ganze Zeit, Tag und Nacht. Alles tat ich um meinen Eltern zu helfen, ich ging ins Krankenhaus und bettelte um Medikamente. Ich wusste, dass die Zustände dort katastrophal waren, die Überlebenschance sehr gering, also pflegte ich meine Eltern zu Hause. Hier hatten sie eine vertraute und saubere Umgebung, es pflegte sie jemand, der sie liebte.
Doch all meine Bemühungen halfen nichts, sie starben. Zuerst starb meine Mutter, sie war so abgemagert und quälte sich so herum, dass ihr Tod eine Erlösung waren. Ich glaubte, dass mein Vater den Virus überlebt hätte, er war ein sehr starker Mann. Doch die Tatsache, dass er seine Frau so hat leiden und sterben sehen, riss ihn einfach mit in den Tod. Er konnte unmöglich ohne seine Frau weiterleben. Ich freute mich zwar über die große Liebe, die meine Eltern miteinander verband.
Jedoch zerriss es mich auch zu sehen, dass mein Vater lieber der Frau in den Tod folgte, als bei mir im Leben zu bleiben.
Ruckartig erwach ich aus meinen Gedanken, als alle um mich herum aufstehen, um das „Vater unser“ zu beten. Ich stehe auch auf, bete aber nicht, ich kann einfach nicht. Dass ich auf die Leichen meiner Eltern starren muss, schnürt mir einfach die Kehle zu. In meinem Kopf hämmern Schmerzen, die ich wohl den vergangenen Nächten zu verdanken habe, in denen ich ständig weinte und im Selbstmitleid versank. Ich habe mich schon vor dem Gottesdienst in einer ruhigen Minute von meinen Eltern verabschiedet. Und sehe somit tatenlos zu, wie acht Diener in die Kirche kommen um die zwei Särge zu schließen. Sie werden zu ihrer letzten Ruhestätte getragen und ich folge ihnen über den Friedhof mit letzter Kraft.
Nur Jannice, meine beste Freundin, ist da um mich zu trösten, die mir zur Seite steht und mich fest im Arm hält. Als wir da sind, schau ich mir die Särge noch einmal an, sie sind einfach und schlicht aus Buchenholz geschnitzt.
Unter normalen Umständen hätte ich mir schönere Särge für meine Eltern gewünscht, aber im Moment werden so viele Särge benötigt, dass es unmöglich ist irgendwelche Wünsche zu äußern. Dafür ist es aber eine wunderschöne Gruft, in die sie gebettet werden. Es ist die Familiengruft, in der auch meine Großeltern liegen.
Der Stein der Gruft ist elfenbeinweiß und sieht aus wie ein griechischer Tempel, in der eine kleine Mutter Gottes kniet. Die beiden Särge werden in die Gruft hineingetragen und der Pfarrer hält noch eine letzte kleine Rede. Ich habe eine ältere Dame engagiert, die das Ave Maria für die beiden spielt, meine Stimmung sinkt dabei auf den absoluten Nullpunkt.
Nun weiß ich, dass ich niemanden mehr auf der Welt habe, ich bin jetzt ganz allein. Der Pfarrer und auch die letzten Trauergäste sind bereits gegangen. Auch Jannice habe ich weg geschickt mit der Bitte, ein bisschen alleine sein zu können. Ich setze mich auf eine kleine Bank, die unter der Trauerweide direkt neben der Gruft steht.
Der Baum sieht so aus als würde er Wache halten. Ein zügiger Wind streift die Trauerweide, die langen Zweige wiegen sich hin und her. Die Gruft wird verschlossen, ich werde meine Eltern nie wiedersehen.
Mein Herz verkrampft sich vor Traurigkeit, ich lasse meinen Tränen freien Lauf. Was soll ich nun tun? Ich habe niemanden mehr, ich bin nun ganz allein. Angst macht sich in meinem Körper breit, ich fang an zu zittern. Ich muss fürchterlich Weinen, mein Hals schmerzt von den tagelangen Anstrengungen.
Dann erinnere ich mich an die letzten Worte meines Vaters:
„Sei stark und gib dich niemals auf, egal was passiert oder man dir antut.“
Ich steh auf und schaue in den Himmel, der Wind peitscht mir durch mein Gesicht und ich schwöre mir beim Tod meiner Eltern stark zu sein. Ich werde mich nicht zurückziehen, meinen Vater nicht enttäuschen und im Selbstmitleid versinken. Nein, ich will mit viel Stärke und Selbstbewusstsein durch mein Leben gehen.
London 1891
„Sie ist eine schöne Frau geworden“ denkt sich Emma, als sie Chantal über den Marktplatz schlendern sieht.
„Guten Morgen Chantal.“
Ich blicke auf und lächele, ich sehe zwar noch nicht, wer mich da gerade anspricht, aber diese Stimme kenne sie sehr gut.
„Guten Morgen Emma, wie geht es dir denn so?“
Die kleine dicke Bauersfrau ist stets um mich bemüht und guter Laune, ich mochte Emma schon immer sehr gerne.
“Ach ganz gut, da der Frühling jetzt da ist, fühlen sich meine alten Knochen viel besser an. Und du, wie geht es dir?“ „Ich bin zufrieden, mein Haus ist jetzt endlich fertig renoviert.
Zurzeit lerne ich sehr viel, bald habe ich auch meine Stunden in Fremdsprachen abgeschlossen.“
„Aber Chantal, was soll denn das alles eigentlich?“
„Wie meinst du das?“
„Also, du bist doch noch so jung und hübsch dazu. Wieso vergräbst du dich eigentlich so sehr in deine Arbeit? Es gibt doch noch andere Dinge im Leben die Spaß machen.“ Sofort muss ich lachen, denn ich weiß, dass mir nun wieder einmal eine Standpauke droht.
„Etwas Wichtigeres im Leben als zu lernen? Wichtiger als sein Leben in die Hand zu nehmen und etwas zu werden?
Sich einen Platz in der Gesellschaft zu erarbeiten?“
„Oh Gott, Chantal! Ja, aber natürlich, sieh dich doch an. Ich kenne dich nun wirklich schon seitdem du ein kleines Mädchen warst. Du warst immer sehr fröhlich und aufgeweckt und jetzt bist du zu fast jedermann verschlossen. Du gehst ja nur noch am Samstag aus deinem Haus, um hier auf dem Markt deine Einkäufe zu erledigen.“
„Das ist nicht wahr Emma, ich besuche die Schule.“ Ich werde abrupt unterbrochen.
„Ja das ist ja was ich meine, du kennst nichts außer zu lernen. Du gehst zu keinerlei gesellschaftlichen Ereignissen. Und sieh dir dein Kleid an, bekommst du eigentlich noch Luft unter diesem engen Korsett und dem steifen Stehkragen?“ jetzt werde ich puterrot im Gesicht und schnappe hektisch nach Luft. Ich gelange immer wieder in Verlegenheit, wenn Emma eine solche plumpe und direkte Aussage macht. Obwohl ich die Bäuerliche Umgangssprache von Emma ja schon längst gewohnt sein müsste, ärgere ich mich immer wieder so sehr, dass mein Blut bis in den Kopf steigt. Zumal dieser Umstand Emma immer wieder zu amüsieren scheint.
„Also, Emma, ich möchte doch wirklich bitten. Die Kleider, die ich trage, sind äußerst respektabel, so ist eine junge Dame nun mal gekleidet.“
Emma lacht von ganzem Herzen, sie schmeißt ihren Kopf dabei nach hinten und reißt ihren Mund weit auf. Ihr Doppelkinn verteilt sich dabei rund um ihren Hals, ihre Brüste wippen ebenfalls amüsiert hoch und runter. Irgendwie erinnert Emma mich an ein Spanferkel. Aber das würde ich ihr niemals sagen, denn nach dem Tod meiner Eltern hat Emma sich liebevoll um mich gekümmert. Ich fühlte mich geliebt und nicht so allein auf dieser Welt:
„Also, Kindchen, diese Zeiten sind nun wirklich vorbei. Alle Damen in deinem Alter tragen andere Kleider. Aus Frankreich kommen die herrlichsten Kleider in den schönsten Farben und Schnitten. Sogar deine Freundin Jannice ist besser gekleidet als du.
Sie ist außerdem so aufgeweckt und frech, du solltest dir ruhig eine Scheibe von ihr abschneiden. Du in deinem ewig fröhlichen Grau, ich bitte dich Chantal. Versteck dich nicht hinter der Tatsache, dass du keine Familie mehr hast. Das Leben geht weiter, auch für dich. Außerdem hast du ja auch noch mich. Und außerdem brauchst du ja auch noch einen Mann, der...“ Jetzt bin ich sauer, wie kann sie es wagen? „Jetzt reicht es mir aber, Emma, ich bin selbstständig, unabhängig und einen Mann brauch ich ganz bestimmt nicht. Ich kann durchaus für mich selbst sorgen!“
Erstaunt über meinen Wutausbruch entschuldige ich mich.
„Es tut mir leid, aber seit dem Tod meiner Eltern habe ich viel mitgemacht. Man wollte mir mein Haus nehmen, mir den Mund verbieten, nur, weil ich eine Frau bin. Und wenn der Bäckersohn Clark mir nicht zur Hilfe gekommen wäre, dann würde ich bestimmt schon lange verrottet in der Themse liegen.“
Emma hört mir mit gesenktem Kopf zu und weiß genau, dass ich Recht habe.
“Ich wollte dir bestimmt nichts Böses, ich weiß ganz genau was du schon alles mitgemacht hast. Aber ich kannte deine Mutter schon von klein auf an, seitdem sie tot ist, fühle ich mich dir sehr verpflichtet. Ich selbst habe keine Kinder und du weißt genau, dass du das größte Glück in meinem Leben bist. Bitte vergeude deine Jugend nicht zu sehr und öffne dich auch anderen Menschen, auch dein Vater hätte das so gewollt.“
Chantal nickte stumm und die beiden nahmen sich eine kurze innige Zeit in die Arme. Sie hatte einfach keine Lust, über Kleidung oder Männer nachzudenken.
„Danke Emma, ich weiß das zu schätzen, es ist nur alles so verwirrend, bitte sei mir nicht böse.“
Dann gab sie Emma noch einen Kuss auf die Wange und verabschiedete sich von ihr. Ohne Emma die Chance zu geben noch etwas zu sagen, drehte sie sich um und bewegte sich heimwärts.
Sie musste quer über den Markt und drängte sich durch Menschenmassen. Es war ein sehr bunter freundlicher Markt, der von Bauern beherrscht wurde. Hier gab es immer etwas Neues zu sehen und nach all den Jahren gab es auch keine Hinweise mehr auf den schrecklichen Winter, in dem ihre Eltern starben. In Gedanken versunken bewegte sie sich weiter und hörte den ganzen Lärm auf dem Markt nur noch wie durch eine Seifenblase.
Als sie den Marktplatz verließ, sich durch die zahlreichen engen Gassen bewegte, sprang ganz plötzlich eine junge Dame vor sie und lachte sich kaputt.
„Oh Jannice, bist du von allen guten Geistern verlassen? Du hast mich fast zu Tode erschreckt!“ Bei diesem Satz gab Chantal ihrer Freundin einen leichten Klaps auf den Arm.
„Chantal, Hallo wie geht’s? Mir geht es fantastisch. Wo warst du eigentlich? Und sag mal, wo willst du eigentlich so eilig hin?
Ach, du ahnst ja nicht, was mir so eben passiert ist.
Soll ich es dir erzählen? Weißt du wer der...“
„Jannice! Welche Frage soll ich denn zuerst beantworten?
Holst du denn nie Luft zwischen den Fragen, mit denen du gerade jemanden bombardierst? Du bist unmöglich.“ Die beiden schauten sich einen kurzen Augenblick an und dann redete Jannice wie immer ununterbrochen einfach weiter.
„Ja, ja Chantal, jetzt hör mir doch mal endlich zu!“ „Wie bitte?“ Chantal war sichtlich angespannt.
„Chantal, dies ist der wichtigste Tag in meinem Leben, jetzt hör auf mir auf die Nerven zu gehen und hör endlich zu.“
„Also gut, was ist denn so wichtiges passiert?“ fragte Chantal resignierend.
„Du wirst es mir nicht glauben, aber Roy Huksley hat mich heute beim Tanzunterricht gefragt, ob ich ihn zum Ball begleiten werde.“ „Wer ist Roy Huksley?“
„Du kennst ihn nicht? Jedes Mädchen der Stadt schwärmt von ihm. Und du kennst ihn nicht?“
„Na ja vielleicht, aber was für einen Ball meinst du eigentlich?“
„Oh, Chantal Events. Willst du mir jetzt wirklich weiß machen, das du nicht weißt, von welchem Ball ich gerade spreche?“
Chantal sah Jannice belustigt an, während diese einfach weiter schimpfte, ohne zu bemerken, dass Chantal sich köstlich amüsierte. Jannice war ein sehr attraktives Mädchen und sie sah so wunderbar gefährlich aus, wenn man sie aus der Fassung brachte. Mit ihrem offen getragenen Haar und ihren grünen Augen sah sie aus wie eine Wildkatze. Auch ihr unbändiges Temperament, das dann und wann mit ihr durchging, sprach für sie. Diese Frau brachte es fertig, Chantal den ganzen Weg nach Hause zu begleiten und dabei ohne Pause auf sie einzureden. Jannice bemerkte manchmal gar nicht, dass Chantal ihr gar nicht richtig zuhörte.
„Jannice wir sind da.“
„Wo?“
„Bei mir zu Hause oder hast du in deinem eifrigen Getratsche überhaupt nicht mitbekommen, dass wir zu mir gegangen sind?“
„Eh? Ja! Natürlich habe ich das bemerkt.“ Chantal schenkte ihr ein hämisches Lächeln.
„Was soll dieses verfluchte Grinsen? Du weißt ganz genau, wie sehr ich es hasse, wenn du mich so bemutternd ansiehst.“
„Du sollst nicht ständig so fluchen, das gehört sich nicht für eine Dame!“
„Ist mir egal, gehen wir nun herein oder soll ich auf deiner Veranda Wurzeln schlagen?“
„Jannice du bist einfach unverbesserlich.“ Chantal hatte ein wunderschönes Haus. Als ihre Eltern starben, verkaufte sie die große Villa, um sich von all den alten Erinnerungen zu trennen und ließ sich dafür ein süßes kleines Spitzdachhaus bauen. Es war von außen wie ein Fachwerkhaus verarbeitet mit roten Ziegelsteinen und weiß lackiertem Holz. Das Haus war klein aber sehr chic, wobei die mit Blumen besetzte Veranda sehr an ein Märchenhaus erinnerte.
„Möchtest du Tee?“, fragte Chantal und bot ihrer Freundin Platz zu nehmen.
„Ja gerne, hast du vielleicht auch etwas Gebäck?“ Chantal hörte die Frage nicht mehr, weil sie schon in der Küche verschwunden war. Nun setzte Jannice sich auf die Couch und bewunderte wie immer das Inventar. Chantal hatte damals beim Verkauf des Hauses einige Möbelstücke und Porzellan sowie alle persönlichen Dinge behalten. Die Couch, auf der Jannice gerade saß, war eine mit rosa Samtstoff bezogene Chippendale Garnitur. Sie bestand aus Mahagoni, sowie der dazu passende Tisch und die Schränke auch.
Die Intarsien, die den Schrank zierten, waren elfenbeinweiß und wunderschön. Chantal hatte ihr Wohnzimmer wirklich stilvoll eingerichtet. Das Deckenlicht war eine kostbare Porzellanlampe, Chantals Eltern mussten ein Vermögen dafür ausgegeben haben. Rechts neben der Couch stand ein Sekretär, der voll beladen mit Büchern, Papierstücken, Tinte und Federn war. Jannice liebte dieses Zimmer, es strahlte mit dem Kamin in der Mitte Gemütlichkeit und Ruhe aus. Chantal kam mit Gebäck und Tee herein.
„Oh lecker.“ Jannice sprang auf und nahm sich ein Stück Gebäck.
„Sag mal, kannst du eigentlich nicht warten? Wenigstens bis ich mit dem Tablett am Tisch angekommen bin?“ Jannice ging überhaupt nicht auf die Frage ein.
„Sag mal kennst du Roy wirklich nicht?“
Chantal schnaubte leise vor sich hin.
„Doch ich kenne ihn und so schön ist er nun wirklich nicht. Außerdem ist er ein kleiner Rüpel. Er stammt zwar aus gutem Hause, ist aber ständig in Raufereien verwickelt.“ „Das ist es ja, er wirkt auf mich so gefährlich und seine kalten blauen Augen machen mich noch wahnsinnig. Immer wenn er mir über den Weg läuft, habe ich so ein erdrückendes Gefühl im ganzen Körper und bin ziemlich nervös. Bei einer Begegnung mit ihm auf dem Markt habe ich sogar meinen Einkaufskorb fallen lassen.“
„Das ist doch nicht dein Ernst?“
„Doch, ich glaube sogar, dass ich ihn liebe.“ Chantals Wangen röteten sich langsam aber sicher.
„Jannice, es ist unsittlich in deinem Alter von so etwas zu sprechen.“
„Ich bin achtzehn Jahre alt und in drei Jahren gelte ich als Erwachsen, außerdem brechen neue Zeiten an. Und ich habe es ja auch nur dir erzählt und nicht Roy persönlich. Ich habe auch nicht vor ihn nächste Woche zu heiraten.“
„Wie kannst du eigentlich behaupten, dass du ihn liebst? Du hast dich doch gerade erst mit ihm unterhalten.“
„Na und! Bitte versteh mich doch, wenn ich ihn sehe, durchflutet mich so ein Gefühl von Angst und Freude. Mein Magen krampft sich zusammen und mein Herz schlägt mir bis zum Hals.“
“Ich verstehe dich nicht, wie kannst du deinen Gefühlen überhaupt so freien Lauf lassen? Beängstigt dich das nicht?“
„Nein, und du solltest mal so langsam damit anfangen auch andere Menschen in dein Leben zu lassen. Sei doch nicht immer so schrecklich steif und konsequent.“ Chantal überlegte kurz.
„Vielleicht hast du ja Recht, aber für die Liebe bist du auf jeden Fall noch zu jung.“ Gerade wollte Jannice protestieren, da klopfte es unerwartet an ihrer Haustür.
„Chantal, wer ist das?“ fragte Jannice.
„Ich weiß es nicht.“ und schritt zur Tür.
Als sie diese öffnete, stand ein Bote davor und fragte:
„Sind sie Mrs. Chantal Evants?“ Chantal nickte und nahm einen Brief entgegen. Der Bote drehte sich um und wünschte noch einen angenehmen Tag. Als Chantal die Tür ins Schloss fallen ließ schaute sie dabei ungläubig auf den Umschlag.
„Was ist? Von wem ist der Brief? Ist es ein Verehrer? Nun mach es nicht so spannend“, sagte Jannice zu ihr und gebot ihr dabei mit einer Handbewegung sich zu ihr auf die Couch zu setzen.
„Von Phillip Anthony Evants“ antwortete sie und starrte weiter auf dem Briefcouvert.
„Wer zum Teufel ist das? Und wieso trägt er den gleichen Familiennamen wie du?“ Chantal achtete nicht auf die Ausdrucksweise ihrer Freundin und antwortete schlicht.
„Mein Onkel. Der Bruder meines Vaters.“
„Was? Wieso? Was für ein Onkel? Du hast doch gar keine Verwandtschaft! Das ist ein Hochstapler, was will er denn von dir?“
„Oh Gott Jannice, jetzt hör doch mal für eine Minute auf zu reden, du machst mich noch ganz verrückt.“
Nach einer kurzen Stille im Raum sagte Chantal: „Doch ich habe einen Onkel, ich wage mich daran zu erinnern, dass mein Vater einmal von ihm gesprochen hat.“
„Und wieso kennst du ihn nicht? Oder warum hast du nie von ihm erzählt?“
„Weil ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen habe und weil ich völlig vergessen habe, dass dieser Mann überhaupt existiert. Ich meine, dass mein Vater einmal ganz kurz mit meiner Mutter über ihn gesprochen hat. Aber als ich den Raum betrat schwieg mein Vater sofort, ich sollte rausgehen. Aus irgendeinem Grund sollte ich wohl nichts von der Existenz meines Onkels wissen.“
„Nun mach schon den Brief auf,“ drängte Jannice. Und Chantal tat nach kurzem, was ihre Freundin ihr Befahl. Sie überblickte den Brief, er war kurz und bündig.
„Was steht denn im Brief Chantal?“ Chantal war völlig verstört und kam kaum mit der Sprache heraus.
„Da steht, dass er mein Onkel ist.“
„Toll, so weit war ich auch schon. Was will er denn von dir?“
„Es tut ihm leid, dass er sich noch nie bei mir vorgestellt hat. Er schreibt auch, dass sein Bruder es nicht für so wichtig empfand mich ihm vorzustellen.“ Chantal runzelte die Stirn, schüttelte den Kopf und schaute ihre Freundin fragend an.
„Das kann doch nicht sein. Wieso sollte mein Vater es nicht für nötig halten, mich seinem eigenen Bruder vorzustellen?“
„Vielleicht mochten dein Vater und sein Bruder sich nicht besonders gut und haben deshalb den Kontakt zueinander abgebrochen.“
„Das glaube ich einfach nicht, mein Vater konnte mir doch nicht einfach verbergen, dass er einen Bruder hatte. Da stimmt doch etwas nicht, irgendetwas Schreckliches muss passiert sein.“
„Allem Anschein ist es so Chantal! Lies doch endlich weiter.“
„Mein Gott Jannice, er hat mir geschrieben, weil er vom Tod meiner Eltern gehört hat.“
„Wieso schreibt er dann erst jetzt? Nach über zwei Jahren?“
„Sei nicht so taktlos, vielleicht war der Brief ja so lange unterwegs.“
„Ja klar! Was denkst du denn, wo der Brief wohl herkommt?“
„Sieh nur, er kommt aus Amerika, Kalifornien. Wie konnte mein Onkel das überhaupt erfahren?“ Chantal war total nervös, sie zitterte so sehr, dass ihr der Brief aus den Händen fiel. Jannice bückte sich sofort, um den Brief wieder aufzuheben. Mit einem liebevollen zur Seite schieben bat sie ihre Freundin, sich wieder zu setzen.
„Also, jetzt sei bitte nicht so nervös, du bekommst sonst gleich noch einen Herzinfarkt. Ich lese jetzt erst mal für dich weiter.“
Jannice überflog das Papier und schaute Chantal an, die immer noch völlig verwirrt aus der Wäsche schaute.
„Chantal hörst du mir überhaupt zu? Er möchte dich kennen lernen. Er lädt dich zu sich nach Hause ein und möchte dich seiner Ehefrau und seinem Sohn vorstellen.“ Jannice machte eine kurze Pause.
“Er hofft, dass du eines Tages zu ihm ziehst.“
„Was? Das ist doch wohl nicht sein Ernst. Ich kann doch unmöglich nach Kalifornien auswandern. In ein Land, das ich gar nicht kenne, zu einem Mann, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Dieser Mann muss völlig verrückt sein.“
„Aber er ist immerhin dein Onkel!“
„Na und? Willst du mir damit etwa sagen, dass ich dieser Einladung folgen soll?“ Chantal erboste, sie wurde richtig aufbrausend und schrie Jannice an.
„Wieso hat dieser vorsorgliche Onkel sich dann vorher nie bei mir gemeldet? Sich um mich gekümmert, als ich ihn brauchte?
Nach dem Tod meiner Eltern?“
„Du siehst doch anhand des Briefes, wie spät er von dem Tod deiner Eltern gehört hat. Selbst wenn er sofort aufgebrochen wäre, dann wäre er auch erst heute hier eingetroffen.“ Chantal beruhigte sich wieder und bereute den Wutausbruch ihrer Freundin gegenüber.
„Es tut mir leid, aber ich kann doch nicht einfach von England weggehen. Nein, dafür liebe ich meine Heimat viel zu sehr.“
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du hier für immer weggehen sollst. Ich glaube aber, dass dir eine Reise sehr gut tun würde. Außerdem ist es ja wohl deine verdammte Pflicht, deinen einzigen Verwandten zu besuchen, wenn der dich einlädt. Ich weiß überhaupt nicht, was dich davon abhält? Du hast genug Geld, um es dir leisten zu können und um dein Haus würde ich mich schon kümmern.“ Jannice nahm Chantals Hand und schaute sie freundschaftlich an.
„Siehe mich bitte nicht so bemitleidend an.“
„Das mache ich ja auch gar nicht, aber ich finde, du solltest die einzige Chance nutzen, um deinen Onkel kennen zu lernen.
Du kannst ja wieder zurückkommen. Ich habe ja nicht gesagt, dass du da mit deiner Stehlampe einziehen sollst.“ Chantal lachte über Jannice Ausdrucksweise.
„Und meine Schule? Was ist mit meinen ganzen Prüfungen? Ich bin noch lange nicht fertig, außerdem...“
„Chantal! Jetzt denk doch mal an etwas Anderes und nicht immer nur an deine blöde Schule. Deine blöden Prüfungen kannst du auch später machen. Und außerdem weißt du wie lang so eine Schiffsreise werden kann? Du hast dort alle Zeit der Welt zum Lernen.“
„Also jetzt unterlass es bitte, ständig auf mich einzureden, so etwas kann man doch nicht einfach von der einen zur anderen Minute entscheiden. Und überhaupt könntest du mal endlich mit deinen blöden Ausdrücken aufhören, die brauche ich ganz bestimmt nicht.“
Jannice ging wie immer überhaupt nicht auf ihre Ermahnungen ein.
„Wieso kann man so etwas denn nicht einfach so entscheiden? Es ist doch dein Onkel?“
„Na weil man sich so was genau überlegen muss.“
„Und warum?“
„Weil, Jannice! Jetzt stell nicht so ungezogene Fragen! Du könntest das auch nicht einfach so entscheiden.“
„Doch, wenn ich keine Familie hätte und die Zeit so wie du.
Dann würde ich selbstverständlich eine wunderschöne Reise machen um meinen Onkel zu besuchen. Das ist doch gar keine Frage, du musst da einfach hinfahren, wenn dein Onkel dich einlädt. Was hast du denn vor? Willst du ihm etwa mitteilen, dass du weder Zeit noch Lust oder Angst hast ihn kennen zu lernen?“ Jannice trat Chantal mit einem herausfordernden Blick entgegen und stemmte die Hände in die Hüften.
Chantal lächelte ihre Freundin liebevoll an. Das waren die Eigenschaften, die ihr so gut an ihr gefielen. Sie war so was von aufbrausend und bestimmend so wie Chantal es noch bei keiner anderen Frau gesehen hat.
„Wieso grinst du mich jetzt wieder so an.“
„Du hast wahrscheinlich Recht, ich habe keine andere Wahl. Ich werde wohl fahren müssen, doch ich habe ganz schön Angst vor dieser Reise.“
„Du wirst es wohl überleben und du kommst ja auch bald wieder zurück nach Hause.“
„Ja, ja ich weiß, ich werde auch nicht gleich in Tränen ausbrechen. Irgendwie freue ich mich ja auch auf die Reise.
Und schließlich habe ich ja dann auch jemanden, mit dem ich eine Familie bilde.“
Chantal und Jannice blieben noch den ganzen Abend zusammen. Sie aßen Gebäck und tranken den guten alten englischen Tee, den sie beide so sehr schätzten. Bis spät in den Abend sprachen sie nur über das eine Thema. Wie der Onkel wohl sein mochte, wie lang die Fahrt dorthin wohl wäre und was es alles zu organisieren, einkaufen und zu packen gab. Der Gesprächsstoff der beiden war unerschöpflich.
Als Chantal abends endlich allein war und in ihrem Bett lag, träumte sie von dem sonnigen Kalifornien und der wunderbaren Landschaft, die sie aus Büchern kannte.
Eine Woche war nun vergangen, seitdem Chantal den Brief bekommen hatte. Nachdem sie den Entschluss gefasst hatte, diese unglaubliche Reise anzutreten, war ihr nicht bewusst, wie viel Arbeit damit verbunden war. Sie ging zum Hafen und reservierte sich einen Platz auf einem Schiff, das angemessen für eine Dame war. Chantal freute sich von Tag zu Tag mehr, sie war richtig aufgeregt. Sie packte ihre komplette Garderobe in riesige aus Mahagoniholz geschnitzte Holztruhen. Eine weitere Truhe diente den Lebensmitteln, die sie mit auf die Reise nehmen wollte, da die Versorgung auf solchen Schiffen im Allgemeinen sehr schlecht war. Also packte sie reichlich gepökelte Fleischstreifen, Zwieback und den feinen englischen Tee ein, den sie nirgendwo vermissen wollte.
Zusätzlich packte sie jede Menge getrockneter Weintrauben, Apfelscheiben und Pflaumen sowie Honig, Mehl, Zucker und ja sogar Medikamente durften nicht fehlen. Nun ging es darum, sich bei all ihren Bekannten und Freunden zu verabschieden. Es hatte sich schon längst herumgesprochen und jedermann wusste, wohin Chantal reisen wollte und zu wem. Sie verabschiedete sich von ihrer lieben Freundin Emma, die sich wie immer Sorgen um Chantal machte und ihr mindestens einhundert Ratschläge für die bevorstehende Reise gab. Auch in der Schule verabschiedete sie sich von ihren Studienkameraden und Lehrern. Und natürlich von ihren Nachbarn und all den bekannten Gesichtern auf dem Markt.
Der Tag war da, auf den sie die letzten Wochen hingearbeitet hatte.
Fertig mit allen Dingen saß sie nun in ihrem Garten auf einer kleinen Bank und wartete auf ihre Freundin Jannice, die wirklich zu jedem Anlass zu spät kam. Wartend, in Gedanken versunken genoss sie die ersten Sonnenstrahlen, die wohl den Sommer ankündigten. Ihr gingen viele Dinge durch den Kopf, wie ihr Onkel wohl wäre und wie es dort wohl sein würde? Sie stellte sich alles bildlich vor, wie sie am Hafen ankommen würde und wie ihr Onkel sie in Empfang nahm. Es war für sie immer noch kaum vorstellbar, dass sie einen Onkel haben sollte. Aber sie freute sich so riesig, das sie kaum einen Gedanken zu Ende bringen konnte.
„Chantal!“ rief Jannice völlig außer Atem, weil sie das letzte Stück von der Kutsche bis zu ihrem Haus gelaufen war.
„Komm schon, sitz da nicht so langweilig herum, sonst verpasst du noch dein Schiff.“ Mit diesen Worten nahm sie Chantals Handgepäck von der Bank hoch.
Chantal funkelte Jannice wütend an.
Wie bitte? Du wagst es mich langweilig zu nennen? Nachdem du zehn Stunden zu spät bist?“
„Eh Stunden? Jetzt übertreibst du aber ein bisschen.“
„Na dann eben eine Stunde. Aber wegen dir verpasse ich noch mein Schiff! Und wieso kommst du eigentlich immer, aber auch immer zu spät?“
„Mein Gott, dass du aber auch immer so maßlos kleinlich sein musst, jetzt steh lieber auf und setz dich in Bewegung.
Wir haben es eilig.“ Chantal war von Jannice Art und Weise immer wieder überrumpelt worden und tat dann einfach was sie ihr sagte. Sie hatte ja schließlich Recht, jetzt war wirklich nicht der richtige Zeitpunkt zum Streiten. Somit gingen die beiden jungen Mädchen zur Kutsche, wo der Fahrer ihnen zur Hilfe kam, um die schweren Koffer auf das Dach zu packen. Sie baten den Kutscher so schnell wie möglich zu fahren, um die verloren gegangene Stunde noch einzuholen.
Die Kutsche polterte grässlich hart über die unebene Straße an der Küste entlang, die beiden mussten sich gut festhalten um nicht durch den Wagen geschleudert zu werden. Als es über die etwas sanfteren Sandwege und die letzten Hügel ging machte Chantal ihrer Freundin Vorwürfe. Es sei nur ihre Schuld, wenn sie morgen mit blauen Flecken übersät wäre.
Jannice lachte leise und schaute aus dem Fenster. „Weißt du dass ich dein Gejammer ganz schön vermissen werde?
„Wie bitte?“
„Na dich, ich werde dich ganz schön vermissen. Dein Gezeter wird mir ganz schön im Leben fehlen.“

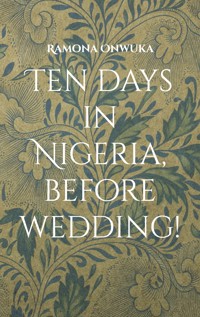














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












