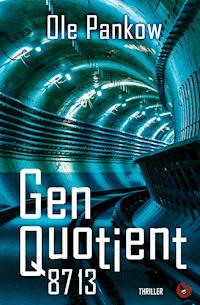
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Bombenanschlag auf eine Berliner U-Bahn mit vielen Todesopfern und Verletzten versetzt die Stadt in Schockstarre. Doch wer ist dafür verantwortlich? Linda Hawkins, Leiterin einer amerikanischen Sondereinheit, hat den Islamischen Staat in Verdacht. LKA-Hauptkommissar Konrad Berger ist dagegen überzeugt, dass militante Umweltaktivisten dahinter stecken. Nur Ex-Kommissar Doering bemerkt die fragwürdigen Lücken in den verschiedenen Theorien und versucht sie zu schließen. Doch mit jeder neuen Erkenntnis erhärtet sich ein Verdacht, der ihn erschaudern lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Meinen Eltern (†)
periplaneta
Ole Pankow: „Genquotient 8713“ 1. Auflage, Dezember 2017, Periplaneta Berlin, Edition Totengräber
© 2017 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Zitat: Raymond Chandler: “Lebwohl, mein Liebling”, 2009, Diogenes Verlag, Seite 177
Lektorat: Sarah Strehle (www.lektorat-strehle.de) Cover: Alexander Sager (orig.pic by Sved Oliver, powered by fotolia.com) Satz & Layout: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-95996-077-9 epub ISBN: 978-3-95996-078-6
Ole Pankow
Genquotient 8713
Thriller
periplaneta
Januar 2013 New York-K-001
Kanzlei “Rechtsanwälte & Notare – Kramer, Young & Stevenson”
Garfield Place, Brooklyn
„Sind Sie bereit, meine Damen und Herren?“
„Fangen Sie endlich an!“
„Also gut. Nachdem die Formalitäten erledigt sowie die Anwesenden notiert und aufgeklärt sind, verlese ich jetzt den Letzten Willen von Sir Arthur T. Sullivan, geboren am 23. März 1923 in Berlin, New Hampshire, verstorben am 2. Dezember 2012 in Westhampton, New York:
Ich setze den von meiner Tochter Anne Sullivan gegründeten Verein ,El Mundo Verde‘ als meinen Alleinerben ein. Gebunden daran sind folgende Bedingungen: Meine Aktien, mein Grundbesitz sowie alle meine Immobilien sollen weiter gewinnbringend bewirtschaftet oder angelegt werden. Diese Aufgabe übertrage ich der oder den Personen, diemeinen Letzten Willen vortragen. Dazu habe ich bereits zu Lebzeiten einen Fonds angelegt, der die Finanzierung dieser Arbeit auf unabsehbare Zeit absichern wird. Das vorhandene Barvermögen sowie das Ertragskapital der vorgenannten Eigentümer darf, nach Abzug der laufenden Kosten für deren Unterhalt, sofort und fortlaufend für die dem Verein dienlichen Zwecke verwendet werden. Die Ziele des Vereins sind im Gründungsprotokoll desselben aufgeführt und in der Anlage dieses Dokumentes nachzulesen. Werden die Ziele und Vorgaben des Vereins verletzt, erlischt mein Letzter Wille.“
„Das ist ein Witz!“
„Wir machen hier keine Witze, Mister Sullivan“, antwortete Notar Matt Stevenson.
„Mehr haben Sie nicht zu sagen?“
„Zu Ihnen nicht. Nein. Hat von den anderen Anwesenden jemand eine Frage?“
„Ähm … von wie viel Geld ist hier die Rede?“, fragte Ian Gillan, der den Umweltverein vertrat.
„Das hat unsere Kanzlei in den letzten Tagen versucht, genau auszurechnen. Wir sind noch nicht durch. Wir können hier und jetzt jedoch eine Schätzung geben. Inklusive aller Besitztümer, Immobilien und Bargelder beträgt die Erbschaft etwa 1,3 Milliarden Dollar. Dazu kommen Aktien und Fonds, die momentan noch einmal so viel Wert haben. Summa summarum sprechen wir also von 2,5 Milliarden Dollar.“
2017 Seaside Heights-K-002
„Trigeminusneuralgie.“
Wie leicht dem Quacksalber das Wort über die Lippen gekommen war. So, als ob es sich um eine leichte Erkältung handeln würde.
Der Mann schlug den Kragen seiner Jacke hoch und zog die Baseballkappe tiefer ins Gesicht. Vorsichtig lehnte er sich auf das morsche Holzgeländer, das die Promenade vom Strand trennte. Von der Landseite wehte ein frischer Wind Richtung Atlantik. Der Himmel war im Norden voller weißgrauer Wolken. Sie sahen aus, als hätte ein riesiger Kamm sie durchstrichen. In Richtung Süden war der Himmel eher blau und wolkenlos. Ein Flugzeug zog einen schnurgeraden weißen Streifen hinter sich her, als wolle es den Himmel in eine gute und in eine schlechte Seite teilen.
Er schaute über den breiten Strand, auf das Meer, bis hin zu zwei Containerschiffen am Horizont. Aus der Entfernung wirkten sie wie riesige Häuser, weil sie scheinbar auf der Stelle zu stehen schienen. Davor blitzte immer mal wieder das Silberweiß eines Segels auf. Sonst war der Ozean verlassen. Die Wellen klatschten träge an den Strand. Hier schien es noch nicht einmal mehr Möwen zu geben, die doch sonst jeden Strand mit ihrem Geschrei belebten. ‚Nichts los hier, rein gar nichts‘, dachte der Mann zufrieden. ‚Ziemlich perfekt. So ein verlassenes Nest bedeutet wenig Zeugen.‘
Er atmete tief die salzige Meeresluft ein, achtete dabei darauf, seine Gesichtsmuskulatur so wenig wie möglich zu bewegen. Er wusste: Schon die kleinste Regung konnte der Beginn eines neuen Anfalls sein. Doch nicht jetzt. Noch nicht.
Der Mann sah sich um. Außer ihm waren nur noch ein junges Paar und ein Alter auf dem Holzplankenweg am Pier. Der alte Mann saß auf einem Fass und starrte zum Meer. Die beiden jungen Leute waren Touristen, das war kaum zu übersehen. Der Mann hatte einen Blick dafür. Wie sie gingen, wie sie schauten und wie sie die Umgebung betrachteten, so verhielten sich nur Menschen, die sich in einer fremden Umgebung befanden.
‚Wie leicht durchschaubar doch die Menschen sind‘, dachte er und fixierte wieder die beiden Schiffe am Horizont. Anhand seiner eigenen Position und der des alten Rettungsschwimmer-Wachturmes rechts von ihm wusste er, dass sie sich ein Stück in Richtung Norden bewegt hatten. Das kleinere der beiden Containerschiffe war ein bisschen schneller vorangekommen als das andere.
Uno de ellos es siempre más rápido.
Er lächelte in sich hinein und konzentrierte sich wieder auf das Geschehen auf der Promenade. Hand in Hand schlenderte das Paar nun davon, bis er es schließlich aus dem Blick verlor.
Der Alte saß noch immer ein Stück entfernt auf einem umgekippten alten Ölfass. Leere Bierbüchsen und Weinflaschen standen vor seinen Füßen. Ein bunter Hut saß schräg auf dem Kopf, der zottelige Bart reichte fast bis zum Bauch. Er trug ein verwaschenes T-Shirt mit dem Konterfei Bruce Springsteens. Es schien, als würde der Alte vor sich hin brabbeln und sich mit den Bierbüchsen und Weinflaschen unterhalten. ‚Oder er betet zu Gott‘, dachte der Mann und wollte lächeln, als ein starker Schmerz sein Gesicht erstarren ließ.
Es fing also wieder an.
Der Schmerz begann am Kinn und schlängelte sich hoch bis zur Stirn. Wie eine Giftschlange, die sich unter seiner Haut einen Weg zum Hirn bahnte. Aber sie würde heute noch dran glauben müssen.
Trigeminusneuralgie.
Diese Kurpfuscher hatten aber auch für alles eine Erklärung. Solange sie damit Geld verdienen konnten. Er wusste es besser. Er wusste, warum der Schmerz kam. Und wie er ihn loswerden konnte. Doch der letzte Anfall war schlimm gewesen. Fast ohnmächtig war er geworden.
Also war er doch in die Klinik gegangen, was ihn große Überwindung gekostet hatte. Er hatte Ärzten noch nie vertraut. Zu oft schon hatten sie versagt. Bei seinem Cousin, der drei Jahre zuvor mit Krebszellen im ganzen Körper elendig verreckt war, genau wie bei seiner Stiefmutter, die er ein Jahr später beerdigen musste. Kein Arzt hatte ihr helfen können.
Vor fünf Tagen hatte er es nicht mehr ausgehalten. Eine Eigentherapie war nicht in Sicht gewesen. Also hatte er sich gezwungen, in die Klinik zu gehen. Der Quacksalber dort war sehr schnell zu einer Diagnose gekommen. Viel zu schnell.
„Trigeminusneuralgie. Unheilbar. Im Frühstadium kann man bei dieser Erkrankung etwas machen. Aber in Ihrem Fall, da ist das eigentlich schon zu spät“, hatte der gesagt und dabei immer wieder irgendwas in seinen Computer getippt. Und dann dessen nervende Fragen. „Leiden Sie an Multipler Sklerose? Oder hatten Sie in letzter Zeit eine schwere Erkrankung in Form einer Entzündung? Gibt es schwere Erkrankungen in Ihrer Familie?“
Der Mann hatte dazu nur geschwiegen und sich geärgert. Wie hatte er nur annehmen können, irgendein mexikanischer Medico könnte ihm helfen?
„Eine Möglichkeit gibt es“, hatte der Arzt gesagt. „Eine Gesichtsoperation. Da kann man auch die defekten Nervenbahnen und damit den Schmerz wegoperieren. Das ist nicht unmöglich. Aber teuer. Sie können sich das bestimmt nicht leisten.“
Da hätte der Mann fast laut losgelacht. Ein neues Gesicht. Genau das wollte er. Aber was bildete sich der Kurpfuscher ein? Woher wollte der wissen, was er sich leisten konnte?
In diesem Moment war der Schmerz wiedergekommen. Nur kurz, aber stärker noch als vorher. Jetzt half nur noch die Therapie. Seine Therapie. Sein Blick heftete sich auf das Skalpell, das in einer Nierenschale auf dem Schreibtisch stand. „Wollen Sie wissen, wie man das richtig behandelt?“
„Mit Medikamenten“, hatte der Quacksalber geantwortet und sich weiter seinem Computer gewidmet, ohne ihn anzublicken.
Das war zu viel für ihn gewesen. „Nein, nicht mit Medikamenten, nicht mit Operationen. Sondern mit Glauben und mit meiner Therapie.“
Er hatte den Quacksalber fast angeschrien. Doch der war erstaunlich ruhig geblieben.
„Glaube mag oft helfen. Aber nicht in einem Fall wie dem Ihren. Da helfen nur medizinische Behandlungen, also eine Therapie mit Medikamenten. Und das auf Dauer. Oder die erwähnte Operation.“
„Operation ist gut“, hatte der Mann geantwortet. „Aber Therapie ist besser. Viel besser.“
Der Quacksalber hatte kurz mit dem Kopf genickt. „Hab ich mir gedacht.“
„Nichts haben Sie gedacht. Denn ich werde nicht Ihre, sondern meine Therapie anwenden.“
„Ihre Therapie? Was soll das sein?“
„Nun, das werde ich Ihnen zeigen“, hatte er geantwortet und dabei mit einer schnellen Bewegung das Skalpell gegriffen.
Seaside Heights-K-003
‚Ich muss heute eine Entscheidung treffen‘, war Sylke Guestavsons erster Gedanke, als sie erwachte. Sie blinzelte ins Morgenlicht, das durch die Lamellen der Jalousie ins Motelzimmer schien. Irgendwo in der Nähe lief Musik, typische amerikanische Countrymusik. ‚Die stirbt hier auch nie aus‘, dachte sie, als die Musik plötzlich verstummte.
Eine Tür wurde zugeschlagen, die vordere Wand ihres Zimmers vibrierte leicht.
‚Vielleicht ist das ja der hübsche Mittdreißiger?‘, dachte sie. Als sie gestern Abend aus der Bar gekommen war, hatte der Typ mit einer glimmenden Zigarette in der Hand vor der benachbarten Tür gestanden. Sie hatten sich kurz zugelächelt. Einem Flirt hätte eigentlich nichts im Wege gestanden. Aber wegen der Ereignisse des Tages war sie zu durcheinander für irgendetwas gewesen. Also war sie in ihrem Zimmer verschwunden. Gerade eben war der Mann in ihrem Traum aufgetaucht. Aber was genau geschehen war, entglitt ihr gerade.
Guestavson rieb sich die Augen. Sie fühlte sich zerschlagen, wenngleich es schon nach neun Uhr war. Die halbe Nacht hatte sie wach gelegen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen waren ihr nicht aus dem Kopf gegangen. Dreimal war sie aufgestanden, hatte die Zahlen immer wieder überprüft. Es war jedoch alles richtig, ein Irrtum war ausgeschlossen. Außerdem machte ihr immer noch der Jetlag zu schaffen, obwohl sie schon eine Woche hier war. Morgen würde es zurück nach Europa gehen, zurück in ihre Zeitzone. Nur noch dieser eine Tag. Der ihr jedoch jetzt schon Kopfschmerzen bereitete.
Einen richtigen Kaffee. Was würde sie jetzt dafür geben. Aber dieses Motel und guter Kaffee – das hatte sie sich abgeschminkt. ‚Doch besser den, als gar keinen‘, dachte Guestavson. Sie sah zur Kaffeemaschine auf dem Tischchen neben dem Bett, seufzte und drückte den roten Knopf neben dem Wasserbehälter. Ein leises Röcheln verriet, dass die Maschine mit der Zubereitung begann.
Sylke Guestavson schlug die Decke beiseite, setzte sich auf und band ihre Haare zusammen. Sie fühlte eine leichte Verspannung im Nacken. Sie schloss die Augen, neigte den Kopf zur linken und zur rechten Seite. Das half für den Moment, wirkliche Linderung brachte es nicht.
Sie hatte ein flaues Gefühl im Magen und überlegte, ob es an dem mexikanischen Essen am Vorabend oder an den Ergebnissen ihrer Untersuchungen lag. Grund genug wären diese jedenfalls. Zuerst hatte Guestavson an einen Zufall geglaubt. Einen kurzen Moment sogar an Sabotage. Aber das hatte keinen Sinn ergeben.
Immer und immer wieder hatte sie die Wasserproben getestet. Erst am Strand, dann in ihrem Motelzimmer. Immer wieder war das Ergebnis eindeutig gewesen. Für die genaue Konzentration war zwar ein ausgiebiger Labortest nötig, aber für den Nachweis reichte ihr Testverfahren vollkommen aus. Schließlich war sie mit einem modernen mobilen Bio-Chip-Laborsystem ausgerüstet. Es war noch recht neu. Und eigentlich hätte sie es aus der Firma nicht mitnehmen dürfen. Käme das jemals heraus, wäre das ihr Ende im Unternehmen. Für diese Überlegungen war es nun zu spät.
Die Meeresbiologin stand auf, schlüpfte in ihre Badelatschen und öffnete die Tür zum Bad. Sie hoffte, dass es heute warmes Wasser geben würde. Oder wenigstens Wasser. Am Vortag war sie zu spät aufgestanden und hatte wohl die Duschzeiten verpasst. Zunächst war nur kaltes, dann gar kein Wasser mehr aus der Leitung gekommen. Eine Beschwerde an der Rezeption hatte keinen Erfolg gebracht. Der Mann dort hatte ihr mehrfach versichert, dass es nicht das Problem des Motels wäre, sondern der Wasserversorgung im Ort. Sie hatte ihm nicht geglaubt. Konnte sie doch von ihrem Fenster aus einen kleinen Springbrunnen sehen, der vor sich hinplätscherte.
Heute hatte sie Glück. Das Wasser lief noch. Kalt und heiß. Es roch allerdings eigenartig chemisch, so dass sie sich mit einem kurzen Abbrausen zufriedengab und auf das Haarewaschen verzichtete. Ein Bad im Meer kam aber nun auch nicht mehr in Frage. Nicht, wenn das wahr sein sollte, was sie gestern herausgefunden hatte. Erst jetzt wurde Sylke Guestavson klar, welch weisen Entschluss sie am ersten Abend gefasst hatte, nicht im Atlantik zu schwimmen.
Sie trocknete sich mit einem der typisch weißen Handtücher ab, das ungewöhnlich klein ausfiel. Gerade so konnte sie es sich um ihre Hüfte binden. Sie verknotete es an der Seite und ging ins Zimmer zurück. Überraschend angenehm roch es nach frisch gebrühtem Kaffee. Vielleicht war er doch nicht so schlecht wie sonst? Guestavson goss sich eine Tasse ein und setzte sich an den kleinen Tisch, auf dem ihr Laptop stand. Es war eines dieser neueren Geräte, halb Tablet, halb Notebook mit abnehmbarer Tastatur. „Man kann es sich kaum vorstellen, aber in dem Ding stecken zwei Terabyte Speicher. Außerdem ist es unfassbar schnell“, hatte ihr der Techniker der Firma erklärt. Guestavson hatte keine Ahnung von solcher Technik. Hauptsache diese Dinger funktionierten. Anschalten und loslegen. Sie las einen Artikel über Greenpeace-Aktionen, doch sie konnte sich nicht konzentrieren.
‚Ich muss eine Entscheidung treffen‘, dachte sie wieder. Vorsichtig nippte sie an dem Kaffee. Er war überraschend gut. Als sie aufstand, um sich eine zweite Tasse einzuschenken, huschte ein Schatten vom Fenster. Irritiert blieb sie stehen. Hatte sie sich das eingebildet? Nein, da war irgendetwas gewesen. Oder irgendwer? Mit zwei Fingern drückte sie die Lamellen der Jalousie ein wenig auseinander und schaute hinaus. Auf dem Treppengangaufgang vor ihrem Zimmer war jedoch niemand zu sehen. Auch die Straße vor dem Motel schien verlassen. ‚Ich sehe Gespenster‘, dachte sie und goss sich eine zweite Tasse Kaffee ein. Wer sollte hier schon sein? Niemand konnte wissen, dass sie sich kurzfristig entschlossen hatte, nach dem Kongress in New York noch zwei Tage an der Atlantikküste zu verbringen. Hier, wo sie zweimal mit ihren Eltern im Urlaub gewesen war. Damals, vor den Stürmen.
Leger in Jeans und T-Shirt gekleidet verließ sie das Zimmer wenig später. Sie ging die Treppe hinunter. Die Rezeption vom Knights Inn war verlassen. Ein Zettel an der Tür verriet, dass um 17.00 Uhr wieder jemand da sein würde. Darunter stand eine Telefonnummer für Fragen und Ankünfte außerhalb der Öffnungszeiten. ‚Naja‘, dachte Guestavson, ‚bei dem Preis muss man das hinnehmen.‘
Sie lief die Straße hinunter in Richtung Strand. Heute wollte sie nun endlich in Ruhe noch einmal den Urlaubsort sehen, mit dem sie ein paar Kindheitserinnerungen verband. Nach wenigen Minuten war sie am Pier, wo die Reste des einstigen Vergnügungsparkes immer mehr im Sand und auch im Vergessen versanken. Sie blickte auf die alte Strandwache und die windschiefen Umkleidekabinen. Einzig ein eiserner Wachturm der Rettungsschwimmer hatte die Zeit anscheinend fast unbeschadet überstanden. Zwar war er voller Graffitis, schien aber sonst noch intakt zu sein, auch wenn hier schon lange keine Rettungsteams mehr benötigt wurden. Die letzten Bretterbuden am Strand, oder was von ihnen übrig war, nutzten jetzt nur noch ein paar Möwen oder neuerdings Kiebitze auf der Flucht vor Flut, Stürmen oder vor dem Atlantiknebel, der sich auch für heute wieder angekündigt hatte. Jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst traf die kalte Abendluft vom Land auf das noch warme Meer und verwandelte sich so in eine dicke Nebelwand. Dieser Ort, in Guestavsons Kindheit beliebter und bevölkerter Bade- und Erholungsort an der Ostküste südlich New Yorks, glich an diesen Tagen immer einer Waschküche. Der Atlantiknebel war damals ein noch viel beachtetes Wetterphänomen gewesen, das in den Abendstunden die Touristen an die Strandpromenade gelockt hatte.
Doch seit Jahren schon hatte die Zahl der Stürme stark zugenommen und hatte fast alle zwei, drei Jahre den gesamten Küstenstreifen verwüstet. Hurrikan Sandy hatte 2012 zum ersten Mal den Ort sowie die komplette Strandpromenade zerstört. Kaum aufgebaut zerstörte im Sommer 2013 ein Brand wieder fast alle Häuser auf der Promenade. Zwei Jahre später, als Blizzard Juno über die Ostküste fegte, brach die Holzpromenade unter der Last großer Schneemassen ein.
Seitdem waren immer mehr Hotel- und Ferienhausbesitzer ins Landesinnere oder in den Süden gezogen. Zu teuer waren Wiederaufbau und Pflege der zerstörten Häuser. Versicherungen gegen Sturmschäden gab es hier schon lange nicht mehr. Jedenfalls keine bezahlbaren.
Das hatte der Besitzer des kleinen Restaurants Guestavson erzählt, in dem sie am Vorabend gegessen hatte. In der Zeit vor den Stürmen hatte es auf der sogenannten Casino Pier noch einen Vergnügungspark mit Riesenrad, einem Sessellift und Achterbahnen sowie den typisch amerikanischen grell-bunten Rummelbuden, Hotdog- und Hamburgerimbissen sowie einige Kneipen und Bars gegeben. Sie konnte sich noch daran erinnern, wie sie mit ihren Eltern mit einer Seilbahn die komplette Strandpromenade entlang gefahren war. Unter ihnen Strandkörbe und tausende Touristen, über ihnen der weite Himmel. Damals hatte hier an der Promenade noch ein Motel neben dem anderen gestanden. An den Sommerwochenenden war hier halb New York zum Erholen und Vergnügen angereist. Ein Musik-TV-Sender hatte von hier aus sogar eine seiner Veranstaltungen live gesendet. Das war nun schon lange vorbei.
Übrig geblieben waren eine heruntergekommene Billardkneipe, eine mexikanische Bar, sowie zwei, drei Motels. Im Ort wohnten nur noch etwa einhundert Einwohner, von zehn Supermärkten war noch einer geöffnet. Kurzum, der Urlaubsort ihrer Kindheit war inzwischen leider nur noch irgendein Küstenort ohne Bedeutung. Ein wenig erinnerte sie das alles hier an einen der Ostsee-Campingorte im Osten Deutschlands vor der Wende, wo sie einmal mit ihrer DDR-Verwandtschaft gewesen war. ‚Nur vielleicht nicht so öde‘, dachte Sylke Guestavson und sah dabei auf der Promenade wieder den seltsam aussehenden Mann, der ihr gestern schon aufgefallen war. Mit seiner Tarnjacke und der schwarzen Baseballkappe sah er aus wie ein einsamer Soldat, wie ein Kämpfer einer Elite-Truppe der US-Armee.
Bei seinem Anblick musste Guestavson an einen Wettbewerb denken, der damals hier am Strand stattgefunden hatte. Eine Art Armee-Wettkampf für den Nachwuchs. Jungen und Mädchen waren über eine Kampfbahn gerannt, geklettert und gerobbt. Auf der Promenade daneben hatten US-Army und -Navy an mehreren Infoständen um Nachwuchs gebuhlt. Jetzt fiel ihr auch ein, dass sogar ein einbeiniger alter Mann unter dem Beifall des Publikums an dem Wettbewerb teilgenommen hatte. Das hatte sie damals ziemlich verstört.
Als sie sich jetzt nach dem Tarnjacken-Mann umwandte, war er nicht mehr da. Er war nirgends zu sehen, als ob er sich in Luft aufgelöst hätte. Wohin war der so schnell verschwunden?
Egal. Sylke Guestavson sah auf die Uhr. Es war noch etwas Zeit bis zu ihrer Verabredung. Sie hatte sich doch am Vormittag mit dem jungen Pärchen aus Finnland verabredet, das sie am Strand kennengelernt hatte. Sie setzte sich auf eine Bank mit Blick auf das Meer und genoss die salzige Luft. Bevor sie sich auf den Weg zur mexikanischen Bar machte, fällte Sylke Guestavson eine Entscheidung. Sie wusste nun genau, was sie mit den beunruhigenden Ergebnissen ihrer Untersuchungen tun würde. Auch wenn das im schlimmsten Fall das Ende ihrer Karriere bei der ENERWATEC bedeutete.
Seaside Heights-K-004
Der Mann fuhr sich mit der linken Hand übers Gesicht. Er fühlte es, schon bald würde der Schmerz wiederkommen. Er spürte ein leichtes Ziehen im Kinn.
Seit einer Stunde wartete er hier. Er hatte sich mit einem Buch auf eine Bank an der Promenade gesetzt. Ein Tourist bei der Lektüre eines alten Krimis. Das Buch, eine alte deutsche Taschenbuchausgabe von Raymond Chandlers „Lebwohl, mein Liebling“, war schon stark abgegriffen, hatte einige Eselsohren und mehrere Seiten waren lose. Dieses und andere Bücher Chandlers begleiteten ihn nun schon mehrere Jahre. Zudem war dies immer wieder eine Gelegenheit, die Fremdsprachen aufzufrischen. Dieses Buch besaß er außerdem noch auf Spanisch, Russisch, Portugiesisch und natürlich auch im Original, auf Englisch. Er klappte das Buch zu, steckte es in seine Jackeninnentasche und ging in Gedanken noch einmal alle Schritte durch.
Es musste alles perfekt laufen. Er hasste es, wenn irgendetwas nicht nach seinem Plan verlief. So, wie beim letzten Mal. In Deutschland. Da hatten sie ihn fast gekriegt. Das durfte nicht noch einmal passieren. Mit diesem leidigen Thema würde er sich nun aber auch bald beschäftigen. Der neue Auftraggeber hatte ihm fest zugesagt, dass sie das Problem gemeinsam lösen könnten. Ein für alle Mal.
Der Mann sah sich um. Noch war niemand zu sehen. Auch der Alte war verschwunden. Nur dessen Bierbüchsen und Weinflaschen standen noch neben dem Ölfass. Von Süden her zog langsam eine Nebelwand in Richtung Pier, von der Promenade waren jetzt nur noch verschwommen die Lampen zu sehen, deren gelbes Licht schon halb vom Dunst verschluckt wurde.
Der Anblick erinnerte den Mann an einen Gruselschocker aus den 80ern, wo eine Schiffscrew innerhalb eines Nebels Schrecken und Grauen verbreitet hatte. Er überlegte noch, wie der Film hieß, als er Sylke Guestavson aus dem Augenwinkel den Strand entlang schlendern sah. Sie hatte, wie auch an den Tagen zuvor, ihre blonden Haare hochgesteckt, die Sonnenbrille hochgeschoben und sich ein T-Shirt mit buntem Aufdruck angezogen. Die Hosen hatte sie hochgekrempelt.
Am Morgen hatte er sie in ihrem Motelzimmer beobachtet, als sie halbnackt Kaffee getrunken und irgendetwas auf ihrem Computer gelesen hatte. Perfekte Figur, lange blonde Haare, genau sein Typ. Er hätte sie auf maximal Anfang 30 geschätzt, wusste aber aus den Auftrags-Unterlagen, dass sie schon fast 40 war. Eigentlich schade um sie. Doch der Mann verdrängte die Gedanken, die ihm heute Morgen bei ihrem Anblick gekommen waren und ihn jetzt wieder gefangen nehmen wollten.
Sylke Guestavson kam näher. Ihre Sandalen hielt sie locker an den Schlaufen in der Hand. Barfuß lief sie durch den Sand. Sie tänzelte und sprang leicht bei jeder Welle, die an den Strand schwappte. Es sah aus, als ob sie dem Wasser ausweichen würde. Als ob es ihr etwas anhaben könnte. Er beobachtete, wie ihre Füße Abdrücke im Sand hinterließen, die nur für Sekunden blieben, bevor die nächste Welle sie wieder auslöschte. ‚Ich bin die Welle, sie der Fußabdruck‘, dachte der Mann.
Er sah nun, wie Guestavson in Richtung Pier auf die mexikanische Bar zuging. Das Touristen-Pärchen war kurz vorher in der Bar verschwunden. Sicher würden sie sich jetzt begrüßen und gemeinsam essen. Er hatte am Vorabend mitbekommen, wie die drei sich hier verabredet hatten. Ein Zufall, der ihm helfen würde. Normalerweise war er gegen Zufälle. Aber so hatte er Sylke Guestavson nicht unter einem Vorwand in die Bar locken müssen.
Das Zucken in seinem Gesicht kam nun in kürzeren Abständen. Es wurde Zeit. Der Mann griff in die Jackentasche und holte ein altes Prepaidhandy heraus. Eines von denen, die es inzwischen nur noch auf Flohmärkten oder bei Gebrauchthändlern gab. Und das noch mit dem alten UMTS-Netz funktionierte. Er hatte es zusammen mit zwei weiteren Handys bei einem Straßenhändler in dem mexikanischen Kaff gekauft, wo er zuvor in der Klinik gewesen war. Drei Handys ohne Vertrag zum Preis von einem, perfekt. Ohne Vertrag – das hieß in dieser Gegend: nicht registriert. Der Händler hatte ihn zwar komisch angesehen, als er das Blut an seinen Händen entdeckt hatte. Doch als er die Dollarscheine herausgeholt hatte, war der Deal schnell über die Bühne gegangen.
Einen Tag später hatte er hier alles vorbereitet. Ohne Probleme. Niemand hatte ihn gehindert, niemand hatte ihn gesehen. Sein längerer Aufenthalt auf der Restaurant-Toilette war niemandem aufgefallen. Alles war nun an seinem Ort.
Eine leere SMS an die richtige Nummer und schon würde der Vibrationsalarm des Empfängerhandys den ersten Zünder auslösen. Die Ampullen würden zerspringen und das Sarin sich innerhalb von drei Minuten über die Klimaanlage in der gesamten Bar verteilen. Wenn die Gäste es registrierten, würde es für sie schon zu spät sein. Zehn Minuten später würde er die zweite Zündung auslösen, was wenige Augenblicke danach zur Explosion führen würde.
Doch ein Anfall riss ihn fast von den Beinen. So stark, so brennend war der Schmerz noch nie gewesen. Es wurde höchste Zeit. Er zog das Handy hervor, wählte die erste der im Telefon gespeicherten Nummern, startete das Nachrichtenprogramm und drückte die Senden-Taste. In 15 Minuten musste er hier verschwunden sein.
Der Mann startete den Countdown auf seiner Armbanduhr und schlich sich leicht gebückt zum Eingang der Bar. Kurz schaute er durch das Bullauge der Tür hinein. Sylke Guestavson saß mit dem Pärchen an einem Tisch auf der rechten Seite. Die beiden Touristen saßen auf einer Ledercouch an der Wand, Guestavson auf einem Stuhl mit dem Rücken zum Tresen. Sie hatten Bier und Cola vor sich stehen und sahen gemeinsam in die Speisekarte. Zwei Tische daneben saß der Alte vom Vormittag, er hatte ein Pitcher Bier und ein halbleeres Plastikbierglas vor sich stehen. Wieder sah es so aus, als ob er Selbstgespräche führen würde. Die Bedienung verschwand gerade in der Küche. Sonst war die Bar leer.
Der Mann holte Gaffa-Tape aus der Jackentasche und wickelte es wie einen Achterknoten mehrfach um die beiden Türknäufe der Pendeltüren. Den Hinterausgang zwischen Lager und Toiletten hatte er zuvor schon verschlossen. Er sah auf die Uhr: 30 Sekunden. Er duckte sich vom Fenster weg und zählte die letzten Sekunden mit.
Dann zerschlug ein Glas. Er hörte aufgeregte Stimmen, das Kreischen einer Frau und dann dumpfes Poltern. Einige Sekunden später war alles ruhig. Der Mann sah erneut durch das Bullauge in die Bar. Die Wirkung des Giftgases hatte eingesetzt.
Das Pärchen lag seltsam verschlungen und bewegungslos neben dem Tisch auf dem Boden, als wären sie aufgesprungen, um wegzurennen. Die Kellnerin saß zusammengesunken auf dem Boden am Tresen. Sie starrte an die Decke, ihre Lippen zitterten, kurz darauf rührte auch sie sich nicht mehr.
Sylke Guestavson lag mit weit aufgerissenen Augen und gerötetem Gesicht auf dem Fußboden kurz vor dem Ausgang. Sie erbrach sich und hustete Blut. Doch sie versuchte, weiter zur Tür zu kriechen und sah hoch. In seine Richtung. In ihren Augen lag eine Mischung aus Flehen, Angst und auch Erkenntnis. Tränen liefen ihre Wangen hinab, vermischten sich mit dem Blut. Er wusste: Dies war das vorletzte Stadium. Jetzt würden Krämpfe folgen, die Muskeln würden anfangen zu zucken, dann würde sie sich erneut erbrechen und unbewusst urinieren. Nur Sekunden später würde sie keine Luft mehr bekommen. Bewusstlosigkeit. Tod.
Sylke Guestavson stemmte sich mit den Armen noch einmal hoch, doch schon verließen sie die Kräfte. Ein letztes Mal schaute sie zur Tür, dann schlug ihr Kopf hart auf den Holzfußboden.
Erledigt. Mission erfüllt. Therapie abgeschlossen. Er fühlte, wie der Schmerz sich langsam aus seinem Gesicht schlich.
Esta es una prueba.
Der Mann ging zum Pier zurück, bis zum vorderen Rand. Er kletterte über das Geländer und stieg eine alte, halb verrostete Leiter hinab. Er setzte sich in das Schlauchboot, mit dem er vor zwei Tagen hier angekommen war und das er hier versteckt hatte. Mit einem Code startete er den Elektromotor, löste den Sicherungstampen und fuhr ein Stück aufs Meer hinaus um den Casino Pier herum, bis er die Bar sehen konnte. Er holte das Handy heraus, wählte die zweite eingespeicherte Nummer und sendete eine weitere SMS ohne Inhalt.
Zehn Sekunden später gab es einen ohrenbetäubenden Knall, Flammen stiegen auf, die Fenster zersprangen, Bretter und Steine flogen durch die Luft bis an den Strand. Er zählte die Sekunden. Eins … zwei … drei … Bei vier knallte es erneut, wuchtiger und lauter als beim ersten Mal. Die Sprittanks und Ölfässer, die unter der Bar gelagert hatten, waren nun explodiert. ‚Alles nach Plan‘, dachte der Mann zufrieden, als die Druckwelle der Explosion das Boot erreichte. Er hielt sich an der flachen Reling fest, das Boot schaukelte gefährlich nach beiden Seiten. Mit seinem Gewicht versuchte er das Wanken auszugleichen, betätigte den Gashebel, so dass das Boot einen Satz nach vorn machte. Er drückte das Ruder nach links und das Boot schob sich in Längsrichtung der Wellen. Jetzt hatte er es wieder im Griff.
Nach einigen Metern stoppte er und zog das Handy hervor. Der Mann nahm den Akku heraus und warf alles ins Wasser. Von den Handys in der Bar würde nicht viel übrig bleiben. Er schaute noch einmal zurück. Der ganze Pier brannte lichterloh. Auch die Häuser neben der Bar, die alte Rummelbude und der Burgerimbiss, hatten Feuer gefangen. Perfekt. So mochte er das. Ein Feuerwerk nach Maß. Die Deutschen würden zufrieden mit ihm sein.
Der Mann schob den Gashebel bis zum Anschlag nach vorn. Mit einem leisen Aufheulen beschleunigte der Motor das leichte Schlauchboot innerhalb weniger Sekunden auf 25 Knoten. Als Minuten später die ersten Sirenen heulten, war der Mann bereits im Atlantiknebel verschwunden.
Berlin-K-005
Regen. Immer nur Regen. Schon seit Tagen war der Himmel über Berlin ein graues Etwas, aus dem es unaufhörlich goss. Mal Sturzbächen gleich, mal tröpfelte es leicht. Immer war es nass, am Tag, in der Nacht. Als wolle eine unbekannte Macht die Stadt mit Wasser in die Knie zwingen. Und tatsächlich schien es, als hätte Berlin sich seinem Schicksal ergeben. Die Sonne hatte sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Nach einem strengen Winter hatten alle auf einen sonnigen Frühling gehofft. So, wie es die Meteorologen auch vorausgesagt hatten.
Doch was waren schon Wetterprognosen. Doering sah aus dem Fenster seines Appartements in der 15. Etage. Unter ihm lag der Alexanderplatz, in dessen nassen Mosaikfliesen sich die Häuser und deren bunt leuchtende Reklame spiegelten. Er fragte sich, warum diese Wetterfrösche es immer noch nicht auf die Reihe bekamen. Alle paar Sekunden wurde an tausenden Orten auf der Welt das Wetter aufgezeichnet. Da musste es doch langsam mal möglich sein, genauere Vorhersagen zu machen.
Aber wer waren schon diese Experten. Die angekündigte Klimakatastrophe war auch noch nicht eingetreten. Jedenfalls nicht wie vorausgesagt.
Doering startete den Wasserkocher und öffnete die Tüte mit den Kaffeebohnen. Er wog exakt 20 Gramm auf seiner Küchenwaage ab, da war er pingelig. Mit seiner alten Handkaffeemühle begann er, die Bohnen zu mahlen. Doering füllte den Porzellanfilter mit dem Kaffeepulver und übergoss es mit 90 Grad heißem Wasser. Die beste Methode für den besten Geschmack. Wenigstens ein guter Kaffee, wenn schon das Wetter schlecht war.
Noch immer hatte Doering ein leichtes Netzbrummen im Kopf. So nannte einer seiner Freunde, ein Musiker, den Kater nach einer durchzechten Nacht. Am Vortag hatte Doering seine Freunde Petra und Albert Griseberg aus der Maßschneiderei in ihr gemeinsames Stammrestaurant in Charlottenburg eingeladen. Es wurde, wie immer, später als gedacht. Nach dem Essen hatte sich noch der Chefkoch zu ihnen gesetzt und die eine oder andere Flasche Mosel-Riesling wurde geleert. Gemessen an der Menge, die sie getrunken hatten, ging es ihm heute aber doch recht gut.
‚Musik wäre jetzt eine Idee‘, dachte Doering und startete die Anlage.
Er wählte die zufällige Wiedergabe und lauschte den ersten Takten von Lynyrd Skynyrds „Simple Man“. Ein freier Tag nach Maß. Mitten in der Woche einen freien Tag zu haben, war durchaus angenehm. Er goss sich eine Tasse Kaffee ein, tat ein Stück Würfelzucker dazu (so schmeckte ihm nicht nur der Kaffee besser, der Zucker verstärkte zudem die Wirkung des Koffeins), rührte um und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Im Gegensatz zu seinen Kleiderschränken, in denen es immer akkurat und perfekt aussah, herrschte hier das reine Chaos. Alte und neue CDs, Visitenkarten, ungelesene Bücher, sein E-Book-Reader, alte Briefe aus einem ihm unbekannten Nachlass, die er im Antiquariat erstanden hatte, zwei Spanisch-Wörterbücher, Bleistifte und Kugelschreiber, sein Kreditkartenetui, Batterien – alles lag durcheinander. Morgen würde er sich dem Chaos widmen.
Mit dem Auflegen seines rechten Mittelfingers und einem Dezimalcode entsperrte er sein Notebook, loggte sich über eine sichere Spezialverbindung ins Internet und las die Nachrichten des Tages.
Starke Gewitterstürme über Deutschland, las er dort, während nun Dave Grohls „Outside“ aus den Bluetooth-Lautsprechern schallte. Doering scrollte weiter durch die Nachrichten. China überschreitet 1,5-Milliarden-Grenze. Erneuter Vulkanausbruch in Chile. Korruption: Streit um Zukunft der UEFA. Windmühlen-Blase – US-Bank bankrott.
Doering lehnte sich zurück und schlürfte seinen Kaffee. ‚Hat es nun also die USA erwischt‘, dachte er. In Deutschland waren erst kürzlich einige Banken an der Pleite vorbeigerutscht. Zuerst war die Immobilienblase geplatzt, dann folgte die Energiewende. Die war aber nach hinten losgegangen.
Zunächst war die Zahl der Windmühlenhersteller und Solarfirmen immer schneller gewachsen, Energiefirmen hatten ganze Landstriche mit ihren Windrädern zunichtegemacht. Auch immer mehr Private, Landwirte, Hausbesitzer, Kleingärtner, waren auf die Idee gekommen, ihren eigenen Strom zu produzieren. Jeder Grundstückseigentümer hatte sich die Genehmigung für den Bau einer Windmühle besorgt – nicht immer ganz legal. Die sogenannte New-Energy-Branche boomte. Banken gaben gern und viele Kredite.
Aber bald schon war der große Knall gekommen. Kein Wind, keine Sonne, kein Strom, kein Geld. Solarfirmen waren reihenweise in die Pleite geschlittert, danach hatte es die Windmühlenhersteller getroffen. Kredite waren wie Seifenblasen geplatzt, Banken bankrottgegangen, Kreditnehmer hatte es in den Ruin getrieben.
Auch Doering hatte Aktien gekauft, deren Wert seitdem nicht mehr aus dem Keller gekommen war. Aber wie pflegte ein Freund zu sagen: Abwarten, die kommen wieder hoch, und wenn es Jahre dauert. Daran glaubte Doering aber nicht mehr. Sogenannter Ökostrom kostete inzwischen doppelt so viel wie Atomstrom.
Alle hatten auf preiswerten Alternativstrom gehofft. Nun kostete Energie mehr als je zuvor.
Einzig in Asien, wo man entgegen dem Trend sogar neue Atomkraftwerke gebaut hatte, sah es anders aus. Dort gab es Strom auch ohne Wind. Aber immer wieder Zwischenfälle mit Atomreaktoren. Das Japanische Meer war nicht nur voller Müll, sondern auch gebietsweise radioaktiv verseucht. Alles in allem war die sogenannte umweltfreundliche Energieerzeugung Meilen und Jahre weit weg von dem, was man sich erhofft hatte.
Das nächste war das hausgemachte Problem mit der gebietsweisen Erderwärmung durch die Windmühlen, das sich nicht einmal die Experten unter den Wissenschaftlern erträumt hatten.
Dort, wo besonders viele Windkraftanlagen an einem Ort standen, wie an den windreichen Küsten oder in den Bergen, hatte die stete Aufwirbelung der Luftschichten die Abkühlung der Erdoberfläche verhindert. Über die Jahre hinweg war das Klima durcheinander geraten und rächte sich mit warmen Nächten und kalten Tagen, mit Stürmen in bis dahin verschonten Gegenden, mit Wintereinbrüchen in subtropischen Gebieten. Und jetzt den Regentagen über Berlin.
‚Da haben wir den Salat‘, dachte Doering. ‚Umweltfreundliche Energie, die dem Klima schadet. Wie blöd.‘ Die Welt hatte mit allem gerechnet: mit dem Abschmelzen der Polkappen, mit absaufenden Südsee-Inseln, mit dem 3. Weltkrieg um Öl und Wasser, mit Asteroideneinschlägen und sogar mit der Invasion aus dem Weltall. Nur mit diesem scheiß Wetter hatte keiner gerechnet.
Doering scrollte weiter durch die News und blieb bei einem Bericht aus den USA hängen: Sechs Tote bei Explosion am Jersey Shore. FBI und Heimatschutzbehörde ermitteln. Er klickte auf den Artikel, um mehr lesen zu können. Doch der war gesperrt, Weiterlesen bedeutete Bezahlen. Doering hatte jedoch schon genug andere Abos, er musste seine Infos aus anderen Quellen holen.
Als er sich einen zweiten Kaffee eingegossen hatte, rief er seine E-Mails ab, in der Hoffnung, es würde einen neuen Beraterauftrag geben. Doch da gab es nichts. Zu seinem Leidwesen. Nicht, dass er sich wegen seiner Finanzen Gedanken machen musste. Er hatte so einiges gespart und erhielt außerdem noch regelmäßig Erlöse aus seinen Aktien und seinen Fonds, die nichts mit erneuerbaren Energien zu tun hatten. Doch das ungestillte Jagdfieber machte Doering immer mehr zu schaffen. Sein Kopf gierte förmlich nach Denkarbeit.
Seit er wegen seiner Augenerkrankung aus dem aktiven Polizeidienst ausgeschieden war, verdiente Doering sein Geld als Privatdozent. Es machte ihm teilweise sogar Spaß, mit Studenten zu arbeiten. Mit seiner jahrelangen und gewohnten Ermittler-Tätigkeit hatte das aber etwa so viel zu tun wie ein maßgeschneiderter Anzug mit einem von der Stange. Er konnte beides tragen, aber nur im Maßanzug fühlte sich Doering wirklich gut.
Der Fußboden unter ihm vibrierte. Im gleichen Moment hörte Doering die Gläser in der Vitrine klirren, die Lampe auf dem Schreibtisch wankte leicht hin und her. ‚Was zum Teufel …?‘, dachte Doering und lief zum Fenster. Der Alexanderplatz glich einem Ameisenhaufen. Überall hasteten Menschen in alle möglichen Richtungen, weg vom Zentrum. Sie rannten aus den Schächten der U-Bahn und den Eingängen des Fernbahnhofes. Sie prallten gegeneinander, stießen sich rücksichtlos nach vorn. Panik. So sah eine Massenpanik aus.
Doering hörte Sirenen und dann bogen auch schon zwei Streifenwagen auf den Platz, eine Kolonne an Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeugen folgte.
Doering lief zu seinem Laptop. Die ersten Onlineportale berichteten bereits. Er überflog die Schlagzeilen: Bombe auf Berliner Bahnhof explodiert. Terroranschlag auf U-Bahn? Bombenexplosion in Berlin. Näheres in Kürze. Doch erst die nächste Überschrift schockierte ihn: Tote bei Anschlag im U-Bahnhof Schillingstraße.
Das war die U-Bahn-Linie 5! Mit der fuhren täglich viele seiner Studenten zur Uni. Und jetzt war genau die Zeit dafür. Verdammt, er musste herausfinden, was da los war. Nicht nur aus Sorge um seine Studenten.
Doering sprang aus der Jeans, warf sein T-Shirt in die Ecke und nahm den erstbesten Anzug aus seiner Kleiderkammer. Er griff sich das oberste weiße Hemd vom Stapel, schlüpfte in seine neuen Hamburger Maßschuhe und rannte zu den Aufzügen.
Er musste rausfinden, was los war.
Berlin-K-006
Sechs Minuten später war Doering am U-Bahnhof Schillingstraße. Obwohl er regelmäßig seine Ausdauer trainierte, war er so außer Atem, dass er sich abstützen musste. Auf dem Weg hatte er verschiedene Szenarien im Kopf durchgespielt. So, wie er es seinen Studenten lehrte. Bei ihm geschah es völlig automatisch. Ob er wollte oder nicht.
Was war passiert? Wer? Warum? Wieder der IS? Nach dem LKW-Attentat auf dem Breitscheidplatz wäre das der zweite Terroranschlag in Berlin. Könnte durchaus sein. Die Sicherheitsbehörden hatten immer wieder vor erneuten Anschlägen gewarnt. Erst kürzlich hatte das Innenministerium die aktuelle Terrorwarnstufe angehoben.
Oder eine militante, politische Gruppe? Rechts oder links. Da war beides möglich. Seit der Energiekrise gab es immer wieder Demonstrationen politischer Gruppen, die gewaltsam ausarteten. In Berlin krachte es mindestens einmal pro Woche zwischen Polizei und Demonstranten. Jeden Tag gingen hier irgendwelche Spinner für oder gegen irgendetwas auf die Straße. Manchen Gruppierungen traute Doering auch Anschläge zu. Seit dem Attentat eines irren Börsen-Spekulanten auf den Bus der Dortmunder Fußballer war wirklich alles möglich.
Über dem U-Bahnhof kreisten ein Helikopter und einige unbemannte Kamera-Drohnen, wobei nicht zu erkennen war, ob sie zu den Einsatzkräften oder zu den Medien gehörten. Das brummende Dröhnen der Rotorblätter vermischte sich mit den Polizeisirenen. Alles zusammen ergab eine Kakophonie der Angst und Panik.
Rings um den Bahnhof Schillingstraße stauten sich etliche Taxis und BVG-Busse, Rettungswagen und Einsatzfahrzeuge. In den Pfützen spiegelten sich die blinkenden Lichter der Rettungsfahrzeuge. Sanitäter und Feuerwehrmänner hetzten hin und her, behandelten und betreuten Verletzte. Etwa 50 Frauen, Männer und Kinder kauerten zwischen den Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr. In ihren Gesichtern Bestürzung, Fassungslosigkeit, Entsetzen. Eins fiel Doering auf: Schwerverletzte schien es nicht zu geben. Die Sanitäter behandelten hauptsächlich Schürfwunden und Prellungen. Was im U-Bahn-Tunnel los war, konnte Doering nur ahnen.
Polizeibeamte waren gerade dabei, das Gebiet mit Absperrgittern und den üblichen rot-weißen Bändern abzusichern. Auch die Gaffer, die sich natürlich bereits versammelt hatten, drängten sie zurück.
Die Sensationsgier des Menschen – wie oft hatte Doering mit seinen Studenten dieses Thema behandelt. Das Ergebnis ihrer Diskussionen und Untersuchungen hatte niemanden gewundert, aber doch alle irgendwie verunsichert: Kein Leid dieser Welt war groß genug, um die Schaulust zu unterbinden. Immer öfter gab es Unfälle und Gewalttaten, bei denen sich Anwesende weigerten, Hilfe zu leisten, sondern einfach nur alles filmten. Auch in Deutschland. Auf Autobahnen wurden nach Unfällen keine Rettungsgassen mehr gebildet, andernorts wurden Sanitäter und Ärzte daran gehindert, den Opfern Hilfe zu leisten. Eine lebensgefährliche Neugier. Wie sehr Doering das hasste.
Polizeibeamte spannten nun auch Planen als Sichtschutz, denn aus den umstehenden Häusern glotzten die Leute auf die Straße. Doering musste näher ran, um herauszubekommen, was genau passiert war. Als er an einigen Sanitätern vorbei ging, von denen er einige kannte, nickte er ihnen kurz zu. Doering nuschelte was von „Einsatzleitung“ und konnte sich so fast bis zum Bahnhofseingang mogeln. Er hoffte, hier die richtigen Ex-Kollegen zu treffen, sonst würde er sofort auf- und damit auch rausfliegen.
Doering hatte Pech. Ausgerechnet Konrad – Conny – Berger vom Landeskriminalamt war im Moment der ranghöchste Beamte. Er stand telefonierend vor den Treppen, die in den Bahnhof führten. Wie immer hatte Berger seine Nullachtfünfzehn-LKA-Uniform an. Das Haar trug Berger mit viel Gel ordentlich zur Seite gelegt, so dass es sogar vom Regen nicht ruiniert werden konnte. Der Gürtel inklusive Pistolengurt war so eng geschnallt, dass sein Bauch wie ein nasser Sack darüber hing. Auch wie immer. Typisch Berger eben.
Als er Doering sah, kam er gleich auf ihn zugestürzt. Doering ahnte, was nun kommen würde. „Doering, Sie schon wieder! Was wollen Sie hier? Wie sind Sie überhaupt bis hierhergekommen?“, blaffte Berger ihn an.
„Zu Fuß.“
„Nun werden Sie mal nicht frech, Doering. Sie sind als Zivilist hier. Sehe ich das richtig?“
„Das sehen Sie richtig.“
„Hauen Sie einfach ab, sonst sorge ich dafür, dass Sie von hier entfernt werden. Oder wollen Sie sich wieder einmal mit mir anlegen?“
Doering zuckte nur leicht mit den Schultern.
Berger war einst Bulle in einem berüchtigten Schlägertrupp der Berliner Einsatzpolizei gewesen. Da war er auch kurz vor der Suspendierung gewesen, nachdem er auf einer Demonstration von Umweltschützern einer jungen Frau gedroht hatte, ihr „so lange auf die Fresse zu hauen, bis sie nichts mehr zu sagen hätte.“
Solche Sprüche waren bei dem Schlägertrupp keine Seltenheit gewesen. Berger hatte damals nur das Pech gehabt, dass sein Spruch gefilmt und am gleichen Tag noch der Renner im Internet geworden war. Nach einer öffentlichen Entschuldigung war er in der Versenkung verschwunden.
Bis er drei Jahre später auf einmal als Ermittler beim LKA wieder aufgetaucht war. Unter Kollegen tuschelte man seitdem, Berger sei zwischenzeitlich V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen und sei im Besitz von Informationen, die man lieber geheim halten wolle. Sein Schweigen würde seitdem mit einem gehobenen Posten entlohnt.
Im Grunde genommen war er aber ein Jammerlappen, der allem, was irgendein Vorgesetzter auch immer sagte, zustimmte. Ein Ja-Sager ohne Rückgrat. Kollegen erzählten sich, Berger habe sogar seinen Musikgeschmack mal eben so von Schlager auf Rock geändert, weil sein Chef eines Tages eine alte Pink-Floyd-Platte mitgebracht hatte.
Doering schob seine Brille mit den selbsttönenden Gläsern zurecht und wandte sich an Berger. Er entschloss sich, den freundschaftlichen Ton zu wählen, wenn es ihm auch verdammt schwerfiel. „Hören Sie, Berger. Ich bin gleich wieder weg. Nur eine Frage. Viele meiner Studenten fahren täglich mit der U5. Ich muss wissen, ob …“
„Das tut mir ehrlich leid“, unterbrach ihn Berger. „Ich kann Ihnen nichts sagen. Seit ein paar Minuten haben wir hier die höchste Terrorwarnstufe. Was das bedeutet, muss ich Ihnen ja nicht sagen, oder?“
Doering schüttelte den Kopf. Er wusste, was das bedeutete: absolute Nachrichtensperre.
Doch zu seiner Verwunderung beugte Berger sich ein Stück zu ihm. „Eins im Vertrauen, aber das bleibt unter uns! Ist das klar?“
„Sie kennen mich, Berger.“
Berger sah sich kurz nach allen Seiten um, bevor er flüsterte: „Was auch immer da unten explodiert ist – von den Opfern ist nicht viel übrig, an eine Identifizierung ist überhaupt nicht zu denken. Außerdem muss da erst einmal das ABC-Team …“
„Das ABC-Team? Das müssen Sie mir jetzt erklären.“ Doering hob eine Augenbraue.
„Ich denke nicht“, sagte Berger.
„Das“, murmelte Doering mehr zu sich, „ist mir allerdings auch schon aufgefallen.“
Berger schaute ruckartig auf und sein Tonfall änderte sich schlagartig. „Hauen Sie ab, Doering, ich kann nichts für Sie tun.“
Doering sah Berger die leichte Bestürzung an, als der registrierte, was er da für Informationen preisgegeben hatte. ABC-Team? Ein Giftgasanschlag? Biowaffen?
„Ich bin gleich weg. Aber zurück zum ABC-Team.“
„Halten Sie bloß die Klappe, Doering“, zischte Berger. „Sie wissen ja, ich sitze am längeren Hebel.“ Wieder sah Berger sich um. „Nehmen Sie eigentlich nie Ihre verdammte Sonnenbrille ab? Ich meine, es regnet seit Tagen. Oder ist selbst das zu hell für Sie? Soll ja Leute geben, die Tageslicht nicht ertragen können.“
Doering wusste, dass Berger ihn nur provozieren wollte. Aber es war völlig sinnlos, darauf einzusteigen. Berger wollte nur seine Macht demonstrieren.
„Bitte, eins noch: Wo ist es passiert? In der Bahn stadtauswärts? Oder Richtung City?“
„Stadtauswärts. Kurz hinter der Einfahrt. Und jetzt verschwinden Sie!“ Berger drehte sich um, winkte zwei Beamte heran und wies auf Doering.
Zeit, das Feld zu räumen.
Hier konnte er nichts mehr tun. Weitere Informationen musste er sich über andere Wege beschaffen. In seinem Kopf spielte er jedoch schon einige Szenarien durch. Giftgas? Explosion? Das erinnerte ihn an einen seiner schlimmsten Albträume. Er ermahnte sich zur Ruhe. Noch wusste er zu wenig. Außerdem war er nicht der leitende Ermittler. Sondern nur ein Ex-Bulle.
Doering sah noch einmal zurück. Er hatte das Gefühl, dass hier etwas faul war. Sein Instinkt hatte ihn bisher selten getäuscht. Nur was war es? Er sah sich um. Nichts Verdächtiges.
Die Zahl der Gaffer hatte sich inzwischen verdoppelt, obwohl sie wegen der Schutzplanen nichts mehr sehen konnten. Mussten sie auch nicht. Auf einem großen Werbe-Bildschirm an der Fassade eines Kinos gegenüber konnten sie das Geschehen hier live verfolgen. Die Nachrichten liefen in Endlosschleife mit Live-Bildern vom Ort der Katastrophe. Unterbrochen von Werbefilmchen für die neuesten Mobiltelefone, schicke Autos und vegetarisches Bio-Hundefutter, sah man immer wieder die Karl-Marx-Allee aus der Luft sowie aus anderen Blickwinkeln.
Doering wandte sich zum Gehen, sah aber plötzlich inmitten der Gaffer einen Mann stehen, der so gar nicht hierher zu passen schien. Anstatt Fotos zu machen oder zu telefonieren oder sich mit den anderen zu unterhalten, stand er einfach nur da. Der Typ hatte seine schwarze Baseballmütze tief ins Gesicht gezogen, seine Augen blieben darunter verborgen. Trotzdem kam es Doering vor, als ob er in seine Richtung starren würde.
Berlin-K-007
„He, Sie, machen Sie mal Platz.“
Doering drehte sich um und begegnete dem wütenden Blick eines Streifenpolizisten, der gerade zwei schwarze Autos durch die Absperrung lotste. Zwei große Wagen mit schwarzen Scheiben. Die Marke kannte er: Chevrolet Suburban. Mit genau so einem Chevy war er im vorletzten Urlaub durch die USA gefahren. Mit solchen Wagen fuhren dort das FBI und der Secret Service. In Deutschland waren die großen SUV eher selten. Zum einen waren sie für deutsche Straßen zu breit, zum anderen verbrauchten sie eine Menge Sprit.
Wer also fuhr hier solche Wagen? Die Amis? Schwer vorstellbar. Deutsche Behörden waren derzeit nicht besonders gut auf die zu sprechen. Andererseits machten die Amerikaner sowieso, was sie wollten.
Die beiden Chevys fuhren an dem Streifenpolizisten vorbei bis zum Bahnhofseingang, der nun außerhalb Doerings Blickfeld lag. Die ersten Puzzleteilchen sammelten sich in seinem Kopf, ergaben aber noch keinen Zusammenhang.





























