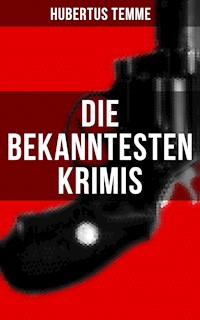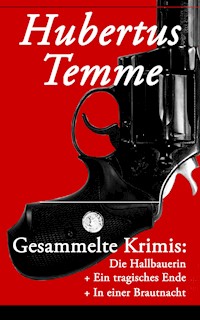
Gesammelte Krimis: Die Hallbauerin + Ein tragisches Ende + In einer Brautnacht E-Book
Hubertus Temme
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
Dieses eBook: "Gesammelte Krimis: Die Hallbauerin + Ein tragisches Ende + In einer Brautnacht" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Hubertus Temme (1798-1881) war ein deutscher Politiker, Jurist, Professor des Kriminalrechts und Schriftsteller. Er verfasste u. a. zahlreiche Kriminalerzählungen, die zum großen Teil in Ernst Keils Familienzeitschrift Die Gartenlaube veröffentlicht wurden und wichtige Anstöße für die Entwicklung der deutschsprachigen Kriminalliteratur gaben. Inhalt: Die Hallbauerin Ein tragisches Ende In einer Brautnacht Aus dem Buch "Die Hallbauerin": "Die jungen Damen der Gesellschaft - in der Hauptstadt hießen sie damals schon Damen - behandelten ihn begreiflich mit großer Aufmerksamkeit. Unter ihnen zeichneten sich und zeichneten ihn besonders die Töchter eines reichen Bankiers aus, der zugleich den Titel eines hochfürstlichen Geheimrats führte. Thresette Lindemann war zwar nicht mehr ganz jung, sie zählte sechs-, siebenundzwanzig Jahre. Aber sie war eine Schönheit, und sie hatte ihre Schönheit sehr zu konservieren gewußt. "
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gesammelte Krimis: Die Hallbauerin + Ein tragisches Ende + In einer Brautnacht
Kriminalgeschichten von Jodocus Donatus Hubertus Temme
Inhaltsverzeichnis
Die Hallbauerin
In dem früheren Fürstbistum Münster war, wie damals in fast allen deutschen Ländern, bis zu seiner Besitznahme durch Preußen im Jahre 1802 die Gerichtsbarkeit mit der Verwaltung verbunden. Der Richter hatte zugleich die Polizei, die Umlage und Erhebung der Steuern, Gewerke-und Gewerbesachen, kurz, fast alle jene Angelegenheiten zu besorgen, mit denen ein Land regiert zu werden pflegt. Indes regierte man freilich damals nicht den zehnten, vielleicht nicht den zwanzigsten Teil soviel wie heutzutage. Die Gerichte waren teils landesherrliche, teils städtische, teils adelige. Die letzteren, auf dem Lande die meisten, führten verschiedene Benennungen; die bedeutendsten hießen Gaugerichte oder, wie im Münsterland der Name gebräuchlich war, Gogerichte. Der Richter, der sie verwaltete, hieß Gaugraf, Gograf, auch plattdeutsch Gogreve. Der münstersche Adel gehört wie zu dem ältesten, so auch zu dem reichsten und angesehensten Adel Deutschlands. Das Gogericht manches Freiherrn erstreckte sich über ein Gebiet von vielen tausend Einwohnern. Der Gograf, der ihm vorstand, der es verwaltete, war, zumal da er neben der Rechtspflege auch alle jene anderen obrigkeitlichen Funktionen und Rechte auszuüben hatte, ein angesehener Mann. Er verwaltete oder eigentlich regierte, namentlich da, wo der Gerichtsherr nicht zu Hause war, wie ein unumschränkter Herr. Manchmal auch, wenn der Gerichtsherr da war; denn der Gograf war fest, auf Lebenszeit, unter Genehmigung und Garantie des Landesherrn, des Fürstbischofs, angestellt. Er übte unmittelbar die Gewalt aus; er war ein wissenschaftlich gebildeter Mann. Der freiherrliche Gerichtsherr dagegen, der auf seinem Gute saß, hatte in der Regel, außer in den noblen Passionen, eben keine große Ausbildung erhalten und selten auch die Lust, sich um andere Angelegenheiten zu bekümmern, zumal um Beschwerden seiner Bauern und sonstigen Hintersassen über die Gografen. Dazu kam, daß im Laufe der Zeiten manche Gografschaft erblich geworden war. Der älteste oder sonst am nächsten befähigte Sohn des Gografen hatte studieren müssen, er war nach Beendigung seiner Studien dem Vater adjunktiert worden und trat nach dessen Tod ganz in das Amt ein. So waren Amt und Familie manchmal seit Jahrhunderten miteinander verwachsen. Man wußte gar nicht mehr, daß es jemals anders gewesen ist; man konnte sich nicht denken, daß es jemals anders werden könne.
Zu den bedeutendsten Gogerichten des Münsterlandes gehörte das zu Sanden. Ich glaube nicht, daß meine Leser den Ort in einer Geographie oder auf einer Landkarte noch antreffen werden; einen Grund wüßte ich ihnen wahrhaftig nicht dafür anzugeben, wenn sie ihn nicht eben in der nachfolgenden Tatsache finden wollen.
Vorstand des Gogerichts zu Sanden war in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der Gograf Schirmer. Er war ein sehr strenger, aber auch ebenso gerechter Mann. Er war wegen seiner Strenge ebensosehr gefürchtet als wegen seiner Gerechtigkeit allgemein geachtet. Er konnte als unumschränkter Herr in der Gaugrafschaft, in »seinem Gogericht«, sein, und er war es; denn der Gerichtsherr war seit Menschengedenken nicht in der Heimat gewesen. Das Gericht gehörte einem Zweige der alten münsterschen freiherrlichen Familie von Droste an, der schon seit mehreren Generationen in Österreich lebte; der gegenwärtige Freiherr war österreichischer Gesandter in Neapel. Der Gograf Schirmer regierte in solcher Weise gleich einem absoluten Landesherrn. Aber es gab in dem ganzen Gogerichte keinen Menschen, der sich über irgendeinen unberechtigten Eingriff, über irgendeine Eigenmacht von seiner Seite beklagen konnte. Über Härte glaubte wohl mancher klagen zu können; aber wenn er seine Beschwerde einem Unparteiischen oder Unbefangenen vortrug, so wurde es diesem leicht, ihn zu überzeugen, daß der Gograf zwar nach der Strenge der Gesetze, aber auch nur nach dieser verfahren habe. Der Gograf Schirmer gehörte zu denjenigen Beamten, die das Amt von ihren Vorfahren ererbt hatten. Sein Vater war Gograf zu Sanden gewesen, sein Großvater war es gewesen, sein Urgroßvater und so weiter, soweit die Archive des Gogerichts reichten. Er selbst sollte indes das Amt nicht vererben, er hatte keinen Sohn.
Er war verheiratet, ob glücklich oder nicht glücklich, das war eine nicht wohl zu lösende Frage. Er zählte schon einige dreißig Jahre, als er zur Ehe schritt. Früh seinem etwas kränklichen Vater adjunktiert, dann selbständiger Verwalter des Amtes, war er immer vollauf mit Geschäften beladen gewesen, und er hatte kaum Zeit gehabt, an das Heiraten zu denken. Auch keine rechte Gelegenheit, denn zu den freiherrlichen Töchtern, die in der Gegend lebten, durfte der freiherrliche Beamte seine Augen nicht erheben, und andere junge »Frauenzimmer« der Umgegend standen zu tief unter ihm. Damals hatte die Französische Revolution noch nicht nivelliert, und man hatte noch sehr strenge Begriffe und Urteile über Mißheiraten. Da hatte er zu einer Zeit eine Geschäftsreise nach Münster zu machen und dort mehrere Wochen sich aufhalten müssen. Seine Geschäfte betrugen Geldangelegenheiten seines Gerichtsherrn, des österreichischen Gesandten in Neapel. Sie brachten ihn mit den ersten Rentiers und Bankiers Münsters zusammen, und diese brachten ihn wieder in die ersten Gesellschaften Münsters, freilich nur in die ersten bürgerlichen. Denn, wie gesagt, es fehlte damals noch das Nivellement der Französischen Revolution, und der münstersche Adel war auch äußerlich, auch durch seinen Umgang, auf das strengste kastenmäßig von den Bürgern geschieden. Selbst nur eine annähernde Vermischung beider Stände durch die höchsten Spitzen des einen und etwaige untere Sprossen des anderen wäre zu jener Zeit ebensowohl eine soziale als selbst politische Unmöglichkeit gewesen. In Münster konzentrierte sich damals mehr als zu anderer Zeit der Adel des Landes. Es hatte dort der Fürstbischof seine Residenz. Die Fürstbischöfe Münsters waren gerade in jener Zeit österreichische Erzherzöge. Das alles hatte großen Reichtum und auch großen Aufwand nach Münster gezogen, nicht bloß in die adeligen, auch in die bürgerlichen Kreise und Gesellschaften.
In diese bürgerlichen Gesellschaften der Hauptstadt des Landes wurde der Gograf Schirmer eingeführt. Er war ein sehr wohlgestalter Mann in der vollen Blüte und Kraft des männlichen Alters. Er wußte sich mit sicherer, selbst feiner Sitte zu benehmen. Den tüchtigen, gewandten Juristen und Geschäftsmann hatte der in der Umgegend von Sanden wohnende Adel oft zu Rat und Tat in Anspruch genommen. Er war bei solchen Gelegenheiten zu der adeligen Tafel gezogen; selbst bei der gnädigen Frau zum Tee war er manchmal, wie man jetzt an den Höfen sagt, befohlen worden. Zu dem allen war er ein sehr wohlhabender, gar ein reicher Mann; seine Vorfahren waren nicht umsonst ein paar hundert Jahre lang Gografen zu Sanden gewesen.
Die jungen Damen der Gesellschaft – in der Hauptstadt hießen sie damals schon Damen – behandelten ihn begreiflich mit großer Aufmerksamkeit. Unter ihnen zeichneten sich und zeichneten ihn besonders die Töchter eines reichen Bankiers aus, der zugleich den Titel eines hochfürstlichen Geheimrats führte. Thresette Lindemann war zwar nicht mehr ganz jung, sie zählte sechs-, siebenundzwanzig Jahre. Aber sie war eine Schönheit, und sie hatte ihre Schönheit sehr zu konservieren gewußt. Es war ihr in ihren noch jüngeren Jahren viel der Hof gemacht von jungen Domherren in Münster und von jungen, namentlich preußischen Lieutnants in den Bädern von Pyrmont und Hofgeismar. Allein, ist es eine Schuld einer jungen und schönen Dame, wenn ihr der Hof gemacht wird? Und weiter wußte man zuletzt der schönen Dame nichts nachzusagen. Wohl aber war sie die Zierde, und zwar die liebenswürdigste Zierde, der Zirkel Münsters.
Der Gograf Schirmer konnte der Auszeichnung der ersten Dame des bürgerlichen Münsters nicht widerstehen. Er zeichnete bald auch sie aus. Nach einem halben Jahre war die schöne Thresette Lindemann Frau Gogräfin Schirmer.
Freilich hieß es einige Zeit nachher, der Geheime Rat Lindemann habe in der letzteren Zeit bedeutende Verluste gehabt, und er mußte sich sehr zurückziehen. Als er ein paar Jahre nachher starb, fand sich, daß er arm gestorben war; aber das war ein Unglück, für das die schöne Thresette Lindemann nicht konnte. Freilich ließ die Frau Gogräfin sich dadurch nicht abhalten, jeden Sommer in die Bäder zu gehen und jeden Winter ein paar Monate Gesellschaften, Konzerte und Maskenbälle in Münster mitzumachen; aber ihr Mann war ja ein reicher Mann, und seine Zinsen und sein Amtseinkommen wurde durch solche Reisen und Vergnügungen und den Putz und anderen Aufwand, den sie erforderten, noch lange nicht aufgezehrt. Zwar war auch die junge Frau in den Bädern wie in Münster immer von einem großen Schwarm von Anbetern umgeben, und im Frühjahr und im Herbste kamen, anfangs nach und nach, später regelmäßig, Husarenlieutnants und Domherren nach Sanden geritten und gefahren, bloß um der Frau Gogräfin ihre Verehrung zu bezeigen und ihr die Zeit des einsamen Landlebens zu verkürzen. Allein, ist es denn etwas Unnatürliches, oder muß man gerade etwas Schlimmes dabei denken oder sofort Vorwürfe bei der Hand haben, wenn eine junge, schöne und liebenswürdige Frau jung, schön und liebenswürdig gefunden wird? Blieb sie dieses alles doch auch für ihren Mann. Und im übrigen war der Gograf weder durch die Reisen noch durch die Besuche viel geniert; denn daß er seinen Geschäften sich entziehe, verlangte seine Frau durchaus nicht. Und der Geschäfte hatte er eine solche Menge, daß er vom Morgen bis zum Abend hinlänglich damit zu tun hatte, und er nahm sich ihrer mit einem solchen Eifer an, daß man meinen konnte, er habe für nichts anderes Sinn mehr als für seine Geschäfte, und daß er zuletzt in der Tat für nichts anderes Sinn mehr hatte.
So führten die beiden Eheleute nicht nur ein recht regelmäßiges, sondern auch für beide Teile recht angenehmes und jedenfalls durchaus friedliches Leben miteinander. Und dieses Leben beschränkte sich nicht etwa auf die erste Zeit ihrer Ehe, solange die Frau Gogräfin noch eine junge Frau war, sondern es erhielt sich auch bis in spätere Zeit, ja, es bestand noch, als die Frau Gogräfin bereits zwei-oder dreiundfünfzig und der Gograf mithin ein-bis zweiundsechzig Jahre zählte. Das hatte aber folgenden Grund: Die Frau Gogräfin hatte ihrem Mann, wenn auch keinen Sohn, doch schon gleich in den ersten Jahren ihrer Ehe zwei Töchter geschenkt, die zu ebenso schönen und liebenswürdigen Damen heranwuchsen, wie ihre Mutter war. Indem nun zugleich die Mutter, wenn eben nicht immer jung, doch schön und liebenswürdig geblieben war, bis die Töchter in solcher Weise herangewachsen waren, so wurde auch das Anbeten sowohl in den Bädern, in den Gesellschaften und auf den Bällen Münsters als auch auf dem Amthause zu Sanden nicht im geringsten unterbrochen. Und die Zahl der Anbeter nahm nicht etwa ab, nahm vielmehr zu, indem zu den älter gewordenen Domherren und zu Rittmeistern, Majoren oder gar Obersten avancierten Lieutnants wieder jüngere Domherren und neue Lieutnants hinzukamen – und andererseits der Gegenstand ihrer Anbetung nicht bloß die schöne Frau, sondern auch neben ihr ihre schönen Töchter waren.
Nur seit einiger Zeit waren auf einmal die Anbeter ausgeblieben, sowohl für die Mutter als für die Töchter. Das mußte seine besonderen Ursachen haben, über die man freilich nicht viel erfahren konnte, vielleicht aber desto mehr sprach. Die Mutter hatte mit den Töchtern sich im vorletzten Winter ungewöhnlich lange in Münster aufgehalten. Es war dann im Frühjahr ein ungewöhnlich reges Leben in Sanden gewesen, nicht bloß bei Tage, denn bis tief in die lauen und duftigen Mainächte hinein hatte man in dem großen Amtshausgarten und selbst in dem daranstoßenden und größeren Park des freiherrlichen Schlosses Musik und Gesang, Tanz und Gelächter gehört, und manche Leute wollten auch leises Seufzen und Liebesgeflüster vernommen haben. Das dauerte, bis man im Sommer nach Pyrmont aufbrach. Nach Beendigung der Badesaison war noch eine Reise gemacht. Im Herbst erst war man nach Sanden zurückgekehrt. Aber die Rückkehr war nicht völlig so lustig wie die Abreise gewesen. Marianne, die jüngste Tochter, kam krank heim und ließ sich im eigentlichen Sinne des Wortes außer in ihrer Stube gar nicht mehr sehen. Mit ihrer Gesundheit fehlte auch die Zahl der Anbeter, die auf ihren Anteil kamen. Die Mutter war fortwährend verstimmt, unruhig, manchmal wie von einer inneren großen Angst; aufgejagt, auch von ihren Anbetern fehlten deshalb mehrere. Ludmilla die älteste Tochter, blühte zwar noch voll in ihrer Schönheit und in ihrem Antlitze, aber sie hatte einen anderen, zuletzt noch weit größeren Fehler heimgebracht als Mutter und Schwester. Sie legte nämlich sehr deutlich an den Tag, daß aus dem bisherigen Spielen ein Ernst werden, daß einer von ihren Anbetern sie heiraten müsse; sie wollte gnädige Frau werden. Das entfernte ihre Anbeter noch mehr.
Nur die frivolsten blieben. Und auch für diese war bald kein Bleibens mehr, und in dem Amtshause zu Sanden, in dem schönen Amtsgarten und in dem freiherrlichen Parke wurde gar keine laute Fröhlichkeit und noch weniger leises Liebesgeflüster gehört. Das aber hatte folgenden Grund:
Zu Schloß und Amt Sanden gehört das Dorf Sanden. In dem Dorfe Sanden wohnte ein alter Musikus, Hallbauer mit Namen. Er hatte – denn er war jetzt Invalide – viele Instrumente gespielt, vorzüglich aber die Trompete; er hieß daher unter den Leuten der alte Trompeter. Musikanten erwerben gewöhnlich nicht viel oder können selten das Erworbene zusammenhalten. So war es auch dem alten Trompeter ergangen. Er besaß zwar, von seinem Vater ererbt, ein eigenes Haus mit einem Gärtchen dabei, aber außerdem blutwenig. Doch hatte er eine sehr schöne Tochter, und in Köln am Rheine lebte von ihm eine Schwester, der es dort gut ging und die ihn unterstützte. Diese nahm auch seine schöne Tochter Anna zu sich, als das Mädchen siebzehn Jahre alt war, um sie etwas Ordentliches lernen zu lassen, Nähen und Schneidern, daß sie künftig ihr Brot sich selber verdienen könne. Nachdem die Tochter vier Jahre fort gewesen war, wurde der alte Trompeter blind und überhaupt körperlich sehr hinfällig. Das war der Tochter nach Köln am Rheine gemeldet, und eines Tages erschien im väterlichen Hause zu Sanden Anna Hallbauer, um bei ihrem alten, elenden Vater zu bleiben und ihn zu hegen und zu pflegen. Sie tat das mit der hingebendsten, treuesten kindlichen Liebe. Wenngleich sie nun schon darum ein sehr eingezogenes Leben führte und außer ihrem Hause und Garten fast nur in der Kirche, und zwar nur in der wenig besuchten Frühmesse, gesehen wurde, so hatte sie nicht vermeiden können, die besondere Aufmerksamkeit gewisser Personen auf sich zu ziehen.
Haus und Garten des Musikus Hallbauer lagen dicht hinter dem großen Garten des Amtshauses, in welchem der Gograf Schirmer mit seiner Familie wohnte. Jener kleine und dieser große Garten waren nur durch einen schmalen Wiesenraum voneinander getrennt. Anna Hallbauer war in demselben Herbst in das väterliche Haus zurückgekehrt, in welchem Frau und Töchter des Gografen teils verstimmt, teils krank, teils sonst unliebenswürdig, aber immer noch mit einigen Anbetern zurückgekommen waren. Diese letzteren hatten auf ihren Promenaden in dem Amtshausgarten nebenan in dem kleinen Trompetergärtchen die Musikantentochter gesehen, wenn sie die Weintrauben für ihren Vater oder eine Aster für sich pflückte. Anna Hallbauer war ein sehr schönes Mädchen, schöner als die schöne Gogräfin und ihre beiden Töchter zusammen; denn sie hatte vor diesen zugleich etwas voraus, was ihr, vielleicht selbst in den Augen frivoler Husaren – und anderer Lieutnants, einen ganz besonderen Reiz verleihen mußte: Ihr ganzes Wesen war mit der liebenswürdigsten, anspruchslosesten Sanftmut und Sittsamkeit wie übergossen. Dem bloßen Sehen der Herren waren bald sehnsüchtige, dann dreistere, darauf dringende Blicke gefolgt und, als nun trotzdem diese alle nicht erwidert, nicht einmal beachtet wurden, endlich verstohlenes Einschleichen in den kleinen Garten, verstohlen freilich bloß gegenüber den Bewohnern des Amtshauses. Die Musikantentochter war nur eine Landschöne. Sie war zwar längere Zeit in einer großen Stadt gewesen, und sie kam mit dem vollen Anstande und in der geschmackvollen Kleidung einer Großstädterin zurück, aber die große Stadt war das gerade damals sehr unheilige heilige Köln. Und warum kehrte das Landmädchen mit solchem Anstande und so aufgeputzt wie eine Stadtmamsell auf das Land in das arme väterliche Haus zurück? Anna Hallbauer hatte die Eindringlichen entschieden zurückgewiesen, sie hatte mit ihrem Vater, mit dem Amtshause gedrohet. Allein das half nur für den Augenblick; das Landmädchen hatte es mit vornehmen Herren zu tun. Eines Tages indes sollte ihre Drohung mit Vater und Amtshaus zu gleicher Zeit erfüllt werden.
Es war ein heller Herbsttag. Anna hatte ihren Vater in das Gärtchen geführt; er saß in der Sonne hinter einem dichten Rebengeländer. An der anderen Seite des Geländers stand sie, nach ihren Herbstblumen zu sehen. Von drüben her aus dem Amtsgarten hatte sie einer der Offiziere vom Amtshause gesehen, er hatte aber auch nur sie, nicht den Vater gesehen. Gewandt und leise hatte er Hecken und Zäune übersprungen, und ehe das Mädchen nur seine Nähe ahnte, stand er vor ihr. Sie erschrak und wollte fliehen; er hielt sie zärtlich fest. Aber das alles hörte der blinde Musikant auf der anderen Seite, und der grobe Trompeter rief sehr zornig und laut dem Husaren zu, er solle sich augenblicklich wieder hinscheren, woher er gekommen sei, dort, auf dem Amtshause, habe er ja Liebeleien genug. In dem Amtsgarten war unbemerkt hinter ihm hergekommen die schöne Gografentochter Ludmilla. Sie hatte seine Sprünge über Zäune und Hecken bemerkt; sie war ihm bis an die Grenze des Amtsgartens gefolgt und hatte die groben Worte des Trompeters gehört. Um ihr Unglück, aber auch ihren Zorn, ihre Wut voll zu machen, war gerade dieser Offizier ihr treuester Anbeter und derjenige, auf den sie die festesten Heiratshoffnungen gesetzt hatte. Der arme Mensch kam bei seiner Rückkehr aus dem Trompeter-in den Amtsgarten aus dem Regen unter die Traufe. Genau bekannt wurde nicht, was zwischen ihm und der Dame vorgefallen war. Genau bekannt wurde auch nicht, was er darauf mit den anderen fremden Herren verhandelt haben mochte, die sich mit ihm im Amtshause auf Anbetung noch befanden. Aber er reiste noch denselben Abend ab und mit ihm seine näheren Bekannten. In den nächsten zwei Tagen folgten ihm die sämtlichen übrigen.
So war das Amtshaus zu Sanden auf einmal sehr leer und still geworden. Die arme Marianne blieb krank und ließ sich nach wie vor nicht sehen. Die Mutter und Ludmilla wurden immer verstimmter; die Mutter zugleich immer unruhiger, als wenn sie irgendein großes Unglück zu befürchten habe. Unter solchen Umständen ging sie, als der Winter kam, nicht einmal nach Münster, das erstemal nicht seit mehr als fünfundzwanzig Jahren.
Auch Ludmilla ging daher nicht hin, von der kranken Marianne verstand es sich von selbst.
Das war ein trauriger Winter in dem Amtshause zu Sanden.
Der alte Gograf nur wurde ihn nicht gewahr. Er lebte schon lange einzig und allein für seine Geschäfte.
Der traurige Winter war vorüber. Ein nicht besseres Frühjahr war ihm gefolgt; es nahte sich gleichfalls seinem Ende. Dieses Ende sollte eine Veränderung für die Familie Schirmer bringen.
Es war an einem Nachmittage zu Ende des Monats Mai. Der Gograf Schirmer hatte wie gewöhnlich bis Mittag in der Amtsstube gearbeitet. Mit dem Glockenschlage zwölf war er nach Hause gekommen; die Amtsstube befand sich in einem Nebengebäude des Amtshauses. Das Mittagessen hatte schon bereitgestanden; er hatte es mit seiner Frau und Ludmilla – Marianne lag wie immer krank in ihrer Stube – verzehrt, er hatte dann seinen Mittagsschlaf gehalten und war wieder mit Frau und Tochter in dem Familienzimmer, um den Kaffee einzunehmen.
Der Gograf, obwohl schon im Anfange der sechziger Jahre, war noch ein sehr rüstiger, kräftiger Mann. Er war groß und stark gebaut und hielt sich noch völlig gerade; sein Haar fing kaum an, in den Spitzen sich etwas grau zu färben. Die Züge seines etwas starkknochigen Gesichts zeigten eine gewisse Strenge, wohl eigentlich nur die Gewohnheit der Strenge, denn im tieferen Grunde bemerkte man sogar den Ausdruck von Gutmütigkeit. Er schien zu denjenigen Beamten zu gehören, die von Natur sogar mild sind, aber keine Pflicht und in ihrer Pflichttreue zuletzt dann keine andere Gewohnheit mehr kennen, als die volle Strenge des Gesetzes zu vertreten. Daher sind sie dann aber auch oft außer ihrem Amte desto nachgiebiger, oft gerade am meisten in ihrer Familie.
Wie der Gograf seine Rüstigkeit, so hatte die Gräfin noch immer ihre Schönheit bewahrt. Ihre Taille war fein, ihre Gesichtszüge waren regelmäßig, ihr Teint war rein und durchsichtig geblieben, ihre Zähne waren vollständig und blendend weiß. Sie war vielleicht ein wenig zu mager geworden, und ihr Blick war zu leidend sehnsüchtig. Aber das war keine Magerkeit und leidende Sehnsucht, die nach dem Genüsse der Freuden des Lebens zum Himmel hindeuten, man glaubte vielmehr eine neue Sehnsucht gerade nach jenen Freuden des Lebens zu gewahren, und das gab, man kann es nicht leugnen, der schön gebliebenen Frau einen Reiz.
Ludmilla war so schön und so reizend, daß man, wenn man angesichts ihrer frischen Schönheit solche Betrachtungen hätte anstellen mögen, sich sagen mußte, im Alter der Mutter werde sie vielleicht noch schöner sein als diese jetzt.
Der Gograf rauchte bei seiner Tasse Kaffee. Ludmilla las in einem Roman. Die Gogräfin war in Nachsinnen versunken. Sie mußte etwas auf dem Herzen haben. Ludmilla schien dies übrigens zu wissen, denn sie sah von ihrem Buche manchmal nach der Mutter hin, als wenn sie diese fragen wolle, ob es denn noch nicht bald Zeit sei.
Es war Zeit.
»Lieber Schirmer«, hob die Gogräfin zu ihrem Manne an, »Mariannens Zustand will sich noch immer nicht bessern.« »Leider nicht«, erwiderte der Gograf, »was ist das nur mit dem Kinde?«
»Ich begreife es auch nicht. Weiß doch selbst der Amtsphysikus nicht, was er daraus machen soll. Aber anders muß es mit ihr werden.«
»Das muß es.«
»Ich hatte schon daran gedacht, den Medizinalrat aus Münster kommen zu lassen; allein, er ist doch ein zu alter Mann. Die jungen Ärzte dort haben noch keine Erfahrung. Es wird daher nichts übrigbleiben, als daß ich diesen Sommer dem Kinde das Opfer einer Badereise bringe.«
Der Gograf sah seine Frau eigentümlich fragend an.
Sie fuhr schnell fort: »Nicht nach Pyrmont oder Hofgeismar. Ich wollte mit ihr nach Ems gehen. Der Aufenthalt soll dort traurig sein, denn das Bad ist nicht in Aufnahme, aber nach allem, was ich darüber gehört und gelesen habe, paßt es für den Zustand Mariannens, und der dortige Brunnenarzt ist als einer der ausgezeichnetsten Arzte bekannt.«
Der Gograf sah seine Frau wieder an; diesmal etwas mißtrauisch und daher nur von der Seite. Er fand in der Tat keinen Hintergedanken in ihrem Auge.
»Du meinst also wirklich, Thresette?«
»Wenn du nichts dagegen hättest!«
»Wie könnte ich für das Wohl unseres Kindes!«
»Ludmilla begleitet uns natürlich?«
»Ich habe nichts dagegen.«
»Und wann könnten wir abreisen? Ich fürchte, wir haben schon zu lange gezögert.«
»Ich habe nichts dagegen, daß ihr abreist, sobald ihr alle Eure Anstalten getroffen habt.«
»Deren sind nicht viele, zumal da es sich ja nur um die Genesung der Kranken handelt.«
»Desto besser.«
»Also vielleicht schon in der nächsten Woche, wenn du nicht etwas anderes bestimmen möchtest?«
Der Gograf wollte antworten, als rasch und laut an die Türe geklopft wurde. Ein Untervogt des Gerichts trat in das Zimmer. Der Mann trat mit einem wichtigen, etwas feierlichen und doch auch wieder etwas verstörten Gesicht ein.
»Herr Gograf«, begann er, »da ist soeben eine große, schreckliche Entdeckung gemacht worden.«
»Sofort heraus damit, Vogt, ich liebe die Umwege nicht.«
»In dem Teiche hinter dem herrschaftlichen Parke, Sie wissen, Herr Gograf, gerade an dem kleinen Tannenwäldchen, hat man die Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden.« »Was? Was?« rief der Gograf, in seinem Diensteifer aufspringend.
Ludmillas bemächtigte sich ein natürliches Entsetzen, sie mußte ihr Buch auf die Seite legen.
Die Gogräfin war leichenblaß geworden. Sie wollte, wie um ihre Blässe zu verbergen, eine Tasse Kaffee zum Munde führen; aber ihre Hände zitterten so heftig, daß sie die Tasse nicht aufheben konnte.
Der Gograf in seinem Eifer und Ludmilla in ihrem Entsetzen hatten die Angst der Frau nicht bemerkt.
»Ein Kindermord?« rief der Gograf. »Das ist unerhört im Gogericht. Davon hat man seit Menschengedenken nicht gehört. Und nun gar hier in Sanden selbst! Berichtet das Nähere, Vogt.«
Der Vogt berichtete das Nähere. Es bestand nur in wenigem: Hinter dem freiherrlichen, an dem Schlosse gelegenen Park befand sich ein kleines Tannenwäldchen; hinter dem Tannenwäldchen lag ein Teich von mäßigem Umfange, auf allen Seiten mit dichtem, aber niedrigem Gebüsch umgeben. Der Teich war früher der herrschaftliche Fischteich gewesen,, seitdem aber die Herrschaft abwesend war, schon seit mindestens zwei Menschenaltern nicht mehr benutzt worden, weder als Fischteich noch zu einem anderen Zwecke. Er lag daher, zumal in einer einsamen Gegend, wohin selten jemand kam, völlig vernachlässigt und wüst. Sein Wasser war schlammig und wegen des üppig darin wuchernden und hoch daraus hervorragenden Schilfes kaum zu sehen; an seinen Ufern wuchs das Gebüsch wild und undurchdringlich. Es war selten, daß jemand sich ihm nahte; vielleicht kamen des Jahres kaum drei oder vier Menschen in seine Nähe. An dem Tage, an welchem der Untervogt dem Gografen seinen Bericht abstattete, waren zufällig einige Knaben in das dichte Gebüsch gegangen, um nach späten Vogelnestern zu suchen. Sie hatten dabei auf dem Wasser zwischen dem Schilfe das Pfeifen von Wasserhühnern gehört; neugierig hatten sie durch das Gebüsch sich hindurchgedrängt bis unmittelbar an das Wasser. Als sie dieses erreicht, hatten sie nicht weit von sich in dem Schilfe etwas gesehen, was ihnen wie eine Kindeshand vorgekommen war. Sie hatten sich näher herangemacht und die nackte Leiche eines kleinen Kindes entdeckt.
Erschrocken waren sie fortgelaufen. Zufällig hatten sie in der Nähe den Vogt getroffen, sie hatten ihm Anzeige von ihrer Entdeckung gemacht, und er hatte sich von ihnen zu dem Teiche führen lassen. Er hatte gefunden, was sie ihm mitgeteilt, die Leiche eines neugeborenen Kindes, männlichen Geschlechts, völlig nackt.
Der Gograf hatte den Bericht mit dem Eifer, aber auch mit der Ruhe des Dienstes, namentlich als besonnener Kriminalbeamter, angehört.
»Habt Ihr Spuren einer Verletzung an der Leiche entdeckt?« fragte er den Vogt.
»Eine Wunde zwar nicht, Herr Gograf; um den Hals des Kindes war aber noch ein starker Bindfaden befestigt.«
»Hatte die Leiche schon lange im Wasser gelegen?«
»Sie war schon stark in Fäulnis. Sie kann immer schon ein halbes Jahr dagelegen haben.«
»Wo habt Ihr die Leiche gelassen?«
»Ich habe sie an das Ufer des Teiches gelegt und Wache dabei gestellt, um unterdes hier die Anzeige zu machen.«
»Ihr habt recht gehandelt, Vogt. Kamen Leute herbei?«
»So ziemlich. Die Knaben hatten die Sache im Dorfe bekanntgemacht.«
»Was sagten die Leute? Auf wen rieten sie?«
»Man riet hin und her.«
»Sprach man Namen aus? Der erste Laut der Volksstimme bei einer solchen Begebenheit ist ganz besonders zu beachten.«
»Man nannte nur einen Namen, Herr Gograf. Es war auch nur einer, der ihn aussprach, und auch keiner von den anderen wollte etwas davon wissen.«
»Nun, welcher Name wurde genannt?«
»Die Trompeterstochter …«
»Hm, hm«, sagte der Gograf.
Die leichenblasse Gogräfin aber war aufgesprungen.
»Nein«, sagte sie hastig, »hütet euch vor einem ungerechten Verdacht.« Ruhiger fügte sie hinzu: »Es ist unrecht von den Leuten, so ohne allen Beweis den Namen eines unbescholtenen Mädchens auszusprechen.«
Auch Ludmilla war aufgestanden.
»Unbescholten nennst du die Person, Mutter?« sagte sie scharf. »Ein Frauenzimmer, das ohne Mutter lebt und junge Männer bei sich aufnimmt.«
»Hast du Beweise?« fragte die Mutter beinahe gereizt.
»Durften nicht die Offiziere ungeniert zu ihr in den Garten kommen?«
Der Gograf brach das Gespräch zwischen Mutter und Tochter ab.
»Nur einer, Vogt«, wandte er sich an diesen, »sprach von dem Mädchen? Wer war es?«
»Der Stellmacher Knübbel.«
»Redete er von Beweisen?«
»Er meinte, er könne mancherlei sagen.«
»Vogt«, befahl der Graf, »holt sofort den Gerichtsschreiber und zwei Schöffen auf das Amt, bestellt zugleich den Amtsarzt und den Amtsphysikus dahin und wartet Ihr dann ebenfalls dort. In einer halben Stunde werde ich dasein, um mich mit dem Gerichtspersonal an Ort und Stelle zu begeben und das Weitere zu veranlassen. Den Stellmacher Knübbel laßt sogleich hierher zu mir kommen.«
Der Vogt ging.
Der Gograf maß mit großen Schritten das Zimmer; er machte schon seinen Inquirentenplan. Wenn auch seit Menschengedenken das Verbrechen eines Kindesmordes in seinem Gerichtsbezirke nicht verübt worden, so waren darin doch manche andere, mitunter auch schwere Verbrechen vorgekommen, und der Gograf hatte sich durch deren Untersuchung, durch Ermittlung des Tatbestandes wie durch Überführung der Täter im ganzen Münsterlande den Ruf eines sehr tüchtigen und gewandten Inquirenten, zugleich aber auch eines zwar strengen, aber stets besonnenen, gemäßigten und, soweit die Gesetze es gestatteten, selbst humanen Mannes erworben.
Seine Frau unterbrach sein Nachdenken und seine Pläne. »Schirmer«, sagte sie mit einer Aufregung, die sie nicht ganz zu unterdrücken vermochte, »du wirst in einer so wichtigen, schweren Angelegenheit nicht bloßen Gerüchten vertrauen, nicht wahr?«
»Gewiß nicht, Thresette«, antwortete der Gograf. »Darum eben habe ich den Knübbel zuerst hierher bestellen lassen. Ich will ihn allein, ohne Einmischung des Gerichts, befragen.«
»Er wird gewiß nichts gegen das Mädchen vorbringen können.«
»Ich hoffe es; sie pflegt ihren Vater mit treuer, kindlicher Liebe.«
Ludmilla zuckte etwas höhnisch die Achseln.
Die Mutter sah es.
»Ludmilla«, sagte sie zu der Tochter, »gehe zu Mariannen und trage Sorge, daß sie nicht das geringste von der Sache erfahre. Sie ist so reizbar, ihr ganzes Nervensystem ist so krankhaft erregt, daß diese schreckliche Nachricht, die uns Gesunde schon so sehr angegriffen hat, den nachteiligsten Einfluß auf sie ausüben müßte.«
Die Tochter ging.
»Schirmer«, sagte, als sie fort war, die Frau zu ihrem Manne, »diese unglückliche Geschichte veranlaßt mich zu einer Bitte an dich. Ich fürchte in der Tat für Mariannen, wenn sie davon erführe. Wirst du nichts dagegen erinnern, wenn wir noch in dieser Woche abreisen?«
»Im Gegenteil, Thresette«, antwortete der Gograf, »ich teile ganz deine Befürchtung.«
Auch die Gogräfin verließ das Zimmer.
Einige Augenblicke später trat in dieses der Stellmacher Knübbel. Er hatte das Aussehen eines schlichten, ehrlichen Landhandwerkers. So bewies er sich auch.
»Knübbel«, redete ihn der Graf an, »Ihr habt die Leiche des Kindes gesehen?«
»Ja, Herr Gograf.«
»Haltet Ihr dafür, daß ein Mord begangen ist?«
»Die Schnur lag noch um den Hals, Herr Gograf.«
»Habt Ihr Verdacht auf jemanden?«
»Ehrlich gesagt, nein, Herr Gograf.«
»Knübbel, Ihr habt einen Namen genannt.«
»Herr Gograf«, sagte der Mann mit Wärme und mit Zeichen der Reue, »ich hatte in dem ersten Augenblicke, in dem ersten Schrecken zuviel gesagt. Vergeben Sie es mir. Man kann sich leicht einmal vergessen. Ich weiß nichts, gar nichts gegen das Mädchen.«
»Ihr meint doch die Tochter des Musikus Hallbauer?«
»Die nämliche. Ich weiß wahrhaftig nichts von ihr.«
»Wie war Euch denn ihr Name über die Lippen gekommen?«
»Ich hatte einmal gehört, daß sie in Köln einen Bräutigam habe, der bald kommen werde, sie abzuholen. Er sollte schon im Winter kommen, wie die Leute sagten, ist aber immer ausgeblieben, hat nichts von sich hören lassen, soviel man weiß, und da kam mir denn in dem ersten Schreck der dumme Gedanke.«
»Das war alles?«
»Das ist alles, Herr Gograf. Und dann …«
»Und dann?«
»Der Teich, in dem das Kind gefunden wurde, liegt vom Dorfe über eine Viertelstunde, und in der Nähe ist nur das Schloß des Barons und das Haus des Trompeters.«
»Und dieses Amtshaus!« setzte der Graf hinzu.
»Gewiß, Herr Gograf, und ich sehe immer mehr ein, wie unrecht ich hatte. Vergeben Sie es mir, und vergessen Sie das übereilte Wort ganz. Ich könnte in meinem Leben keine Ruhe mehr haben, wenn ich die Schuld davon trüge, daß dem Mädchen nur das geringste Leid geschehe.« Wieviel Unheil sollte dennoch sein übereiltes Wort anstiften.
»Es ist gut, Knübbel, Ihr könnt gehen«, sagte der Gograf zu ihm. »Nehmt auf ein andermal Eure Zunge besser in acht.« Der Stellmacher ging.
Der Gograf folgte ihm bald, um sich in die Amtsstube zu begeben. Im Vorhause begegnete ihm seine Frau.
»Du kannst dich beruhigen, Thresette«, sagte er ihr im Vorbeigehen, »der Stellmacher wußte nichts gegen das Mädchen. Er gestand selbst, daß er ein übereiltes Wort gesprochen habe.«
»Das freut mich«, erwiderte leichthin die Gogräfin. Beide gingen ihren Geschäften nach. Die Gogräfin traf Anstalten zu ihrer baldigen Abreise, der Gograf begab sich mit den anderen Gerichtsbeamten zu dem Teiche, um den objektiven Tatbestand des vermutlichen Verbrechens festzustellen.
Der Tatbestand eines verübten Kindesmordes wurde wenigstens bis zu hoher Wahrscheinlichkeit ermittelt. Die vorgefundene Leiche zeigte ein neugeborenes, vollständig ausgetragenes Kind; die Schnur, die noch eng und festgebunden um den Hals lag, gab unzweideutig genug zu erkennen, daß sie in der Absicht festgebunden war, das Kind zu erdrosseln. Allerdings war bei dem hohen Grade der Verwesung, in welcher der Leichnam sich bereits befand, nicht mehr festzustellen, ob das Kind in solcher oder anderer Weise wirklich getötet und nicht vielmehr dennoch eines natürlichen Todes gestorben war, ja nicht einmal, ob es überhaupt lebendig geboren sei. Allein ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit mußte, wie gesagt, nach allen feststehenden Umständen hierfür sprechen. Auch nach der Versicherung des Arztes konnte übrigens die Leiche schon seit einem halben Jahre, vielleicht noch länger, fast den ganzen verflossenen Winter hindurch, in dem Wasser gelegen haben.
Von einer Täterin wurde nicht die geringste Spur entdeckt, gegen niemanden wurde irgendein Verdacht erhoben. Das ungewöhnliche Ereignis hatte das ganze Dorf Sanden herbeigezogen, Männer, Frauen und Kinder. Kein Mensch wußte etwas von einem gefallenen Mädchen in dem Dorfe oder in der Umgegend. Kein Mensch konnte gegen ein Mädchen nur den leisesten Verdacht aussprechen, daß man davon geredet habe, es sei nicht richtig mit ihr. Es gibt in Westfalen manche Gegend, wo noch jetzt eine solche Reinheit der Sitten herrscht.
Der Gograf mußte sich darauf beschränken, dem Amtsvogt und sämtlichen Untervögten gemessene Befehle zur Vornahme der genauesten und sorgfältigsten weiteren Nachforschungen zu erteilen. Das war das Resultat eines zweitägigen gründlichen und umsichtigen Inquirierens von Seiten des Gografen. Der Name Anna Hallbauer war dabei kein einziges Mal wieder genannt.
An demselben Tage war die Gogräfin mit ihren beiden Töchtern nach dem Bade Ems bei Koblenz abgereist.
Vierzehn Tage lang hatte man in der Angelegenheit, die gleichwohl fortwährend ungeschmälert die allgemeine Aufmerksamkeit beschäftigte, nichts Neues ermittelt, namentlich nichts über einen Urheber des Verbrechens. Da erschien eines Morgens der Küster des Dorfes bei dem Gografen. Die Küster gehören meist zu den halbgebildeten Menschen, die in keine Klasse der Leute hineinpassen, unter denen sie leben, indem sie für die einen zuwenig, für die anderen zuviel wissen. Sie sind deshalb auch meist närrische Käuze und Menschen, die sich in alles mischen, was sie nichts angeht. So war auch der Küster zu Sanden. Das entdeckte Verbrechen des Kindesmordes war ihm durch den Kopf gegangen, noch mehr, daß kein Urheber ermittelt war. Es war ihm, wie er sagte, als müsse er jetzt jedes Frauenzimmer in der Gemeinde für das Verbrechen verantwortlich machen, das doch nur von einer begangen sein könne. Er wollte das Verdienst haben, diese eine, die rechte, zu ermitteln. Der Stellmacher Knübbel hatte einmal den Namen Anna Hallbauer ausgesprochen. Das Mädchen war in Köln gewesen. Er, der Küster, hatte eine Verwandte in Köln. An diese schrieb er. An dem Tage, als er bei dem Gografen erschien, hatte er Antwort erhalten. Er teilte diese pflichtschuldigst dem Gografen mit. Diese Verwandte schrieb nicht viel Gutes von dem Mädchen: Anfangs, als Anna Hallbauer nach Köln gekommen, habe diese sie manchmal besucht; sie sei ein ordentliches, sittsames, bescheidenes Mädchen gewesen. Später aber sei sie hochmütig, eitel geworden, habe, anstatt ordentlicher, solider bürgerlicher Kleidung, allerlei Fähnchen auf dem Leibe getragen, sei immer seltener und zuletzt gar nicht mehr zu ihr gekommen; und sie, die Verwandte des Küsters, habe nun gehört, daß sie ein leichtfertiges Geschöpf geworden sei, sich namentlich mit einem Buchdruckereibesitzer abgegeben habe und von diesem im Stiche gelassen sei. Verführt und verlassen habe sie denn zuletzt nach Sanden zurückkehren müssen.
Dies berichtete der Küster dem Gografen. Dem Gografen fielen wieder die Worte seiner Tochter Ludmilla bei dem ersten Nennen des Namens Anna Hallbauer in dieser Geschichte ein. Es fiel ihm ein, daß dieser Name doch einmal der zuerst genannte sei; und noch jetzt war er der allein genannte. Er, der vorsichtige Beamte, der er war, empfahl dem Küster das tiefste Stillschweigen und beschloß, wiewohl im stillen, weitere Nachforschungen anzustellen.
Allein der Küster hatte nicht stillschweigen können. Er hatte hier und da, bald beim Schnäpschen mit einem Gevatter, bald beim Kaffee mit einer Gevatterin von seinem Briefe aus Köln gesprochen und so zuerst ein leises und vereinzeltes, dann aber ein allgemeines, lautes Gespräch erregt, nach welchem die Trompeterstochter in schrecklicher Weise, nach einigen sogar mit unmittelbarer Hilfe des leibhaftigen Satans, am Teiche hinter dem Schloßgarten ihr Kind umgebracht und in das Wasser geworfen habe. Dem Gografen wurde alles dieses Geschwätz brühwarm von berufenen und unberufenen Leuten zugetragen, von seinem Amtsvogte, von den Untervögten, von dem Küster, von andern. Es enthielt aber keine Tatsachen, und der verständige Beamte gab nichts darauf.
Allein, das Geschwätz war zuletzt auch einer alten, tauben Bäuerin zu Ohren gekommen, und als diese es mühsam vernommen und verstanden hatte, schlug sie die Hände über dem Kopfe zusammen und erzählte eine schreckliche Geschichte, in welcher denn freilich auch Tatsachen enthalten waren. Zu Ende des vorigen Herbstes war die alte Frau einmal spät in der Nacht von ihrer verheirateten kranken Tochter, die seitab vom Dorfe in der Bauerschaft wohnte, zurückgekehrt. Es war ein kaltes und stürmisches Wetter gewesen; der Wind hatte geheult, und hinten in den Wäldern hatte man die alten Eichen krachen gehört; vom Himmel war der Schnee so dicht und so dick gefallen, daß man keine zehn Schritte weit hatte sehen können. Ihr Weg hatte sie zuerst an dem Amtshausgarten und dann an dem Hause des Trompeters vorbeigeführt. Als sie dieses hinter sich gehabt, hatte sie rechts an dem Schloßgarten vorbei in das Dorf nach Hause gehen wollen. Auf einmal, hinter dem Hause des Trompeters, sah sie vor sich eine schneeweiße Gestalt, die bald langsam, bald geschwind vor ihr her ging und sich zuletzt links zu dem Teiche am Schloßgarten wandte, wo sie verschwand. Sie hatte die Gestalt für ein Gespenst gehalten, denn es war bekannt, daß in dem herrschaftlichen Schlosse eine weiße Jungfrau umgehe, die auch wohl des Nachts sich weiter in die Heide hinein begebe. Deshalb war die Frau auch der Gestalt nicht gefolgt, ja, sie hatte nicht einmal gewagt, von der Geschichte zu erzählen, da sie damals oft in der Nacht zu ihrer kranken Tochter mußte und sie gefürchtet hatte, wenn sie von dem Gespenst erzähle und so diesem neugierige Leute auf den Weg locke, so möge es ihr dafür einen Schabernack antun. Sie hatte übrigens die Erscheinung später nie wieder gesehen.
Auch das wurde dem Gografen hinterbracht. Er selbst befragte die alte Frau. Sie bestätigte ihm alles wörtlich.
Bei dem Manne der strengen Pflicht war jetzt eine sehr ernste Stunde gekommen. Anna Hallbauer hatte in Köln den Ruf eines leichtsinnigen Lebenswandels zurückgelassen, sie sollte sogar von einem Liebhaber verlassen sein. Sie war plötzlich, freilich unter dem plausiblen Vorgeben, ihren blinden Vater zu pflegen, nach Hause zurückgekehrt, sie hatte hier sehr eingezogen gelebt und geflissentlich vermieden, sich vor den Leuten sehen zu lassen. Umgang hatte sie mit niemandem im Dorfe gehabt. Dagegen hatte seine, des Gografen eigene Tochter fallenlassen, daß Offiziere zu ihr in das Haus gekommen seien. Vor einem halben Jahr war eine wie bleiche Gestalt in stürmischer Herbstnacht einsam, mit schwankendem Gange auf dem Wege von ihrer Wohnung nach dem Teiche gesehen worden. Um dieselbe Zeit mußte, nach dem Befunde des Arztes, die Leiche des ermordet gefundenen Kindes in den Teich geworfen sein.
Der Gograf suchte einen halben Tag nach einem Entschlusse. Er schlug die »Peinliche Gerichtsordnung« von Kaiser Karl V. auf, er studierte in allen Kommentaren zu diesem Gesetzbuche; er ging bis auf Matthäi, bis auf den alten Carpzov, selbst bis auf Damhouder zurück. Es blieb ihm nichts anderes übrig: ein Verdacht war einmal gegen eine bestimmte Person erhoben; dieser Verdacht mußte weiter verfolgt werden, bis er wieder verschwand oder zur Gewißheit wurde. Der Gograf ließ den Amtsvogt zu sich rufen.
Wie der Gograf in seinem Bezirke der Chef aller Regierungsgewalten war, so war der Amtsvogt sein Unterchef für die eigentliche vollziehende Gewalt, also eine sehr angesehene Person, freilich dennoch immer ein Subalternbeamter. Er erhielt deshalb auch in jener Zeit der strengen Etikette von seinem Vorgesetzten nicht das Prädikat Herr und wurde nicht mit Sie, aber auch nicht mit Ihr, sondern mit Er angeredet.
»Amtsvogt«, sagte der Gograf zu dem Beamten, »ich habe einen Auftrag an Ihn, den eigentlich der Untervogt ausführen sollte. Es ist aber ein rücksichtsvolles und menschliches Vorgehen nötig, und darum wende ich mich an Ihn. Er kennt die Gerüchte gegen die Hallbauerin in betreff des ermordeten Kindes. Nach den Rechten muß die Person nunmehr vernommen werden; es liegt aber noch nicht so viel vor, daß sie arretiert werden kann. Hole Er sie daher einfach zu mir ab, mit dem Andeuten nur, daß ich mit ihr zu sprechen habe. Beileibe sage Er ihr nicht den Grund des Vorführens.«
Der Amtsvogt entledigte sich seines Auftrags ganz im Sinne seines Vorgesetzten.
Er brachte die Hallbauerin zum Amte.
Der Gograf wartete ihrer hier. Bei ihm war nur der Gerichtsschreiber. Die gewöhnlichen beiden Gerichtsschöffen hatte er nicht zugezogen; denn wenn er auch ein Verhör anstellen wollte, so war dies doch noch kein eigentliches Kriminalverhör vor besetzter peinlicher Bank.
Anna Hallbauer erschien in der Gerichtsstube. Sie war eine große, schöne Gestalt. Ihr feines, blasses Gesicht zeichnete, wie ihre ganze Erscheinung, sich besonders durch ein bescheidenes, sinniges, beinahe melancholisches Wesen aus. Sie bewegte sich übrigens mit städtischem Anstande, so wie auch ihre Kleidung eine zwar einfache, aber doch kleidsam gewählte städtische war. Sie trat dem Anschein nach sehr unbefangen, wenngleich mit dem Ausdrucke einiger Neugierde vor den gestrengen Richter, der sie zum erstenmal sah und auch sie nicht ohne Neugierde betrachtete.
»Ich habe einige Fragen an Sie zu richten«, hob der Gograf zu ihr an. »Ich erwarte von Ihr, daß Sie mir mit der vollen Wahrheit antworte.«
»Ich werde Ihnen nur die Wahrheit sagen«, antwortete das Mädchen in bescheidenem Tone.
»Wie lange war Sie in Köln?«
»Etwas über vier Jahre.«
»Bei wem war Sie dort?«
»Bei meiner Tante, der verwitweten Klempnermeister Klöpper.«
»Hat Sie immer bei der gewohnt?«
»Nur die ersten zwei Jahre. Sie hatte mich das Schneidern lernen lassen, und darauf bezog ich eine eigene Wohnung.«
»Lebte Sie dort allein?«
»Ich wohnte allein; ich arbeitete aber den Tag über in den Häusern bei den Familien.«
»Hatte Sie Bekanntschaften?«
»Welche Bekanntschaften?« fragte das Mädchen mit einigem Zögern.
»Ich meine von jungen Männern.«
Anna Hallbauer errötete.
»Nein«, sagte sie, aber wieder zögernd.
»Es ist doch davon gesprochen?«
»Ein junges Mädchen, das allein wohnt, zumal in einer großen Stadt, ist dem Gerede der Leute oft ausgesetzt. Aber darf ich wissen, Herr Gograf, warum Sie alle diese Fragen an mich richten?«
Der Gograf besann sich ein paar Sekunden; dann sagte er, indem er sie fest und scharf anblickte, mit erhöhter Stimme: »Hat Sie von dem Kindesmorde gehört, der hier vor einigen Wochen an das Tageslicht gekommen ist?«
Anna Hallbauer wurde plötzlich sehr blaß.