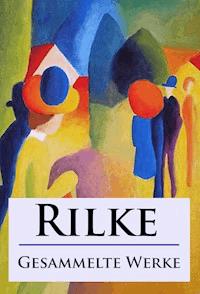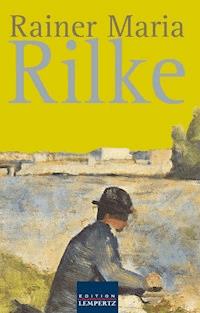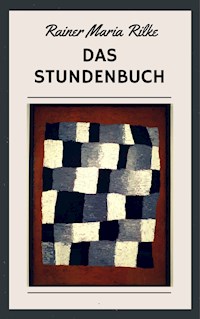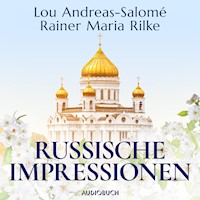1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Gesammelte Schriften zu Kunst und Literatur" versammelt Rainer Maria Rilke eine eindringliche und facettenreiche Reflexion über die Kunst, die Literatur und die gesellschaftlichen Implikationen dieser Ausdrucksformen. Rilke, bekannt für seine lyrische Sprachkraft, bedient sich eines analytischen Stils, der sowohl philosophische als auch emotionale Dimensionen anspricht. Diese Sammlung gibt Einblicke in seine Ansichten über die Rolle des Künstlers in der modernen Welt und dessen Beziehung zur Schöpfung, die gängige Wahrnehmung von Kunst hinterfragt und den Leser zu einer tiefen Auseinandersetzung mit der Ästhetik und dem schöpferischen Prozess anregt. Rainer Maria Rilke, geboren 1875 in Prag, gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts. Sein tiefes Interesse an der menschlichen Existenz und der spirituellen Dimension des Lebens prägt sein Werk bis heute. Rilkes zahlreiche Begegnungen mit Künstlern und Intellektuellen in Europa, sowie seine große Sensibilität für das Schöne und seine philosophischen Überlegungen zum Leben, haben ihn dazu inspiriert, diese wichtigen Schriften zu verfassen, die nicht nur sein literarisches Schaffen reflektieren, sondern auch seinen unermüdlichen Drang nach Wahrheit und Verständnis. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die sich für die Schnittstellen von Kunst und Literatur interessieren. Rilkes scharfsinnige Beobachtungen und seine Fähigkeit, tiefere Bedeutungen zu erfassen, machen diese Sammlung zu einem wertvollen Archiv für Künstler, Literaturwissenschaftler und Leser, die sich mit den komplexen Fragen des kreativen Schaffens auseinandersetzen wollen. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Kunst zur Sprache wird und das Leben selbst als künstlerisches Werk erkannt wird. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gesammelte Schriften zu Kunst und Literatur
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Sammlung Gesammelte Schriften zu Kunst und Literatur versammelt Rainer Maria Rilkes Prosaschriften, Kritiken, Betrachtungen und Briefe, die sich im weitesten Sinn der Kunst und der Dichtung widmen. Sie führt durch Jahrzehnte seines Denkens und Schreibens, von frühen Programmen bis zu spätem Rat. Der Band versteht sich nicht als Gesamtausgabe, sondern als thematisch gebündelte Zusammenstellung: Er will den Dichter jenseits seiner Lyrik sichtbar machen – als Seher, Leser, Gesprächspartner der Künste. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen mit Werken, Künstlerinnen und Künstlern, Büchern und Formen; daraus entsteht ein Panorama von Rilkes ästhetischer Reflexion und ihrer Wirkung auf sein Schreiben.
Die hier vertretenen Gattungen sind vielfältig: monografisch ausgreifende Studien wie Worpswede und Auguste Rodin; poetologische Entwürfe und Essays wie Notizen zur Melodie der Dinge, Über Kunst, Der Wert des Monologes und die daran anschließende Erwiderung; feuilletonistische Miniaturen und Prosaskizzen wie Intérieurs; literaturkritische Besprechungen zu zeitgenössischen Autorinnen und Autoren; dazu Briefe, die zu eigenständigen Texten geworden sind, etwa Briefe an einen jungen Dichter und Der Brief des jungen Arbeiters. Ergänzt wird dies durch paratextuelle Stücke wie eine Vorrede und den Entwurf einer Rede. Trotzt der Formenvielfalt behauptet sich eine unverwechselbare Stimme.
Worpswede und Auguste Rodin markieren in dieser Sammlung die vertiefte Auseinandersetzung Rilkes mit bildender Kunst. Beide Texte zeigen, wie aus genauem Hinschauen und einer Sprache der behutsamen Annäherung ein geistiges Bild des Werkes entsteht. Rilke vermeidet das bloß Berichtende; er versucht, eine Bewegung des Sehens mitzuteilen, die Materialien, Gesten und Formtriebe achtet. So entsteht keine bloße Künstlerchronik, sondern eine Schule der Wahrnehmung. Der Blick, den diese Schriften einüben, prägt auch die übrigen Texte: Er verbindet Aufmerksamkeit für die Sache mit einer Sprache, die dem Werk Raum lässt.
Die literaturkritischen Beiträge führen Rilke in die Nähe seiner Gegenwartsliteratur. In Besprechungen zu Detlev von Liliencrons Poggfred, zu Thomas Manns Buddenbrooks, zu Hermann Bang, zu Friedrich Huch und Hermann Hesse erprobt er Maßstäbe, die weder auf bloße Gefälligkeit noch auf abwertendes Urteil zielen. Ihn interessiert die innere Notwendigkeit eines Tons, die Spannung einer Form, die Verlässlichkeit eines Blicks. Texte wie Demnächst und Gestern sowie Moderne Lyrik umkreisen darüber hinaus poetische Gegenwartsfragen. Kritik wird hier zur Kunst des vorherigen Schweigens: das Werk soll aus seiner eigenen Ordnung heraus verstanden werden.
Mit Notizen zur Melodie der Dinge, Über Kunst, Der Wert des Monologes und Noch ein Wort über den »Wert des Monologes« treten Grundzüge von Rilkes Ästhetik hervor. Er fragt, wie Sprache Klang und Welt zueinander bringt, wie ein Monolog zugleich Sammlung und Öffnung sein kann, wie Kunst Erfahrung formt, ohne sie festzustellen. Über den Dichter und Über den jungen Dichter verdichten diese Suche zur Poetik einer Existenzweise: Arbeit, Geduld, Haltung. Diese Texte sind weniger Lehrbuch als Einladung, die Bedingungen der eigenen Wahrnehmung zu prüfen – und die Ethik der Aufmerksamkeit als Teil des Ästhetischen zu begreifen.
Die Miniaturen und Prosaskizzen – Intérieurs, Von der Landschaft, Kunstwerke, Puppen Zu den Wachs-Puppen von Lotte Pritzel – führen Rilkes Sprache an Gegenstände, Räume und Gestalten heran. Hier wird das Sehen tastend, die Beschreibung zu einer Art Berührung. Innenräume, Landschaften, Dinge und Figuren werden nicht bloß abgebildet, sondern in ihrem Rhythmus, ihrer Stille, ihrem Eigengewicht wahrgenommen. Die Würdigung der Wachs-Puppen zeigt exemplarisch, wie Rilke Grenzgänge zwischen Bühne, Objekt und Bild untersucht. In solchen Stücken schult er eine Prosa, die Materialität ernst nimmt und zugleich das Geheimnis des Erscheinens wahrt.
Andere Texte weiten den Horizont auf gesellschaftliche und kulturkritische Felder. Das Jahrhundert des Kindes, Die Bücher zum wirklichen Leben, Samskola und Furnes rücken Fragen der Bildung, der Lektüre, der Gegenwartserfahrung und des kulturellen Umfelds ins Blickfeld. Rilke interessiert, wie Zeitumstände die innere Arbeit an der Form beeinflussen und wie Lese- und Lebensweisen einander durchdringen. Diese Beiträge verbinden Gegenwartsnähe mit einer behutsamen Distanz: Sie suchen nicht den schnellen Befund, sondern prüfen Haltungen, Wege, Möglichkeiten. So wird die Kunstbetrachtung in einen weiteren Zusammenhang des gelebten Lebens gestellt.
Eine besondere Rolle nehmen die Briefe ein. Briefe an einen jungen Dichter dokumentieren eine Korrespondenz, in der Rilke auf die Fragen eines angehenden Autors antwortet. Nicht Rezepte stehen im Vordergrund, sondern die Ermutigung zu eigener Arbeit, Geduld und Konzentration. Der Brief des jungen Arbeiters fügt eine soziale und existenzielle Perspektive hinzu. Im brieflichen Ton entfaltet Rilke eine Nähe, die nicht vereinnahmt: Die Adresse an ein Du schärft das eigene Sprechen, macht es konkret, verantwortet. Die Briefe gehören so zur Poetik, die in den Essays theoretisch erwogen wird.
Mit [Entwurf einer politischen Rede] und [Vorrede zu einer Vorlesung aus eigenen Werken] zeigt sich Rilkes Verhältnis zur Öffentlichkeit. Die Texte geben Einblick in die Frage, wie die Zartheit des Denkens in öffentliche Sprache treten kann, ohne sich selbst zu verlieren. Reden und Vorreden exponieren eine Stimme, die Gewicht und Maß der Worte prüft, bevor sie sie freigibt. Darin liegt kein Rückzug, sondern die Suche nach einer Form, in der das Persönliche und das Gemeinsame einander nicht ausschließen. Die literarische Haltung erweist sich als Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit.
Über die Einzelstücke hinweg ist Rilkes Prosa von musikalischer Bewegung, Bildkraft und Genauigkeit geprägt. Ihre Sätze atmen und tragen, sie verbinden Konkretion mit tastender Offenheit. Das Eigentliche vollzieht sich im Übergang: zwischen Ding und Wort, Blick und Begriff, Nähe und Abstand. Polemik meidet sie, Pathetik verwandelt sie in stilles Drängen. So entsteht eine Schreibweise, die das Lesen verlangsamt und das Gesehene festigt, ohne es zu verengen. In dieser Haltung wird das Denken über Kunst selbst zu einer Kunst, die auf Resonanz setzt statt auf endgültige Definitionen.
Die verbindenden Themen dieser Sammlung sind Aufmerksamkeitsarbeit, Formbewusstsein und die Ethik des Schauens. Rilke fragt, wie ein Leben mit Kunst möglich wird, ohne die Welt zu verlieren; wie Einsamkeit und Teilnahme, Tradition und Erneuerung einander tragen; wie Werke zu Gesprächspartnern werden. Seine Texte sind zugleich Zeitdokumente und Versuche, einer sich wandelnden Moderne eine Sprache des Verstehens abzugewinnen. Ihre anhaltende Bedeutung liegt darin, dass sie Übung und Haltung lehren: die Geduld des Blicks, das genaue Hören, die Bereitschaft, von den Dingen her zu denken.
Diese Ausgabe lädt zu unterschiedlichen Lesewegen ein. Man kann den großen Bögen der Monografien folgen, die poetologischen Texte bündeln, die Kritiken im Licht der Zeit lesen oder die Briefe als eigene Erzählung betrachten. In jeder Anordnung wird eine Bewegung sichtbar, die vom Werk zum Leben und vom Leben zurück zum Werk führt. Für Kennerinnen und Kenner eröffnet sich ein konzentrierter Überblick, für neue Leserinnen und Leser ein verlässlicher Einstieg. Die Gesammelten Schriften zu Kunst und Literatur möchten nicht abschließen, sondern öffnen: für die erneute, gegenwärtige Begegnung mit Rilkes Denken und Schreiben.
Autorenbiografie
Rainer Maria Rilke (1875–1926) gilt als eine der prägenden Stimmen der europäischen literarischen Moderne. Sein Werk verbindet eine genaue, bildhafte Sprache mit einer reflektierten Poetik, die das Verhältnis von Kunst, Wahrnehmung und Innerlichkeit neu bestimmt. Neben Lyrik schuf er Prosa, Essays, Kritiken und Briefe, die sein künstlerisches Denken offenlegen. Die hier versammelten Schriften – von Worpswede über Auguste Rodin bis zu Briefe an einen jungen Dichter – zeigen ihn als Autor, der literarische Formen souverän wechselt und im Dialog mit den Künsten steht. Rilkes Einfluss wirkt in der deutschsprachigen und internationalen Literatur bis heute fort.
Ausgebildet im multikulturellen Prag und später als Hörer in München, orientierte sich Rilke früh an Kunstgeschichte, Literatur und Philosophie. Ohne sich einer Schule dogmatisch zu verschreiben, suchte er Nähe zu Strömungen der europäischen Moderne, darunter Symbolismus und Impressionismus. Entscheidenden Anstoß erhielt er aus der bildenden Kunst: Seine Begegnungen mit Künstlerkreisen, wie sie in Worpswede greifbar werden, schärften seinen Blick für Form und Materialität. Als Mentor im praktischen Sinn wirkte Auguste Rodin, dessen Arbeitsdisziplin und plastisches Denken Rilke in Paris studierte und in Sprache übersetzte. So verband sich seine dichterische Schulung mit einer kontinuierlichen ästhetischen Selbstbefragung.
Rilkes frühe theoretische und poetologische Texte legen die Grundlagen seines Schreibens. In Notizen zur Melodie der Dinge entwickelt er eine sensibel abgestimmte Wahrnehmungslehre, die Klang, Bewegung und Blick in Beziehung setzt. Intérieurs und Moderne Lyrik erproben Werkstattberichte, Miniaturen und Gattungsreflexionen. Mit Über Kunst bündelt er Beobachtungen zur ästhetischen Erfahrung; Der Wert des Monologes und Noch ein Wort über den »Wert des Monologes« prüfen die Möglichkeiten der Stimme zwischen Theater und innerem Sprechen. Texte wie Über den Dichter und Über den jungen Dichter öffnen zugleich einen Raum für Selbstverständigung, in dem Schreiben als Übung der Aufmerksamkeit erscheint.
Die produktive Nähe zur bildenden Kunst prägte Rilkes Pariser Jahre. In Auguste Rodin untersucht er Werk, Methode und Ethos des Bildhauers und gewinnt daraus Kriterien für dichterische Arbeit: Geduld, Genauigkeit, Formstrenge. Worpswede dokumentiert sein Interesse an Künstlergemeinschaften und Landschaftsauffassung. Mit Kunstwerke und Von der Landschaft erweitert er den Blick auf Gattung, Motiv und Wahrnehmungsräume. Puppen Zu den Wachs-Puppen von Lotte Pritzel zeigt, wie seine Prosa feine Übergänge zwischen Dingbeobachtung und poetischer Anverwandlung schafft. Diese Texte belegen, dass Rilke Kunst nicht illustriert, sondern in Sprache neu erzeugt – als eingeübte, gegenständlich fundierte Aufmerksamkeit.
Als kritischer Beobachter der zeitgenössischen Literatur trat Rilke in Rezensionen und Essays pointiert auf. Er besprach Detlev von Liliencron, Poggfred, reflektierte über Thomas Mann's »Buddenbrooks« und würdigte Hermann Bang, Das weiße Haus. Auch zu Debatten der Erziehung und Kultur äußerte er sich, etwa in Das Jahrhundert des Kindes. Seine Auseinandersetzungen mit Autoren der Gegenwart zeigen Breite und Fairness: Texte wie Hermann Hesse und die beiden Besprechungen zu Friedrich Huch, Peter Michel dokumentieren dialogische Aufmerksamkeit. Mit Die Bücher zum wirklichen Leben bezeichnete er Literatur als Erfahrungsraum, der auf die Wirklichkeit bezogen bleibt, ohne sie zu vereinfachen.
Rilkes Briefe und kürzere Prosatexte zeigen ein Ethos des Gesprächs. Briefe an einen jungen Dichter ist zu einem Klassiker des literarischen Rats geworden; Der Brief des jungen Arbeiters erweitert die Perspektive um soziale Erfahrungsräume. Mit der [Vorrede zu einer Vorlesung aus eigenen Werken] reflektiert er Öffentlichkeit und Vortragssituation; der [Entwurf einer politischen Rede] markiert tastende Annäherung an gesellschaftliche Sprecherrollen. Ur-Geräusch erkundet die Herkunft des Hörens und die Tiefe des Wortes. Stücke wie Samskola und Furnes bezeugen seine genaue Beobachtung von Orten und Namen. So entfaltet sich ein prosaisches Werk, das Beratung nicht mit Belehrung verwechselt.
In seinen späteren Jahren konzentrierte sich Rilke auf die Verdichtung der Sprache und die Verschränkung von Innen- und Außenwelt; zugleich ordnete er Essays, Reden und Briefe, die seine poetische Haltung erläutern. Er verbrachte längere Zeiträume in der Schweiz und starb 1926, nachdem er sein Werk in konzentrierter Form zur Reife gebracht hatte. Heute wird Rilke als europäischer Autor gelesen, dessen Genauigkeit des Blicks, künstlerische Selbstzucht und Offenheit für andere Künste vorbildlich bleiben. Die vorliegende Sammlung zeigt ihn als kritischen Beobachter, poetologischen Denker und Korrespondenten – und macht nachvollziehbar, warum seine Stimme anhaltend überzeugt.
Historischer Kontext
Rainer Maria Rilke (1875–1926) schrieb die in dieser Sammlung vereinten Texte zwischen den späten 1890er Jahren und den frühen 1920ern. Sie begleiten den Übergang vom habsburgischen Fin de siècle über die wilhelminische Epoche bis in die ersten Jahre der Weimarer Republik und der Ersten Republik Österreichs. Diese Zeit war von rascher Urbanisierung, technischen Medienrevolutionen und einer Neuordnung der europäischen Kultur geprägt. Rilkes Beobachtungen reichen von Künstlerkolonien und Ausstellungswesen bis zu neuen Formen des Lesens im Feuilleton. So entsteht ein Panorama, in dem Kunst, Literatur und Gesellschaft wechselseitig aufeinander reagieren und sich in beschleunigten Rhythmen neu definieren.
Um 1900 prägten Symbolismus, Décadence und Jugendstil die deutschsprachige Kunstszene; in München und Wien formierten sich Secessionen. Gleichzeitig verschoben sich philosophische Horizonte, von Nietzsche-Rezeption bis zu frühen Debatten über Psyche und Bewusstsein. In diesem Klima entstehen Notizen zur Melodie der Dinge und Der Wert des Monologes; der Nachtrag Noch ein Wort über den Wert des Monologes vertieft die Debatte. Rilkes Texte kalibrieren die Aufmerksamkeit des modernen Subjekts: Wahrnehmen, Sprechen, innere Haltung. Sie stehen als Teil einer öffentlichen Diskussion, die Theater, Lyrik und bildende Kunst übergreift, und antworten auf das Bedürfnis, Erfahrung und Form neu zu ordnen.
Worpswede dokumentiert die Faszination einer Künstlerkolonie, die seit 1889 nördlich von Bremen das Leben jenseits der Großstadt erprobte. Namen wie Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Heinrich Vogeler und Paula Modersohn-Becker markieren den Versuch, Landschaft, Arbeit und einfache Formen gegen den Lärm der Industrialisierung zu setzen. Rilke besuchte die Kolonie um 1900 und veröffentlichte 1902 seine Studie. Sie fügt sich in eine breitere Bewegung, die Heimat, Handwerk und Natur als Gegenmodelle zur Metropole suchte. Gleichzeitig zeigt die Monographie, wie stark diese vermeintliche Gegenwelt bereits in überregionalen Markt- und Ausstellungszusammenhängen eingebunden war.
Mit Auguste Rodin öffnet sich die Sammlung auf Paris, die führende Kunstmetropole der Zeit. Rilke lebte ab 1902 zeitweise in der Stadt und arbeitete 1905–1906 als Sekretär des Bildhauers. Seine Monographie von 1903, später erweitert, beobachtet eine Skulptur, die den Körper nicht idealisiert, sondern als arbeitende Form begreift. Im Hintergrund stehen Weltausstellungen, neue Museen und die internationale Presse, die Künstlerkarrieren beschleunigen. Paris verkörpert zudem eine Moderne der Bewegungen – Verkehr, Menschenströme, Blickregime –, die Rilkes Wahrnehmung schärfen und seine Kunstbetrachtungen in ein dichtes urbanes Erfahrungsfeld stellen.
Die Prosastücke Intérieurs reagieren auf die Ausweitung des Feuilletons und eine Leserschaft, die Stadt, Wohnung und Gegenstände als Zeichen moderner Identität liest. Seit den 1890ern verbreiteten sich Fotografie und frühe Kinematographie; Illustrierte formten eine Grammatik des Sehens. Rilkes Beobachtungen von Räumen und Figuren – oft als Momentaufnahme gebaut – stehen damit im Austausch. Sie betonen, wie Interieurs soziale Rollen und Stimmungen speichern. Feuilletonstücke wie Demnächst und Gestern zeigen, wie Gegenwart und Erinnerung ineinandergreifen. Der Textmodus ist beweglich, zwischen Reportage, Porträt und lyrischer Prosa, und spiegelt die Medienökonomie der Jahrhundertwende.
Eine weitere Achse führt in den Norden. 1904 reiste Rilke nach Skandinavien und besuchte Ellen Key an ihrem Haus Strand am Vätternsee. Die Auseinandersetzung mit deren Schrift Das Jahrhundert des Kindes – im Deutschen seit 1902 stark rezipiert – verknüpft Pädagogik, Frauenbewegung und Sozialreform. Stücke wie Samskola und Furnes verweisen auf Koedukation, Volksbildung und regionale Lebensformen, die in Schweden, Norwegen und Finnland breit diskutiert wurden. Rilkes Texte registrieren diese Reformklimata nicht statistisch, sondern als Kulturstimmung. Die Bücher zum wirklichen Leben markiert in diesem Zusammenhang die Frage, welche Lektüren in die Alltagswelt hineinwirken.
Die literarische Kritik dieser Sammlung kartiert zugleich die Neuordnung der deutschsprachigen Poesie. Detlev von Liliencron, seit den 1880ern ein Impulsgeber knapper, sprechender Verse, erscheint in Rilkes Betrachtung zu Poggfred als Wegbereiter eines moderneren Tons. Der Essay Moderne Lyrik verallgemeinert solche Beobachtungen: Rhythmus, Bildlichkeit und die Nähe zur gesprochenen Sprache verschieben sich. Dahinter steht eine vitalisierte Zeitschriftenlandschaft, in der Gedichte, Rezensionen und poetologische Skizzen schnell zirkulieren. Rilke nutzt diese Foren, um Entwicklungen zu bündeln und zu differenzieren, ohne sie auf Schulrichtungen zu reduzieren.
Rezensionen zu Hermann Hesse und Thomas Manns Buddenbrooks markieren den Anschluss an die bürgerliche Romanproduktion um 1900. Buddenbrooks, 1901 erschienen, wurde früh zum Prüfstein einer Erzählweise, die ökonomische und familiäre Dynamiken seziert. Rilkes Beiträge zeigen, wie Lyriker sich mit dem langen Roman ins Gespräch bringen und dabei Fragen von Stil, Generation und Milieu akzentuieren. Hesse, dessen literarischer Durchbruch mit Peter Camenzind 1904 einsetzte, steht in diesen Jahren für eine Suche nach Einfachheit und Innerlichkeit. Die Kritik spiegelt eine Lesekultur, die Autoren rasch kanonisiert und zugleich öffentlich verhandelt.
Hermann Bangs Das weiße Haus steht in der deutschen Diskussion für eine skandinavische Spielart impressionistischen Erzählens. Bang, 1857–1912, war als Romancier und Journalist europaweit vernetzt; Übersetzungen machten sein Werk früh zugänglich. Rilkes Hinwendung zu Bang verdeutlicht, wie Literaturkritik um 1900 transnational arbeitet: Stoffe, Stile und Publikationswege überschreiten Sprachgrenzen, während Theater und Feuilleton als Verstärker fungieren. Die Aufnahme solcher Autoren schärft auch den Blick auf die eigenen Traditionen, indem Erzähltempo, Perspektivwechsel und die Beobachtung flüchtiger Seelenlagen als moderne Verfahren kenntlich werden.
Mit den mehrfachen Besprechungen zu Friedrich Huchs Peter Michel wird der Prozesscharakter der Kritik sichtbar. Der Roman von 1902 provozierte Nachfragen, auf die Rilke in einer zweiten und dritten Betrachtung reagiert. Dieses seriell geführte Gespräch verweist auf ein dichtes Netz literarischer Zeitschriften, in dem Positionen präzisiert, korrigiert oder vertieft werden konnten. Kritik erscheint hier weniger als Urteil denn als fortgesetzte Lektüre, die den Wandel der eigenen Maßstäbe offenlegt. Damit dokumentiert die Sammlung eine Praxis, die um 1900 typisch wurde: öffentliche, iterierende Verständigung über neue Prosaformen.
In den Texten Über Kunst und Kunstwerke bündelt sich Rilkes Erfahrung mit Ausstellungen, Ateliers und Reproduktionen. Seit den 1890ern professionalisierten sich Museen und Kunstvereine; Kataloge, Photogravüren und Postkarten stellten Werke in Umlauf. Rilke nutzt diese Infrastrukturen als Anlass, Materialität und Form zu befragen, ohne das Werk auf eine Botschaft zu reduzieren. Die Texte stehen in einem Diskurs, der die Autonomie der Kunst betont, zugleich aber ihre soziale Präsenz im Blick behält. So werden Institutionen, Öffentlichkeiten und künstlerische Verfahren als miteinander verschränkte Kräfte der Moderne beschrieben.
Von der Landschaft knüpft an Worpswede an, reicht aber über die Kolonie hinaus. Um 1900 wurde Landschaft in Malerei, Fotografie und Reiseprosa neu verhandelt. Eisenbahnen, neue Wege und der wachsende Tourismus machten entfernte Gegenden erreichbar; Vereine und Zeitschriften pflegten ein Heimatbewusstsein, das zwischen Bewahrung und Inszenierung oszillierte. Rilke beobachtet, wie der Blick auf Felder, Moore oder Küsten nicht nur Natur, sondern auch soziale Ordnungen abliest. Landschaft erscheint als medialer Schnittpunkt, in dem künstlerische Konventionen, wirtschaftliche Nutzung und kulturelle Selbstbeschreibungen zusammenlaufen.
Der Essay Puppen zu den Wachs-Puppen von Lotte Pritzel datiert aus der Vorkriegszeit und reagiert auf Münchens lebendige Kunst- und Unterhaltungsszene. Pritzels fragile Figuren, um 1913 ausgestellt und diskutiert, verbanden Kunsthandwerk, Mode und Bühnengestus. Rilkes Text ordnet dieses Phänomen in eine Debatte über künstliche Körper, Maskerade und moderne Objektwelten ein. Im Hintergrund stehen Kabaretts, Tanz und eine von Zeitschriften orchestrierte Bilderflut. Die Aufmerksamkeit für das Gemachte, Flüchtige und Seriell-Hergestellte macht den Essay zu einem Dokument jener Jahre, in denen Konsumkultur und Avantgarde sich produktiv berührten.
Ur-Geräusch spiegelt die Faszination für neue Medientechniken, die seit dem späten 19. Jahrhundert Klang und Schrift anders verbanden. Phonograph und Grammophon, das Telefon und mechanische Schreibgeräte veränderten die Speicherung und Zirkulation von Stimmen. Rilkes Reflexion nimmt diese technischen Möglichkeiten zum Anlass, über Spur, Echo und Präsenz nachzudenken. Der Text steht damit nahe an zeitgenössischen Diskussionen in Naturwissenschaft und Ästhetik, ohne sich auf technische Einzelheiten zu beschränken. Er dokumentiert eine Sensibilität für die historische Zäsur, die das Aufzeichnen des Flüchtigen in alltägliche Praxis überführte.
Die politischen Erschütterungen von 1918/19 bilden den Hintergrund für Entwurf einer politischen Rede und für den späteren Brief des jungen Arbeiters. Mit dem Ende des Krieges, Revolutionen und Räterepubliken veränderten sich Adressaten, Bühnen und Tonlagen des öffentlichen Sprechens. Rilke hielt sich in diesen Jahren in München und danach in der Schweiz auf; seine Texte reagieren nicht parteipolitisch, sondern fragen nach Haltung, Verantwortung und Sprache in einer erhitzten Öffentlichkeit. Die Aufmerksamkeit gilt der Form der Ansprache ebenso wie der sozialen Erfahrung, die sie ermöglichen oder verfehlen kann. Die Vorrede zu einer Vorlesung aus eigenen Werken reflektiert diese Situation mit.
Über den Dichter, Über den jungen Dichter und die Briefe an einen jungen Dichter rahmen das Thema ästhetischer Ausbildung. Die zehn Briefe an Franz Xaver Kappus, 1902–1908 geschrieben und 1929 veröffentlicht, wurden zu einem international verbreiteten Dokument literarischer Selbstverständigung. Sie gehören in eine Epoche intensiver Briefkultur, in der Post, Zeitschriften und Verlage Autoren und Leser dichter vernetzten. Rilkes Reflexionen verbinden künstlerische Praxis mit Alltagsdisziplin und zeigen, wie Vokationen im modernen Berufs- und Mediengefüge verhandelt werden. Die Sammlung macht diese pädagogische Dimension seiner Prosa gut sichtbar.
Als Ganzes kommentiert die Sammlung die Jahrzehnte um 1900 aus der Perspektive eines Autors, der Kunst als gesellschaftliche Praxis versteht. Sie protokolliert die Verflechtung von Ausstellungswesen, Buchmarkt, Medien und Politik und dient der Forschung als Fundus zur europäischen Moderne. Nach 1945 wurden viele dieser Texte erneut ediert und in kunst- und literaturwissenschaftliche Lektüren eingebunden; Worpswede und die Rodin-Studie sind für Kolonien- und Skulpturforschung ebenso wichtig wie die Briefe an einen jungen Dichter für Schreib- und Bildungsgeschichte. Wiederlektüren betonen heute die transnationale Spannweite und die Aufmerksamkeit für mediale Rahmenbedingungen.
Synopsis (Auswahl)
Künstler- und Kunstbetrachtungen
Von den Monographien Worpswede und Auguste Rodin über Über Kunst, Notizen zur Melodie der Dinge, Kunstwerke und Von der Landschaft bis zur Miniatur Puppen – Zu den Wachs-Puppen von Lotte Pritzel erkunden diese Texte das Verhältnis von Anschauung, Form und dem stillen Eigenleben der Dinge. Rilke zeichnet nach, wie geduldiges Sehen in Gestaltung übergeht und wie Materialien, Räume und Landschaften eine innere Stimme gewinnen. Der Ton ist kontemplativ, präzise und atmosphärisch, mit Sinn für die Würde des Gegenstands.
Poetologie und Monolog
Über den Dichter, Über den jungen Dichter, die Briefe an einen jungen Dichter sowie Der Wert des Monologes und Noch ein Wort über den »Wert des Monologes« umkreisen Beruf, Haltung und Technik der Dichtung. Rilke betont Innerlichkeit, Reife und Selbstprüfung und versteht den Monolog als Übungsform, in der eine Stimme ihr Maß findet. Der Ton ist zugewandt und anspruchsvoll, mehr ermutigend als tröstend, und zielt auf eine klare, normative Ästhetik.
Medien, Stimme und Öffentlichkeit
Ur-Geräusch, der [Entwurf einer politischen Rede], die [Vorrede zu einer Vorlesung aus eigenen Werken] und Der Brief des jungen Arbeiters zeigen, wie Rilke das Sprechen zwischen Innerem und Öffentlichkeit erprobt. Im Vordergrund stehen Verantwortung, Hörbarkeit und Medium: Wie lässt sich eine feine Wahrnehmung öffentlich machen, ohne im Geräusch der Welt zu verschwinden. Der Ton ist tastend und selbstkritisch, mit Aufmerksamkeit für Nuancen statt für Deklamation.
Literaturkritik und Autorenporträts
Diese Gruppe versammelt Detlev von Liliencron, Poggfred, Moderne Lyrik, Hermann Hesse, Thomas Mann's »Buddenbrooks«, Hermann Bang, Das weiße Haus sowie Friedrich Huch, Peter Michel [Zweite Besprechung] und [Dritte Besprechung]. Rilke liest weniger auf Handlung als auf Ton, Rhythmus und Formdisziplin hin und verfolgt, wie Figuren und Welten aus sprachlicher Haltung entstehen. Die Urteile sind ruhig und differenzierend, oft mit leisen Leitlinien für eine kommende Moderne.
Feuilletons, Orte und Gesellschaft
Demnächst und Gestern und Intérieurs skizzieren Zeitgefühl, Räume und Blickregime; Das Jahrhundert des Kindes, Samskola, Furnes und Die Bücher zum wirklichen Leben befragen Bildung, Erziehung und Alltagskultur. Rilke verbindet genaue Szenen mit grundsätzlichen Überlegungen zur Menschenbildung und zur Würde des Gewöhnlichen. Der Ton ist beweglich und sachlich, getragen von diskreter Empathie.
Gesamtblick: Motive und Stil
Immer wieder erscheinen Verwandlung, Dingnähe und geduldige Innerlichkeit; Sehen und Sagen bedingen einander. Stilistisch bevorzugt Rilke eine präzise, bilderreiche Prosa zwischen Essay, Brief und Miniatur, die Anschauung und Urteil ausbalanciert. Der Akzent verschiebt sich von anschaulicher Kunstnähe zu konzentrierter Poetologie und zur Verantwortung der Stimme im Öffentlichen.
Gesammelte Schriften zu Kunst und Literatur
Worpswede
Inhaltsverzeichnis
Portrait: Rainer Maria Rilke, gemalt von Paula Modersohn-Becker (1876 - 1907)
Wir gingen zusammen durch die Heide, abends im Wind. Und das Gehen in Worpswede ist jedesmal so: eine Weile wandert man vorwärts, in Gesprächen, welche der Wind rasch zerstört, – dann bleibt einer stehen und in einer Weile der andere. Es geschieht so viel. Unter den großen Himmeln liegen flach die dunkelnden farbigen Felder, weite Hügelwellen voll bewegter Erika, daran grenzend Stoppelfelder und eben gemähter Buchweizen, der mit seinem Stengelrot und dem Gelb seiner Blätter köstlichem Seidenstoff gleicht. Und wie das alles daliegt, nah und stark und so wirklich, daß man es nicht übersehen oder vergessen kann. Jeden Augenblick wird etwas in die tonige Luft gehalten, ein Baum, ein Haus, eine Mühle, die sich ganz langsam dreht, ein Mann mit schwarzen Schultern, eine große Kuh oder eine hartkantige, zackige Ziege, die in den Himmel geht. Da gibt es nur Gespräche, an denen die Landschaft teilnimmt, von allen Seiten und mit hundert Stimmen.
R. M. Rilke Schmargendorfer Tagebuch
Die Geschichte der Landschaftsmalerei ist noch nicht geschrieben worden und doch gehört sie zu den Büchern, die man seit Jahren erwartet. Derjenige, welcher sie schreiben wird, wird eine große und seltene Aufgabe haben, eine Aufgabe, verwirrend durch ihre unerhörte Neuheit und Tiefe. Wer es auf sich nähme, die Geschichte des Porträts oder des Devotionsbildes aufzuzeichnen, hätte einen weiten Weg; ein gründliches Wissen müßte ihm wie eine wohlgeordnete Handbibliothek erreichbar sein, die Sicherheit und Unbestechlichkeit seines Blickes müßte ebenso groß sein wie das Gedächtnis seines Auges; er müßte Farben sehen und Farben sagen können, er müßte die Sprache eines Dichters und die Geistesgegenwart eines Redners besitzen, um angesichts des weiten Stoffes nicht in Verlegenheit zu geraten, und die Wage seiner Ausdrucksweise müßte auch die feinsten Unterschiede noch mit deutlichem Ausschlagswinkel anmelden. Er müßte nicht allein Historiker sein, sondern auch Psychologe, der am Leben gelernt hat, ein Weiser, der das Lächeln der Mona Lisa ebenso mit Worten wiederholen kann wie den alternden Ausdruck des tizianischen Karl V. und das zerstreute, verlorene Schauen des Jan Six in der Amsterdamer Sammlung. Aber er hätte doch immerhin mit Menschen umzugehen, von Menschen zu erzählen und den Menschen zu feiern, indem er ihn erkennt. Er wäre von den feinsten menschlichen Gesichtern umgeben, angeschaut von den schönsten, von den ernstesten, von den unvergeßlichsten Augen der Welt; umlächelt von berühmten Lippen und festgehalten von Händen, die ein eigentümlich selbständiges Leben führen, müßte er nicht aufhören, im Menschen die Hauptsache zu sehen, das Wesentliche, das, zu dem Dinge und Tiere einmütig und still hinweisen wie zu dem Ziel und zu der Vollendung ihres stummen oder bewußtlosen Lebens.
Wer aber die Geschichte der Landschaft zu schreiben hätte, befände sich zunächst hilflos preisgegeben dem Fremden, dem Unverwandten, dem Unfaßbaren. Wir sind gewohnt, mit Gestalten zu rechnen, – und die Landschaft hat keine Gestalt, wir sind gewohnt aus Bewegungen auf Willensakte zu schließen, und die Landschaft will nicht, wenn sie sich bewegt. Die Wasser gehen und in ihnen schwanken und zittern die Bilder der Dinge. Und im Winde, der in den alten Bäumen rauscht, wachsen die jungen Wälder heran, wachsen in eine Zukunft, die wir nicht erleben werden. Wir pflegen, bei den Menschen, vieles aus ihren Händen zu schließen und alles aus ihrem Gesicht, in welchem, wie auf einem Zifferblatt, die Stunden sichtbar sind, die ihre Seele tragen und wiegen. Die Landschaft aber steht ohne Hände da und hat kein Gesicht, – oder aber sie ist ganz Gesicht und wirkt durch die Größe und Unübersehbarkeit ihrer Züge furchtbar und niederdrückend auf den Menschen, etwa wie jene »Geistererscheinung« auf dem bekannten Blatte des japanischen Malers Hokusai.
Denn gestehen wir es nur: die Landschaft ist ein Fremdes für uns[1q], und man ist furchtbar allein unter Bäumen, die blühen, und unter Bächen, die vorübergehen. Allein mit einem toten Menschen, ist man lange nicht so preisgegeben wie allein mit Bäumen. Denn so geheimnisvoll der Tod sein mag, geheimnisvoller noch ist ein Leben, das nicht unser Leben ist, das nicht an uns teilnimmt und, gleichsam ohne uns zu sehen, seine Feste feiert, denen wir mit einer gewissen Verlegenheit, wie zufällig kommende Gäste, die eine andere Sprache sprechen, zusehen.
Freilich, da könnte mancher sich auf unsere Verwandtschaft mit der Natur berufen, von der wir doch abstammen als die letzten Früchte eines großen aufsteigenden Stammbaumes. Wer das tut, kann aber auch nicht leugnen, daß dieser Stammbaum, wenn wir ihn, von uns aus, Zweig für Zweig, Ast für Ast, zurückverfolgen, sehr bald sich im Dunkel verliert; in einem Dunkel, welches von ausgestorbenen Riesentieren bewohnt wird, von Ungeheuern voll Feindseligkeit und Haß, und daß wir, je weiter wir nach rückwärts gehen, zu immer fremderen und grausameren Wesen kommen, so daß wir annehmen müssen, die Natur, als das Grausamste und Fremdeste von allen, im Hintergrunde zu finden.
Daran ändert der Umstand, daß die Menschen seit Jahrtausenden mit der Natur verkehren, nur sehr wenig; denn dieser Verkehr ist sehr einseitig. Es scheint immer wieder, daß die Natur nichts davon weiß, daß wir sie bebauen und uns eines kleinen Teiles ihrer Kräfte ängstlich bedienen. Wir steigern in manchen Teilen ihre Fruchtbarkeit und ersticken an anderen Stellen mit dem Pflaster unserer Städte wundervolle Frühlinge, die bereit waren, aus den Krumen zu steigen. Wir führen die Flüsse zu unseren Fabriken hin, aber sie wissen nichts von den Maschinen, die sie treiben. Wir spielen mit dunklen Kräften, die wir mit unseren Namen nicht erfassen können, wie Kinder mit dem Feuer spielen, und es scheint einen Augenblick, als hätte alle Energie bisher ungebraucht in den Dingen gelegen, bis wir kamen, um sie auf unser flüchtiges Leben und seine Bedürfnisse anzuwenden. Aber immer und immer wieder in Jahrtausenden schütteln die Kräfte ihre Namen ab und erheben sich, wie ein unterdrückter Stand gegen ihre kleinen Herren, ja nicht einmal gegen sie, – sie stehen einfach auf, und die Kulturen fallen von den Schultern der Erde, die wieder groß ist und weit und allein mit ihren Meeren, Bäumen und Sternen.
Was bedeutet es, daß wir die äußerste Oberfläche der Erde verändern, daß wir ihre Wälder und Wiesen ordnen und aus ihrer Rinde Kohlen und Metalle holen, daß wir die Früchte der Bäume empfangen, als ob sie für uns bestimmt wären, wenn wir uns daneben einer einzigen Stunde erinnern, in welcher die Natur handelte über uns, über unser Hoffen, über unser Leben hinweg, mit jener erhabenen Hoheit und Gleichgültigkeit, von der alle ihre Gebärden erfüllt sind. Sie weiß nichts von uns. Und was die Menschen auch erreicht haben mögen, es war noch keiner so groß, daß sie teilgenommen hätte an seinem Schmerz, daß sie eingestimmt hätte in seine Freude. Manchmal begleitete sie große und ewige Stunden der Geschichte mit ihrer mächtigen brausenden Musik oder sie schien um eine Entscheidung windlos, mit angehaltenem Atem stille zu stehn oder einen Augenblick geselliger harmloser Froheit mit flatternden Blüten, schwankenden Faltern und hüpfenden Winden zu umgeben, – aber nur um im nächsten Momente sich abzuwenden und den im Stiche zu lassen, mit dem sie eben noch alles zu teilen schien.
Der gewöhnliche Mensch, der mit den Menschen lebt und die Natur nur so weit sieht, als sie sich auf ihn bezieht, wird dieses rätselhaften und unheimlichen Verhältnisses selten gewahr. Er sieht die Oberfläche der Dinge, die er und seinesgleichen seit Jahrhunderten geschaffen haben, und glaubt gerne, die ganze Erde nehme an ihm teil, weil man ein Feld bebauen, einen Wald lichten und einen Fluß schiffbar machen kann. Sein Auge, welches fast nur auf Menschen eingestellt ist, sieht die Natur nebenbei mit, als ein Selbstverständliches und Vorhandenes, das so viel als möglich ausgenutzt werden muß. Anders schon sehen Kinder die Natur; einsame Kinder besonders, welche unter Erwachsenen aufwachsen, schließen sich ihr mit einer Art von Gleichgesinntheit an und leben in ihr, ähnlich den kleinen Tieren, ganz hingegeben an die Ereignisse des Waldes und des Himmels und in einem unschuldigen, scheinbaren Einklang mit ihnen. Aber darum kommt später für Jünglinge und junge Mädchen jene einsame, von vielen tiefen Melancholien zitternde Zeit, da sie gerade in den Tagen des körperlichen Reifwerdens, unsäglich verlassen, fühlen, daß die Dinge und Ereignisse in der Natur nicht mehr und die Menschen noch nicht an ihnen teilnehmen. Es wird Frühling, obwohl sie traurig sind, die Rosen blühen und die Nächte sind voll Nachtigallen, obwohl sie sterben möchten, und wenn sie endlich wieder zu einem Lächeln kommen, dann sind die Tage des Herbstes da, die schweren, gleichsam unaufhörlich fallenden Tage des Novembers, hinter denen ein langer, lichtloser Winter kommt. Und auf der anderen Seite sehen sie die Menschen, in gleicher Weise fremd und teilnahmslos, ihre Geschäfte, ihre Sorgen, ihre Erfolge und Freuden haben, und sie verstehen es nicht. Und schließlich bescheiden sich die einen und gehen zu den Menschen, um ihre Arbeit und ihr Los zu teilen, um zu nützen, zu helfen und der Erweiterung dieses Lebens irgendwie zu dienen, während die anderen, die die verlorene Natur nicht lassen wollen, ihr nachgehen und nun versuchen, bewußt und mit Aufwendung eines gesammelten Willens, ihr wieder so nahezukommen, wie sie ihr, ohne es recht zu wissen, in der Kindheit waren. Man begreift, daß diese letzteren Künstler sind: Dichter oder Maler, Tondichter oder Baumeister, Einsame im Grunde, die, indem sie sich der Natur zuwenden, das Ewige dem Vergänglichen, das im tiefsten Gesetzmäßige dem vorübergehend Begründeten vorziehen, und die, da sie die Natur nicht überreden können, an ihnen teilzunehmen, ihre Aufgabe darin sehen, die Natur zu erfassen, um sich selbst irgendwo in ihre großen Zusammenhänge einzufügen. Und mit diesen einzelnen Einsamen nähert sich die ganze Menschheit der Natur. Es ist nicht der letzte und vielleicht der eigentümlichste Wert der Kunst, daß sie das Medium ist, in welchem Mensch und Landschaft, Gestalt und Welt sich begegnen und finden. In Wirklichkeit leben sie nebeneinander, kaum voneinander wissend, und im Bilde, im Bauwerk, in der Symphonie, mit einem Worte in der Kunst, scheinen sie sich, wie in einer höheren prophetischen Wahrheit, zusammenzuschließen, aufeinander zu berufen, und es ist, als ergänzten sie einander zu jener vollkommenen Einheit, die das Wesen des Kunstwerks ausmacht.
Unter diesem Gesichtspunkt scheint es, als läge das Thema und die Absicht aller Kunst in dem Ausgleich zwischen dem Einzelnen und dem All, und als wäre der Moment der Erhebung, der künstlerisch-wichtige Moment derjenige, in welchem die beiden Waagschalen sich das Gleichgewicht halten. Und, in der Tat, es wäre sehr verlockend, diese Beziehung in verschiedenen Kunstwerken nachzuweisen; zu zeigen, wie eine Symphonie die Stimmen eines stürmischen Tages mit dem Rauschen unseres Blutes zusammenschmilzt, wie ein Bauwerk halb unser, halb eines Waldes Ebenbild sein kann. Und ein Bildnis machen, heißt das nicht, einen Menschen wie eine Landschaft sehen, und gibt es eine Landschaft ohne Figuren, welche nicht ganz erfüllt ist davon, von dem zu erzählen, der sie gesehen hat? Wunderliche Beziehungen ergeben sich da. Manchmal sind sie in reichem, fruchtbaren Kontrast nebeneinandergesetzt, manchmal scheint der Mensch aus der Landschaft, ein anderes Mal die Landschaft aus dem Menschen hervorzugehen, und dann wieder haben sie sich ebenbürtig und geschwisterlich vertragen. Die Natur scheint sich für Augenblicke zu nähern, indem sie sogar den Städten einen Schein von Landschaft gibt, und mit Centauren, Seefrauen und Meergreisen aus Böcklinschem Blute nähert sich die Menschheit der Natur: Immer aber kommt es auf dieses Verhältnis an, nicht zuletzt in der Dichtung, die gerade dann am meisten von der Seele zu sagen weiß, wenn sie Landschaft gibt, und die verzweifeln müßte, das Tiefste von ihm zu sagen, stünde der Mensch in jenem uferlosen und leeren Raume, in welchen ihn Goya gerne versetzt hat.
Die Kunst hat den Menschen kennengelernt, bevor sie sich mit der Landschaft beschäftigte. Der Mensch stand vor der Landschaft und verdeckte sie, die Madonna stand davor, die liebe, sanfte, italische Frau mit dem spielenden Kinde, und weiter hinter ihr erklang ein Himmel und ein Land mit ein paar Tönen wie die Anfangsworte eines Ave Maria. Diese Landschaft, die sich im Hintergrund umbrischer und toskanischer Bilder ausbreitet, ist wie eine leise, mit einer Hand gespielte Begleitung, nicht von der Wirklichkeit angeregt, sondern den Bäumen, Wegen und Wolken nachgebildet, die eine liebliche Erinnerung sich bewahrt hat. Der Mensch war die Hauptsache, das eigentliche Thema der Kunst, und man schmückte ihn, wie man schöne Frauen mit edlen Steinen schmückt, mit Bruchstücken jener Natur, die man als Ganzes zu schauen noch nicht fähig war.
Es müssen andere Menschen gewesen sein, welche, an ihresgleichen vorbei, die Landschaft schauten, die große, teilnahmslose, gewaltige Natur. Menschen wie Jacob Ruysdael, Einsame, die wie Kinder unter Erwachsenen lebten und vergessen und arm verstarben. Der Mensch verlor seine Wichtigkeit, er trat zurück vor den großen, einfachen, unerbittlichen Dingen, die ihn überragten und überdauerten. Man mußte deshalb nicht darauf verzichten, ihn darzustellen, im Gegenteil: durch die gewissenhafte und gründliche Beschäftigung mit der Natur hatte man gelernt, ihn besser und gerechter zu sehen. Er war kleiner geworden: nicht mehr der Mittelpunkt der Welt; er war größer geworden: denn man schaute ihn mit denselben Augen an wie die Natur, er galt nicht mehr als ein Baum, aber er galt viel, weil der Baum viel galt.
In den deutschen Romantikern war eine große Liebe zur Natur. Aber sie liebten sie ähnlich wie der Held einer Turgenieffschen Novelle jenes Mädchen liebte, von dem er sagt: »Sophia gefiel mir besonders, wenn ich saß und ihr den Rücken zuwendete, das heißt, wenn ich ihrer gedachte, wenn ich sie im Geiste vor mir sah, besonders des Abends, auf der Terrasse…« Vielleicht hat nur einer von ihnen ihr ins Gesicht gesehen; Philipp Otto Runge, der Hamburger, der das Nachtigallengebüsch gemalt hat und den Morgen. Das große Wunder des Sonnenaufgangs ist so nicht wieder gemalt worden. Das wachsende Licht, das still und strahlend zu den Sternen steigt und unten auf der Erde das Kohlfeld, noch ganz vollgesogen mit der starken, tauigen Tiefe der Nacht, in welchem ein kleines nacktes Kind – der Morgen – liegt. Da ist alles geschaut und wiedergeschaut. Man fühlt die Kühle von vielen Morgen, an denen der Maler sich vor der Sonne erhob und, zitternd vor Erwartung, hinausging, um jede Szene des mächtigen Schauspiels zu sehen und nichts von der spannenden Handlung zu versäumen, die da begann. Dieses Bild ist mit Herzklopfen gemalt worden. Es ist ein Markstein. Es erschließt nicht einen, es erschließt tausend neue Wege zur Natur. Runge fühlte das selbst. In seinen »Hinterlassenen Schriften«, die 1842 erschienen sind, findet sich folgende Stelle: »… Es drängt sich alles zur Landschaft, sucht etwas Bestimmtes in dieser Unbestimmtheit. Doch unsere Künstler greifen wieder zur Historie und verwirren sich. Ist denn in dieser neuen Kunst – der Landschafterei, wenn man so will – nicht auch ein höchster Punkt zu erreichen? der vielleicht noch schöner sein wird als die vorigen?«
Im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hat Philipp Otto Runge diese Worte geschrieben, aber noch weit später galt die »Landschafterei« in Deutschland als ein fast untergeordnetes Gewerbe, und man pflegte auf unseren Akademien die Landschafter nicht für voll zu nehmen. Diese Anstalten hatten allen Grund, die Konkurrenz der Natur zu fürchten, auf welche schon Dürer mit so ehrfürchtiger Einfalt hingewiesen hatte. Es ergoß sich ein Strom von jungen Leuten aus den staubigen Sälen der Hochschulen, man suchte die Dörfer auf, man begann zu sehen, man malte Bauern und Bäume und man feierte die Meister von Fontainebleau, die das alles schon ein halbes Jahrhundert vorher versucht hatten. Es war jedenfalls ein ehrliches Bedürfnis, welches dieser Bewegung zugrunde lag, aber es war eben eine Bewegung und sie konnte viele mitgerissen haben, denen die Akademie eigentlich nicht zu enge war. Man mußte abwarten. Von allen, die damals hinauszogen, sind inzwischen viele in die Städte zurückgekehrt, nicht ohne gelernt zu haben, ja vielleicht sogar nicht ohne von Grund aus andere geworden zu sein. Andere sind von Landschaft zu Landschaft gewandert, überall lernend, feine Eklektiker, denen die Welt zur Schule wird, – einige sind berühmt geworden, viele untergegangen, und es wachsen neue heran, die richten werden.
Nicht weit aber von jener Gegend, in welcher Philipp Otto Runge seinen Morgen gemalt hat, unter demselben Himmel sozusagen, liegt eine merkwürdige Landschaft, in der sich damals einige junge Leute zusammengefunden hatten, unzufrieden mit der Schule, sehnsüchtig nach sich selbst und willens, ihr Leben irgendwie in die Hand zu nehmen. Sie sind nicht mehr von dort fortgegangen, ja, sie haben es sogar vermieden, größere Reisen zu machen, immer bange, etwas zu versäumen, irgendeinen unersetzlichen Sonnenuntergang, irgendeinen grauen Herbsttag oder die Stunde, da nach stürmischen Nächten die ersten Frühlingsblumen aus der Erde kommen. Die Wichtigkeiten der Welt fielen ihnen ab und sie erfuhren jene große Umwertung aller Werte, die vor ihnen Constable erfahren hatte, der in einem Briefe schrieb: »Die Welt ist weit, nicht zwei Tage sind gleich, nicht einmal zwei Stunden; noch hat es seit Schöpfung der Welt zwei Baumblätter gegeben, die einander gleich waren.« Ein Mensch, der zu dieser Erkenntnis gelangt, fängt ein neues Leben an. Nichts liegt hinter ihm, alles vor ihm und: »Die Welt ist weit.«
Diese jungen Menschen, die jahrelang ungeduldig und unzufrieden auf Akademien gesessen hatten, »drängten sich« – wie Runge schrieb – »zur Landschaft, sie suchten etwas Bestimmtes in dieser Unbestimmtheit«. Die Landschaft ist bestimmt, sie ist ohne Zufall, und ein jedes fallende Blatt erfüllt, indem es fällt, eines der größten Gesetze des Weltalls. Diese Gesetzmäßigkeit, die niemals zögert und sich in jedem Augenblicke ruhig und gelassen vollzieht, macht die Natur zu einem solchen Ereignis für junge Menschen. Gerade das suchen sie, und wenn sie in ihrer Ratlosigkeit nach einem Meister verlangen, so meinen sie nicht jemanden, der fortwährend in ihre Entwicklung eingreift und durch ein Rütteln die geheimnisvollen Stunden stört, in denen die Kristallbildung ihrer Seele geschieht; sie wollen ein Beispiel. Sie wollen ein Leben sehen, neben sich, über sich, um sich, ein Leben, das lebt, ohne sich um sie zu kümmern. Große Gestalten der Geschichte leben so, aber sie sind nicht sichtbar, und man muß die Augen schließen, um sie zu sehen. Junge Menschen aber schließen nicht gerne die Augen, zumal wenn sie Maler sind: sie wenden sich an die Natur und, indem sie sie suchen, suchen sie sich.
Es ist interessant zu sehen, wie auf jede Generation eine andere Seite der Natur erziehend und fördernd wirkt; diese rang sich zur Klarheit durch, indem sie in Wäldern wanderte, jene brauchte Berge und Burgen, um sich zu finden. Unsere Seele ist eine andere als die unserer Väter; wir können noch die Schlösser und Schluchten verstehen, bei deren Anblick sie wuchsen, aber wir kommen nicht weiter dabei. Unsere Empfindung gewinnt keine Nuance hinzu, unsere Gedanken vertausendfachen sich nicht, wir fühlen uns wie in etwas altmodischen Zimmern, in denen man sich keine Zukunft denken kann. Woran unsere Väter in geschlossenem Reisewagen, ungeduldig und von Langerweile geplagt, vorüberfuhren, das brauchen wir. Wo sie den Mund auftaten, um zu gähnen, da tun wir die Augen auf, um zu schauen; denn wir leben im Zeichen der Ebene und des Himmels. Das sind zwei Worte, aber sie umfassen eigentlich ein einziges Erlebnis: die Ebene. Dia Ebene ist das Gefühl, an welchem wir wachsen. Wir begreifen sie und sie hat etwas Vorbildliches für uns, da ist uns alles bedeutsam: der große Kreis des Horizontes und die wenigen Dinge, die einfach und wichtig vor dem Himmel stehen. Und dieser Himmel selbst, von dessen Dunkel-und Hellwerden jedes von den tausend Blättern eines Strauches mit anderen Worten zu erzählen scheint und der, wenn es Nacht wird, viel mehr Sterne faßt, als jene gedrängten und ungeräumigen Himmel, die über Städten, Wäldern und Bergen sind.
In einer solchen Ebene leben jene Maler, von denen zu reden sein wird. Ihr danken sie, was sie geworden sind und noch viel mehr: Ihrer Unerschöpflichkeit und Größe danken sie, daß sie immer noch werden.
Es ist ein seltsames Land. Wenn man auf dem kleinen Sandberg von Worpswede steht, kann man es ringsum ausgebreitet sehen, ähnlich jenen Bauerntüchern, die auf dunklem Grund Ecken tiefleuchtender Blumen zeigen. Flach liegt es da, fast ohne Falte, und die Wege und Wasserläufe führen weit in den Horizont hinein. Dort beginnt ein Himmel von unbeschreiblicher Veränderlichkeit und Größe. Er spiegelt sich in jedem Blatt. Alle Dinge scheinen sich mit ihm zu beschäftigen; er ist überall. Und überall ist das Meer. Das Meer, das nicht mehr ist, das einmal vor Jahrtausenden hier stieg und fiel und dessen Düne der Sandberg war, auf dem Worpswede liegt. Die Dinge können es nicht vergessen. Das große Rauschen, das die alten Föhren des Berges erfüllt, scheint sein Rauschen zu sein, und der Wind, der breite mächtige Wind, bringt seinen Duft. Das Meer ist die Historie dieses Landes. Es hat kaum eine andere Vergangenheit.