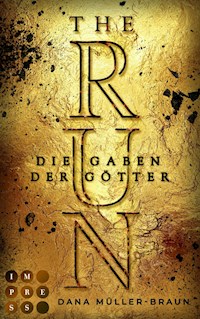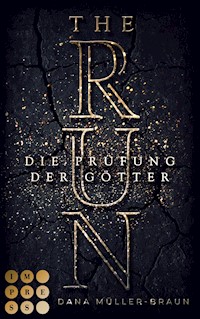Gesamtausgabe der vierbändigen Prinzessinnen-Dystopie (Die Königlich-Reihe) E-Book
Dana Müller-Braun
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
**Undercover ins Herz des Prinzen gestohlen** Die bildhübsche Insidia wurde ihr ganzes Leben lang darauf vorbereitet, die anstehende Partnerschaftswahl des Prinzen zu infiltrieren und den Königssohn für sich zu gewinnen. Als beste Agentin ihrer Einheit ist sie an strategischer Raffinesse und Kampfgeschick kaum zu übertreffen, nur das Tragen ausladender Ballkleider und die höfische Etikette machen ihr etwas zu schaffen. Wie viel der Auftrag ihr jedoch wirklich abverlangen wird, merkt sie erst, als sie es bis ganz nach oben an die Seite des Prinzen schafft. Nun muss sie nicht nur Tag für Tag ihr Doppelleben verbergen und sich den Anforderungen der oberen Gesellschaft stellen, sondern allem voran auch darauf achten, ihr eigenes Herz nicht zu verlieren. Doch dafür mag es schon zu spät sein… Mit der »Königlich«-Reihe erschafft die Debütautorin Dana Müller-Braun ein wunderbar romantisches Romanreich, das voller Gefühle und Emotionen steckt und so authentisch erzählt ist, dass man sich beinahe selbst wie eine Prinzessin fühlt! //Die E-Box enthält alle Bände der romantisch-dystopischen »Königlich«-Reihe -- Königlich verliebt (Königlich-Reihe 1) -- Königlich verraten (Königlich-Reihe 2) -- Königlich vergessen (Königlich-Reihe 3) -- Königlich verloren (Königlich-Reihe 4)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2018 Text © Dana Müller-Braun, 2017, 2018 Coverbild: shutterstock.com / © sivilla / © run4it / © Vandathai Covergestaltung der Einzelbände: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60455-9www.carlsen.de
Dana Müller-Braun
Königlich verliebt (Die Königlich-Reihe 1)
**Plötzlich Prinzessin?** Jahrelang wurde die Agentin Insidia innerhalb ihrer Geheimorganisation darauf trainiert, einen ganz speziellen Auftrag zu erfüllen: den Prinzen bei der alljährlichen Partnerschaftswahl für sich zu gewinnen und schließlich zu heiraten. Doch aufgewachsen hinter dicken Mauern, gelehrt keine Emotionen zuzulassen, fällt es ihr nicht leicht, sich dem Stadttrubel mit den vielen Menschen und der Mode mit den pompösen Kleidern anzupassen. Erst langsam lernt sie sich in dem alltäglichen Leben zurechtzufinden, das sich in den letzten Jahren ungesehen vor ihr abgespielt hat. Dazu gehört, dass sie in der Gegenwart des hübschen Nachbarsjungen Kyle merkwürdige Gefühle in sich wahrzunehmen beginnt. Aber nachgeben darf sie ihnen auf gar keinen Fall. Denn schließlich hat ihr Auftrag oberste Priorität …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Dana Müller-Braun wurde Silvester '89 in Bad Soden im Taunus geboren. Geschichten erfunden hat sie schon immer – Mit 14 Jahren fing sie schließlich an ihre Phantasie in Worte zu fassen. Als das Schreiben immer mehr zur Leidenschaft wurde, begann sie Germanistik, Geschichte und Philosophie zu studieren. Wenn sie mal nicht schreibt, baut sie Möbel aus alten Bohlen, spielt Gitarre oder verbringt Zeit mit Freunden und ihrem Hund.
Menschen sterben, Insidia! Sie sterben und kommen nie wieder. Ja, es ist grausam – und man hat das Gefühl, dass die Welt untergegangen ist. Aber das ist egoistisch! Nicht deine Welt ist untergegangen, sondern ihre.
Der Tod ist unbarmherzig und bringt nur Leid mit sich. Schmeiß das Leben nicht weg, das dir vergönnt ist und ihnen nicht. Halt es! Krall dich daran fest, wenn es nötig ist. Aber zeig verdammt noch mal, dass du es wert bist, zu leben! Denn das Leben kennt genauso wenig Gnade wie der Tod. Das Leben ist genauso angsteinflößend. So angsteinflößend, dass du dich fragen musst, wer es besser hat: die Lebenden oder die Toten.
Du wirst damit nicht klarkommen. Du wirst es nie verstehen. Du wirst es nie begreifen können. Es gibt keinen Grund, außer dem, dass die Menschen vergänglich sind. Das Leben ist vergänglich. Aber auch der Schmerz, den du jetzt spürst.
Was nicht vergänglich ist, sind deine Erinnerungen. Also bleib gefälligst am Leben und halte diese Erinnerungen aufrecht!
Und wenn du ins Straucheln gerätst. Wenn die Trauer dich übermannt. Dann flieh! Flieh vor dir und deinen Gefühlen. Flieh vor der Wahrheit.
Denn der einzige Weg, dem Schmerz wirklich zu entkommen, ist die Flucht vor der Wahrheit.
Für meinen kleinen Bruder Niklas
PROLOG
Geschichten aus meiner Zeit beginnen fast immer mit einem unschuldigen Mädchen, das in irgendetwas hineingezogen wird. Völlig naiv steuert es in sein Unglück und entpuppt sich am Ende als Heldin.
Bei meiner Geschichte ist das etwas anders. Ich war nie unschuldig. Schon während meiner Erziehung wurde mir jegliche Unschuld genommen – das bisschen Naivität, das ein Kind von Natur aus in seinen Genen mit sich trägt.
Was das wirklich heißt, habe ich erst in meiner Betaphase erfahren. Vorher wusste ich zwar aus Büchern und aus dem Unterricht, wie diese Eigenschaft definiert wird, aber nie zuvor habe ich sie an einem echten Menschen beobachtet. An mir beobachtet.
Mein Leben ist in Phasen aufgeteilt. So wie das einiger anderer Auserwählter, wie sie uns zu nennen pflegen.
Die Pre-Alphaphase umfasst die komplette Zeit, die wir im DF verbracht haben. Disciplina Focus, eine Art Erziehungscamp – milde ausgedrückt. Von unserer Geburt an, bis wir sechzehn Jahre alt sind, leben und lernen wir im DF.
Ab einem Alter von zehn Jahren beginnt die Alphaphase. Das ist der Zeitpunkt, an dem unsere körperliche Ausbildung radikalere Züge annimmt. Plötzlich war es nicht mehr nur ein einfacher Kampfsport, den wir ausübten, sondern viel mehr als das.
Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag, als ich in den Übungsraum trat und mein Mentor mir ein Gewehr in die Hand drückte. Er und all die anderen Mentoren nannten mich oft Wunderkind. Vielleicht war das der Grund dafür, dass ich nicht – wie die anderen – auf eine Zielscheibe schießen sollte, sondern auf einen Menschen. Einen älteren Mann mit Bart. Ich weiß nicht mehr genau, wie er ansonsten aussah, aber seine Augen werde ich niemals vergessen. Sobald ich meine schließe, sehe ich sie vor mir. Wie mein Mentor immer sagte: Die Augen seines ersten Opfers vergisst man nie.
Heute würde ich vielleicht noch einmal darüber nachdenken, ob ich wirklich abdrücken soll. Damals habe ich keine Sekunde gezögert. Und obwohl die Waffe nicht geladen war und ich den Mann nie getötet habe, verfolgen mich seine Augen bis heute. Dieser Ausdruck in ihnen nimmt mir noch heute den Atem. Es war mehr als nur der Schock darüber, dass ein kleines Mädchen bereit war, auf ihn zu schießen. Nein, es war Abscheu. Tiefe, unbarmherzige Abscheu, die mich damals kaltließ, ja, die mir sogar ein Lächeln auf mein Gesicht zauberte. Heute birgt dieser Blick meine größte Angst.
Ich bestand die Alphaphase damals mit Bravour. Und wem es vorher noch nicht klar gewesen war, dem wurde es spätestens jetzt ganz deutlich: Wir wurden zum Kämpfen ausgebildet, vielmehr: zum Töten. Warum, wusste ich nicht und ich hätte auch nie gefragt. Nicht, weil ich Angst davor hatte, nein. Einfach, weil es mir egal war. Ich war mir sicher, dass es einen guten Grund dafür gab und ich ihn dann erfahren würde, wenn es notwendig wäre.
Vielleicht wünsche ich mir mittlerweile, dass ich damals gefragt hätte. Aber das ist nur ein kleiner Wunsch. So tief vergraben, dass ich ihn kaum spüren kann. Denn eigentlich weiß ich, dass sie immer einen Grund hatten. Dass sie ihn immer haben werden. Und wir einfach zu winzig sind, um ihn zu begreifen.
Nachdem ich die Alphaphase bestanden hatte, wurde ich in die Welt eingeführt. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht einmal, dass es überhaupt eine Welt außerhalb des DF gab.
Sie erzählten mir von der alten Welt, die beinahe von Terroristen zerstört wurde. Doch diese Terroristen handelten nicht aus freien Stücken. Die Regierungen selbst, in deren Ländern die Anschläge verübt wurden, waren ihre Geldgeber. Sie inszenierten einen Krieg und griffen an. Was daraus folgte, war ein Rassenkrieg, den niemand zu stoppen vermochte.
Die Welt, wie sie damals – 2026 – war, existiert nicht mehr. Die meisten Kontinente sind mittlerweile unbewohnt. Man vermutet, dass in Amerika noch Menschen leben, die sich jedoch so abgeschottet haben, dass ihr Dasein nicht der Rede wert ist. Australien gibt es nicht mehr. So wie es mir erzählt wurde, ist der komplette Kontinent, auch Neuseeland, vom Ozean verschluckt worden. Ebenso wie Teile Europas. Afrika ist totes Land und das, was von Asien und Europa noch bewohnbar ist, nennt sich heute Insidia – genauso wie ich. Ich werde nie verstehen, warum ich den Namen dieses Staates trage, aber ich werde auch nicht danach fragen.
Insidia wird von einem König beherrscht. Mein Mentor sagte mir, dass es nur die geschönte Ausdrucksweise für eine Diktatur sei, doch mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob er damit recht hat. Auch wenn ich ihn bisher nie infrage gestellt habe.
Sie erklärten mir außerdem, dass die Betaphase, in die ich zu dem Zeitpunkt übertreten sollte, aus einem Experiment bestehen würde. Wofür ich Insidia erst kennen musste. Bevor ich also die Betaphase beginnen konnte, lernte ich eine Woche lang alles über Insidia, den Staat, der mir meinen Namen gab.
Neben der alleinigen Herrschaft hatte die Regierung auch als Einzige die Macht, Kinder zu erzeugen.
Ich weiß immer noch nicht genau, wie es wirklich funktioniert, aber sie setzen den Frauen Kinder ein, die sie dann in ihrem Körper wachsen lassen müssen, bis sie groß genug sind. Ich erschaudere jedes Mal bei der Vorstellung, dass etwas in mich reingesetzt wird, das in mir wächst. Kinder sind Parasiten – nichts anderes.
Wenn die Kinder geboren sind, werden sie in eines der DF gegeben. Was eigentlich keine Camps zur Kampfausbildung, sondern normale Erziehungscamps sind, in denen die Kinder Lesen, Schreiben und Geschichte lernen.
Das Camp, das ich besuchte, war einzigartig und ich wurde speziell dafür gezüchtet. Mein Lebensplan stand somit schon immer geschrieben.
Sie erklärten mir, dass es etwas gibt, das sich allgemein Liebe nennt, etwas, das sie nicht in der Lage waren zu vernichten, die Regierung aber erheblich schwächte. Diese Liebe zwischen zwei Menschen versuchten sie durch eine exakt dafür vorgesehene Veranstaltung einzudämmen. Eine Art Partnerschaftswahl, die einmal im Jahr stattfindet und für die sich junge Männer und Frauen anmelden können, um einen geeigneten Partner zu finden. Auf diese Weise meint die Regierung, freie Liebe einschränken zu können.
Das Jahr, in dem meine Betaphase beginnen sollte, war ein besonderes Jahr. Der Sohn des Königs, der natürlich nicht in einem der DF aufgezogen wurde, nahm an diesem Wettbewerb teil.
Und genau aus diesem Grund wurde ich gezüchtet. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem auch der Prinz gezüchtet wurde.
Meine Betaphase konnte beginnen.
Was ich damals noch nicht wusste, war, dass mir mit der Betaphase klar werden würde, dass ich genauso naiv und unschuldig bin wie all die anderen Mädchen und dass etwas anfangen würde, in mir zu wachsen wie ein Parasit.
KAPITEL 1
»Jeder von euch hat seine Aufgabe«, brummte Philipp, der in meinem Türrahmen stand und mir beim Packen zusah. Ich nickte. Es war das erste Mal, dass ich Missmut empfand. Aber das durfte ich ihn nicht spüren lassen. Er war schließlich mein Mentor.
»Ich weiß, dass dir deine Aufgabe nicht passt, dass du dir das anders vorgestellt hast«, murmelte er.
Ich warf ihm einen Blick zu. Betrachtete seine verschränkten Arme und wie er dort an meinen Türrahmen gelehnt stand und mich ebenfalls musterte. Das konnte nur ein Test sein. So etwas würde er nie sagen und schon gar nicht würde er solche Gefühle bei mir tolerieren.
»Nein«, antwortete ich knapp und packte weitere Klamotten zusammen.
»Insidia, lass das sein. Du wirst von uns eingekleidet.«
Ich stockte kurz. Womöglich einen Moment zu lange, denn als ich wieder zu Philipp sah, beäugte er mich mit Argwohn.
Als Philipp mit fünfzehn Jahren seine Alphaphase beendet hatte, wurde auch ihm seine Aufgabe offenbart. Er sollte Mentor werden. Und ich wurde sein erster Schützling. Warum konnte ich nicht auch Mentorin werden? Warum musste ich so etwas tun? Einen verwöhnten Schnösel für mich zu gewinnen – das konnte doch nicht mein Lebensinhalt sein. Das, worauf ich hingearbeitet hatte. All die Jahre.
Ich nickte und warf einen Blick zurück auf mein Bett, auf dem mein offener, halb voller Koffer lag.
»Was passiert mit den Sachen? Soll ich sie vernichten?«, fragte ich tonlos und sah Philipp weiter an.
»Das werden wir erledigen. Schon heute Nachmittag zieht hier ein neues Mädchen ein.«
Mein Körper verkrampfte sich. »Dein neuer Schützling?«
Er nickte.
Irgendetwas in mir wollte sich damit nicht abfinden. Aber ich musste – und das war wichtiger. Ich nickte erneut, beinahe automatisch, und ging an Philipp vorbei in den Flur, ohne einen weiteren Blick auf mein Zimmer zu werfen.
»Es ist normal, dass du dich jetzt komisch fühlst. Das war schließlich die letzten fünf Jahre dein Zuhause.«
Ich atmete schwer. Mein Zuhause war die Kämpfer-Vereinigung, die mich gemacht hatte. Sie war alles, was ich war. Pugnator Globus. Gegründet, um die Machtfülle des Monarchen einzudämmen. Und jeder von uns war nur dafür da, nur dafür gemacht, ihr zu dienen. Der Geheimorganisation, der wir den Fortbestand dieser Welt verdankten.
»Das PG ist mein Zuhause«, erwiderte ich und ging ihm voraus in Richtung Esszentrum, als er mir nacheilte und nach meiner Hand griff. Ich sah ihn entgeistert an. Ich wollte ihn nicht infrage stellen, aber das war nun wirklich eine unangebrachte Geste, wenn wir uns nicht im Training befanden.
»Ich war mir meiner Sache und meiner Loyalität immer sicher, Insidia. Bis ich dich traf«, flüsterte er so leise, dass ich mich schon bei seinem letzten Wort fragte, ob er das überhaupt gesagt hatte.
Ich entzog mich ihm, indem ich seinen Arm packte, ihn drehte und seine Hand an seinem Rücken immer weiter nach oben schob.
»Wenn du mich auf die letzten Meter noch testen willst, Philipp, dann lass dir was Besseres einfallen als das!«, knurrte ich und ließ ihn los. Philipp hatte keinen Ton von sich gegeben, obwohl ich genau wusste, wie schmerzhaft das war.
»Ich teste dich nicht!«
Ich hob die Augenbrauen. So einen Schwachsinn hatte ich noch nie aus seinem Mund gehört. Und auch aus keinem anderen.
Er trat ein paar Schritte heran.
»Hör mir zu, Insidia. Es ist nicht alles so, wie es scheint. Und ich hoffe, dass du nie an den Punkt gelangen wirst, an dem ich mich jetzt befinde. Aber ich möchte, dass du weißt, dass meine Loyalität alleine dir gilt. Und sollte der Tag doch irgendwann kommen, der Tag, an dem alles zu bröckeln beginnt, dann wende dich an mich.«
Er wich wieder etwas vor mir zurück. Mein Ohr war noch warm von seinem Geflüster. Dann setzte er eine herrische Miene auf und ging voraus.
Falls es doch ein Test gewesen war, ließ ich mir nichts anmerken und folgte ihm. Er hatte mir selbst beigebracht: Traue niemandem außer dir selbst und dem PG. Was eigentlich das Gleiche war. Denn die Kämpfer-Vereinigung, die uns ausbildete – Pugnator Globus – war das einzige Ich, das wir kannten. Wir waren sie. Und sie waren wir. Also warum sollte ich Philipp plötzlich Dinge glauben, die das PG niemals tolerieren würde? Es konnte nur ein Test sein. Und dennoch hallten seine Worte in meinem Kopf nach und hinterließen einen schönen Klang – was auch immer daran schön sein sollte …
Ich schüttelte den Kopf und setzte mich, im Esszentrum angekommen, Philipp gegenüber. Die übrigen Rekruten hier »kannte« ich nur vom Sehen. Mit dem einen oder anderen hatte ich vielleicht schon mehr Worte gewechselt als die üblichen Begrüßungen. Aber tatsächlich Kennenkonnte man das nicht nennen. Seit unserem zehnten Lebensjahr verbrachte jeder von uns seine Zeit ausschließlich mit seinem Mentor. Und meiner war nun einmal Philipp. Ich mochte ihn, aber das gerade nahm ich ihm wirklich übel. Ich hätte niemals erwartet, dass gerade er es sein würde, der mich an meinem letzten Tag, bevor endlich die Betaphase begann, derart in den Prüfstand nehmen würde. Jedem anderen hätte ich das zugetraut – aber nicht ihm. Schließlich sollte er stolz darauf sein und es nicht noch zu verhindern versuchen.
»Alles in Ordnung?«, fragte er und beäugte die Schlange an der Essensausgabe, die immer noch nicht kleiner geworden war. Ich nickte. Und hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gesagt, dass er enttäuscht aussah.
»Darf ich künftig eine Waffe tragen?«
Philipp schaute mich skeptisch an und lachte dann leise.
»Eine Waffe? Insidia, in dieser Welt musst du deine eigene Waffe sein. Du darfst nicht auffallen«, erwiderte er.
Seit dem Beginn meiner Alphaphase hatte ich beinahe täglich mein Schießtraining absolviert. Und jetzt, da ich wirklich in die Welt außerhalb des DF entlassen wurde, verweigerten sie es mir. Ich schluckte schwer, nickte aber trotzdem.
»In deiner Reisetasche wird sich eine Waffe befinden, aber am Körper darfst du sie zunächst nicht mit dir herumtragen«, sagte er mahnend – als hätte ich mich jemals gegen Vorschriften gewendet.
Er musterte mich noch einen Augenblick und erhob sich dann, um sich an der nun doch etwas kleiner gewordenen Schlange anzustellen. Ich tat es ihm gleich. Und ehe ich mich versah, war das letzte Essen in meinem alten Zuhause beendet.
Philipp redete seltsamerweise nicht mehr mit mir. Er war zwar sowieso ein schweigsamer Mensch, aber heute hätte ich mit etwas anderem gerechnet. Gerade weil ich doch voraussichtlich nie wieder hier sein würde. Aber Wehmut konnte ich von ihm nicht erwarten. Eigentlich sollte ich das nicht einmal von mir selbst. Ich atmete tief ein und aus, um wieder einen klaren Gedanken zu fassen.
Wir liefen ein paar Gänge des unterirdischen Bunkers entlang und betraten einen Raum der Kommandozentrale.
»Du musst Insidia sein! Ich bin Charlotte«, sagte ein Mädchen – eher eine junge Frau, wahrscheinlich so alt wie Philipp – und sprang aufgeregt auf der Stelle herum. Ich musterte sie skeptisch. Ihre blonden Haare. Das bunte Kleid und die Schminke in ihrem Gesicht. Ich warf einen Blick in einen kleinen Spiegel über einem Waschbecken und schämte mich ganz plötzlich. Nicht etwa wegen meiner dunklen, streng zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haare, meiner breiteren Augenbrauen, meiner fahlen, ungeschminkten Haut oder meiner Militärkleidung. Nein, ich schämte mich ihretwegen. Und dankte dem PG inständig, dass ich nie so rumlaufen musste.
Ich sah wieder zu Charlotte, die mich immer noch angrinste, die Hände vor ihrer Brust aufeinandergelegt. Ein Überbleibsel ihres Anfalls gerade und dem damit einhergehenden Klatschen.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss Charlotte«, sagte ich, nahm eine Hand von meinem Rücken – eine Haltung, die ich während meiner Erziehung eingetrichtert bekommen hatte – und reichte sie ihr. Die junge Frau allerdings stupste sie belustigt zur Seite und nahm mich, ohne Umschweife, in den Arm.
»Du musst noch einiges lernen. Ich habe ja gesagt, dass so ein Grundkurs nicht in zwei Stunden erledigt ist. Aber mir will ja keiner zuhören. Du wirst es genauso schwer haben wie ich damals.« Ich konnte ihr kaum folgen, so viel redete diese Frau. Ihre Stimme war deutlich zu hoch für meinen Geschmack und allmählich begann ich mich zu fragen, was sie hier suchte. Zu diesem Quartier hatten nur PG-Soldaten Zutritt.
»Charlotte war in meinem Jahrgang. Wir haben die Alphaphase gemeinsam abgeschlossen und sie ist damals in den Außendienst berufen worden. Sie hat dort eine andere Aufgabe als du, aber sie kennt Insidia und seine Bewohner. Die Kultur und Gepflogenheiten. Also wird sie dir ein paar nützliche Tipps geben können«, erklärte Philipp. Ich legte meine Hand wieder zurück zur anderen auf meinen Rücken und nickte. Ich dachte nicht weiter über Charlottes Aufzug und ihre Art nach oder über die grausame Vorstellung, dass ich auch so sein müsste. Es war ein Befehl, den ich befolgte.
»Zuallererst musst du mal ein bisschen lockerer werden«, quietschte sie, packte meine Schultern und zog meinen Oberkörper ein wenig nach vorne. Dann schnappte sie sich meine Hände und legte sie neben meinem Körper ab. Ich fühlte mich seltsamer als je zuvor.
Charlotte bewegte meinen Körper immer wieder hin und her, bis mein Rücken von der gekrümmten Haltung so sehr schmerzte, dass ich mich wieder gerade aufrichtete. Doch obwohl Charlotte aussah wie ein Mädchen, hatte sie nicht nur eine starke Willenskraft, sondern war auch körperlich ziemlich stark, was ich zu spüren bekam.
»Sie sollte erst einmal eines der Kleider anziehen. Das hat in den Klamotten einfach keinen Sinn.«
Einen Moment lang dachte ich darüber nach, ihr meine Waffe an die Schläfe zu halten. Eventuell sogar abzudrücken. Nicht nur wegen des Kleides. Auch das Verstummen ihrer ätzenden Stimme wäre es wert gewesen. Sie hallte noch Sekunden später schmerzend in meinen Ohren wider.
Doch stattdessen begab ich mich in einen separaten Raum und stülpte mir eines der Kleider über, das noch am schlichtesten aussah. Es war weiß mit einem eingestickten Muster und für meinen Geschmack viel zu kurz und eng. So etwas trugen Mädchen in Insidia? Das war wirklich ein seltsamer Staat. Ich ging ein paar Schritte auf die Tür zu und öffnete sie einen Spalt, dann stockte ich. Ich wollte nicht, dass mich irgendwer in diesem Aufzug sah. Ich atmete tief ein, als ich ein Flüstern vernahm.
»Du lebst jetzt schon fünf Jahre mit ihnen. Ich denke, da ist es normal, dass sie dir ans Herz gewachsen sind, Charlotte«, hörte ich Philipp sagen.
Charlotte stöhnte auf. »Ich weiß doch, Philipp. Aber …« Sie stockte. »Ach egal.«
»Was aber?«, bohrte Philipp nach. Hatte Charlotte keine Angst vor dem, was sie da sagte, und vor allem, vor wem sie es sagte? Sie musste doch wissen, dass Philipp einer der loyalsten PG-Soldaten war, die es gab.
»Ich mag sie.«
Das folgende Schweigen ließ mein Blut in den Adern gefrieren. Hatten sie mich entdeckt? Und was meinte sie damit, dass sie sie mochte? Etwa die Menschen in Insidia? Durfte sie das überhaupt? Und warum erzählte sie ausgerechnet Philipp davon?
Langsam schob ich meinen Kopf durch den Türspalt, um Philipps entrüsteten Gesichtsausdruck sehen zu können. Doch als ich ihn erblickte, bemerkte ich etwas ganz anderes in seinem Gesicht. Wehmut. Das, wovon Charlotte da sprach, das wollte Philipp offenbar auch. Was sollte ich nun tun? Ich musste ihn verraten. Sie verraten. Eigentlich war Charlotte an allem schuld. Philipp wäre niemals von alleine auf so einen Schwachsinn gekommen. Er kannte die Welt da draußen doch gar nicht.
So leise ich konnte, schloss ich die Tür wieder und öffnete sie dann so laut, dass sie mich hören mussten. Beide standen da und sahen mich freudig an, als wäre nie etwas gewesen. Als wären sie keine Verräter. Doch genau das waren sie. Verräter. Denn ihre Aufgabe war es, niemanden zu mögen. Agenten des PG wurden dazu ausgebildet, keine Bindungen einzugehen. Keine emotionalen. Also was sollte das, was sie da besprochen hatten, anderes sein, als ein Verrat an all dem, was uns das PG gelehrt hatte? Ein Verrat an der Organisation, mit der sich jeder von uns zu identifizieren hatte?
»Entzückend!«, rief Charlotte und klatschte in die Hände. Philipp sah mich ganz seltsam an. So einen Blick kannte ich von ihm gar nicht.
Charlotte erklärte mir, wie ich zu gehen und zu essen hatte und dass ich lachen sollte und all so ein albernes Zeug, für das ich keine Aufmerksamkeit übrig hatte. Meine Gedanken kreisten nur um Philipp, das Gespräch und um den merkwürdigen Blick, den er mir unentwegt zuwarf.
Natürlich galt meine Treue dem PG. Aber galt sie nicht irgendwie auch Philipp? Ich vertraute ihm. Er war es schließlich, der mich ausgebildet hatte. Er war das einzige Gesicht zu der Organisation, für die ich kämpfen sollte.
Ich musste ihn verraten. Aber ich entschied mich, noch eine Weile damit zu warten. Und wusste genau, dass es falsch war. Das erste Mal in meinem Leben funktionierte ich nicht so, wie ich sollte, und es tat weh. Aber viel mehr hätte es wehgetan, wenn Philipp wegen meines Verrats gestorben wäre. Charlotte hätten sie meinetwegen umbringen können. Aber ich fand keinen Weg, sie zu verraten und Philipp nicht. Außerdem war er viel zu loyal, um seine Beteiligung zu verschweigen. Er hätte gestanden, dass er es war, gegenüber dem Charlotte diese Äußerungen hervorgebracht hatte und der sie nicht verraten hatte.
Charlotte schubste mich andauernd hin und her, und meine Lust wuchs ins Unermessliche, ihre schwächliche PG-Soldaten-Fassade auffliegen zu lassen. Aber ich lächelte, so wie sie es mir befahl.
Nach ein paar Stunden, die mir rein gar nichts gebracht hatten, allein, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders gewesen war, folgte ich Philipp in einen weiteren Raum.
Ein riesiger Bildschirm zierte die komplette Wand. Etwas, das wir nicht allzu oft zu Gesicht bekamen.
Das Bild eines Mannes erschien. Seine weißen Haare reichten bis über seine Ohren. Sein breites Grinsen bereitete mir allein vom Zusehen Schmerzen in den Mundwinkeln und auf seinem Kopf thronte eine riesige, prunkvolle Krone. Der König – dachte ich fast zeitgleich, als Philipp es sagte.
»König Ferdinand.« Ein seltsamer Name für einen Mann, der aussah wie eine Witzfigur mit Spielzeugkrone auf dem Kopf.
Philipp drückte einen Knopf und das Bild wechselte zu dem einer Frau. Eine hübsche Frau – keine Frage. Die Krone, die sie auf ihrem langen blonden und welligen Haar trug, war um einiges kleiner und schlichter als die des Königs. Nicht einmal ich konnte anders, als diese Frau wunderschön zu finden.
»Und last, but not least …« Das Bild veränderte sich und zeigte das Gesicht eines jungen Mannes. Ich stutzte. Den Prinzen hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Seine dunkelblonden Haare fielen lässig durcheinander über seine Ohren und ließen gerade so die Sicht auf seine eisblauen Augen zu. Beinahe waren sie grau. Bei ihrem Anblick erschauderte ich.
Philipp betrachtete mich prüfend. Als ich zu ihm aufsah, grinste er schadenfroh. Ich erwiderte es nicht. Die Genugtuung würde ich ihm nicht verschaffen. Machte ihm das etwa Spaß?
Ich musterte Philipps kurz geschorene Haare. Der kleine Flaum auf seinem Kopf war auch eher dunkelblond, aber kaum zu vergleichen mit der Haarfarbe des Prinzen.
Philipps schokoladenbraune Augen ruhten nach wie vor auf mir. »Wenn du deinen Auftrag zufriedenstellend erledigst, ist das dein zukünftiger Mann.«
Ich warf erneut einen Blick auf den starren Ausdruck des Prinzen und schluckte schwer. Er wirkte so kühl und glatt, dass sich etwas in mir gegen diese Vorstellung sträubte. Aber ich musste dieses seltsame Gefühl beiseiteschieben. Ich durfte mir über solche Dinge keine Gedanken machen. Ich hatte doch immer gewusst, dass dieser Tag irgendwann kommen würde.
Aber dass mein Auftrag so ausfallen würde, hätte ich nie gedacht. Und ein kleiner Teil von mir wollte sich dagegen wehren – aber das konnte ich nicht. Ich durfte keine Gefühle zulassen. Weder bezüglich des Auftrags noch dem Prinzen gegenüber. Alles, was für mich ab jetzt von Bedeutung sein sollte, war, dass ich einen Auftrag zu erledigen hatte – egal, was ich dabei empfand und wer die Person war, die diesen Auftrag ausmachte.
Mein Blick schweifte wieder zu den Augen des blonden Jungen auf dem Bildschirm. Ich wusste es schon jetzt. Ich konnte es in seinen Augen sehen – er war ein Monster!
KAPITEL 2
Unser Abschied fiel Philipp sichtlich leicht. Obwohl ich nach dem, was ich ihn hatte sagen hören, damit gerechnet hatte, dass er wieder unangebrachte Emotionen zeigen würde. Aber da täuschte ich mich.
Stumm warf ich ihm noch einen letzten Blick zu und setzte mich dann in das schwarze Auto. Die Sonne strahlte und raubte mir die Sicht in dem dunklen Inneren des Wagens. Ich blinzelte ein paar Mal und erkannte einen Mann, der mir gegenüber auf dem Sitz saß – vertieft in irgendwelche Zettel, die auf seinem Schoß lagen. Als die Tür geschlossen wurde, blickte er zu mir auf.
»Ihr Name ist Insidia Jones. Sie sind siebzehn Jahre alt und die Cousine einer gewissen Emili Jones, die seit ihrer Geburt in Insidia lebt.«
Er schwieg für einige Sekunden. Seine Augen wanderten über die Papiere auf seinem Schoß.
»Ihr Geburtsdatum ist der 1.6.2194. Ihre Eltern sind letzte Woche bei einem Autounfall gestorben. Cecilia und James Jones. Sie gehörten beide dem PG an und lebten die letzten siebzehn Jahre in Insidia, zusammen mit einem Mädchen Ihres Alters, das ebenfalls bei dem Autounfall starb. Das ist die wahre Geschichte. In unserer Version ist sie nicht gestorben, sondern hat den Unfall überlebt und zieht zu ihrer Cousine …?« Er sah mich fragend an.
»Emili«, vervollständigte ich. Er nickte zufrieden. Ich sog die abgestandene Luft in dem Auto ein. Erst jetzt bemerkte ich, dass wir bereits fuhren. Unwillkürlich fragte ich mich, ob dieser Autounfall ein Zufall gewesen war. Das konnte er wohl kaum sein, wenn er genau mit meinem Auftrag zusammenpasste. Ich schluckte schwer. Aber ich wusste, dass das PG seine Gründe dafür hatte und sich die Familie Jones im Klaren darüber gewesen war, welches Schicksal sie ereilen würde. Es war ihre Aufgabe – gewesen.
»Emili gehört nicht zum PG, zumindest weiß sie es nicht. Sie wurde von uns gezüchtet. Weil sie jedoch in Insidia aufwuchs, hielten wir es für sicherer, sie nicht aus der Ferne auszubilden. Und da wir sie nicht ausbilden konnten, war es auch unmöglich, ihr die Existenz des PG zu offenbaren. Die Gefahr eines Verrats wäre zu groß gewesen. Emili ist achtzehn Jahre alt, was in Insidia bedeutet, dass sie volljährig ist. Also lebt sie alleine. Wir haben dafür gesorgt, dass sie ihre Cousine, die fünfhundert Kilometer entfernt gewohnt hat, nie treffen konnte. Sie kennt nur unsere Version der Geschichte. Also geht sie davon aus, dass Ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben sind und Sie ihn überlebt haben.« Wieder flog er über seine Aufzeichnungen. »Haben Sie noch irgendwelche Fragen, Miss Jones?«
Ich atmete tief ein und schüttelte den Kopf. Ein paar Fragen waren da zwar noch, aber für uns gehörte es sich nicht, sie zu stellen.
»Sobald wir die Grenze von Insidia erreicht haben, werden Sie mit dem Zug in die Hauptstadt gebracht, dort am Bahnhof erwartet Sie Ihre Cousine«, ratterte er runter.
Ich nickte erneut.
»Eine Sache noch. Insidia Jones – also Sie – hat einen Schock erlitten. Sie sahen dabei zu, wie Ihre Eltern starben. Also ist es nur verständlich, dass Sie über Ihre Vergangenheit nicht reden wollen. Was uns den Vorteil verschafft, dass wir Sie nicht in das komplette Leben des Mädchens einführen müssen. Wenn Sie aber doch einmal an den Punkt kommen, an dem Sie eine Antwort geben müssen: Die Antworten befinden sich alle in Ihrem Kopf.«
Ich wusste nicht, was er damit meinte, nickte aber dennoch.
Der Mann begann wieder zu lesen, doch er sagte weiter nichts. Stundenlang saßen wir einfach nur da und schwiegen, und ich dachte an nichts, außer daran, diesen Auftrag zu erledigen. Komme, was wolle.
Als wir schließlich am Bahnhof ankamen, hielt mir der Fahrer die Tür auf. Dann öffnete er den Kofferraum und stellte mein Gepäck zu mir auf den Asphalt. Die Sonne schien zwar noch, aber sie war bereits dabei, unterzugehen. Doch ich sah mich nicht um, sondern starrte einzig und allein auf die Tür des Autos. Der Mann erschien nicht mehr. Stattdessen drückte mir der Fahrer einen Umschlag in die Hand, stieg wieder ein und fuhr davon.
Ohne darüber nachzudenken, öffnete ich das Kuvert. Darin befand sich ein Ticket. Gleis 8.
Ich zog meinen Koffer hinter mir her und steuerte den Eingang des Bahnhofs an. Noch abgeschiedener konnte ein solcher Ort kaum sein. Als befände ich mich mitten in der Wüste.
Ich öffnete die Tür und ein leises Summen drang an meine Ohren. Alle meine Körperzellen sprangen auf Alarm. Was war das? Ein Angriff? Ich sah mich lauernd um, doch als ich genauer hinhörte, bemerkte ich, dass die Menschen um mich herum bloß angeregt miteinander redeten. Warum taten sie das? Wie viel konnte man sich denn zu sagen haben? Ich schüttelte den Kopf und damit den Gedanken ab und lief zu einem kleinen Infoschalter, hinter dem ein junger Mann saß und mich genervt ansah.
Ich zeigte ihm meine Karte, woraufhin er jegliche Körperhaltung verlor und entgeistert auf ein Schild verwies, das »direkt hinter« mir hing. Ich rümpfte die Nase. Am liebsten hätte ich ihm sein dämliches Gesicht gegen die Fensterscheibe geschlagen. Aber wahrscheinlich war das hier eher unangebracht. Also drehte ich mich um und starrte das Schild an. Die Pfeile unter den verschiedenen Gleisen ergaben für mich keinen Sinn. Gleis 8 sollte angeblich auf der rechten Seite zu finden sein. Rechts befand sich aber nur eine Wand.
»Wo müssen wir denn hin?«, riss mich eine dunkle Stimme aus meinen Gedanken. Ich sah mich um und blickte in die braunen Augen eines jungen Mannes, während ich vergebens nach meiner Pistole griff, die sich nicht wie üblich an meiner Hüfte befand.
»Wir?«, erwiderte ich tonlos.
»Na du.«
Ich sah ihn argwöhnisch an. Was genau wollte er eigentlich von mir?
»Wo musst du hin?«, fragte er dann, als ich ihn weiterhin verdutzt anblickte.
»Gleis 8«, erwiderte ich.
»Mein Gott, bist du freundlich«, sagte er lachend und drehte sich um. »Mir nach!«
Obwohl es mir missfiel, ging ich ihm hinterher. Schließlich wäre mein Auftrag gefährdet, wenn ich diesen Zug nicht bekäme.
Er lief auf die Wand auf der rechten Seite zu. Toll. So weit war ich auch schon gewesen. Doch kurz bevor er gegen die Wand lief, entdeckte ich ein Loch im Boden, von wo aus eine mechanische Treppe in den Keller hinunterfuhr. Ich biss mir auf die Unterlippe, stellte mich hinter ihn und hoffte, dass er nicht noch mal mit mir redete. Ich verstand diese Art zu kommunizieren einfach nicht. Im DF gab es klare Anweisungen. Klare Aussagen. Wenn Philipp mich gefragt hätte, wo wir hinwollten, hätte er uns beide gemeint – und nicht nur mich. Das war es doch auch, was diese Frage aussagte. Oder etwa nicht?
»Wo geht's hin?«
Ich überlegte, was er meinte. Doch da ich ausschließen konnte, dass er erneut nach dem Gleis fragte, nahm ich an, dass er nun mein Reiseziel in Erfahrung bringen wollte.
»Ich bin auf dem Weg in die Hauptstadt«, antwortete ich und fragte mich, ob es so schlau war, einem dahergelaufenen Jungen meine Reisepläne zu verraten.
»Dämliche Frage!«, feixte er und schlug sich die Hand auf die Brust.
»Warum?«, erwiderte ich.
Er hob die Augenbrauen. »Na weil alle in unserem Alter auf dem Weg in die Hauptstadt sind.«
Ich zögerte einen Moment und dann nickte ich einfach. Mir wurde nicht wirklich klar, warum alle in unserem Alter dort hinfuhren, aber ich wollte mich nicht noch unwissender präsentieren, als ich es ohnehin schon war.
»Dieses Jahr werden es wahrscheinlich hundert Mal so viele Mädchen sein wie sonst, weil ja der Prinz dabei sein wird!« Er lachte wieder und jetzt wusste ich, was er meinte. Die Partnerwahl, die einmal jährlich stattfand. Wegen der ich ja eigentlich hier war. Deshalb waren sie alle auf dem Weg in die Hauptstadt.
»Was passiert eigentlich, wenn jemand keinen Partner findet?«, fragte ich völlig in Gedanken und bemerkte erst viel zu spät, was da gerade meinen Mund verlassen hatte.
»Wow. Ihr Mädchen aus dem Norden lebt wirklich hinterm Mond!«, sagte er amüsiert. »Na ja, man darf vier Jahre hintereinander teilnehmen. Bis man einundzwanzig ist. Und wenn man bis dahin niemanden gefunden hat, hat man eben niemanden gefunden.«
Irritiert sah ich ihn an. Ich wusste, warum er meine Herkunft kannte. Unser DF befand sich im toten Land. Ganz im Norden vom ehemaligen Schweden. Viel weiter nördlich ging nicht. Das Auto hatte mich vermutlich dicht hinter der Grenze von Insidia abgeladen, was ungefähr in der Mitte von Schweden lag. Aber stammte er etwa nicht von dort?
»Und wo kommst du her?«
»Aus Roma«, murmelte er und bog ein paar Mal ab. Es fiel mir schwer, seinen Worten und Schritten gleichzeitig zu folgen. Ich war es nicht gewohnt, während des Laufens zu reden. Roma war die Hauptstadt von Insidia. Damals war es die Hauptstadt von Italien gewesen und hieß einfach nur Rom.
»Und was hast du hier gemacht?«, fragte ich weiter und sah ihn skeptisch an.
»Wird das jetzt ein Verhör?«, feixte er.
Ich verzog keine Miene.
»Meine Eltern wollten, dass ich der Tochter von Bekannten eine Chance gebe, sie kennenzulernen. Sie ist so alt wie ich – einundzwanzig – und das ist ihr letztes Jahr und ihre Eltern fürchten, dass sie keinen Partner mehr finden wird. Was ich ehrlich gesagt nur bestätigen kann. Sie ist furchtbar!« Er lachte wieder. Er lachte generell ziemlich häufig.
Wir liefen eine Treppe hinauf und gelangten zu den Gleisen. Auf Gleis 8 stand bereits der Zug nach Roma. Ich stieg ein, bedankte und verabschiedete mich höflich, damit er nicht auf die Idee kam, mir weiterhin Gesellschaft zu leisten, aber er durchkreuzte meine Pläne und folgte mir, bis er sich auf einem Platz mir gegenüber niederließ und mich angrinste.
»Und was ist mit dir?«, fragte ich und sah aus dem Fenster.
»Was soll mit mir sein?«
»Na ja. Das ist auch deine letzte Partnerwahl, oder?«, erwiderte ich und biss mir auf die Unterlippe. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, dass ich ihn plötzlich so persönliche Dinge fragte.
»Ich habe noch nie und werde auch nie an einer Partnerwahl teilnehmen. Diesen Quatsch können gerne die anderen machen«, sagte er ernst, aber immer noch zierte ein kleines Lächeln seine Lippen.
Ich musterte seine braunen, verwuschelten Haare, die viel zu lang waren. Ähnlich wie bei dem Prinzen reichten sie bis über seine Ohren.
Als könnte er meine Gedanken lesen, strich er sich die Haare nach hinten und grinste mich breit an.
»Nicht traurig sein. Du findest sicherlich einen anderen. Nur vielleicht solltest du dich dazu ein bisschen herrichten.« Er deutete mit den Augen auf mein Outfit. Und ich war mir sicher, dass er auch mein Gesicht nachdenklich betrachtete.
»Kein Interesse, danke«, erwiderte ich und warf einen kurzen Blick auf die schwarze Hose und den schwarzen Pulli, den sie mir zum Anziehen herausgelegt hatten. Unwillkürlich fragte ich mich, wie viel schlimmer sein Blick wohl gewesen wäre, wenn ich immer noch meine Militärkleidung getragen hätte.
»An mir oder dem Wettbewerb?«, fragte er lachend.
»An dir.«
»Autsch!«, sagte er und hielt sich theatralisch die Hand auf die Brust. »Aber wie gesagt: Ich halte das für schwachsinnig. Ich bin lieber frei wie ein Vogel.« Er bewegte seine Arme, als sei er wirklich ein Vogel, und ich konnte nicht anders, als genervt an die Decke zu sehen.
»Das werdet ihr Frauen wohl nie verstehen. Ihr sucht immer nur nach der einzig wahren und großen Liebe. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, Kleines. Aber die gibt es nicht! Und schon gar nicht bei so einem dämlichen Wettbewerb, bei dem sich alle anbiedern, als wären sie ein Stück Fleisch.«
Endlich sagte er mal etwas Vernünftiges. Bis auf den Anfang natürlich. Ich wartete mit Sicherheit nicht auf die große Liebe. Ich wusste genauso wie er, dass Liebe nur Einbildung war.
»Du redest ziemlich viel«, raunte ich, um nicht auf das eingehen zu müssen, was er gerade gesagt hatte.
Er hob seine Augenbrauen. »Und du bist ziemlich mürrisch«, entgegnete er. »Ich frage mich langsam, was du überhaupt in der Hauptstadt willst. So wie du drauf bist und gehst und aussiehst, findest du mit Sicherheit keinen Kerl, der dich auswählen würde.«
Ich sah ihn einen Moment lang an. Eigentlich hatte er recht. Ich war mir nicht einmal sicher, warum sie mich dafür nicht besser ausgebildet hatten. Wie stellten sie sich das vor, dass ich einen Prinzen überzeugen sollte, mich auszuwählen, wenn ich offensichtlich nicht dem Typ Frau entsprach, den sich ein Mann an seiner Seite wünschte?
»Meine Eltern und ich hatten einen Autounfall. Ich sah sie sterben. Ich bin auf dem Weg in die Hauptstadt, weil ich dort Verwandte habe, bei denen ich wohnen werde, bis ich volljährig bin«, erwiderte ich kalt und als ich seinen entsetzten Blick sah, wusste ich, dass mein Ton nicht ganz angemessen gewesen war.
»Oh … ähm … Das tut mir leid«, sagte er und schwieg danach. Ich tat es ihm gleich. Ich hatte sowieso kein Bedürfnis, mich weiter mit ihm zu unterhalten. Er redete nur unnötiges Zeug, das mich nicht interessierte, und trotzdem erwischte ich mich ein paar Mal dabei, wie ich mein Spiegelbild im Fenster musterte. Ich war wirklich keine Augenweide.
Nach gefühlten Stunden spürte ich erneut seinen Blick auf mir. Am liebsten hätte ich ihn dafür geschlagen. Ich versuchte krampfhaft, nicht in seine Richtung zu sehen, und dann geschah es doch. Und wie erwartet, starrte er mich an.
»Wie heißt du eigentlich?«
»Insidia«, erwiderte ich und atmete schwer. Meine Ruhe war damit wohl beendet.
»Wie das Königreich selbst?«, hakte er irritiert nach.
Ich verzog nickend den Mund. Ziemlich schlau schien er nicht zu sein.
»Ich bin Kyle!«, sagte er dann ablenkend und lächelte mich an. Ich überlegte einen Moment, zurückzulächeln, entschied mich dann aber dagegen.
»Das vorhin war nicht ernst gemeint. Also, dass du hässlich bist.«
Ich riss überrascht meine Augen auf. Von hässlich war nie die Rede.
»Also du hast auf jeden Fall Potenzial, das du allerdings nicht ganz ausschöpfst«, murmelte er und sah dann wieder aus dem Fenster.
»Das war jetzt auch nicht viel netter, als das davor«, raunte ich und verzog meinen Mund.
»Du weißt schon, wie ich das meine. Ihr Mädchen aus dem Norden seid doch alle so. Und wenn ich ehrlich bin, mag ich das. Die Mädchen in der Hauptstadt sind einfach … unecht.«
»Am besten sagst du einfach nichts mehr. Das hat die letzten Stunden doch auch ziemlich gut geklappt«, entgegnete ich und ballte meine Hände zu Fäusten.
»Du bist irgendwie interessant«, murmelte er und sah schief grinsend zu mir. »Ganz anders als die anderen.«
Ich warf ihm einen skeptischen Blick zu. Dass ich anders war, wusste ich. Aber ich bezweifelte, dass er das interessant fand. Er wollte sich nur rausreden, weil ich das mit meinen Eltern gesagt hatte. Aber mir war es gleich. Es waren ja nicht einmal meine Eltern gewesen.
»Also willst du die nächsten drei Stunden weiterhin kein Wort mehr mit mir wechseln?«, fragte er.
Ich sah ihn an und nickte.
»Ehrlich?« Er wirkte irgendwie so, als hätte ich gerade seinen Stolz verletzt.
»Ja, ehrlich, Kyle.«
Er verstummte für einen Moment, begann dann aber wieder zu reden: »Wie soll dein Traummann denn aussehen?«
Ich schnaufte genervt. »Warum willst du das wissen?«
»Ich bin es nicht gewohnt, dass ich nicht dem Ideal eines Mannes für eine Frau entspreche. Also kann es nur daran liegen, dass du schon ein Auge auf jemanden geworfen hast. Etwa den Prinzen?« Er verschluckte sich beinahe an seinem eigenen Lachen und nun war ich wirklich wütend. Er stellte ja auch gerade meinen Auftrag in Frage.
»Ich habe keine Vorstellungen von meinem Traummann. Aber jetzt habe ich eine Vorstellung davon, wie er auf keinen Fall sein soll!«, erwiderte ich und hoffte, dass er mich nun endlich in Ruhe ließ.
»Lügnerin!«, flüsterte er.
Ich starrte ihn entrüstet an. Unsere Augen trafen sich und mein Magen zog sich zusammen. So sehr, dass ich mich plötzlich beim Lügen ertappt fühlte. Dabei hatte ich nicht gelogen. Oder?
»Und selbst wenn ich lügen würde«, flüsterte ich, als ich meine Stimme wiedergefunden hatte, »es wäre egal, weil du sowieso frei wie ein Vogel bist.« Ich flatterte ebenfalls mit meinen Händen und zwinkerte ihm zu. Dann wendete ich meinen Blick von ihm ab.
»War das etwa der Anfang eines Lächelns auf deinen Lippen?«, fragte er und kam näher. Mein Herz blieb beinahe stehen. Aber warum? War das meine antrainierte Wachsamkeit? Es fühlte sich anders an.
»Ich glaube kaum!«, murmelte ich und spürte seinen Blick auf mir. Er kam noch näher und mein Atem ging seltsam schnell. Ja – mein Körper musste sich gerade im Angriffsmodus befinden. Als ich mich vergewissern wollte, wie nah er bereits an mich herangerückt war, fing er meinen Blick mit seinen braunen Augen auf.
»Wer zuerst wegguckt!«, flüsterte er.
»Das ist doch albern!«, entgegnete ich, doch ich hielt seinem Blick stand. Das zittrige Gefühl in mir wurde immer stärker. So stark, dass ich meinen Blick abwenden musste. Ich konnte dieses Etwas zwischen uns nicht zulassen.
»Gewonnen! Was krieg ich dafür?«
»Einen Kinnhaken, wenn du nicht endlich deinen Mund hältst!«, knurrte ich gereizt.
Er lachte. Ihm würde das Lachen vergehen, wenn er meine Faust zu spüren bekäme. Aber ich musste mich ja bedeckt halten.
»Hey, ist doch nicht so schlimm. Es muss auch einen Verlierer geben!«, sagte er belustigt.
Ich war so wütend, dass ich ihn wieder anblickte. Doch als ich seine strahlenden Augen sah, schlich sich tatsächlich auch auf meine Lippen ein winziges Lächeln.
»Ha! Ich hab dich zum Lachen gebracht!«
»Lachen ist ein wenig übertrieben, meinst du nicht?«
»Mir egal. Du bist hübsch, wenn du lächelst. Solltest du öfter tun.«
Prompt zwang ich mich, nicht wieder zu lächeln. Wie bescheuert war ich eigentlich? Genauso bekam dieser Mistkerl sicher alle Frauen rum und ich machte bei der ganzen Nummer auch noch mit. Wahrscheinlich wurde bei mir sein Jagdinstinkt geweckt und jetzt wollte er mich um jeden Preis dazu bringen, dass ich mich hoffnungslos in ihn verliebte. Aber da war er bei mir an der falschen Adresse. Dieses In-die-Augen-schauen-Spiel hatte er wahrscheinlich schon mit hunderten Mädchen zuvor gemacht und am Ende immer gewonnen. Zumindest sie hatte er gewonnen. Ekel kroch meine Kehle hinauf. Und die nächsten zwei Stunden redete ich kein Wort mehr mit ihm, obwohl er noch ein paar Mal etwas sagte. Meine Ohren waren auf Durchzug geschaltet und ich hörte nicht einmal, was er da sprach.
Als der Zug hielt, stand ich abrupt auf und warf Kyle einen letzten Blick zu. Er saß immer noch da, als hätte er alle Zeit der Welt.
»Mach's gut!«, sagte ich und ging davon. Ich spürte seinen Blick in meinem Nacken und es verschaffte mir Genugtuung. Endlich hatte er mal ein Mädchen nicht in sein Nest gelockt, dieser peinliche freie Vogel.
KAPITEL 3
Das Mädchen, das am Gleis plötzlich vor mir stand, war so schön, mir raubte es glatt den Atem. Sie winkte und lächelte mich dermaßen liebevoll an, dass mein Herz kurz aussetzte. Ihre blonden Haare flossen wie Wellen über ihre Schultern und ihre tiefbraunen Augen zierte ein dichter dunkler Wimpernkranz. Ihre zierliche Figur war eingehüllt von einer engen, zerrissenen Jeans und einem langen, weiten weißen Oberteil, über dem ein paar braune lange Ketten baumelten. Insgeheim hoffte ich, dass Kyle sie nicht zu sehen bekam. Warum, wusste ich selbst nicht so genau. Wahrscheinlich, weil sie den perfekten Beweis dafür erbrachte, dass ich einfach nur hässlich war.
»Insidia. Ich freue mich so, dich kennenzulernen!«, rief sie über den Lärm hinweg und schloss mich in ihre Arme. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte, also tätschelte ich ihr den Rücken. Sie kicherte amüsiert.
»Ihr aus dem Norden seid einfach so anders!«
War das hier so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz? Was zur Hölle war mit den Leuten aus dem Norden?
»Das ist bestimmt das viele schlechte Wetter. Doch das wird sich jetzt ändern!«, sagte sie süß und berührte meine Schulter noch einmal, bevor sie ganz von mir abließ.
»Ich nehme deine Tasche!« Ich ließ es zu, obwohl ich mir insgeheim dachte, dass diese kleine Person nicht einmal ein Zehntel meiner Kraft besaß. Aber das musste ich ihr ja nicht auf die Nase binden.
Als sie sich noch einmal zu mir umdrehte und mich anlächelte, versuchte ich es nicht allzu sehr an mich heranzulassen. Schließlich wusste ich, wenn ich den Auftrag dazu bekäme, sie zu töten, musste ich es tun. Und eine emotionale Bindung würde das nicht gerade erleichtern. Wieder tauchten die Augen des Mannes vor mir auf. Des Mannes, den ich ohne mit der Wimper zu zucken getötet hätte, wenn die Waffe geladen gewesen wäre. Für mich war es so, als hätte ich ihn getötet. Schließlich hatte ich abgedrückt. Ob ich das bei Emili auch einfach tun könnte? Ich würde es müssen.
Wir fuhren ein paar Treppen hinunter, bis wir an einem unterirdischen Gleis stehen blieben. Die Bahn kam wenige Sekunden später und wir stellten uns direkt an die Tür. Emili erklärte mir, dass nur noch eine Station zu fahren sei.
Immer wieder sah sie mich von der Seite an, als würde sie irgendetwas aus mir herauslesen wollen, und wenn ich sie dabei erwischte, änderte sich ihr trauriger Blick flugs in ein Lächeln. Warum aber sah sie mich so traurig an? Fand sie mich etwa auch so hässlich, dass es sie traurig machte? Ich schluckte schwer. Dieser dämliche Kyle verwandelte mich in ein unsicheres Mädchen. Unwillkürlich verzog ich den Mund.
Wie angekündigt stiegen wir nach einer Haltestelle aus und liefen aus dem Bahnhof hinaus auf die Straße. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich sah, wie Emili sich mit meiner Tasche abrackerte, und packte mit an, als wir die Treppen hinaufgingen.
»Es ist gleich hier um die Ecke!«, schnaufte sie und deutete auf eine große Kreuzung. So viele Häuser, die aneinandergereiht dastanden, hatte ich nie zuvor gesehen. Alles wirkte, wie in einer anderen Welt.
»Es gibt schönere Viertel!«, warf sie amüsiert ein, als sie meinen Blick sah und ich hatte das Gefühl, dass sie plötzlich hinkte. Mit viel Aufwand überzeugte ich sie davon, dass ich meine Tasche nun selbst tragen konnte, und am Ende sah ich ihr die Erleichterung an.
Wir bogen um die Ecke und Emili schloss ein Tor auf, das uns in einen Innenhof brachte. Das alles kannte ich nur von Bildern aus dem Unterricht. Etwas anderes als unseren unterirdischen Bunker zu sehen, löste ein seltsam befremdliches Gefühl in mir aus. Der Innenhof war voll von Fahrrädern, Bäumen – und Wäsche. Tatsächlich hing überall Wäsche herum. Hatten sie dafür keinen eigenen Raum?
Emili schloss eine weitere Tür auf und ich folgte ihr ein Treppenhaus hinauf in den dritten Stock. Sie schnaufte, als wir oben ankamen.
»Daran wirst du dich wohl noch gewöhnen müssen!«, sagte sie belustigt, sah mich dann aber etwas verwundert an, weil ich kaum einen Laut von mir gab.
»Ich mache viel Sport«, entgegnete ich und versuchte ihr Lächeln nachzuahmen, was mir Emilis Blick zufolge nicht wirklich gut gelang. Sie wirkte ein bisschen enttäuscht, lächelte aber immer noch, als sie ihre Wohnungstür aufschloss.
Ein langer Flur erstreckte sich vor uns. Die Decke war meterhoch, den Boden zierten alte Holzdielen. An der linken Seite standen aufgereiht ein Dutzend Schuhe und über ihnen hingen Jacken an der Wand.
Links von mir sah ich ein kleines Bad, rechts ein Zimmer, in dem ein Bett stand.
»Das ist dein Zimmer!«, sagte Emili erfreut und stieß die halb offene Tür noch weiter auf. Sie nahm mir meine Tasche wieder ab und legte sie auf mein neues Bett. Das Einzige, was sich noch in dem Raum befand, waren ein Schrank und gut zehn Kisten, aus denen Klamotten, Blätter und andere Dinge herausquollen.
»Die räume ich noch weg. Ich hatte bisher leider keinen anderen Platz dafür«, murmelte Emili, als würde sie sich schuldig fühlen.
»Kein Problem«, erwiderte ich und warf einen Blick auf das Fenster, das bis zum Boden reichte.
»Dahinter ist ein Balkon«, erklärte Emili und langsam nervte es mich, dass sie ständig genau beobachtete, wo mein Blick hinging. Ich nickte.
»Wir machen dir das hier schön. Keine Sorge!«
Ich wusste nicht genau, was sie mit schön meinte. Es war alles da, was ich brauchte. Wozu sollte mein Zimmer schön sein?
»Komm! Ich zeig dir den Rest!«, sagte sie und hüpfte aufgeregt auf und ab. Das war offensichtlich beliebt unter den Mädchen aus Insidia. Charlotte hatte genau das Gleiche getan.
Sie führte mich in ihr Zimmer, das genauso groß wie meins, jedoch viel vollgestellter war, und dann in das Wohnzimmer. Hier standen drei Sofas, die alle einen anderen, kitschigen Überwurf hatten, lauter kleine Tischchen in verschiedenen Holzarten, dazu ein weißer runder Tisch mit vier Stühlen und eine alte kleine Küchenzeile.
»Es ist nicht schön, aber selten!«, murmelte Emili mit einem Lächeln im Gesicht und warf sich auf eines der Sofas.
»Ich glaube, du hast Steine in deiner Tasche. Eine andere Erklärung gibt es nicht!«, jammerte sie feixend und massierte sich die Schulter. Erst als ich Emilis erschrockenen Gesichtsausdruck sah, wurde mir bewusst, dass ich lachte.
»Hey! Du kannst also doch lachen!«
»Scheint so«, entgegnete ich immer noch lächelnd.
»Ich freue mich schon seit Monaten auf unseren Sommer. Es ist traurig, dass er jetzt mit so schlimmen Ereignissen beginnt«, murmelte sie. Dass schon vor dem Tod der Jones feststand, dass ich den Sommer hier verbringen würde, war mir nicht klar.
»Seit wir wegen des Wettbewerbs Briefkontakt haben, ist es, als wäre ich ganz«, sagte sie und lächelte mir zu, »Warum stehst du eigentlich immer noch? Komm – setz dich!«
Ich nahm auf einem der anderen beiden Sofas Platz und bemühte mich, dabei so ähnlich auszusehen wie sie.
Wir hatten also Briefkontakt? Und wahrscheinlich sollte die echte Insidia ihren Sommer hier verbringen, um an der Partnerwahl teilzunehmen.
»Wo wohnen denn die anderen Kandidaten, die keine so tolle Cousine wie ich haben?«, fragte ich.
An Emilis Blick erkannte ich, dass sie sich zwar über das freute, was ich sagte, aber gerne über meine verstorbenen »Eltern« geredet hätte.
»Es gibt doch diese großen Gebäude, die nur dafür gebaut wurden. Wusstest du das nicht?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Na ja«, sie machte eine wegwerfende Bewegung mit ihrer Hand, »da gibt es Tausende kleine Zimmer, die einmal im Jahr von den Kandidaten benutzt werden. Ab morgen wird hier die Hölle los sein! Die letzten Tage war schon viel mehr los als sonst im ganzen Jahr.«
»Wie sieht der konkrete Plan für morgen aus?«
»Wir müssen auf den Marktplatz, um uns anzumelden. Und abends findet dann der Kennenlernball statt. Unser Jahrgang feiert im Pantheon!« Emilis Augen strahlten. Sie erklärte mir, dass sie im Januar Geburtstag hatte und deshalb trotzdem noch zu meinem Jahrgang gehörte.
Ich war erleichtert. Die Jahrgänge sollten für sich bleiben, weil es vorgesehen war, dass sich Partner in etwa demselben Alter fanden. In seltenen Fällen gab es aber die Möglichkeit, einen Verlobungsantrag zu stellen, auch wenn man nicht im selben Jahr geboren wurde.
Emili redete und redete. Schon nach kurzer Zeit pochte mein Kopf schmerzhaft. Als sie bemerkte, dass ich ihr nicht wirklich folgte, erhob sie sich und schlug vor, erst einmal schlafen zu gehen. Ich war froh darüber und schlief augenblicklich ein, sobald mein Kopf das Kissen berührte.
Beim Aufwachen stieg mir der Geruch von Kaffee in die Nase und ein wohlig warmes Gefühl durchfuhr mich. Ich konnte Emili in der kleinen Essküche summen hören, rappelte mich hoch, machte mich fertig und ging zu ihr ins Zimmer.
»Guten Morgen, Sonnenschein!«, sang Emili, als sie mich sah, und wendete einen Pfannkuchen in der Luft – was ihr nicht allzu gut gelang. Ich setzte mich auf einen der Stühle und legte meine Arme auf dem Tisch vor mir ab.
»Nicht so verkrampft. Du hast mir ja schon in den Briefen geschrieben, dass deine Eltern streng waren. Aber hier ist alles ganz entspannt.«
Ich wusste nicht, was sie damit meinte. Sollte ich meine Arme anders legen? Oder meine Beine? Ich bewegte meine Füße hin und her, um entspannterauszusehen, und Emili lachte aus vollem Halse.
»Hoch mit den Beinen!«
»Auf den Stuhl?«, fragte ich entsetzt und hob die Augenbrauen.
Sie nickte eifrig.
»Du bewegst dich wie ein Roboter, Insidia!«
Ich hob meine Beine an und verschränkte sie verkrampft unter mir. Warum jemand das freiwillig machte, war mir ein Rätsel.
Emili lachte immer noch und schüttelte amüsiert den Kopf.
»Ich hoffe, du hast Hunger!« Sie stellte eine Tasse Kaffee und einen Teller mit einem Pfannkuchen vor mir ab und nickte mir auffordernd zu. Dann nahm sie sich das Gleiche und setzte sich mir gegenüber. Ein Bein ließ sie vom Stuhl baumeln und das andere zog sie hoch zu ihrer Brust. Sie griff nach ihrem Kaffee, stellte ihn auf ihrem Knie ab und nippte immer mal wieder daran.
»Wenn wir nicht allzu lange anstehen wollen, müssen wir bald los«, nuschelte sie, nachdem sie von ihrem Pfannkuchen abgebissen hatte, und hielt sich dann lachend die Hand vor den Mund. »'tschuldigung.«
Ich bemühte mich, ihr ebenfalls ein Lächeln zu schenken, und aß schnell auf. Dann erhob ich mich, räumte unsere Teller in die Spüle und musterte Emili auffordernd. »Gut, lass uns gehen!«, sagte ich – und erntete prompt einen verwirrten Blick von ihr.
»Willst du etwa so gehen?«
Ich sah an mir hinab. Dieselbe schwarze Hose und der gleiche Pulli wie gestern. Ich hatte meinen Koffer nur einmal kurz geöffnet, um mir frische Unterwäsche und eine Zahnbürste rauszuholen.
»Was ist falsch daran?«, fragte ich und verzog den Mund. Wie oft wollten mir die Menschen hier eigentlich noch sagen, dass ich hässlich war?
»Generell nichts. Aber für heute ist es einfach zu … locker.«
Ich musterte Emili nun eingehender. Sie selbst trug ein T-Shirt mit einer seltsamen Aufschrift und eine Jogginghose. Ihre Haare waren zu einem unordentlichen Dutt auf ihrem Kopf gebunden. Sie war also die Letzte, die mir etwas darüber sagen konnte, dass mein Outfit zulocker war.
»Ich ziehe mich gleich noch um!«, erklärte sie und musste laut lachen, als sie meinen musternden Blick sah.
Beschämt sah ich zu Boden.
»Wir finden auch etwas Passendes für dich.« Damit erhob sie sich.
Einigermaßen verwirrt folgte ich ihr in ihr Zimmer, wo sie sich ein hellblaues Kleid anzog. Darüber hängte sie wieder die braunen langen Ketten von gestern. Sie öffnete ihr Haar, was – ohne, dass sie irgendetwas dafür tun musste – perfekt fiel. Dann setzte sie sich auf einen kleinen Stuhl vor einem Schreibtisch, über dem ein Spiegel hing, und schminkte sich.
Sie war einfach wunderschön. Schöner, als ich je sein könnte.
»Husch, husch! Jetzt bist du dran!«, befahl sie betont streng und zog mich an ihrer Hand in mein Zimmer. Dort stellte sie meinen Koffer aufs Bett und öffnete ihn.
»Oh Insidia! Du hast wunderschöne Kleider!« Ich warf einen verstohlenen Blick über ihre Schulter, schließlich wusste ich selbst nicht so genau, was sich eigentlich alles in dem Koffer befand. Letzte Nacht war ich nur froh gewesen, die Dinge im Dunkeln herauskramen zu können, die ich zum Schlafen brauchte.
»Das hier ist perfekt!«
Das Kleid, das sie mir entgegenstreckte, kannte ich bereits. Ich musste unwillkürlich an Philipp denken und wie er mich angesehen hatte, als ich das Kleid getragen hatte.
»Nein! Das ist viel zu kurz und eng.« Ich musterte noch einmal Emilis Kleid, um mich zu vergewissern, dass ich sie damit nicht beleidigt hatte. Ihr Kleid war zwar genauso kurz, aber es war nur an ihrer Brust eng. Ein helles Band umspielte ihre Taille und danach war der Rock weit ausladend.
Sie lachte laut auf. »Insidia, mit der Figur kannst du alles tragen. Wofür machst du denn sonst Sport?«
Um Leute zu töten, dachte ich. Aber das konnte ich wohl kaum als Argument anbringen.
Nachdem sie mir eine geschlagene Minute lang den flehendsten und süßesten Blick der Welt zugeworfen hatte, gab ich mich geschlagen und zog mir das Kleid über. Ich wartete ein paar Sekunden, bis Emili hinausgehen würde oder sich umdrehte. Aber ganz offensichtlich hatte sie das nicht vor.
»Und neue Unterwäsche brauchst du auch«, sagte sie und kicherte hinter vorgehaltener Hand.
Meine Wangen brannten. »Was ist denn jetzt daran wieder falsch?«, fragte ich und ärgerte mich, dass ich nicht hingesehen hatte, als sie sich umgezogen hatte. So hätte ich wenigstens erahnen können, was sie für »anständige« Unterwäsche hielt.
»Zeig ich dir dann ein anderes Mal«, murmelte sie und begann sich irgendwelche kleinen Kugeln in den Mund zu schieben, die sie aus ihrer Tasche angelte. Wie konnte sie nur Süßigkeiten essen, die die ganze Zeit in ihrer Tasche herumflogen? Sie grinste mich an und deutete auf ein paar kurze hellbraune Stiefel, die mit in meinem Koffer lagen. Erst wollte ich mich dagegen wehren, dann hielt ich es angesichts der restlichen Absatzschuhe, die ihre Wohnung bevölkerten, für die beste Lösung. Die Schuhe reichten mir bis kurz über die Knöchel.
Emili zog Schminke aus ihrer Tasche und zwang mich, auf dem Bett Platz zu nehmen. Ich hätte sie töten können. Vielleicht sogar mit einem Schlag. Aber das ahnte sie offensichtlich nicht und ich wehrte mich nicht. Als sie fertig war, zog sie mir das Band aus den Haaren und verwuschelte meine dunkle Mähne.
»Warum läufst du nur immer mit diesem dämlichen Pferdeschwanz herum. Wenn, dann musst du den hier oben binden!« Sie pikste mit ihrem Zeigefinger in eine Stelle ganz weit oben an meinem Hinterkopf. »Oder fängt deiner Meinung nach der Schweif eines Pferdes hier unten an?« Nun kitzelte mich ihr Finger kurz über meinem Nacken, dort, wo sonst mein Zopf saß, und wieder fühlte ich mich irgendwie seltsam. Als würde alles an mir falsch sein. Emili hatte eine Direktheit, die mich immer aufs Neue schlucken ließ. Aber wenigstens schien sie ehrlich zu sein.
»Schau mal, wie schön du aussiehst!«
Mein Blick fiel auf den Spiegel. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich mich nicht wiedererkennen würde. Aber es war nur eine etwas mädchenhaftere Version von mir.
»Jacken brauchen wir nicht!«, summte Emili und lief aus meinem Zimmer hinaus zur Eingangstür.
Ich griff nach einer kleinen braunen Tasche, die in meinem Koffer lag, und öffnete sie. Darin verbarg sich ein zusammengefalteter Zettel sowie eine Geldbörse mit Bargeld, einer Karte und einem Ausweis. Dann folgte ich Emili hinaus in den Flur.
»Na, auf dem Weg zur Anmeldung?«, höhnte eine Stimme, die mir irgendwie vertraut vorkam. Ich sah mich um, doch konnte ich nirgendwo jemanden erkennen.
»Mund halten, Kyle!«, erwiderte Emili und griff nach meiner Hand.
»Mein blöder Nachbar«, flüsterte sie, lächelte aber.