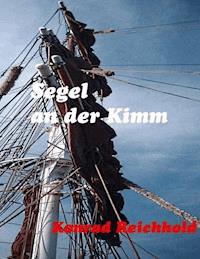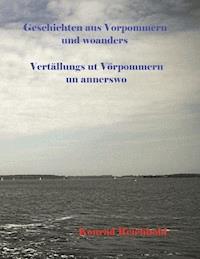
Geschichten aus Vorpommern und woanders / Vertällungs ut Vörpommern un annerswo E-Book
Konrad Reichhold
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
28 Kurzgeschichten aus der DDR-Zeit, der Wende- und der Nachwendezeit mit überwiegend autobiographischem Bezug - Vorpommern - Handelsflotte DSR mit Augenzeugenbericht von der schweren Havarie des Urlauberschiffes "Völkerfreundschaft " in den Schären vor Stockholm - Reservistenzeit Volksmarine - Reisebericht USA 1987
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Konrad Reichhold wurde 1941 in der Stadt Stralsund in Vorpommern geboren. Vierzehnjährig begann er eine Lehre in der Binnenschifffahrt, die er im Januar 1958 erfolgreich abschloss. Noch im gleichen Jahr nahm er eine Tätigkeit als Matrose bei der Weißen Flotte auf. Sein Ziel war es, bei der Handelsflotte zur See zu fahren. 1959 wurde er Matrose auf dem Fährschiff Sassnitz der Deutschen Reichsbahn und ab 1960 war er endlich bei der Handelsflotte eingesetzt, wo er bis zum Sommer 1968 verblieb. Aus familiären Gründen gab er danach die Seefahrt auf und begann ein neues Berufsleben im Bauwesen. Auf dem zweiten Bildungsweg erreichte er den Titel eines Ingenieurökonomen im Bauwesen und in einem postgradualen Studium den Abschluss als Fachökonom für Rekonstruktion und Erhaltung im Hochbau.
Konrad Reichhold hat in den Jahren 2013 bis 2015 Kurzgeschichten, eine Dokumentation und den Roman Segel an der Kimm bei Amazon/Kindle als E-Book veröffentlicht. Der vorliegende Erzählband ist eine zweisprachige Ausgabe (Hoch- und Plattdeutsch) aller seiner bisher veröffentlichten Kurzgeschichten.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Malheur beim Weinmachen
Die Kartoffelpuffer
Außenbords vergessen
Der Klau
MS „Völkerfreeundschaft“ Havarie in den Stockholmer Schären
Sturmfahrt in der Nordsee
Auf dem Tanker „Rositz“
Eisige Fracht für Finnland
Gefahr auf dem Foweyriver
Als ich die Seefahrt an den Nagel hing
Die verlorene Trabbilichtmaschine
Der Giftzwerg
Auf dem Tollensesee
Der Admiral
Wie ich Imker Wurde
Meine Reservistenzeit
Zu Fuß durch den Bodden
Ich wollte Direktor werden
Im Winter 1978/9
Ein schwarzer Tag
Stralsund-Seattle-Stralsund
Aus der Wendezeit
Unternehmen Boot
Die schwarzen Krähen
Nachbars Hund
„Nee, dafür sind wir nicht zuständig!“
Ein nasser Dienstauftrag
Die Aushilfe
Prolog
Dieses Buch ist im ersten Teil in hochdeutscher und im zweiten Teil in plattdeutscher Sprache geschrieben. So soll Lesern, die des Plattdeutschen noch nicht so kundig sind, die Möglichkeit eingeräumt werden, den Inhalt der Geschichten richtig zu verstehen. Die in einfachen Worten gehaltenen Episoden wurden zunächst in plattdeutscher Sprache abgefasst, weil sie dadurch origineller zur Geltung kommen. Es ist sehr schwierig, moderne hochdeutsche Ausdrücke ins Niederdeutsche zu übersetzen, weil diese Sprache seit langem im Rückgang begriffen ist und sich nur sehr schwer der heutigen modernen Zeit anpassen lässt. Ich würde sagen, dass unser heutiges Hochdeutsch durch verschiedenste Einflüsse zu abstrakt geworden ist, um Wort für Wort ins Niederdeutsch übersetzt werden zu können. Besonders problematisch wird es also immer dann, wenn es darum geht, Begriffe der neuesten technischen Errungenschaften oder Ausdrücke aus Politik, Ökonomie u. s. w. entsprechend mit plattdeutschen Worten wiederzugeben.
Ich bin in meiner Kindheit in einer Umgebung aufgewachsen, die von Armut und von den Ängsten des Krieges und der Not der Nachkriegsjahre geprägt war. In dieser Umgebung lebten zumeist einfache Menschen, die hier, an der Küste Nordvorpommerns, sich noch vielfach auf Platt unterhielten. Das Plattdeutsch war also die Sprache des einfachen Volkes und wurde von den gebildeten Schichten mit der Bezeichnung gewöhnlich abgetan. Um also nicht für gewöhnlich gehalten und damit zugleich als ungebildet abgestempelt zu werden, bemühte man sich, auch in den einfacheren Bevölkerungsschichten vorwiegend hochdeutsch zu sprechen. Die Durchmischung der Bevölkerung Mecklenburgs und Vorpommerns mit Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach dem Krieg und der kräftige Zuzug von Arbeitskräften aus Mitteldeutschland für die entstehende Werftindustrie an der Küste, waren weitere Faktoren für den Rückgang des Plattdeutschen. In den überfüllten Eisenbahnzügen des Berufsverkehrs der fünfziger und sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war das Plattdeutsche noch häufig als Umgangssprache zu hören. In der Landwirtschaft und in der Fischerei hat sich das Plattdeutsch noch vielfach erhalten, es ist aber auch hier schon stark im Rückgang begriffen. Das Platt hört sich sehr originell an, wenn es richtig gesprochen wird und nicht zu sehr in das so genannte Missingsch abgleitet. Das Missingsch ist eine Mischung aus hoch- und plattdeutscher Sprache. Zwischen den einzelnen Regionen Mecklenburgs und Vorpommerns gibt es hörbare Unterschiede des Plattdeutschen. Einheimische können durchaus feststellen, aus welcher Gegend der jeweilige Gesprächspartner stammt. Das hängt sicherlich mit dem engen Sprachraum zusammen, der im Südwesten an die Prignitz und im Südosten an die Uckermark grenzt
Nun könnte man fragen, wie ein Autor mit einem rein hochdeutschen Namen dazu kommt, ausgerechnet plattdeutsche Geschichten zu schreiben. Mein Vater stammte ja aus Soest in Westfalen und meine Mutter wurde als Deutsche in Wolhynien geboren. Übrigens stammt mein Familienname aus dem hessischen Raum. Ich habe aber auch nordvorpommersche Wurzeln, denn meine Großmutter väterlicherseits stammte von der Insel Rügen.
Die in diesem Buch wiedergegebenen Episoden haben überwiegend autobiographische Züge. Sie zeugen von den Schwierigkeiten des DDR-Alltags, aber auch von abenteuerlichen oder humorvollen Begebenheiten.
Stralsund im Juni 2014 Konrad Reichhold
Teil I
Erzählungen aus Vorpommern und woanders
Hochdeutscher Text
Malheur beim Weinmachen
Anfangs der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war das Leben bei uns in Vorpommern für die meisten Menschen nicht leicht. Der verlorene Krieg hatte auch bei uns seine Spuren hinterlassen. Flüchtlinge aus dem Osten, aus Schlesien und sogar aus dem Sudetenland waren in und um Stralsund in den leeren Kasernen und Gutshäusern untergebracht. Durch den Bombenangriff vom 6. Oktober 1944 auf unsere Stadt waren viele Wohnhäuser in Schutt und Asche gelegt worden. So gab es nicht genügend Wohnraum und die Menschen mussten enger zusammen-rücken. Wir wohnten zu dieser Zeit auf dem Korrerbarg. Die Straße hieß ja eigentlich Katharinenberg, aber in alten Zeiten hieß ein Teil von ihr wohl Katherberg. Die meisten Leute, die zu meiner Kinderzeit hier wohnten, sprachen damals noch Platt und da haben sie aus Katherberg man eben Korrerbarg gemacht und das für die ganze Straße. Die Häuser, die hier standen, waren alte Bruchbuden. Die Menschen waren arme Schlucker. Unser Haus mit der Nummer zwanzig stand in der Mitte des Abschnitts zwischen Landesherrnstrasse (heute Poststraße) und der Gaststätte Trocadero.
Heute sind an dieser Stelle die Werkstätten und das Gelände des Meeresmuseums. Kein Mensch kann sich jetzt vorstellen, dass hier früher alles voller Wohnhäuser mit ihren Wohnanbauten stand und einige hundert Menschen hier hausten. Die Straße war immer voller Kinder. Die alten Leute sagten dazu: Dei Gören vun d`n Korrerbarg, dei sünd ne dulle Straatenplag!
Unser Haus stand mit seiner Längsseite zur Straße, hatte zwei Stockwerke und ein ausgebautes Steildach, das mit alten roten Pfannen eingedeckt war. Auf dem Boden war noch das große Aufzugsrad mit Seilwinde aus alten Zeiten vorhanden. Über der Haustür war ein Wappenrelief angebracht, aber was sich darauf befand, weiß ich nicht mehr. Die Fachwerksseitenhäuser auf dem Hof waren meistens schon freigezogen, nur im Hinterhaus wohnten zu dieser Zeit noch einige Leute. Wir wohnten im ersten Stock des Vorderhauses. Das Erdgeschoss war schon freigezogen. Auch die kleine Wohnung neben uns war schon leer. Über uns wohnte eine alte Frau aus dem Sudetengau, die manchmal in ihrer Bude Holz hackte. Sie war uns unheimlich, weil wir sie im Verdacht hatten, dass sie ihren Bruder vor einiger Zeit umgebracht hätte. Wir hatten damals schweren Streit zwischen den beiden gehört, dann gab es mit mal einen großen Schlag und es war Ruhe. Von der Zeit an hatten wir ihren Bruder nicht mehr gesehen. Sie ging immer mit einem großen Korb auf dem Buckel zu ihrem Garten. Wir haben uns gedacht, dass sie ihren Bruder stückeweise weggeschleppt hat. Gruselige Zustände! Die Polizei hat damals auch nicht weiter nach- geforscht, wo der Bruder abgeblieben war. Zu der Zeit gingen so viele Menschen von uns über die Sektorengrenzen nach Westberlin und kamen nicht wieder. Aber nun zu der Geschichte, von der in der Überschrift die Rede ist :
Mein Vater kam 1946 aus französischer Kriegsgefangenschaft nach Hause. Er war zu dieser Zeit schon lange an TBC erkrankt. Er wurde 1942 zur Wehrmacht eingezogen und musste zunächst ein Kriegsgefangenenlager in Stolp in Hinterpommern bewachen. Ein Jahr später ging es dann weiter nach Holland, Belgien und Nordfrankreich, wo er 1945 in Dünkirchen gefangen genommen wurde. Danach musste er bei einem französischen Bauern auf dem Hof arbeiten und das alles mit offener TBC. Als er nach Hause kam, war er nur noch ein Wrack und stand kurz vor dem Verhungern. Von der Zeit an hatte er nicht mehr arbeiten können und bekam nur eine ganz kleine Rente. Meine Mutter konnte zu der Zeit gar nicht arbeiten. Sie konnte mit ihren beiden Augen nur sehr schlecht sehen. Sie hatte sieben Kinder geboren, wovon zu der Zeit noch sechs am Leben waren. Meine Mutter bekam überhaupt keine staatliche Unterstützung. So mussten wir immer zusehen, wie wir über die Runden kamen.
Damals haben die Menschen noch gut zusammen gelebt und alle Feste gemeinsam gefeiert. Alkohol war knapp und teuer und so musste man ihn selber machen. Das Weinmachen aus Beeren und anderem Zeugs war groß in Mode. Auch mein Vater verstand sich auf diese Sache. Er hatte in diesem Jahr (1954) Johannisbeerenmost in einem 20-Liter-Ballon angesetzt. Die Gasblasen blubberten schon einige Zeit im Gärrohr vor sich hin. Die Mostrückstände mussten nun aus dem Ballon heraus. Dazu musste der Most zunächst in Eimer und Töpfe umgefüllt werden. Als das nun fertig war, ist mein Vater mit dem Glasballon auf den Hof hinunter gegangen. In unserem Haus gab es damals keine Wasserleitung und auch keine Ableitung. Alles Wasser, das in die Wohnung getragen wurde, musste auch wieder nach draußen getragen werden. Die Wasserstelle war draußen vor dem Hinterhaus. Vater tat nun ein wenig Sand in den Ballon und ließ Wasser in ihn einlaufen. Ich war gerade auf dem Hof, spielte mit meinem Meerschweinchen und ließ es grasen. Vater schüttelt nun den Sand und das Wasser im Ballon, um ihn zu säubern. Das ging aber nicht so, wie er sich das vorstellte. Nun nahm er den Ballon und rollte ihn eine Weile auf dem Rasen hin und her, bis die Mostrückstände sich lösten und ausgespült werden konnten. Dann trug er ihn wieder zurück nach oben in unsere Wohnung. Ich nahm mein Meerschweinchen auf und bin hinterher. Auf dem Flur vor unserer Küche wurde der Ballon auf einen Schemel gestellt und Vater hat den Most aus Eimern und Töpfen wieder zurück gefüllt. Er machte nun erst mal eine kleine Pause und sah stolz auf sein Werk. Der volle Ballon musste jetzt in die Küche getragen werden. Meine Mutter stellte sich neben mich und wir sahen zu, wie Vater den Ballon anhebt. Gerade als er ihn vor der Brust hatte gab es einen dollen Knacks, der Boden des Ballons ging ab und der Most schoss nun über Flur und Treppenhaus und war weg!!! Vater wusste in diesem Moment nicht, was er sagen sollte. Aber dann fing er mit mal an auszuflippen und schimpfte schlimmer, als ein Rohrspatz. Ich wagte nicht, einen Mucks von mir zu geben. Er konnte nämlich sehr grantig werden. Wir sahen alle aus, als wenn wir ein Schwein abgestochen hätten. Flur, Treppenhaus, der Hausflur, Wände und Decken waren rot eingefärbt. Es sah aus, als wenn es hier Mord und Totschlag gegeben hatte. Es dauerte einige Tage, die größte Schweinerei zu beseitigen. Nun ja, das Haus sollte ja sowieso bald abgerissen werden, da kam es eben nicht mehr darauf an, dass da noch ein Schaden mehr war. Vater hatte dann überlegt, warum der Ballon kaputt gehen konnte. Ich sagte zu ihm, dass auf unserem Hof unterm Rasen Buckelpflaster war. Der Glasballon hatte davon sicher einen Sprung bekommen.
Für dieses Jahr war die Weinmachsaison für uns nun abgeschlossen. Es war nur schade um die viele Arbeit und den Zucker, der schon im Most war und eben auch knapp zu dieser Zeit gewesen ist.
Die Kartoffelpuffer
Ich weiß gar nicht mehr, ob das Jahr 1958 irgendein besonderes Jahr gewesen ist. In der Politik und in der Wirtschaft der DDR blieb wohl alles so, wie es vorher auch war, das heißt, es blieb alles beim Alten. Für mich war es aber ein besonderes Jahr. Ich hatte meine Lehre in der Binnenschifffahrt beendet und war nun Bootsmann dort. Drei Monate fuhr ich noch auf einem kleinen Schleppkahn in der Berliner Gegend, dann hörte ich da auf und fing bei der Weißen Flotte in Stralsund als Matrose auf einem Fahrgastschiff an. Das war im Monat April. Das Schiff hieß Deutsch Sowjetische Freundschaft und es war gar nicht mal so klein. Da passten gut dreihundertfünfzig Leute rauf. Ich habe heute noch mein Schifferdienstbuch und da steht drin, dass das Schiff eine Maschinenstärke von dreihundertsechzig PS hatte. Mit dem Aufsteigen auf diesen Schlickrutscher war ich meinem Wunsch, zur See zu fahren, ein großes Stück näher gerückt. Als ich an Bord kam, lag das Schiff noch in der Volkswerft auf Slip und wurde für die Saison vorbereitet. Ich musste nun tüchtig mit den anderen Matrosen Rost klopfen und Mennige streichen. Einstand habe ich natürlicherweise auch geben müssen. Es war damals eine feine Besatzung an Bord. Der Käptn hieß Paul Gau und war so ´n richtiger Vorpommer. Ich glaube, der Name stammt wohl von der Insel Hiddensee. Außer mir waren noch zwei andere Matrosen da, zwei Maschinisten und ein Steuermann. Bevor die Saison losging, kam noch das Wirtschaftspersonal an Bord. Das Schiff wurde damals von den HO-Gaststätten Greifswald bewirtschaftet. Das Wirtschaftspersonal bestand aus zwei Frauen und einem Mann. An Bord kochten sie nur Kaffee und Tee oder sie machten heißes Wasser für Grog und Bockwurst. Eine richtige Küche gab es an Bord nicht, weil es ja nur ein Ausflugsschiff war. Wir mussten nun immer zusehen, wo wir etwas zu Essen bekamen. Morgens und abends machten wir uns selber etwas und saßen dann im vorderen Fahrgastraum zusammen. Mittags gab es meistens `ne Bockwurst. Abends halfen wir dem Wirtschaftspersonal beim Aufräumen und Saubermachen. Dafür gab es dann Freibier aus Flaschen. Damals habe ich mir das Biertrinken so richtig angewöhnt. Schlafen konnten wir alle an Bord. Es gab genug Kammern und Kojen. In der Saison fuhren wir meistens von Wieck-Eldena bei Greifswald nach Baabe auf Rügen, aber an der Boddenküste. Morgens ging es los von Wieck-Eldena und dann dauerte es wohl zwei Stunden, bis wir in Baabe waren. Abends ging es wieder zurück. Meistens wurde nachmittags noch ``ne Boddenrundfahrt gemacht, wenn es sich rechnete. Es gab auch Fahrten von Wolgast nach Baabe. Dazu mussten wir nach Feierabend noch von Wieck-Eldena oder von Stralsund nach Wolgast schippern. Manchmal war auf dem Bodden auch tüchtig was los. Wenn Rasmus sich ins Zeug legte, fing der kleine Dampfer an, sich ordentlich zu schütteln. Der Verdienst der Mannschaft war nicht doll. Das HO-Personal bekam einen Teil als festen Lohn, der auch nicht hoch war, aber die Leute waren am Umsatz beteiligt. Wir Matrosen wussten, wie wir zu Geld kamen. Wir nahmen manchmal Leute ohne Fahrkarten mit, kassierten aber das Fahrgeld. So hatten wir immer genug Geld für Essen und Trinken. Ich habe es erlebt, dass solche Praxis auch heutzutage noch ausgeübt wird.
In der Hauptsaison wurde auf der anderen Seite des Bollwerks von Baabe, in Moritzdorf oben auf dem Berg, die Kartoffelpuffergaststätte aufgemacht. Einmal ließen wir uns mit dem kleinen Fährboot über die Baaber -Bek rudern und kletterten den etwa zehn Meter hohen Berg zum großen Fressen rauf. Der eine von uns, ich glaube es war einer von den Maschinisten, hatte sich sechzehn Puffer und zweimal Kartoffelsalat in seinen Wanst geschlagen. Ich selbst hatte mir zwölf Puffer und auch zweimal Kartoffelsalat reingehauen. Wir taten alle so, als hätten wir lange Zeit kein Essen bekommen. Als wir nun vollgefressen waren, legten wir uns auf eine Wiese und konnten uns kaum noch bewegen. Beinahe hätten wir unseren Rundtörn über den Bodden noch verschlafen. Das Essen lag uns wie Blei in den Mägen. Großen Durst bekamen wir auch noch, aber Bier gab es erst nach Feierabend in Wieck.
Gern denke ich noch an diese Zeit zurück. Ich glaube, das Schiff lebt heute noch. Es war schon neunzehnhundertsechzehn in Stettin gebaut worden und ist damals auf der Oder als Dampfer unterwegs gewesen. Nach der Wende, als wir alle zu Westlern gemacht wurden, ist die Deutsch Sowjetische Freundschaft zuerst an die deutsche Nordseeküste gekommen. Zuletzt ist das Schiff dann wohl an der französischen Kanalküste eingesetzt worden. Aber hierüber weiß ich nichts weiter.
Fahrgastschiff “ Deutsch Sowjetische Freundschaft “
Außenbords vergessen
Es war im Winter 1959/60, ich glaube im Monat Dezember. Damals war ich Matrose auf dem Eisenbahnfährschiff Sassnitz der Deutschen Reichsbahn. Die Fähre lag mit der Steuerbordseite an der Pier des Fährschiffbeckens. Es war ein kalter Morgen, so an die ein Grad minus und ich musste nun im Sassnitzer Hafen außenbords die Fenster auf der Backbordseite putzen. Dazu musste ich mir einen Sicherheitsgurt mit Karabinerhaken und Leine umhängen. Ein Matrose kam noch als Sicherheitsposten mit, der mich mit der Leine absichern sollte. Dieser Matrose sollte mir auch den Eimer mit Wasser und die Gerätschaften herunterlassen. Ich stieg nun die Steigeisen an der Bordwand herunter und zwar bis an die Fenster vom Garagendeck. Da konnte ich auf einer schmalen Trittleiste stehen und den Karabinerhaken in die Griffleisten neben den Fenstern einhängen. Bei dem kalten Wetter nun mit Wasser rum zu klaren machte mir gar keinen Spaß. Es dauerte einige Zeit und ich hatte die Fenster des Garagendecks fertig. Meine Hände waren aber schon blau angelaufen und ich konnte mich an dem kalten Eisen kaum noch festhalten. Nun stieg ich zu den Fenstern des Bootsdecks rauf. Gerade hatte ich die hinteren drei Fenster fertig, da ertönte im Schiff das Signal – klar vorn und achtern! - Ich dachte mir, dass ich die letzten sechs Fenster noch schaffen könnte, doch diese Rechnung ging nicht auf. Mein Sicherheitsposten war auf seine Manöverstation gelaufen und allein konnte ich die Sicherheitsleine nicht weitersetzen. Mit meinen klammen Händen war ich auch nicht in der Lage, ohne Hilfe durch Aufziehen von oben zum Deck rauf zu klettern. Ich war nun außenbords gefangen. Die Fähre lief aus und ich klammerte mich an der Sicherheitsleine fest, weil der eiserne Griff neben dem Fenster zu kalt war. Meine Finger wurden allmählich taub vor Kälte und meine Zähne fingen an zu klappern. Die Fähre kam langsam aus dem Hafen heraus und in die freie See. Da fing sie im Seegang an, ordentlich überzuholen. Als die Fähre sich nach Backbord überlegte verlor ich den Halt unter den Füßen, sauste ab in die Luft und zappelte mit Armen und Beinen herum, so um die zehn Meter über Wasser. Als das Schiff sich wieder nach Steuerbord überlegte wurde ich gegen die Bordwand geknallt, dass mir Hören und Sehen verging. Das ging so einige Male hin und her und ich schrie kräftig um Hilfe, aber kein Mensch hörte mich. Dummerweise hatte ich meinen Sicherheitsgurt ausgehakt. Mir blieb nun nichts anderes übrig, als zu versuchen, an der Sicherheitsleine hochzuklettern, wenn ich überleben wollte. Ich hatte große Kraft in den Armen und kam auch fast oben an. Der Winkel zwischen Leine und Bordwand wurde nun aber zu spitz und ich konnte mit meinen Händen nicht hoch genug greifen. Meine Kräfte ließen nach und ich überlegte schon, ob ich mich nicht einfach in die See fallen lassen sollte, dann wäre die Sache schnell vorbei. Die dreieinhalb Stunden bis nach Trelleborg rüber würde ich wohl doch nicht lebend überstehen. Aber nun erwachte denn doch noch mal der Lebenswille in mir und mit meiner letzten Kraft konnte ich bis über den Schandeckel greifen und mich über das Schanzkleid des Brückendecks ziehen. Wie tot lag ich dann auf Deck und japste nach Luft, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Mein Herz raste. Werkzeug und Eimer hatte ich schon lange vorher in die See geworfen. Nach einer Weile habe ich mich dann aufgerappelt und meinen Sicherheitsposten gesucht. Als ich ihn fand, sah er mich groß an und fasste sich an den Kopf. Er hatte mich einfach außenbords vergessen!!!
Ich habe das Malheur dann nicht an die große Glocke gehängt, sonst hätte das wohl böse Folgen für den anderen Seemann haben können. Vergessen habe ich diese Situation bis heute nicht und so manches Mal träume ich noch davon.
Die Eisenbahnfähre Sassnitz der Deutschen Reichsbahn wurde 1958/59 auf der Neptun-Werft in Rostock gebaut. Das Schiff sah gut aus mit seinen zwei Schornsteinen. Für einen jungen Seemann war es aber nicht das Wahre, auf solcher kurzen Strecke hin und her zu fahren, egal wie groß und wie schön das Schiff auch war. Kurze Zeit später bin ich wieder zurück zur Deutschen Seereederei Rostock gegangen und musterte dann auf dem Urlauberschiff Völkerfreundschaft als Matrose an.
Eisenbahnfähre “ Sassnitz “ der Deutschen Reichsbahn
Der Klau
Im Jahre 1960 hatten wir mit unserem FDGB-Urlauberschiff Völkerfreundschaft im Hafen von Alexandria (Ägypten) an der Pier gelegen. Wir waren damals Vollmatrosen, mein Kumpel Jochen und ich. Als wir nun in Alexandria ankamen, wurden wir darauf hingewiesen, dass in diesem Hafen viel gestohlen wird. Alles was nicht niet- und nagelfest war musste dauernd unter Verschluss gehalten werden. Aber das Klima ist da unten in Ägypten schon sehr warm und wir hatten leider keine Klimaanlage in unseren Kammern. So ließen wir meistens die Bullaugen offen, stellten den Ventilator auf volle Touren, machten die Türen auf und legten den Sperrhaken vor. An diesem Tag hatte ich von acht Uhr morgens bis zum Mittag Wache an der Gangway. Kumpel Jochen hatte die Wache von Mittag bis vier Uhr nachmittags. Es war zwar erst im Monat April, aber es war schon sehr warm. Am Vormittag schien die Sonne schon so stark, dass man fast ein Spiegelei auf dem Deck braten konnte. Kumpel Jochen blieb also, wenn er in der Kammer überleben wollte, nichts anderes übrig, als den Sperrhaken vorzulegen und das Bullauge offen zu lassen. Er zog sich seine Sachen aus, nahm die Armbanduhr ab und legte sie auf den Tisch, dann warf er sich nur mit der kurzen Unterhose bekleidet in seine Koje. Kurze Zeit später ist er so sachte eingeduselt. Auf einmal wurde ihm sehr warm und er wachte auf. Als er auf den Tisch sah, traf ihn fast der Schlag, seine Armbanduhr war weg! Da hatte ihm doch so `n Ali die Uhr geklaut. Wahrscheinlich hatte der so was wie eine Angel gehabt und sich damit die Uhr vom Tisch gegriffen. Mein Jochen dachte sich nun: Warte man Ali, dich werde ich! Er wollte ihn nun austricksen, weil er sich dachte, dass der Ali nochmal wiederkommt. So borgte er sich von einem anderen Matrosen ``ne alte Taschenuhr, legte sie auf den Tisch an dieselbe Stelle, wo vorher die andere Uhr gelegen hatte und dann legte er sich in seiner Koje auf Lauer. Er sah immerzu zur Tür hin, aber das dauerte ihm bald zu lange und er druselte wieder ein. Als er aufwachte, ist auch die Taschenuhr weg. Nun war guter Rat teuer, wie man so sagt. Aber Jochen dachte sich, dass er den Ali doch noch fassen könnte. Er borgte sich noch eine Billiguhr von einem anderen Kumpel und legte diese dann auf den Tisch näher zum Bullauge hin. Diesmal ist er aber nicht eingeschlafen und sah die ganze Zeit nach der Tür hin. Gerade will er aufstehen, weil es ihm zu lange dauert, da sah er einen braunen Arm mit einer kleinen Angel in der Hand durch das Bullauge nach draußen verschwinden. Am Haken der Angel hing die dritte Uhr und die war nun auch weg! Unser Jochen sprang mit Geheul zum Bullauge hin und guckte nach draußen. Dort sah er ein Aliboot mit hohem Mast und oben im Topp saß ein Aliboy und grinste ihn frech an. Für den Ali sind nun alle guten Dinge drei gewesen, wie man so sagt. Unserm Jochen blieb nichts anderes übrig, als die Uhren bei den Kumpeln zu bezahlen. Die beiden Matrosen feixten sich eins und der eine sagte zu dem anderen: Ist deine Uhr auch kaputt gewesen?!
MS “Völkerfreundschaft” (ex. „Stockholm“) schwere Havarie in den Schären vor Stockholm am 13.08.1960
In diesem Jahr (2010) jährt sich im August zum 50.Mal ein Ereignis, welches wohl kaum noch im Gedächtnis der deutschen Öffentlichkeit haften geblieben ist. Es war die schwere Grundberührung des Urlauberschiffes Völkerfreundschaft in den Schären vor Stockholm. Obwohl damals die internationale Presse und das schwedische Fernsehen über das Ereignis berichteten, findet man heutzutage kaum eine Publikation darüber.
Die moderne Computertechnik hat dazu geführt, dass man jetzt an Informationen herankommt, die in früheren Zeiten unter Verschluss lagen, bzw. an die man sowieso nicht herankam, weil sie im westlichen Ausland veröffentlicht wurden und somit für DDR-Bürger nicht zugänglich waren.
Aus Dresden erhielt ich kürzlich einen Ausschnitt aus der Sächsischen Zeitung vom Januar 2010 mit dem Titel “Das Traumschiff der Werktätigen”. Der Untertitel lautet “Heute vor 50 Jahren brach die “Völkerfreundschaft” zu ihrer Jungfernfahrt auf. Eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff war der Traum vieler DDR-Bürger.” Da ich 1960 Matrose auf der Völkerfreundschaft war, bewog mich dieser Beitrag dazu, im Internet auf Suche zu gehen. Dort wurde ich natürlich fündig und stieß auch gleich auf ein Foto, welches das schwer beschädigte Heck der Völkerfreundschaft kurz nach dem Eindocken des Schiffes im Trockendock der Werft Burmeister & Wain im Sommer 1960 in Kopenhagen zeigt. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um ein Werkfoto der Werft B & W. Dieses Foto weckte bei mir die Erinnerung an die Havarie in den Schären vor Stockholm im August1960 , denn ich befand mich am betreffenden Tag und zur betreffenden Zeit als Ausguck in der Steuerbord-Brückennock der Völkerfreundschaft und habe einige Eindrücke von der Grundberührung des Schiffes noch gut im Gedächtnis.
Als Leiter des Fotozirkels auf der Völkerfreundschaft habe ich seinerzeit auf Anordnung des Kapitäns auch Aufnahmen vom beschädigten Schiffskörper im Trockendock der Werft B&W gemacht. Auch auf meinen Fotos war das beschädigte Heck mit der eingerissenen Achterpiek, dem zerstörten Hennegatt und dem zerstörten Ruder-Koker zu sehen, weiterhin das verbogene Ruderblatt, der backbordseitig teilweise abgerissene Schlingerkiel sowie im Inneren des Rudermaschinenraums die total auseinandergerissene Rudermaschine und den in sich verdrehten Ruderschaft. Insgesamt ein Millionenschaden! Man kann sich kaum vorstellen, welche Kräfte da gewirkt haben, um Stahlteile zu brechen, die etwa einen halben Meter Durchmesser besaßen.
Ich musste einen Satz Fotos anfertigen und zusammen mit den Negativen abliefern. Vorher hatte ich mir jedoch einen Satz Fotos für die eigene spätere Verwendung beiseite gelegt. Leider sind diese Fotos im Laufe der Jahre verlorengegangen. Immerhin liegt das Ereignis ja auch schon fünfzig Jahre zurück.
Es war damals in dem schwierigen Fahrwasser der Stockholmer Schären natürlich ein Lotse an Bord, aber die Entscheidungsgewalt bleibt letztlich beim Kapitän. Der Lotse ist lediglich Berater des Schiffsführers.
Als es zur Verhandlung vor der Seekammer der DDR kam, wurde allen, die bei der Havarie im Dienst waren und nun als Zeugen auftreten mussten, unmittelbar vor der Vernehmung eingeschärft, was sie sagen durften und sollten. Möglichst sollte man auf die Befragung nur kurz mit ja oder nein antworten. Persönliche Eindrücke des Geschehens waren absolut nicht gefragt. Die Seekammerverhandlung war zwar öffentlich und fand im Rostocker Ständehaus statt, aber es war wohl nur ausgesuchtes Publikum vertreten.
Gern erinnere ich mich an meine Fahrenszeit als Matrose und Quartermeister auf diesem Schiff vom Januar 1960 bis zum Februar 1962. Es war noch die Zeit, als in den kühleren Monaten die Häfen von Casablanca, La Goullette (Tunis), Alexandria, Rhodos, Piräus, Constanta, Jalta und Sotschi angelaufen wurden und in den Sommermonaten die Häfen von Gdynia, Riga, Leningrad, Helsinki, Stockholm und Oslo. Auch die Reisen nach Conacry und Havanna sind mir noch gut in Erinnerung geblieben. Abgemustert habe ich von der Völkerfreundschaft vor allem deshalb, weil nach der Errichtung der Berliner Mauer im August 1961 ihr Fahrtgebiet zunächst nur auf die sozialistischen Länder beschränkt wurde und damals keine Aussicht bestand, dass sich das in absehbarer Zeit ändern könnte.
Nun meine Ansicht zur Grundberührung der “Völkerfreundschaft” in den Schären vor Stockholm im August 1960 :
Die Völkerfreundschaft befand sich seinerzeit auf einer Ostseerundreise und hatte am Vortag des Unfalls morgens von Helsinki kommend den Hafen von Stockholm angelaufen. Am Abend des gleichen Tages verließ sie gegen 20.00 Uhr Stockholm mit dem Ziel Oslo.
Bei meiner weiteren Schilderung der Vorgänge stütze ich mich auf die Angaben in dem Buch der Autoren Elchlepp und Kretzschmar “Katastrophen auf See - die Seeunfälle der zivilen DDR- Schifffahrt”.
Ich befand mich als Matrose auf Wache von 0.00 Uhr bis 04.00 Uhr zusammen mit zwei anderen Matrosen und dem Quartermeister. Soweit ich mich erinnere waren zwei Offiziere, der Kapitän und ein Lotse auf der Kommandobrücke. Zum Zeitpunkt der Havarie stand der Quartermeister am Ruder.
Der schwedische Lotse machte auf mich einen sehr zerfahrenen Eindruck. Ich befand mich zu der Zeit als Ausguck in der Steuerbord-Brückennock und hielt mich zur Ablösung des Rudergängers bereit. Der Lotse kam öfter in meine unmittelbare Nähe, sodass ich bemerken konnte, dass er nach Alkohol roch. Zur Zeit des Wachwechsels um 0.00 Uhr hatte ein Lotsenwechsel stattgefunden und der ablösende Lotse kam von einem einlaufenden Schiff. Dort hatte man ihn wohl mit Alkohol bewirtet. Als der Lotse die Brücke betrat, verlangte er “voraus langsame Fahrt für beide Maschinen” und später erhöhte er auf “voraus halbe Fahrt” (8-10 Knoten rd.15-18,5 km/h). Wir kamen jetzt an eine schwierige Passage zwischen den Schären .Der Kurs musste um etwa 75-80 Grad nach Steuerbord verändert werden, da recht voraus die Insel Sandön lag. Der Lotse wurde nervös und lief aufgeregt hin und her. Ich merkte, dass die Offiziere sich über seine Untätigkeit hinsichtlich des erforderlichen Kurswechsels Gedanken machten, aber sich nicht trauten, mit ihm darüber zu sprechen. Es wurde jetzt höchste Zeit, den bisher gesteuerten Kurs zu ändern, denn ein so großes Schiff reagiert nun mal nicht sofort auf eine geänderte Ruderlage. Das Kommando kam jedoch noch nicht. Aus meiner Erfahrung als Rudergänger wusste ich sehr genau, wie die Völkerfreundschaft auf Ruderlagen reagiert. Ich konnte daher auch einschätzen, wann bei der jetzigen Geschwindigkeit die Kursänderung erfolgen müsste. Das Fahrwasser war gut zu übersehen. Auch die umliegenden kleinen Überwasserklippen und größeren Schären waren gut zu erkennen.Als der Lotse schließlich den Kurswechsel anwies, wusste ich, dass es bereits zu spät war. „Wir würden die Kirve nicht mehr kriegen“, wie man so sagt.Das große Schiff drehte nur langsam auf den neuen Kurs ein, sodass die Gefahr einer Strandung an der Insel Sandön in Höhe Västerudde bestand. Um das zu vermeiden erfolgten jetzt in schneller Folge Anweisungen des Lotsen zu Ruder- und Maschinenmanövern, die dazu führten, dass die Fahrt fast gänztlich aus dem Schiff genommen wurde und es stärker nach Steuerbord ausschor. Infolge der Trägheit eines so schweren Schiffskörpers bewegrte sich die Völkerfreundschaft jedoch weiter auf die Insel Sandön in Höhe Västerudde zu, kam jedoch in einem geringen Abstand von etwa 15- 20 m an Västerudde vorbei. Stattdessen trieb sie nun auf die kleine Schäreninsel Skötkubben zu, die sich zu diesem Zeitpunkt an Backbord voraus befand. Mit der Backbordseite streifte das Schiff den unter Wasser liegenden Fuß des Skötkubbens und blieb hier schließlich auch längsseits der Insel liegen. Selbst bei dieser sehr geringen Fahrt, die noch im Schiff war, entstand an der Backbordseite ein Schaden am Schlingerkiel, wie sich später bei der Untersuchung des Schiffskörpers im Kopenhagener Dock herausstellte. Der seitliche Aufprall auf die Felsen war deutlich zu spüren, hatte aber kaum Folgen für die Manövrierfähigkeit. Der Kapitän veranlasste sofort, dass durch den Schiffszimmermann und seinen Gehilfen die Tanks der Backbordseite gepeilt wurden. Die Peilung der Tanks ergab jedoch keine veränderten Flüssigkeitsstände. Um das Schiff in die auf der anderen Seite des Skötkubbens liegende Fahrrinne zu bringen (d.h. zwischen Sandön und Skötkubben),befahl der Kapitän jetzt, den Anweisungen des Lotsen nicht mehr zu folgen. Soweit ich mich erinnere wurde das Ruder auf hart Stb gelegt. Beide Maschinen liefen rückwärts. Das bewirkte zweifellos, dass das Schiff von den Unterwasserfelsen freikam, aber der Schlingerkiel wurde dabei auch weiter beschädigt. Die Völkerfreundschaft hatte ja noch keine Verstellpropeller und kein Bugstrahlruder mit denen man An- und Ablegemanöver ohne Schlepperhilfe fahren konnte. Das Schiff bekam bei diesem Manöver zuviel Fahrt achteraus und so dauerte es nicht lange, bis es mit seinem Heck auf die achteraus sichtbare kleine Felseninsel Jutkobben auflief. Es gab einen kräftigen Ruck und dann war alles ruhig! Der Zeitpunkt dieser zweiten und entscheidenden Grundberührung muss zwischen 0.30 Uhr und 01.00 Uhr gelegen haben. Erst hierbei traten die schweren Schäden am Achterschiff auf!
Wenn das Schiff tatsächlich wie im Buch auf den Seiten →/→ geschildert ,die erste Grundberührung auf der Untiefe Svartgrundet gehabt und sich hierbei das Ruder verklemmt hätte, so wäre es schon in dieser Situation manövrierunfähig gewesen und alle anschließenden Manöver hätten sich erübrigt. Es wäre dann auch keine Beschädigung an der Backbordseite des Schiffes am Schlingerkiel aufgetreten.Ich weiß, dass meine Schilderung dieser schweren Havarie im krassen Gegensatz zu den Schilderungen im Buch der Autoren Elchlepp und Kretzschmar steht. Diese Autoren konnten sich ja nur auf die niedergeschriebenen Unterlagen der Seekammer der DDR bzw. des “Königlich schwedischen Reichsamtes für Seeschiffahrt” stützen. Ich war aber damals unmittelbarer Augenzeuge des Geschehens. Meine Meinung und auch die Meinung anderer am Geschehen Beteiligter war aber bei der Verhandlung vor der Seekammer nicht erwünscht. Die Verhandlung der Seekammer der DDR endete also mit dem Spruch, dass die Schiffsführung des MS Völkerfreundschaft kein Verschulden an der Havarie trifft.
Interessant ist auch der letzte Satz auf Seite → des Buches “Katastrophen auf See- die Seeunfälle der zivilen DDR-Schifffahrt” den ich hier zitieren möchte “Das Versagen des Lotsen, das durch Kopflosigkeit und der Lage nicht entsprechende Anweisungen gekennzeichnet war, konnte nur durch die Ausschaltung des Lotsen aus der Beratung des Kapitäns kompensiert werden”. Hierzu kann ich nur bemerken, dass zum Zeitpunkt der Ausschaltung des Lotsen die erste Grundberührung schon passiert war. Das Eingreifen des Kapitäns hätte zu einem viel früheren Zeitpunkt erfolgen müssen! Hierzu kann sich jeder Leser selbst seine Meldung bilden.
Ich möchte jedoch auf ähnliche Fälle in der sowjetischen Handelsflotte verweisen, die in dem Buch “Hart Backbord - auf Grund” des sowjetischen Autors A.B. Judowitsch aufgeführt sind. An der Herausgabe dieses Buches hat der damalige Konteradmiral a.D. der DDR Dr.jur.Friedrich Elchlepp mitgewirkt. In diesem Buch heißt es in dem Abschnitt “1.1.4.Übertragung der Schiffsführung an den Lotsen” auf Seite → “Die weitverbreitete Praxis, die Schiffsführung dem Lotsen anzuvertrauen, ist durch nichts gerechtfertigt.” Ich glaube, dass sich hierzu ein weiterer Kommentar wohl erübrigt.
Die meisten Urlauber und Besatzungsmitglieder werden von dieser Havarie in der Nacht kaum etwas mitbekommen haben, denn alles spielte sich ohne Alarm und ohne große Hektik ab.
Die Folgen der zweiten Grundberührung waren verheerend. Wie ich schon vorher bemerkte, war die aus Großbritannien stammende Rudermaschine dabei total zerstört worden. Das Ruder war blockiert. Die Achterpiek lief wegen des etwa sieben Meter langen Risses voll Seewasser. Das Schiff war jetzt total manövrierunfähig! An die Weiterfahrt nach Oslo war natürlich nicht mehr zu denken. Durch die Schiffsleitung müssen in der gleichen Nacht noch hektische Gespräche mit der Seereederei geführt worden sein, welche Schritte hinsichtlich der Heimreise der Urlauber und hinsichtlich einer Werftreparatur zu unternehmen sind. Jedenfalls wurde erst mal das Podest mit der Gangway im A-Deck ausgebracht, um Behörden das Betreten und Verlassen des Schiffes zu ermöglichen und um die gefahrlose Evakuierung der Passagiere vorzubereiten. Wenn ich mich recht erinnere, erfolgte noch am Morgen des gleichen Tages eine Taucheruntersuchung des Schiffes.Tagsüber umkreisten uns immer wieder kleinere Passagierflugzeuge, wahrscheinlich mit Reportern und Schaulustigen besetzt. Am Nachmittag dieses Tages erfolgte auch das Ausbooten der Passagiere und des für den weiteren Betrieb an Bord nicht mehr benötigten Personals. Alle diese Personen reisten dann von Stockholm per Bahn nach Trelleborg und dann mit der Fähre weiter nach Sassnitz und weiter mit der Bahn in ihre Heimatorte. Einige Tage lagen wir noch hier in den Schären, bis die Entscheidung über eine Werftreparatur mit einer ausländischen Werft getroffen war. Das Ergebnis der Taucheruntersuchung lag ja wohl inzwischen vor. Das Schiff musste ins Dock und für diese Schiffsgröße gab es damals in der DDR kein entsprechendes Schwimm- bzw. Trockendock. Die Entscheidung hieß - mit Schlepperhilfe verholen nach Kopenhagen zur Werft Burmeister & Wain - . Nun hieß es nur noch auf die Bergungsschlepper aus der DDR zu warten. Nach einigen Tagen erschienen drei Schlepper des VEB “Schiffsbergung und Taucherei”. Ein Schlepper sollte als Kopfschlepper an der Steuerbordseite und ein weiterer als Heckschlepper an der Backbordseite festmachen. Der damals größte Schlepper der DDR Eisvogel fuhr als Sicherungsfahrzeug. Nach Abbergung von der Felseninsel konnte die Völkerfreundschaft mit eigener Maschinenkraft der Fahrtstufe “ganz langsam voraus” laufen. Das Kurshalten wurde mit den beiden Schiffspropellern in der entsprechend wechselnden Fahrtstufe und mit den beiden Schleppern ermöglicht. Dreieinhalb Tage war unser Konvoi unterwegs bis wir den Werfthafen erreichten. Zunächst lagen wir in der Werft Burmeister & Wain einige Wochen an der Pier, denn das große Trockendock war noch durch ein anderes Schiff belegt und musste nach dessen Ausdocken auch noch entsprechend für die Aufnahme unseres Schiffes vorbereitet werden. Während dieser Zeit erfolgten jedoch bereits Arbeiten im Schiffsinneren. So wurde unter anderem die Küche total umgebaut. Vorher stand hier ein großer Herd, der noch mit Koks befeuert wurde. Dabei war alle paar Wochen durch die Decksgang das Kokstrimmen erforderlich, um die Küche mit Brennstoff zu bevorraten. Hierzu musste die Luke 2 geöffnet und das Ladegeschirr vorbereitet werden. Dann wurde Koks im Laderaum in Säcke abgefüllt und mit einer Netzbrook an Deck gehievt. Von dort musste der Koks zum Vorratsraum der Küche geschafft werden. Bei dieser Arbeit sah man aus wie früher die Heizer auf den alten Dampfern. Kein angenehmer Job! Die Küche erhielt jetzt also einen Elektroherd und noch andere moderne Ausstattung. Gleichzeitig wurde eine umfangreiche Schädlingsbekämpfung gegen Küchenschaben durchgeführt. Man kann sich kaum vorstellen, was für Massen an Küchenschaben diese Aktion vernichtet hat. Es waren einige kleinere Werftcontainer voll. So etwas habe ich später noch einmal erlebt, als die Küche im NVA-Marine-Objekt Dänholm umgebaut wurde, allerdings in etwas abgeschwächter Form. Während dieser Arbeiten war natürlich kein Küchenbetrieb möglich. Der an Bord verbliebene Teil der Besatzung, das war etwa die Hälfte des Maschinenpersonals und das gesamte Deckspersonal, musste sich selbst verpflegen bei einem Tagessatz von 21 .-DM-West .Das war für damalige Verhältnisse ein sehr guter Satz mit dem man sich selbst in Kopenhagen üppig ernähren konnte. Auch für kulturelle Zwecke und persönliche Ausgaben blieb von dieser Summe noch etwas übrig.Die Werftliegezeit in Kopenhagen dauerte etwa zweieinhalb Monate. Wir hatten dort trotz unserer täglichen Arbeit eine schöne Zeit und lernten dabei die dänische Hauptstadt und ihre unmittelbare Umgebung gründlich kennen. Auch Kontakte mit Werftarbeitern und deren Familien wurden geknüpft. Allerdings nagte auch das Heimweh an meinem jungen Seemannsherzen. Das Maschinenpersonal wurde nach der Hälfte der Werftliegezeit ausgetauscht, das seemännische Mannschaftspersonal jedoch nicht. Die Offiziere konnten ebenfalls in Abständen mal nach Hause fahren, die Unteroffiziere und Matrosen des seemännischen Personals durften aber auch das nicht. Wahrscheinlich befürchtete man, dass das schuldhafte Verhalten der Schiffsführung bloßgelegt werden könnte.
Nach Beendigung der umfangreichen Reparaturarbeiten erfolgte eine Probefahrt des Schiffes im Kattegatt. Das Wetter war sehr gut, fast Windstille und Sonnenschein. Die See war fast glatt mit ganz leichter Dünung. Kein Mensch an Bord dachte an irgendetwas Unvorhergesehenes. Da wurde das Kommando zum Ausfahren der Stabilisatoren erteilt. Plötzlich fing das Schiff an, gewaltig nach beiden Seiten hin und her zu krängen. Die Stabilisatoren, das sind seitlich ausfahrbare Flossen zur Dämpfung der Schlingerbewegungen, wirkten in diesem Moment genau entgegengesetzt und verstärkten somit die Wirkung der vorhandenen Dünung der See. Selbst auf der Kommandobrücke konnte man hören, dass im Schiffsinneren einiges über Stag und zu Bruch ging. Sofort wurden die Stabilisatoren wieder eingefahren und der Steuerkreisel für die Anlage musste neu eingestellt werden. Die Schadensaufnahme ergab, dass unter anderem ein Konzertflügel durch die Gegend gesaust war und dabei einen Totalschaden erlitt. Auch etliches Geschirr und andere Gegenstände gingen zu Bruch. Man braucht wohl nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, was diese ganze Aktion, angefangen bei der Havarie in den Stockholmer Schären, über die Evakuierung der Passagiere, das Verholen mit drei großen Seeschleppern nach Kopenhagen, das Docken, die Reparatur und die anschließende Erprobung gekostet haben kann. Der größte Anteil davon musste sicher in Devisen beglichen werden! Von der Schiffsführung wurde niemand für den Schaden zur Verantwortung gezogen!!!
Ein Traumschiff mag die Völkerfreundschaft vielleicht für Urlauber gewesen sein, die ja zu der Zeit nichts anderes in der DDR kannten, für die Besatzung war sie es jedenfalls nicht! Dafür spricht schon die Tatsache, dass damals lediglich der Speisesaal klimatisiert war. Passagier- und Besatzungskabinen hatten keine Klimaanlage, was sich besonders in südlicheren Breiten zuweilen sehr unangenehm bemerkbar machte. Auch für die Stewards war es immer wieder sehr unangenehm, wenn sie vom klimatisierten Speisesaal zur nichtklimatisierten Küche hin und her wechselten. Auch erinnere ich mich noch an die Reise nach Conacry in Guinea im Februar 1961. Auf dieser Reise war viel Personal der DDR-Forstwirtschaft an Bord. Bei der Abreise in Rostock war es damals sehr kalt. Die Förster trugen fast alle ihre warme Dienstbekleidung. Die Leute hatten wohl auch kaum daran gedacht, welche Temperaturen an der afrikanischen Westküste in der unmittelbaren Nähe des Äquators herrschen. Jedenfalls taten sie mir richtig leid, als sie teilweise noch bei achtundvierzig Grad Celsius im Schatten und sehr hoher Luftfeuchte in Conacry in ihrer Dienstbekleidung, die ja nicht für die Tropen geschaffen war, an Land gingen. Auch in ihren Schiffskabinen müssen sie wohl richtig geschmort worden sein. Das Schiff war ja nicht für Fahrten in subtropische bzw. tropische Gewässer gebaut worden, sondern es war für den Liniendienst im Nordantlantikverkehr zwischen Göteborg und New York konzipiert. Auch war es kein Luxusliner sondern bot als MS Stockholm normalen Komfort in zwei Klassen.
Trotz mancher Fährnisse denk ich gerne an meine zwei Jahre Fahrenszeit auf der Völkerfreundschaft zurück Ich hatte viele Freunde und gute Kameraden unter den rund zweihundertzwanzig Personen der Besatzung. Mit den Passagieren kam ich kaum in Kontakt, was von der Schiffsführung auch nicht erwünscht war. So manchem Passagier konnte ich aber doch eine Freude bereiten, in dem ich seinen Fotoapparat reparierte, oder ihm meinen eigenen Apparat auslieh. Schließlich waren es unvergessliche Erlebnisse, die jeder auf Film und Foto bringen wollte. Mir ist nicht bekannt, dass jemals ein anderes größeres Passagierschiff der Welt eine so lange Dienstzeit hinter sich hat wie die ehemalige Stockholm der Swedish-Amerika-Line; die bereits im Jahre 1948 zu ihrer Jungfernfahrt von Göteborg nach New York aufbrach und noch heute, nach einer schweren Kollision im Jahre 1956 mit der italienischen Andrea Doria vor New York ,bei der der italienische Luxusliner sank, einer schweren Grundberührung in den Stockholmer Schären 1960, mehrmaligen Verkäufen, Umbenennungen und grundlegenden Umbauten immer noch in Dienst ist. Bei ihrer Indienststellung war sie noch vom Aussehen her ein schnittiger Ozeanliner, der auf einem schwedischen Luftbild aus dieser Zeit eher wie eine riesige Yacht aussah. Dieses Bild änderte sich nach Umbauten in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das Oberdeck (Deck 4 des originalen Schnittes) wurde bis an das vordere Pfahlmastenpaar verlängert. Auf diese Decksverlängerung kam noch ein Aufbau. Das zweite Pfahlmastenpaar wurde entfernt. Nach diesem Umbau wirkte das Vorschiff nicht mehr ganz so lang und von der seitlichen Ansicht ging einiges an Eleganz verloren.
Nach dem grundlegenden Umbau ab 1992 war die ehemalige Stockholm nicht mehr wieder zu erkennen. Schließlich blieb nur der größte Teil des alten Schiffsrumpfes erhalten. Ich finde, dass von der ehemaligen Eleganz des Schiffes nichts mehr vorhanden ist. Lediglich die Bedingungen für Passagiere und Besatzung haben sich wahrscheinlich gründlich zum Besseren gewandelt und der heutigen modernen Zeit angepasst.
Ich verfolge das Leben dieses Schiffes mit großem Interesse und wünsche ihm und seiner Besatzung noch weiterhin - allzeit Gute Fahrt!
Technische Daten MS Völkerfreundschaft
Rauminhalt
12.442 BRT
Länge
160,06 m
Breite
21,06 m
Antrieb
2 Propeller
Leistung
12.000 PS
Geschwindigk.
19 Knoten (Dienstgeschw.)
Passagiere
568
Mannschaft
ca. 220
Stapellauf
09.09.1946
Ergänzung zur Kurzgeschichte - Havarie der Völkerfreundschaft 1960 bei der Insel Sandön in den Schären vor Stockholm :
Vor mir liegt die Skizze von Seite → aus dem Buch der Autoren Elchlepp und Kretzschmar “Katastrophen auf See - Die Seeunfälle der zivilen DDR-Schiffahrt” zur Havarie des FDGB-Urlauberschiffes Völkerfreundschaft. Die Skizze ist nicht bemaßt (Absicht?).
Bei Google Earth können wir folgende Maße entnehmen (der Maßstab ist auf der Karte in ft angegeben,ein feet =0,3048 m):
Die Havarie spielte sich also in einem sehr eng begrenzten Seegebiet ab. Aus den Aussagen bei der Seekammer- verhandlung ergab sich, dass der schwedische Lotse die Kursänderung bei Erreichen der Richtfeuerlinie Eknö mit Anweisung an den Rudergänger das Ruder auf Stb 10 zu legen anwies. Gehen wir davon aus, dass bei der Peilung des Richtfeuers von der Bb Brückennock aus das Vorschiff der Völkerfreundschaft mit etwa 70 m Länge die Richtfeuerlinie bereits überquert hatte und zu dieser Zeit die Geschwindigkeit des Schiffes etwa 9 Kn (rd.17 Km/h) betrug, so wird ersichtlich, dass sich der Abstand des Schiffes zur Insel Sandön, der zum Zeitpunkt der angewiesenen Kursänderung nur noch etwa 400 m betrug, rapide verringerte. In jeder Sekunde legte das Schiff einen Weg von etwa 4,7 m zurück und es reagierte nur sehr langsam auf die angewiesene Ruderlagenänderung. Gehen wir weiterhin davon aus, dass der schwedische Lotse noch mindestens weitere 20 Sekunden abwartete ehe er die Ruderlage auf hart-Stb anwies, so hatte das Schiff in dieser Zeit etwa weitere 94 m zurückgelegt und befand sich mit seinem Vorsteven nur noch etwa 300 m von Västerudde entfernt. Aus den Aussagen der Schiffsführung geht hervor, dass die
Völkerfreundachaft mit einem Abstand von etwa 15-20 m von Västerudde klarkam. Wenn man diesen Abstand in den dargestellten Maßstab der Skizze aus dem Buch überträgt, würde sich ein eingezeichneter Abstand von etwas unter einem Millimeter ergeben. Der tatsächlich zurückgelegte Weg des Schiffes ist also auf der Buchskizze falsch dargestellt. Außerdem erfolgte die erste Grundberührung nicht mit dem Heck auf Svartgrundet sondern mit der Bb-Seite auf Skötkubben. Das wird auch leicht verständlich, wenn man sich die Kurve des tatsächlich zurückgelegten Weges (maßstäblich) betrachtet. Bei der Größe des Schiffes und der Manövrierfähigkeit bei beschränkter Geschwindigkeit ergibt sich gegenüber der vorliegenden Havarieskizze doch eher die Möglichkeit, dass die Schiffsführung versuchte, als man von der Kante bei Västerudde
klarkam, das Schiff nach Backbord zu drehen, um in die Durchfahrt zwischen Skötkubben und Sandön zu gelangen. Das gelang jedoch nicht. Das Schiff kam mit der Bb-Seite längs der Westseite des Skötkubben zum Stehen.Das erklärt auch, warum die Völkerfreundschaft an der Bb-Seite Schäden am Schlingerkiel aufwies. Da das Schiff also mit der Backbordseite an einer Felsenklippe lag, konnte es nicht mit dem Heck auf der Stb-Seite auf die Untiefe Svartgrundet aufgelaufen sein. Es war auch zu dieser Zeit noch voll manövrierfähig. Von der Kommandobrücke aus war die kleine Felseninsel in ihrer ganzen Länge und Breite zu übersehen.
Hier, längs des Skötkubben, ließ der Kapitän die Tanks der Bb-Seite peilen. Er übernahm wieder selbst die Schiffsführung und setzte die Völkerfreundschaft nach einem Rückwärtsmanöver bei der Klippe Jutkobben mit dem Heck auf Grund, wobei der schwere Schaden am Achterschiff verursacht wurde.
Wenn man auf der Kommandobrücke der Völkerfreundschaft stand, befand man sich etwa 17 m oberhalb der Wasserlinie und hatte ein Vorschiff von etwa 70 m vor sich. Da hat man eine völlig andere Perspektive, als wenn man eine Skizze betrachtet. Eine Entfernung von etwa 500 m zu einer Felseninsel recht voraus, bei einer Geschwindigkeit von etwa neun Knoten in einem engen kurvenreichen Fahrwasser, hat dann schon etwas Beängstigendes an sich, noch dazu, wenn Schiffsführung und Lotse offensichtlich nicht ordentlich ihren Pflichten nachkommen. Eine geringe Vorstellung der Situation bekommt man, wenn man sich den angekippten 405 ft Google-Ausschnitt bei einer Sichthöhe von 382 m betrachtet.
Wenn der Kurs des Schiffes tatsächlich so verlaufen wäre wie auf der Skizze des Buches der Autoren Elchlepp und Kretzschmar dargestellt, hätte es ohne Probleme die Durchfahrt zwischen Sandön und Skötkubben erreichen müssen.
Nachtrag: In der Bertebszeitung Voll Voraus des VEB Deutsche Seereederei Ausgabe Nr.22 vom Oktober 1965 finden wir die Ehrentafeln der Ausgezeichneten des zum ersten Male gefeierten Tages der Seeverkehrswirtschaft. Den Namen des ersten Kapitäns der Völkerfreundschaft , Adolf Zinn, finden wir dort nicht.! Es ist wohl ein spätes Eingeständnis dafür, dass bei der Havarie der Völkerfreundschaft am 13. August 1960 in den Schären vor Stockholm nicht alles sauber abgelaufen war. Auf den Tag genau,ein Jahr nach dieser Havarie, wurde die Mauer in Berlin errichtet und die ersten Urlauber flüchteten auf Rhodos und in Piräus.
Kapitän Adolf Zinn (Kapitän der Völkerfreundschaft bis November 1960)
Foto aus dem Internet, wahrscheinlich handelt es sich um ein Werkfoto der Werft Burmeister und Wain. Deutlich sind die schweren Schäden am Heck und am Ruder zu erkennen.
Havarieskizze aus dem Buch der Autoren Kretzschmar und Elchlepp
FDGB-Urlauberschiff „Völkerfreundschaft „ 1960
MV „Stockholm“ Swedish- America-Line
MV „Stockholm“ in den Schären (Foto aus Internet)
Kartenausschnitt Stockholm oben rechts Insel Sandön
Recht voraus Insel Sandön, rechts davon der Skötkubben (aus Google Earth)
Sturmfahrt in der Nordsee
Vor dem Weihnachtsfest 1961 habe ich von dem DDR-Urlauberschiff Völkerfreundschaft abgemustert. Ich war dort zuletzt als Quartermeister angeheuert und schon zwei Jahre an Bord. Ich wollte da nicht mehr weiterfahren, weil das Schiff wegen der Mauer in Berlin nur noch in die sozialistischen Länder fahren sollte. In meinem Urlaub im Januar 1962 musste ich zum Wehrkreiskommando Stralsund kommen und wurde dort für die NVA-Marine gemustert. Ich war damals sehr sauer und versuchte, so schnell wie möglich wieder ein Schiff bei meinem Betrieb, der Deutschen Seereederei Rostock, zu bekommen, um mich vom Militär abzusetzen. Das klappte dann ja auch und ich habe den erstbesten Frachter angenommen, der mir als Vollmatrose angeboten wurde. Das war dann das Küstenmotorschiff Barhöft . Ich konnte damals noch nicht wissen, dass gleich meine erste Fahrt auf diesem Kümo, die gefährlichste Fahrt in meiner Seefahrtszeit werden sollte. In Wismar stieg ich an Bord der Barhöft und habe dort eine gute Besatzung angetroffen. Das Schiff war fertig zum Auslaufen nach London. Die Reise ging durch den Großen Belt, das Kattegatt, das Skagerrak und dann durch die Nordsee. Ich musste mich erst an das kleine Schiff und seine Bewegungen in der See gewöhnen. Die Reise nach London verlief ohne Zwischenfälle. In London haben wir unsere Ladung Stückgut an einer Wharf in der Nähe der Tower-Bridge gelöscht,dann verholten wir zu den Westindia-Docks, wo wir eine Ladung Kupferbarren für Rostock übernahmen. Die Kupferbarren wurden von den englischen Schauerleuten in kleinen Haufen auf dem Boden des Laderaumes verteilt. Das war eine gefährliche Ladung, weil sie bei starkem Seegang ins Rutschen kommen konnte. Die schweren Barren hätten auch mit ihren scharfen Ecken und Kanten die Bordwände dieses kleinen Kümos durchschlagen können. Auch ein Kentern des Schiffes wäre bei starkem Seegang möglich gewesen.
Die Barhöft war ein Küstenmotorschiff von fünfhundert Tonnen, hatte eine Länge von 49,9 m, eine Breite von 8,20 m und ging 3,18 m tief. Das Schiff wurde 1956 in Dienst gestellt. Vom Typ her war die Barhöft ein Volldecker, das heißt in diesem Fall ein Stückgutschiff ohne Zwischendeck. An Deck befanden sich für das Laden und Löschen zwei Elektrokräne. Unter der hohen Back waren die Bootsmanns- und die Farbenlast. Auf dem Hauptdeck befanden sich unter der Poop die Kombüse, die Messen, die Sanitärräume und die Wohnräume der Besatzung. Die zwei Laderäume wurden noch in der alten Bauweise abgedeckt. Eiserne Scherstöcke wurden quer über die Luken eingesetzt und in die Zwischenräume wurden hözerne Lukendeckel eingelegt. Obendrauf kam eine doppelte Lage Persennings. Die oberste Lage war besonders wetterfest imprägniert. Die Persennings wurden am Lukensüll mit eisernen Schalklatten und Buchenholzkeilen verschalkt. Quer über die Persennings kamen obendrauf noch eiserne Verschlusslatten, die gegen das Hochfliegen aufgebracht wurden und auch als Zollverschluss dienten. Die beiden Kranausleger wurden beim Seeklarmachen in Stützen gefiert, die an den Seiten des Lukensülls eingesetzt waren. Anschließend wurden sie mit Stropps und Spannschrauben verzurrt.
Die Besatzung bestand aus dem Kapitän, zwei nautischen Offizieren,dem Chief, zwei Maschisten, einem Maschinenassistenten, vier Matrosen und dem Koch. Für die heutige Zeit eine viel zu große Crew.
Die Fahrt von London nach Rostock war erst mal schon auf der Reede von Gravesend, am unteren Ende der Themse gegenüber den Tilbury-Docks, zu Ende. Es war Sturm für die ganze Nordsee gemeldet und wegen unserer Kupferladung konnten wir die Reise nicht fortsetzen. Die Kümos der fünfhunderter Klasse waren ansonsten seetüchtige Schiffe.
Die Barhöft hatte damals eine sehr gute Crew, die Beste, an die ich mich in meiner ganzen Fahrenszeit in der Seefahrt erinnern kann. Alle dreißig Minuten wurde nun während der Wachen der Seewetterbericht abgehört. Die Lage änderte sich aber die nächsten Tage nicht. Trinkwasser und Proviant wurden bald knapp und mussten über das Versorgungsschiff nachgebunkert werden. Nach einer Woche flaute der Sturm ein wenig ab, aber es war immer noch Starkwind für die südwestliche Nordsee und die Deutsche Bucht gemeldet. Das konnte ja noch ewig so weitergehen und bereitete uns keine Angst. Wir sollten zu der Zeit wegen der knappen Devisen der DDR möglichst nicht durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren, sondern mussten den langen Weg um Skagen nehmen. Der Kurs wurde zunächst auf das Feuerschiff Texel vor der holländischen Küste abgesetzt. Als wir Sunk-Pilots an der Themsemündung passierten, spürten wir den starken Seegang und merkten, dass sich das Schiff mit dieser Ladung steif verhielt. Es stukte stark ein und schüttelte sich in seinem ganzen Rumpf durch.
Auf dem halbem Weg nach Texel gab es erneut eine Sturmwarnung für die ganze Nordsee. Es war nun mit sarkem Sturm aus West/Südwest zu rechnen. Für uns hieß das schwere See von ein wenig achterlicher als dwars. Der Wind nahm schon immer mehr zu und man konnte das Schiff kaum auf Kurs halten. Der Wind drehte mittlerweile auf West-Nordwest. So halbwegs zwischen der Themse und Skagen, ungefähr so hundert Seemeilen westlich der Insel Helgoland, konnten wir unseren Kurs nicht mehr beibehalten und mussten beidrehen. Das Beidrehen bei diesem Sturm, der bereits voll aufdrehte und auch schon Orkanspitzen hatte, war einer der gefährlichsten Momente dieser Reise. Die Ladung hätte in dem Augenblick verrutschen können, wo die See von dwars einkommt und dann wäre es schnell aus gewesen mit Schiff und Besatzung. Bei diesem Wetter hätte es wohl keine Rettung geben können. Wir wussten alle, dass nun größte Gefahr bestand, handelten aber als tüchtige Seeleute schnell und entschlossen. Das Schiff quälte sich langsam in der See herum und nahm viel Wasser über. Das Manöver verlief gut. Aber nun ging das Martyrium erst mal richtig los. Der Sturm wuchs sich zum Orkan aus und ein Ende davon war noch nicht abzusehen. Über Funk hörten wir von überall Notsignale von anderen Schiffen, aberwir konnten da nicht helfen. Wir waren ja selber in großer Gefahr.
Wir liefen mit ganz langsamer Fahrt so eben gegenan und hofften, dass unsere Maschine durchhält. Die Wellenhöhe war wohl so bei zehn Meter. Ich habe damals noch einige Fotos mit meiner Exa davon gemacht, aber inzwischen, nach all den Jahren, ist nichts mehr davon vorhanden. Die See kam nun stark über die Back und das Hauptdeck. Für die Luken bestand die Gefahr von Seeschlag. Ich musste nun mit meinem Kumpel Whisky kontrollieren, ob an Deck noch alles fest war. Wir zogen uns wetterfest an und warteten auf den Augenblick, wo wir oben auf dem Wellenberg waren. Dann drehten wir die Vorreiber des Schotts zum Hauptdeck auf und stürmten heraus.
Die nächste See kam in diesem Moment schon über und das Schott war noch nicht wieder zu. Ein großer Schwall Wasser schoss in den Gang und in die Kombüse, die gleich an der Seite hinter dem Schott lag. Wir beide wurden gegen die Säule des achteren Krans geschleudert, dass uns Hören und Sehen verging. In den Pausen zwischen den überkommenden Seeen rannten wir dann zum Vorschiff, wo wir unter der Back erst mal in Sicherheit waren. Aus der Bootsmannslast holten wir Lukenkeile und einen Vorschlaghammer und machten uns dann an die Arbeit. Wir kloppten die losgewordenen Keile nach. Wo einer fehlte, kam ein neuer Keil hinein. Dabei mussten wir ständig aufpassen, dass uns die See nicht überrascht und uns über Bord spült. Manchmal hatten wir das Gefühl, als wären wir in einem Fahrstuhl. Wenn es nach unten ging wurden wir federleicht und wenn es nach oben ging wurden wir schwer wie Blei. Wir konnten uns kaum auf den Beinen halten und wurden ständig mit kaltem Seewasser überschüttet. Das Wasser drang durch das Ölzeug und lief in die Gummistiefel. Beim Luftschnappen bekam man ständig salzigen Gischt mit. Auch das Sehen fiel nicht leicht, weil das Salzwasser einem die Augen verklebte.
Die Arbeit hatten wir nun endlich getan und es ging zurück ins Achterschiff. Hier sah es bös aus, Wasser war ja bei unserem Ausrücken in den Gang und in die Kombüse geschossen. In der Kombüse lagen nasse Lebensmittel und Scherben vom Geschirr auf dem Fußboden, der Koch versuchte alles in Ordnung zu bringen. Der Ölbrenner des Kombüsenherdes funktionierte nicht mehr. Das Kochen war wegen der starken Roll- und Stampfbewegungen sowieso aussichtslos.Heißer Kaffee oder Tee konnte nur noch mit einem Tauchsieder gemacht werden. Zweimal am Tag musste die Crew für je sechs Stunden auf Wache ziehen. In dieser Zeit war das wachhabende seemännische Personal ständig auf der Kommandobrücke. Der Rudergänger stand hinter der Knopfsteuerung und musste scharf auf den Kompass und auf anlaufende Seen aufpassen. Ein Abkommen vom jetzt gesteuerten Kurs barg die Gefahr, dass das Schiff querschlägt. Der Käptn war ständig auf der Brücke, nur zwischendurch machte er ein kurzes Nickerchen im Kartenraum.
Fenster und Türen konnte man auf der Brücke nicht öffnen. Die Luft war voller Qualm, weil die moisten Leute an Bord starke Raucher waren. In den Freiwachen lagen wir angezogen auf unseren Kojen, um jederzeit für einen Gefahrenalarm bereit zu sein. Schlafen konnte man auch nicht, es war mehr ein Dösen. Wenn der Propeller aus dem Wasser kam, gab es starken Lärm und das Schiff wurde in seinen ganzen Verbänden stark durchgerüttelt.
Für das Maschinenpersonal war es besonders schwer. Die Skylights des Maschinenraums konnten nicht geöffnet werden. Die Maschinisten lösten sich in kürzeren Zeitabständen ab und kamen dann auf die Brücke, um sich zu erholen. Gestank von Diesel und Abgasen machte sich in allen Räumen breit. Man war froh, wenn es wieder auf Wache ging. Mit ein wenig Trockenverpflegung im Magen und mit einem warmen Getränk überstanden wir die nächsten Tage.
Nach zwei Tagen Gegenanlaufens kündigte der Seewetterbericht das langsame Nachlassen des Sturmes an.Wir warteten noch einige Stunden und dann kam wieder dieses gefährliche Wendemanöver. Auch dieses Mal klappte das gut, aber in den Räumen ging wieder was zu Bruch. Die See kam nun ein wenig achterlicher als dwars von der Backbordseite und war auch wieder unsere größte Plage. Es bestand imm er noch die größte Gefahr, dass große Seen uns von achtern überlaufen. Wir dachten aber ständig nur daran, dass die Hauptmaschine und die anderen Aggregate durchhielten, ansonsten wären wir erledigt gewesen. Leider hatte dann doch die Hilfsmasachine schlapp gemacht und ich musste mit rein
in den Maschinenraum, um zu helfen. Gemeinsam mit dem Maschinenassistenten hab ich dann an dem Jockel rumgewerkelt. Das Abnehmen der schweren Zylinderköpfe war bei diesem Seegang kein Vergnügen. Mit einer Hand musste man sich ständig festhalten, mit der anderen Hand wurde am Kettenzug gezogen. Dann musste man noch aufpassen, dass man beim Hieven nicht von dem angehobenen Maschinenteil erschlagen wird. Dazu noch der Lärm der Hauptmaschine und der Gestank der Abgase! Jedenfalls war das kein Vergnügen. Beim Aufsetzen der Zylinderköpfe stellten wir fest, dass einige Muttern fehlten. Wieder mussten die beiden Zylinderköpfe abgenommen werden, weil ja die fehlenden Teile in den Zylindern sein könnten, was sich dann ja auch so herausstellte. Ich war jedenfalls froh, dass ich nach dieser Aktion wieder auf die Brücke rauf konnte.
So ging die Reise noch zwei Tage bis zu der Höhe von Hanstholm an der dänischen Nordwestküste. Hier in der Jammerbucht ließ der Seegang nach, weil wir nun langsam unter Landschutz kamen. So richtig froh waren wir aber erst, als Skagen hinter uns lag und wir in das Kattegatt kamen. Unter dem Schutz von Skagen lagen hier viele Schiffe, kleine und große Frachter, die sich bei diesem Wetter nicht in die Nordsee raus trauten.
Wir waren froh, dass wir den gefährlichsten Teil der Reise hinter uns hatten. Auch im Kattegatt wurden wir noch tüchtig durchgeschüttelt, aber das war nicht mehr so, wie in der Nordsee. Wir konnten nun wieder schlafen und an das Aufräumen gehen. Warmes Essen gab es aber immer noch nicht, der Kombüsenherd war ja noch defekt und die Lebensmittel waren verdorben oder über Stag gegangen. So haben wir mit Kohldampf Rostock angesteuert, dass wir dann ja auch nach dieser beschwerlichen Reise mit viel Glück erreichten.
Beinahe hätte die Seereederei Rostock ein Küstenmotorschiff mit Mann und Maus und mit einer teuren Ladung verloren.