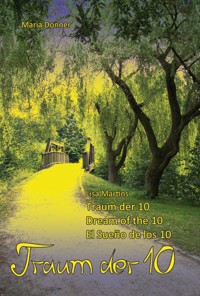2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus einer Idee entstand eine Sammlung von Geschichten – so geschmackvoll und vielseitig wie eine Bowle. Sortiert nach Vorlesezeit sollen die Beiträge Menschen in besonderen Lebenslagen aus dem Alltag entführen und für ein gutes Gefühl sorgen. Die Protagonisten berühren den Regenbogen, retten einen kleinen Hund, besuchen den Jahrmarkt, erinnern sich an die verflossene Liebe, begegnen einer neuen … Ob nachdenklich, lustig oder fantasievoll, die Autoren garantieren stets ein optimistisches Ende. Mit ihren 41 Erzählungen wollen sie Freude schenken und wünschen gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum:
Texte: von den Autoren für das Projekt zur Verfügung gestellt
Umschlag © Copyright Maria Donner
Verantwortlich für den Inhalt:
Maria Donner
Duesbergstr. 5
46325 Borken
Mehr zu
Maria Donner – www.traumder10.de
Sabine Reifenstahl – www.sabinereifenstahl.de
Michael Kothe – www.autor-michael-kothe.jimdofree.com
In jedem Alter
Von klein an Bücher faszinierenBilder zu eigenen Geschichten verführenvorgelesen auch vor der Nacht wurde kuschelig Vertrauen gebracht
Die Stimme begleitet uns weiterdie Träume waren wohltuend – heiterdie gleiche Geschichte wieder und wiederdem Vorleser wäre Abwechslung lieber
Dann viele Jahre – selber lesen war angesagtda wurde keiner zum Vorlesen gefragtselbstständig lesen – außer ab und anwenn eine Lesung oder einer der Lieben war dran
Wenn die Augen dann schwächelnformt sich durchs Vorlesen ein Lächelndie Zeit miteinander ist doppelt wichtigzu fühlen, zu hören, das Leben zu spüren ist richtig
© Maria Donner
Aus »Ein Jahr ist mehr als 365 Tage« – Gedichte zu kuriosen Feiertagen
Gedicht für den 20. November (bundesweiter Vorlesetag)
www.poesiewerkstatt.net
Inhalt
Vorwort
Mein Nikolauswunder (10)
Stadt der Liebe (10)
Ich war noch niemals in New York (10)
Zuckerwattewolken (10)
Es war die schönste Zeit, es war die schlimmste Zeit (10)
Das alte Haus (10)
Der Elfengarten (10)
Berühr den Regenbogen! (10)
Hilde und ich (10)
Schokoladeneis für einen Elf (10)
Die Bremer Weihnachtsmusikanten (10)
Die goldene Nase (10)
Kurz nach elf (10)
Schneeglöckchenstärke (9)
Begleiterscheinungen (9)
Wie Asche im Wind (8)
Herbst (8)
Die Höhle (8)
Tante Olaf (8)
Molly und Oskar (8)
Nach Hause kommen (7)
Mit Liebe gemacht (7)
Nachschub für die Freundschaft (7)
Paul (7)
Flussgespräche (6)
Wie man schwebend älter wird (6)
Das Leben kann tierisch wunderbar sein! (6)
Altersweisheit (5)
Abserviert (5)
Wenn die Leidenschaft vergeht (5)
Unverhofft (5)
Das Kind von nebenan (5)
Nach dem Regen (5)
Ein letzter Blick (5)
Meine Welt (4)
Damenwahl (4)
Günter ist weg (3)
Wenn einer eine Reise tut … (2)
Der Kirschbaum (2)
Voller Einsatz (2)
Ladies Night (1)
Autorinnen und Autoren
Vorwort
Unseren Vorleserinnen und Vorlesern sowie allen, die dieses Buch in die Hand nehmen, danken wir, dass Sie sich für diese Geschichten entschieden haben. Aus über 140 Einsendungen haben wir als Herausgebende diejenigen Erzählungen ausgewählt, die Menschen in besonderen Lebenslagen aufbauen.
Egal ob angehört oder selbst gelesen: Jede Geschichte zeigt eine Wendung zum Guten und bietet einen Ausblick, der Mut macht. Wir möchten damit das Leben bei Schicksalsschlägen, Trauer, Krankheit oder auch nur schlechter Laune erträglicher machen und zusammen mit den Protagonisten für einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft sorgen.
Im Durchschnitt lassen sich in einer Minute 1.000 Zeichen lesen. Vor jeder Geschichte ist die Dauer der Vorlesezeit vermerkt. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie die Vorlesezeit ebenfalls. Planen Sie trotzdem etwas mehr Zeit ein, der Vortrag führt oft zu weiteren Gesprächen.
Allen Autorinnen und Autoren, die sich am Projekt beteiligt haben, danken wir herzlich. Auch, wenn ihre Geschichten den Weg ins Buch nicht gefunden haben.
Maria DonnerSabine ReifenstahlMichael Kothe
Charakter:
gut verständlich – hoffnungsvoll
Inhalt:
nach dem Tod des Partners einen Weg finden, weiter zu leben
Lesezeit:
10 Minuten
Sabine Reifenstahl
Mein Nikolauswunder
Das Weihnachtsfest steht bevor und wird zum ersten Mal kein Fest der Freude sein. Voller Schwermut erinnere ich mich. Wie sehr ich die köstlichen Düfte mochte: gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Zimt, Rum und Anis. Tagelang buk ich Stollen und Pfefferkuchen. Gebratene Äpfel und die gefüllte Gans mit Rotkohl. Beim Anblick der Leckereien leuchteten Andrejs Augen. In ihnen spiegelten sich die Wärme der Kerzenflammen und seine Liebe.
All das gehört der Vergangenheit an. Er ist fort. Obwohl ich ihn so oft warnte, nicht vor mir zu gehen. »Wie sollte ich wohl ohne dich leben, Elisa?«, lautete stets seine Antwort. Und sie bewahrheitete sich auf furchtbare Weise.
Wie soll ich ohne dich leben? In diesem Jahr bleibt die Weihnachtsdekoration verpackt im Keller. Sie erinnert zu stark an Andrej, an die guten wie auch schweren Zeiten. Die Tannenbaumspitze hatte er mir zu unserem ersten Weihnachtsfest geschenkt. Trotz des inzwischen angeschlagenen Engels landete sie immer wieder auf dem Baum. Unser persönlicher Höhepunkt, der die Feiertage einläutete. Viel haben wir gemeinsam durchgemacht und konnten uns stets aufeinander verlassen. Einer stützte den anderen.
Jetzt bin ich allein und vermisse meinen Mann derart, dass mir oft die Luft zum Atmen fehlt. Ohne ihn ist mir das Haus fremd. Jedes Möbelstück ist mit Erinnerungen verknüpft, meist wunderbaren. Und doch versetzen sie mir schmerzhafte Stiche, lassen mich meinen Verlust umso mehr fühlen. Er ist nicht mehr da und hat mich einsam zurückgelassen. Manchmal hasse ich ihn dafür, weiß jedoch, wie unsinnig dieses Gefühl ist. Andrej hatte keine Schuld an seinem Unfall. Nicht einmal Zeit zum Abschied blieb uns. Wie soll ich ohne ihn leben?
Kurz entschlossen fliehe ich am Nikolaus-Tag und fahre aufs Geradewohl los. Anfangs ohne festes Ziel, doch ein Entschluss kristallisiert sich aus der Trauer. Noch einmal will ich dorthin, wo wir so wunderbare Erlebnisse teilten. Kap Arkona, Rügens nördlichster Zipfel. Dieser Ort besitzt eine besondere Form von Magie. Erneut möchte ich mich von ihr verzaubern lassen.
Meine Kinder reagieren verständnislos und meinen, ich solle die Vorweihnachtszeit bei ihnen verbringen. So würde ich die Einsamkeit weniger spüren. Als ob das ginge! Ich weiß, sie meinen es gut. Daher erkläre ich ihnen, dass ich Zeit zum Nachdenken brauche an einem Platz, der ihrem Vater und mir gleichermaßen viel bedeutet hat. Eine Notlüge.
Entgegen meiner Gewohnheit nehme ich das Auto, obwohl ich in den vergangenen Jahren höchstens den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen damit erledigte. Die ersten Kilometer zittere ich vor Anspannung. Kleine Ortschaften, wunderschöne Alleen und unzählige Seen bannen meine Aufmerksamkeit. Ich beruhige mich und folge vertrauensvoll der weiblichen Stimme des Navigationsgeräts.
»Du und deine Kirchturmtouren!«, frotzelte Andrej oft im Bemühen, mich zum Autofahren zu bewegen.
Seine Neckereien fehlen mir. Früher schalt ich ihn oft einen närrischen Kerl. Jetzt vergeht kein Augenblick, ohne mir zu wünschen, er wäre noch da – oder ich bei ihm. Alles, nur nicht dieses Leben allein. Tränen rinnen mir übers Gesicht.
Nun stehe ich am Rand der Steilküste und blicke aufs Meer hinaus. Der Weg nach Kap Arkona lohnt sich zu allen Jahreszeiten. Wir kamen oft hierher, liebten die Aussicht. Und wir liebten einander hier oben, als wir jung waren.
Ein Bild erscheint vor meinem inneren Auge. Leidenschaftlich umschlungen liegen wir im Gras. Andrej küsst und streichelt mich zärtlich. Der Wind trägt fremde Stimmen heran, die uns innehalten lassen. Glücklicherweise ziehen sie vorbei. Genau wie die wunderbare Erinnerung. Ich öffne die Augen und schaue mich um. Seltsamerweise ist mir mein Mann an diesem Ort näher als irgendwo sonst, und ich spüre weniger Traurigkeit.
Auf den Bäumen glitzert Raureif. Sonnenstrahlen brechen sich in den Eiskristallen und lassen jene gleich Brillanten funkeln. Die Ostsee liegt wie ein Spiegel unter mir und verströmt Ruhe. Ich atme tief ein und setze einen Fuß vor.
Eine leichte Brise streicht über die Wasseroberfläche. Wellenkämme reflektieren das Licht, das Gleißen blendet mich. Vor der Pracht muss ich die Lider schließen. Dann hebe ich sie wieder und erschaue – gefühlte tausend Meter tiefer – die Herrlichkeit des Vergessens.
Unwillkürlich mache ich einen weiteren Schritt, verharre ein Stück vom bröckeligen Rand entfernt und richte die Augen auf den Horizont. Ohne Andrej umklammert die Höhenangst mich mit eisigen Klauen.
Mir fällt ein anderes Ereignis ein. Einige Jahre nach unserem frivolen Stelldichein auf den Klippen. Damals tobte ein Unwetter und ich wollte schnellstmöglich zurück ins Hotel. Andrej hielt mich jedoch fest und deutete auf die regenschweren Wolken. »Wir lassen uns diesen Tag nicht vermiesen!«, brüllte er trotzig gegen den Sturm an. Eine Böe rupfte mir den Schal vom Hals. Geschickt fischte er das bunte Tuch aus der Luft und schüttelte triumphierend die Faust.
Der Rückblick bringt mich zum Lächeln. So war Andrej, die Liebe meines Lebens. Stets kämpferisch und optimistisch, mein Halt zu jeder Zeit. Ohne ihn hat die Welt ihre Farbe verloren. Der berückende Anblick des blauen Himmels und der funkelnden Winterpracht prallt von meinem einsamen Herzen ab wie von einem Eisklumpen. Ich fühle mich allein und vom Frost zu einer reglosen Statue gefroren.
Wir teilten fast unser ganzes Leben, ein glückliches, wenn auch kein leichtes. Im letzten Jahr feierten wir goldene Hochzeit. Während des Abendessens meinte er: »Schatz, du hast da einen Fleck auf der Bluse!« Als ich nach unten blickte, schnippte er mir gegen die Nasenspitze und grinste spitzbübisch.
Er brachte mich stets zum Lachen, egal was uns widerfuhr.
Krampfhaft wische ich mir übers Gesicht und nähere mich der Steilküste weiter. Dort lockt der Strand, tief genug … Die Höhenangst weicht der Sehnsucht.
Du fehlst mir so!
Nieselregen setzt ein, vermischt sich mit winzigen Eiskristallen. Kühl netzen sie meine Wangen und sinken lautlos zu Boden. Ich trete von einem Bein aufs andere, lausche dem Rascheln des herabgefallenen gefrorenen Laubes unter den Stiefelsohlen und beobachte das sachte Flockenspiel. Wassertröpfchen reflektieren das Sonnenlicht und zaubern einen bunten Farbenreigen in die Luft.
Fasziniert verfolge ich, wie ein Regenbogen an Pracht gewinnt, sich über den Himmel spannt und dabei an eine Brücke erinnert.
»Ein Wunder!«, höre ich eine Stimme hinter mir und fahre herum.
Ein seltsam gekleideter Mann steht einige Schritte entfernt. Auf dem Kopf trägt er eine Mitra, in der Hand führt er einen Krummstab wie der Heilige Nikolaus. Unter dem schlohweißen Bart gewahre ich ein Lächeln. Mein Herz setzt aus. Diese Augen! Sie lassen den Eispanzer, der mein Herz umklammert, aufbrechen.
»Komm vom Rand weg!« Eine weiß behandschuhte Hand streckt sich mir entgegen.
Vertrauensvoll versuche ich, sie zu ergreifen. »Bist du es wirklich?« Eiskristalle werden vom Wind aufgewirbelt und stechen mir in die Augen. Nur ganz kurz schließe ich die Lider.
Als ich sie wieder öffne, liegt die Welt hinter einem Tränenschleier verborgen. Was auch immer ich gesehen habe, es ist fort. Suchend schaue ich umher, finde weder Fußabdrücke noch sonst einen Hinweis auf die seltsame Erscheinung. Doch ich erinnere mich deutlich an die Forderung, von der Steilküste zurückzutreten. Gehorsam folge ich ihr. Mein Herz rattert immer noch wie die alte Nähmaschine von Singer, die ich noch benutze, obwohl sie inzwischen in die Jahre gekommen ist. Damit gleicht sie mir. Aus diesem Grund brachte ich es nicht über mich, sie gegen eine elektrische einzutauschen. Vielleicht sollte ich wieder zu nähen anfangen. Zum Beispiel ein Nikolaus-Kostüm. Brachte er nicht immer Geschenke? Heute ist der 6. Dezember, und mir scheint es, als hätte der Heilige Nikolaus mich reich bedacht. Seine Gabe an mich war Hoffnung.
Erneut schaue ich über die Ostsee und atme tief ein. Mir ist, als könnte ich Andrejs Nähe spüren. Eine aufkommende Brise spielt mit meinem offenen Haar. Ganz so, wie er es häufig tat.
»Ein Wunder«, wiederhole ich seine Worte und glaube, eine Antwort zu hören. »Das Leben ist ein Wunder!«
Der Wind wird stärker und trägt einen nur allzu vertrauten Duft heran. Trotz des kalten Wetters wird mir heiß. Ich kann meinen Mann riechen, als stünde er direkt hinter mir. Beinah spüre ich den geliebten Körper, die haltgebende Umarmung. Wie konnte ich je an seinem Versprechen zweifeln?
»Wohin ich auch gehe«, sagte er, »ich werde bei dir sein! Wenn du an mich denkst, wirst du meine Gegenwart fühlen. Es endet nicht mit dem Tod. Unsere Seelen sind auf ewig verbunden – und sie finden stets zueinander.«
Ich bin nicht gläubig, doch ist dies nicht eine besondere Zeit? Andrej ist noch bei mir, tief eingepflanzt in mein Inneres wie ein zweites Herz. Und er will nicht, dass ich den nächsten Schritt gehe. Irgendwo am Ende des Regenbogens wartet er auf mich, das weiß ich mit Gewissheit. Jener leuchtet in voller Pracht und bringt mich zum Lächeln. Er überbrückt die Entfernung zwischen meinem Liebsten und mir, vermag meinen Leib zwar nicht zu tragen, wohl aber unsere Liebe.
Ein letztes Mal blicke ich in die Tiefe. Sie hat ihren Reiz verloren.
Mit neuem Mut trete ich vollends von der Steilküste zurück und banne den Anblick dabei auf meine innere Leinwand. Leuchtende Farben, die das Meer berühren und sich darin spiegeln, eine Regenbogenbrücke direkt in den Himmel. Ganz am Ende sehe ich jemanden in einem goldenen Gewand und mit einer spitz nach oben auslaufenden Kopfbedeckung. Ausgerechnet als Nikolaus? Aber man muss die Wunder nehmen, wie sie kommen.
Auf dem Heimweg suche ich bereits nach den passenden Worten, um davon zu erzählen. Mir wird klar, warum ich herkommen musste und was mich nach Hause begleiten wird. Die Hoffnung, die mir hier geschenkt wurde, will ich weitergeben und möchte von diesem magischen Moment berichten.
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Charakter:
gut verständlich – erst mutlos, dann hoffnungsvoll
Inhalt:
sich selbst finden und annehmen
Lesezeit:
10 Minuten
Ulrike Krug
Stadt der Liebe
Ich bin nach Paris gekommen, um zu studieren. Politik und Geschichte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlich – nun ja. Außerdem bin ich hier, um möglichst weit von zu Hause weg zu sein.
Zuhause, das ist ein winziges Dorf im Süden, weitab von der nächsten Großstadt. Im Sommer duftet es dort nach Lavendel, der auf riesigen Feldern rundherum wächst. Die Häuser sind aus hellem Sandstein, auf den Straßen findet man noch überall Kopfsteinpflaster. Jeder kennt jeden – und jeder redet über jeden. Besonders gern redet man über mich: älteste Tochter des Pfarrers; gescheit, war auf der höheren Schule. Trägt aber die Haare zu kurz, läuft immer in Hosen herum. Sie interessiert sich nicht für den Haushalt, hat keine Ahnung von guter Küche, sie redet zu laut, sitzt nie anständig. Kommt nicht mit den anderen Mädchen aus der Gemeinde zurecht. Gibt Widerworte.
Meine Vermieterin im Quartier Latin ist eine ältere Dame. Ihr gehört ein kleines Zweifamilienhaus nicht weit von der Sorbonne entfernt. »Das hier ist ein anständiges Haus«, sagt sie bei der Schlüsselübergabe. »Keine Partys, keine Drogen. Und nachts ist Ruhe.«
»Ist mir ganz recht«, antworte ich. Ruhe will ich auch haben.
Die ersten Wochen sind hart. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie in einer so gewaltigen Stadt gewesen. Ja, Paris ist wunderschön und voller Geschichte, eine öffentlich begehbare Schatzkammer, an jeder Ecke ein neues Kunstwerk. Trotzdem fühle ich mich überwältigt. Der Lärm juckt in meinen Ohren. Die Luft ist so voller Abgase, dass ich kaum atmen kann. Wenn ich das Haus verlasse, ziehe ich mir die Kapuze meines Pullovers tief in die Stirn. Die Menschenmengen in der Metro, die endlosen gekachelten Gänge sind nur mit Kopfhörern zu ertragen, Heavy Metal bis zum Anschlag. Nur gegen die Gerüche – Schweiß, Knoblauch, intensive Parfums – habe ich noch kein Gegenmittel gefunden.
Die Universität ist ein Labyrinth; sie erinnert mich an ein altrömisches Graffiti, das in meinem alten Latein-Lehrbuch abgedruckt war. Hic habitat Minotaurus hatte ein Witzbold an die übertrieben gewaltige Villa eines Kaufmanns geschrieben. Ich lächle, wäre aber nicht überrascht, wenn in den Kellern unter meinem Institut tatsächlich der Minotaurus hauste.
Einige Wochen später liege ich auf meinem Bett. Mit Kopfhörern auf den Ohren bin ich in ein Buch über Napoleons Feldzüge vertieft. Die Worte machen keinen Sinn. Ich blättere, gehe wieder zurück, nur um drei Zeilen weiter festzustellen, dass immer noch kein Wort des Textes in meinem Gehirn angekommen ist. Die Buchstaben beginnen zu verschwimmen. Mir wird kalt, trotz der Decke um meine Schultern. Etwas tropft auf das Papier vor mir. Ich begreife, dass ich weine und verstehe nicht, warum.
Ich bin in Paris, der Stadt meiner Träume seit frühester Kindheit, und studiere Geschichte, wie ich es immer wollte. Ich bin weg von … von … von all den Menschen, die ich verabscheue, und die mich verabscheuen. Und trotzdem fühle ich mich elend.
Ich will es verdammt noch mal nicht zugeben, aber ja – ich habe Heimweh. Und ich bin einsam.
Wütend pfeffere ich das Buch vom Bett, schnappe mir meinen Lieblings-Hoodie, schwarz, mit dem Logo meiner Lieblingsband, schlüpfe in meine Schuhe und gehe hinaus. Die Tür knallt angenehm laut ins Schloss.
Draußen fegt nass-kalter Wind zwischen den Häusern hindurch und nimmt die letzten Blätter von den Bäumen mit. Es ist schon dunkel. Die antiken Laternen malen Kegel, in denen Nieselregen tanzt. Ich ziehe mir die Kapuze über den Kopf, vergrabe die Hände in den Taschen und stapfe los. Ein Ziel habe ich nicht, nur das Bedürfnis, mich zu bewegen.
Die Kälte tut gut, trotzdem gibt mein Kopf keine Ruhe. Dass mich Paris nicht mit Liveband und Feuerwerk begrüßen würde, war mir klar – zumindest meinem rationalen Teil. Aber dass es so hart werden würde? Ich fühle mich verloren, ganz allein in einer kalten und chaotischen und anonymen Millionenstadt. Stadt der Liebe, am A…
Irgendwann verliere ich das Gefühl für Zeit und Ort. Ich bin immer noch im Quartier Latin, soviel weiß ich, doch in diesem Abschnitt war ich noch nie. Ich sehe mich um. Trotz Kälte und Nieselregens sind viele junge Leute unterwegs. Es gibt kleine Geschäfte, Bars und Cafés. Als ich um eine Ecke biege, liegt die Seine vor mir, auf der anderen Seite streckt sich der Turm von Notre Dame in den taubengrauen Himmel. Inzwischen spüre ich meine Hände nicht mehr; der Regen ist längst durch den Stoff meines Pullis gezogen.
Einige Schritte weiter komme ich an einer Bar vorbei. Die Musik ist nett, wenn auch nicht ganz meine Richtung. Ich will vorbeigehen, mich auf die Suche nach der nächsten Metro-Station machen, um nach Hause zu kommen. Einige Leute stehen auf dem Gehweg, unterhalten sich und lachen. Etwas lässt mich genauer hinsehen, irritiert mich.
Alle Gäste sind Frauen.
Nicht alle sehen feminin aus, deshalb fällt es nicht sofort auf. Jetzt bemerke ich auch die Regenbogenflagge an der Innenseite der geöffneten Tür. Ich zögere.
Die Frauen auf dem Gehweg bemerken mich. Eine von ihnen, groß und sehr kurzhaarig, vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich, grinst mich an. »Kalt heute?«
»Mhm.« Mir fällt keine gute Antwort ein.
»Drinnen ist es warm. Wir beißen auch nicht. Außer – du weißt schon.«
Ich lache über den alten Witz, zögere aber noch. Wenn meine Familie mich jetzt sehen würde …
Sollen sie doch, sagt eine Stimme in meinem Hinterkopf. Im nächsten Moment tragen mich meine Füße über die Türschwelle.
Drinnen ist es warm. Ich fühle, wie meine Hände zu glühen beginnen. Auch das Licht ist warm. Die Wände sind mit dunklem Holz getäfelt, die Tische, Stühle und Tresen sind aus demselben Holz und sehen auf gemütliche Art alt aus. Meine Schultern entkrampfen sich, als ich, ein bisschen kurzsichtig, auf die mit Kreide geschriebene Getränkekarte über der Bar spähe.
Drei Minuten später mache ich mich mit einer Flasche Bier-Limo-Mix auf die Suche nach einem Sitzplatz. Mein Blick bleibt an einer jungen Frau hängen, die ganz außen am Tresen sitzt. Sie sieht auf, unsere Blicke treffen sich. Mir fällt beinahe die Flasche aus der Hand. Sie blinzelt, wirkt ebenso überrascht.
»Madeleine?«, fragt sie. »Was zur … Was machst du in Paris?« Sie hüpft von ihrem Barhocker und umarmt mich, kurz, aber fest. Dann hält sie mich auf Armeslänge von sich, die Hände noch auf meinen Schultern, und mustert mich. Sie ist noch so kräftig, wie ich sie in Erinnerung habe, mit starken Armen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben ihre Eltern einen Bauernhof. Die dunkelbraunen Haare fallen ihr fransig in die Stirn, die grauen Augen strahlen.
»Delfíne«, sage ich. »Schätze, ich könnte dich dasselbe fragen.«
Sie lacht, lässt mich los und deutet auf den Barhocker neben ihrem. »Studium?«
Ich nicke. »Politik und Geschichte. Und du?«
»Soziologie, im dritten Jahr.« Sie prostet mir zu. »Und, wie gefällt dir Paris? Ein ziemlicher Schock, oder?« Delfíne ist zwei Dörfer von mir entfernt aufgewachsen, wir kennen uns aus der Schule. Sie war die coole Große, zu der ich aufgeschaut habe; mir war bis eben nicht einmal klar, dass sie meinen Namen kennt. Nach ihrem Abschluss, zwei Jahre vor meinem, habe ich sie nie wiedergesehen.
»Ein riesiger Schock. Es ist …« Mir fehlen die Worte. Und dann beginnen meine Augen zu brennen, ich schaue zur Decke und blinzle hektisch gegen die Tränen an. Vergeblich. Die Gefühle sind zu viel für mich. Meine Fingernägel bohren sich in die Handflächen, während mir die Tränen über das Gesicht laufen. Gleichzeitig fühle ich, wie ich auf meinem Barhocker zusammenschrumpfe. Am liebsten würde ich zwischen den Bodendielen verschwinden.
Eine warme Hand legt sich auf meine Schulter, eine Papierserviette taucht auf dem Tresen vor mir auf. Als ich aufschaue, sehe ich ein warmes Lächeln in Delfínes Gesicht. Ich wische mir mit der Serviette über die Augen und schnaufe: »Tut mir leid. Das ist – so peinlich.«
Sie lacht. »Kein bisschen. Mir ging es genauso.« Sie erzählt, wie sie vor zwei Jahren hier angekommen ist. Auch sie kannte hier niemanden, das Studentenwohnheim war eine einzige Katastrophe, und obendrein fing sie sich eine Viruserkrankung ein, die sie für fast zwei Monate außer Gefecht setzte. »Es wird besser, Madeleine. Wir sind hier frei, niemand verurteilt uns. Sobald dir das klar wird, kannst du lernen, das Leben hier zu genießen.«
Es dauert eine Weile, doch dann wird es besser. Irgendwann ist die Vorweihnachtszeit da, und die Stadt verwandelt sich in ein Meer aus glitzernden Lichtern. Delfíne zeigt mir die Orte, die sie für sich entdeckt hat: Parks, Museen, Paläste, Bars. Die Ereignisse, von denen ich im Studium lerne, werden lebendig, als sie mit mir die Place de la Bastille besichtigt, die Schlösser von Versailles, den Invalidendom.
Mit ihr neben mir fühle ich mich mutig. Sie steuert so geschickt durch die Stadt, als wäre sie hier zur Welt gekommen. Es ist egal, wenn niemand grüßt. Und niemand schaut hin, als sie zum ersten Mal meine Hand hält.
Zwei Tage vor Weihnachten besuchen wir den Eiffelturm. Der Nieselregen hat sich in leichten Schneefall verwandelt, als wir zur Spitze hochfahren, gegen den Wind in dicke Wollschals gewickelt. Die Aussicht ist unglaublich. Das leuchtende Netz der Straßen zieht sich bis hinter den Horizont. Unter uns schimmern die Champs du Mars in festlicher Beleuchtung. Delfíne lehnt sich an meine Schulter und lächelt. Sie nimmt meine Hände in ihre, sie sind warm und fest, genau wie ihr Blick. Und dann küsst sie mich.
Meine Beine werden weich. Ich halte mich an ihren Schultern fest, während ich den Kuss erwidere. Es ist wunderschön, aufregend. Zum ersten Mal im Leben verstehe ich, warum Menschen von Schmetterlingen im Bauch sprechen. Es fühlt sich richtig an, die logische Konsequenz von allem, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Ich halte den Moment in mir fest, möchte mich später an jede Einzelheit erinnern können.
Lange stehen wir hier oben, umarmen uns und genießen die Nähe der jeweils anderen. Und niemand schaut. Niemand verurteilt uns.
Die Stadt der Liebe hat gewonnen.
[zurück zum Inhaltsverzeichnis]
Charakter:
gut verständlich – heiter
Inhalt:
Treffen eines Doubles vom Traummann
Lesezeit:
10 Minuten
Renate Müller
Ich war noch niemals in New York
Der Mann im Abteil schaut verblüfft von seiner Lektüre auf, als ich eintrete. Der Mann im Abteil sieht aus wie – George Clooney!
Ich werde knallrot. Gott, wie peinlich.
»Entschuldigung. Ich wollte nicht …« Ich bringe kaum ein Wort raus.
Da lächelt er mich an. George Clooney lächelt und die Welt wird schöner.
Mein Puls beschleunigt sich um den Faktor 10. Die Luft im Abteil wird plötzlich knapp. Meine Umhängetasche rutscht mir von der Schulter, die Zeitschrift, die Bernhard für mich am Bahnhof gekauft hat, fällt mir aus den Händen. Und zu allem Überfluss fährt der Zug nun mit einem Ruck an und ich lande – auf dem Schoß von George Clooney.
Wo ist das nächste Mauseloch?
Ich weiß nicht, wohin ich schauen soll, und verstecke mein Gesicht hinter meinen Händen.
George Clooney bewegt sich. »Es ist mir zwar eine große Ehre, als Ihr Sitzkissen zu dienen, aber meinen Sie nicht, wir hätten es beide auf getrennten Sitzen bequemer?«
Ich schieße von seinem Schoß und lasse mich auf die gegenüberliegende Bank fallen. Japse: »Entschuldigung. Bitte entschuldigen Sie.« Zu mehr reicht mein Atem nicht. Vor Scham bricht mir der Schweiß aus allen Poren, mein Gesicht glüht wie eine 200-Watt-Birne.
Dabei wäre Verdunkelung jetzt vorteilhafter für mich. Oder ein Ganzkörperschleier. Ich sitze mit George Clooney bzw. seinem jüngeren Double im Abteil. Und meine Augenbrauen sind nicht gezupft, meine Beine nicht rasiert und meine Fußnägel nicht lackiert. Ich verstecke die Unlackierten unter der Sitzbank und versuche, meinen form- und farblosen Rock über die Unrasierten zu ziehen.
Meine Fußnägel biegen sich nach oben, als mir klar wird, wie ich aussehe. Meine Brille war im vorigen Jahrhundert modern, meine Jacke noch 100 Jahre früher und meine Bluse … Reden wir nicht drüber.
George hebt den Blick von seiner Zeitschrift und lächelt mich an. Ehrlich! Er fragt: »Vielleicht darf ich mich erst mal vorstellen? Ich heiße Georg Clunert.«
Das glaub ich jetzt nicht.
»Ich bin Elli Furcht. Äh Frucht. Frucht. Eleonore Frucht. Das ist mein Name.«
»Das ist doch mal ein gesunder Name«, erwidert George und zwinkert.
Sein Zwinkern bringt meine Haut zum Kribbeln. In meinem Magen schlägt irgendetwas Purzelbäume und mein Hirn stellt alle Funktionen ein.
Er fragt: »Und wohin fahren Sie?«
»Nach Flugfurt zum Frankhafen.«
»Nach … zum …?« George zieht die Augenbrauen hoch und legt seinen Kopf schief. »Sind Sie sicher?«
Natürlich bin ich sicher, ich weiß doch, wohin ich fahre. Oder etwa nicht? Warum glauben Männer, Frauen wüssten nicht, was sie reden? Oder tun.
Da heult ein schriller Sirenenton durchs Abteil, so plötzlich und so laut, dass ich alles von mir werfe, mir die Ohren zuhalte und auf die Sitzbank hüpfe. Leider habe ich jetzt keine Hand mehr frei, um mich festzuhalten und falle deswegen prompt wieder runter und lande – auf Georges Schoß. Derweil jault die Sirene immer weiter.
»Da… …om… I… …sche.« Erst, als er es wiederholt, verstehe ich, was er sagt: »Das kommt aus Ihrer Tasche.«
Aus meiner Tasche? Ich schüttele den Kopf und klammere mich an Georges Hemdbrust. Den verlässt seine Höflichkeit, er schubst mich von seinen Knien, hebt meine Tasche auf und greift hinein. In dem Moment, als er die Sirene herauszieht, wird mir klar, woher der Alarm kommt.
»Den Taschenalarm hat mein Bruder mir aufgezwungen, Bernhard. Wenn ich in Gefahr geriete, müsse ich sofort an dem Ring ziehen und den Alarm auslösen. Der würde jeden Schurken vertreiben.«
George hört mir fasziniert zu. »Nicht nur die Schurken«, meint er. »Reisen mit Ihnen ist jedenfalls nicht langweilig.« Er grinst mich an, als hätte ich ihm ein lang ersehntes Geschenk gemacht.
Mir wird heiß, ich muss sofort das Fenster öffnen. Hektisch springe ich auf, bleibe mit dem Fuß in meiner Tasche hängen, stolpere, drehe mich um meine Achse und – finde mich in Georges Armen wieder. Er hält mich fest. Sehr fest. Ich möchte eigentlich nicht, dass er mich wieder loslässt. Tut er auch nicht, er schaut mir stattdessen in die Augen und lächelt.
Er hat sogar die gleiche Augenfarbe. Tiefbraun. So dunkel wie Bitterschokolade. Und ein winziges Fältchen unter seinem Zwinkerauge.
Ich kralle meine Finger in seine Jacke.
Meine Knie sind aus Gelee, mein Herz schlägt alle Geschwindigkeitsrekorde und ich kann mich nicht entscheiden: Möchte ich im Erdboden versinken oder lieber noch ein bisschen in seinen Armen bleiben?
Er riecht gut. Er riecht, wie frau sich vorstellt, dass Georg Clooney riechen muss. Nach Mann und Abenteuer. Bernhard riecht nach Apfelshampoo und 3-Wetter-Taft. Solide und haltbar.
George stellt mich ganz vorsichtig auf die Füße, hilft mir, mein Hab und Gut, das im ganzen Abteil verstreut ist, zusammenzusuchen und setzt sich erst, als auch ich wieder fest auf meinem Platz installiert bin.
Ganz langsam normalisieren sich mein Puls und mein Atem. Auch ohne ihn anzusehen, spüre ich, dass George mich beobachtet. Wahrscheinlich fürchtet er, dass ich gleich wieder durchdrehe.
»Wissen Sie, dass George Clooney einen eigenen Asteroiden hat?«, platze ich heraus.
»Einen eigenen Asteroiden?«, wiederholt George. »Und was tut er damit?« Er zwinkert dabei (schon wieder, immer mit dem linken Auge – es sieht schrecklich nett aus).
»Na, eigentlich hat er ihn nicht. Der Asteroid ist bloß nach ihm benannt. Das muss doch ein schönes Gefühl sein, zu wissen, dass dort oben ein Asteroid rum saust, der so heißt wie man selbst«, sage ich.
»Hätten Sie gerne einen Frucht-Stern, Frau Frucht?« George kann sein Lachen kaum verbergen.
Ich muss selbst lachen. »Warum nicht, wenn er wie eine Erdbeere aussieht.« Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn schon ewig kennen.
»Wohin waren Sie noch mal unterwegs, sagten Sie?«
Ich konzentriere mich auf die Beherrschung meiner Sprechmuskeln und schaffe es tatsächlich, ihm in ganzen deutschen Sätzen zu antworten: »Ja, also, das ist so. Ich habe eine Reise gewonnen. Einen Flug nach New York und drei Übernachtungen. Können Sie sich das vorstellen?«
George nickt. Leider zwinkert er jetzt nicht, sein Zwinkern gefällt mir ziemlich gut.
»Wo oder wie haben Sie diese Reise denn gewonnen? In einem Wettbewerb?«
»Nein, bei einem Preisausschreiben. Stellen Sie sich das vor. Ich mache nämlich jedes Preisausschreiben mit, das ich irgendwo sehe. Schon seit Jahren. Aber außer einer Flasche Sebamed Duschgel und einem Jahresvorrat an Schnürsenkeln habe ich bisher noch nie etwas gewonnen. Und jetzt das. Diese Reise. Na ja, nur den Flug und das Hotel. Bis zum Flughafen muss ich allein kommen.« Ich kann die Stopptaste für meinen Mund nicht finden und quassele immer weiter: »Und ich war nämlich noch nie irgendwo. Und schon gar niemals in New York.«
George schafft es, mich zu unterbrechen: »Da ergeht es Ihnen ja wie Udo Jürgens«, meint er. Netterweise zwinkert er wieder.
Ich kann ihm erst nicht folgen, doch dann fällt der Euro centweise. »Ja, wie in dem Lied, nicht wahr?« Ich summe die Melodie, und George stimmt ein. Es klingt vielleicht nicht wirklich wie Udo, aber es macht fröhlich. Und beruhigt.
Die Abteiltür geht auf, der Schaffner schaut herein.
»Guten Tag, jemand zugestiegen? Die Fahrkarten bitte.«
Oh Gott, wo habe ich meine Fahrkarte? Vorhin hatte ich sie noch, wo habe ich sie bloß hingesteckt? Mein Herz rast wie ein Ferrari unter Michael Schumacher, während George mich beobachtet und wahrscheinlich die Schweißtropfen auf meiner Stirn zählt.
»Ich habe eine, ganz gewiss habe ich eine. Das glauben Sie mir doch«, beginne ich mit dem Kontrolleur zu verhandeln, während ich immer tiefer in meiner Tasche wühle. Durch den Sturz vorhin ist alles darin völlig durcheinandergewirbelt worden, und ich kann die Fahrkarte einfach nicht finden.