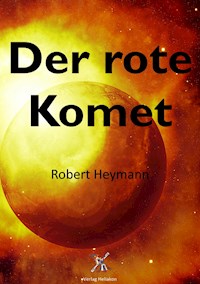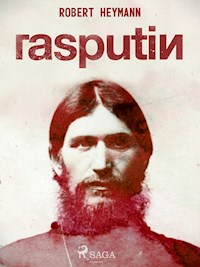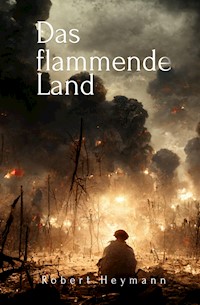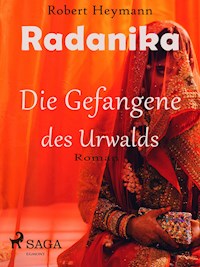Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Todesahnung! Es kommt so . . . ganz plötzlich. Eine dunkle Hand, die über die Stirn streicht . . . und die Mutter geht langsam und müde nach dem Friedhof und legt einen Strauß weißer Nelken auf das baldige Grab ihres Sohnes. Die Mutter sah das Bild voraus… Die Tore der Läden wurden mit Beilen und Äxten eingeschlagen. Hier warfen sie den Inhalt eines Seidenlagers auf die Straße in den Schmutz, zerrten es herum, sprangen darauf. Dort rollten sie Branntweinfässer heran, zapften sie an und soffen sich voll, bis sie besinnungslos wurden wie die Tiere und mit dem Messer hinstachen, wo es eben traf — in die Luft, in die Brust ihrer eigenen Kameraden. Die einzelnen Angstschreie schwollen an zu einem einzigen Ruf des Entsetzens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesegnete Waffen
Fortsetzung des Kriegsromans
„Das flammende Land“
von
Robert Heymann
_______
Erstmals erschienen im:
Verlag von Paul List,
Leipzig, 1915
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2018 Klarwelt-Verlag, Leipzig
ISBN: 978-3-96559-119-6
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Zur Einführung
Parallele:
Einleitung
1. Kapitel.
2. Kapitel.
3. Kapitel.
4. Kapitel.
5. Kapitel.
6. Kapitel.
7. Kapitel.
8. Kapitel.
9. Kapitel
10. Kapitel.
11. Kapitel.
12. Kapitel
13. Kapitel.
14. Kapitel.
15. Kapitel.
16. Kapitel.
17. Kapitel.
Zur Einführung
Als in den schwülen Augusttagen 1914 der europäische Sturm losbrach, weilte ich an den mecklenburgischen Seen. Ich erlebte das erst bedächtige, dann ungestüme kriegerische Erwachen der Seele einer kleinen Stadt. Ich eilte nach Berlin und wurde Zeuge der unvergesslichen, historischen Nachtstunden unter dem Kaiserlichen Schloss. Sah die feldgrauen Legionen die Linden entlang durchs Brandenburger Tor rücken, mit leuchtenden Augen. Rosen glühten auf den Waffen, die der helle Glaube und die gottergebene Zuversicht einer Nation gesegnet hatte. Unter den Rossen der Dragoner lagen die roten Nelken wie ein Teppich. Blonde Mädchen liefen nebenher, Väter und Mütter standen zu beiden Seiten der Straßen. „Kehrt wieder“, stammelten die Lippen — blühende und welke. Ich erlebte das tiefe Atemholen eines Volkes, das von einer feindlichen Welt umstellt war. Eingekeilt von Raubstaaten, aufgeteilt bereits von der frivolen Siegessicherheit erdrückender Übermacht. Und dann brach der Sturm los. In Automobilen jagten die ersten Soldaten nach Belgien. Lüttich, Namur, Maubeuge, Metz, Antwerpen! Heilige Tote zeichneten tausendfach den Weg des Sieges. Die Opferschalen der Nation neigten sich, rot von köstlichem Blut. Heilig war der Rausch der Liebe, der Alle ergriff, dreifach heilig: Liebe zur deutschen Erde. Heilig die Treue, die Alle einte. Es war mir nicht vergönnt, unter den Ersten den Marathonlauf der deutschen Waffen mitzumachen. Aber das gewaltige Erleben ließ mich nicht los. Tag und Nacht kochte es im Blut. Da schuf ich, aus dem impulsiven Erleben des flutenden Nachrichtenstromes schöpfend, das „Flammende Land“. Dachte weder an Fortsetzung des Buches noch an endlose Fortdauer der Schlachten, die um Deutschlands Grenzen tobten. Aber der Krieg zog weiter. Weltenweit flammten die Fackeln der Brände und des Jammers. Stampfend zog der Krieg durch Nordfrankreich und Polen. Hinter ihm eggte schon der deutsche Pflug . . . Wieder wurde es Kriegssommer. Gold gab die Erde für Eisen, goldene Ähren. England knirschte. Der Abruzzenräuber schlug mit Eisenfäusten gegen Tiroler Steinwände, in denen habsburgische Adler nisten. Kreuz und Halbmond stehen für westeuropäische Kultur gegen die Pestfahnen des finsteren Mittelalters. — Da gab ich dem Impuls nach und schuf, dem Wunsche meines Verlegers folgend, die Fortsetzung zu dem „Flammenden Land“. Der Erfolg dieses Romanes beim Publikum, die warme Anerkennung der Presse rechtfertigten das kühne Unternehmen. Denn schier unmöglich schien es, den gigantischen Stoff künstlerisch umzuwerten. Und nur ein Versuch kann die Tat genannt werden, die Nibelungenmär dieser Zeit im Rahmen eines Romanes zu binden. Nur Relief durfte die neue Weltgeschichte bleiben. Und so habe ich versucht, den Charakter der Zeit in romantischer Handlung festzuhalten, dem Siegesflattern deutscher Fahnen von Antwerpen bis zu den Karpaten dichterisch gestaltend zu folgen. Sollten mir Irrtümer, Fehler unterlaufen sein, so bitte ich Leser und sachverständige Kritiker um Nachsicht. Ist mir aber dies eine gelungen: Noch in später Zeit ein Echo dieses Weltbebens zu wecken, so will ich mit dem ehrlichen Versuche, das deutsche Buch des deutschen Krieges geschrieben zu haben, zufrieden sein.
Robert Heymann.
Berlin, August 1915.
Parallele:
Seit der Liga von Cambrai gibt es kein Beispiel einer Verschwörung gleich jener, die das saubere Triumvirat gegen mich geschlossen hat. Es ist abscheulich und verstößt gegen Menschlichkeit und gute Sitten. Hat man je erlebt, dass drei mächtige Fürsten unter einer Decke stecken, um einen vierten zu vernichten, der ihnen nichts getan hat? . . . Wenn in der bürgerlichen Gesellschaft drei Leute es sich beikommen ließen, ihren lieben Nachbarn auszurauben, so würde das Gericht ihnen einen gehörigen Denkzettel geben. Wie! Herrscher, die in ihren Staaten die Anwendung eben dieser Gesetze überwachen, geben ihren Untertanen ein so abscheuliches Beispiel! Wie! Sie, die die Gesetzgeber der Welt sein sollten, werden durch ihr Beispiel zu Lehrmeistern des Verbrechens? O tempora, o mores! Es ist wahrhaftig ebenso gut, unter Tigern, Leoparden und Luchsen zu leben, als in einem Zeitalter, das für hochgebildet gilt, unter diesen Mördern Räubern, und Schurken, die über die arme Welt herrschen
Friedrich der Große an die Markgräfin von Bayreuth.
Einleitung
Es wirbeln Trommeln schwer und dumpf.
Millionen Menschen schreiten stumpf
Zur Ernte der verfluchten Saat
Des Väterchens in Petrograd.
Sie gehen, ohne aufzuschau‘n,
Sie holen ein mit Grimm und Grau‘n
Die Erntewagen, hoch und schwer,
Und zieh‘n sie durch ein stilles Meer.
Die Menschengarben liegen dicht,
Gestorben ist das letzte Licht.
Das Meer, das Meer ist blutig rot,
Der Garbenführer ist der Tod!
Der Tod! — Nun steht er stolz und stumm
Und präsentiert die Sense krumm:
„Hast gut gedüngt, mein edler Zar!
Wie schwarzer Raben dunkle Schaar
So schossen deine Garben auf,
Blutrot, mit großen Körnern drauf.
Die Körner treiben Blüten jetzt,
Ich hab' mein Zeichen d‘rein gesetzt,
Und schnitt — und schnitt. Die Zeit ist gut!
Der Satan lacht. — Wir scheffeln Blut!“
Der Zar, der nur ganz selten lacht,
Der Zar hat sein Honneur gemacht.
Ihm bleibt in dieser Zeit der Not
Der größte General: Der Tod!“
1. Kapitel.
Die Gumppendorferstraße trug noch ihr altes Gesicht, als der Oberleutnant Jesco von Sandern langsam die Häuserreihe hinaufging, die Nummern abzählend:
„. . 27 . . 31 . . 35 . . hier ist es!“ Schnell sprang er die drei Treppen empor und klingelte. An dem Schilde stand:
Johannes Niedermeier, Kaufmann.
Eine junge Dame öffnete. Einige Sekunden betrachtete der deutsche Offizier prüfend das hübsche Gesicht.
„Ich bin doch hier recht, gnädiges Fräulein? Mein Freund, der Herr Rittmeister Januschek . . .“
„Ach, das ist lieb von Ihnen“, rief das Fräulein in einem angenehmen Wiener Dialekt. „Rudi, komm schnell her, der Herr Oberleutnant ist da!“
Aus dem halbdunklen Hintergrund löste sich eine aufgeschossene Gestalt.
Es war offenbar Rudi. In Uniform natürlich — denn wer trug in dieser Zeit, wo die Welt in Waffen klirrte, keine Uniform? — mit roten Pluderhosen und die schmale, rote Reitermütze schief am Kopf.
Nun salutierte er.
„Kommen Sie doch gleich herein, Herr Oberleutnant. Der Herr Rittmeister wird sich in wenig Augenblicken sehen lassen. Sie bleiben lange in Wien? Sind Sie hierherkommandiert? Ach, Sie müssen sich jetzt unsere Stadt anschau’n, Herr Oberleutnant! Nicht wiederzukennen, sag’ ich Ihnen!“
Jesco von Sandern kam gar nicht zum Sprechen. Dieser Rudi hatte ein Temperament — nicht zu zügeln! Und dabei blitzten seine schwarzen Augen, und jede Muskel an dem elastischen, schlanken Körper spielte mit, wenn er redete. . .
„Was trinken Sie denn, Herr Oberleutnant? Anny, mach’ doch schon — wir haben einen Wein — ich kann Ihnen sagen, Herr Oberleutnant, ein Weinerl. . .“
Mit dem Weinerl kam die Mutter der beiden Geschwister, Frau Niedermeier, die seit dem Tode des Mannes, der in Bosnien im Kampf gegen die Serben gefallen war, das große Geschäft in der Kärntnerstraße aufgegeben hatte. Das ungefähr wusste Jesco von der Familie. . . das und dass Januschek, der Rittmeister von den Dragonern, die schöne Anny „rein zum Auffressen lieb hatte“ — und deshalb musste der deutsche Offizier unbedingt auf seiner Reise über Wien hier vorbeikommen.
Er war ganz fremd da. Aber es kam ihm gar nicht so vor. Das schöne Mädchen kredenzte ihm den Wein. Anny hatte ein paar dunkle Augen, in denen bald der Scheint lachte, bald eine tiefe Schwermut brannte, ganz tief, als sei da ein heimliches Leid, von dem sie Niemanden verraten wollte. Und der Rudi brachte Backwerk und die alte Frau Niedermeier meinte, wenn der Herr Oberleutnant schon in Wien sei, müsste er doch unbedingt nach dem Prater hinausfahren. Das Kriegführen dürfe die Menschen nicht so verrohen, dass sie nicht einmal mehr Sinn für den Prater hätten . . .
Das meinte die immer noch hübsche Fünfzigjährige ernst, wenn auch um ihren roten Mund der Schalk lachte.
Und dann kam Januschek. Jesko hatte ihn auf der Berliner Kriegsschule kennen gelernt. Sie waren gute Freunde geworden. Und wie nun Jesko dem Rittmeister nach Wien geschrieben hatte, er komme auf der Reise nach Konstantinopel über die Donaustadt, da hatte er gleich eine Depesche erhalten: „Sprich bei Niedermeier, Gumppendorferstraße 35 vor, gleich nach Deiner Ankunft, ich komme hin.“
„Nun bin ich da. Ist es nicht schnell gegangen?“ rief er und lachte über sein schwarzbärtiges Gesicht. „Lass dich anschau’n, Kamerad! Forsch bist geworden. Also was ich sagen wollte: Ich hab’ Urrlaub gekriegt. Na, und was soll ich jetzt in Prag tun, nachdem sie mich hier in Wien kurriert haben? Ich bin nämlich bei der fünften Arrmee gestanden. Wir haben an der Save bei Waljewe gekämpft, da hab’ ich die Medaille bekommen. . . ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. „Mauzda“, hab’ ich meinem Kommandeur gesagt. Nächsten Tag kriegt’ ich drei Granatsplitter in den Rücken. Nicht, weil ich ausgerissen bin — na, das denkst du doch nicht, gelt? — sondern weil uns die Kunde in den Rücken kamen. Ich durch — und dann bin ich erst in Wien wieder aufgewacht, richtig wenigstens.
Was sollte ich in der Thomasku Alice, wo ich wohne? In Prag? Da wär ich wie ein Hund gestorben. Aber hierrr, das Mädel, das hat mich gesund gepflegt —“
Er wies auf Anny. Sie sagte schüchtern:
„Ich bin beim Roten Kreuz!“
Und dann der Januschek: „Jetzt weißt du alles. Die Familie kennst du ja nun. Da, der Rudi, der Kerrrl, war noch am Gymnasium und hat schnell die Prüfung gemacht. Jetzt geht er mit nach Warschau, als Freiwilliger. Hast unsere Deutschmeister ausziehen sehen? Heute ist ein Ersatzbataillon weg — und was machst also du?“
Sie saßen alle um einen runden Tisch. An den geblümten Tapeten hingen schlichte Familienbilder zwischen Lorbeer und Immergrün ein Porträt des alten Franz Joseph, daneben in unvergänglicher Jugendschönheit die Kaiserin, die in Genf einem Mordbuben zum Opfer fiel. Die Möbel waren alt, solid, gemütlich. Und durch die Fenster mit den gleichfalls geblümten Gardinen fiel die Spätherbstsonne und huschte über die Weingläser, um schließlich als verirrter, müder Strahl wie ein Stückchen Brokatstickerei in Annys Schoss zu ruhen.
Der Oberleutnant von den Ulanen hatte für das alles Sinn. Er antwortete deshalb nicht gleich und sah Anny an. Die blickte scheu vor den kohlschwarzen Augen des Rittmeisters zu Boden. Da wusste Jesco, dass der brave Januschek vergeblich warb, und da erinnerte er sich des tieftraurigen Leuchtens auf dem Grunde ihrer Augen.
„Prossin! Prossin!“ sagte der Rittmeister. „Ihr seid nun also alle wirklich ein einiges Volk?“ fragte Jesco. „Tschechen und Ungarn, Bosnier und Ruthenen und Österreicher?“
„Ja. Es gibt Ausnahmen, natürlich. Da oben an der galizisch russischen Grenze sind Fälle vorgekommen, die einfach eine Schmach sind, weißt du. Aber was da auch für Gesindel wohnt! An der serbischen Grenze hat es auch Zwischenfälle gegeben. Aber im Ganzen, Jesco, das ist ein herzerhebendes Gefühl: Ein einzig einig Volk von Brüdern! Schwarz-Gelb, Frrreund, ist nicht mehr österreichisch für uns, das ist deutsch, ja. Und alle Feindschaft und aller Hass sind begraben!“
Jesco nickte. Überall dasselbe klare Bild, wie im deutschen Reich, aus dem er kam, aus dem geschäftigen Berlin, das Maßregeln gegen Englands Aushungerungspolitik traf, wie man in Friedenszeiten irgend eine kommunale Angelegenheit erledigt, ohne Hast, ohne Parteihader, ohne Sorge, mit der ruhigen Geste der Selbstverständlichkeit.
Januschek hob das Glas:
„Auf dein Wohl — und wenn du mir nun nicht gleich sagst, warum du zu den Türken gehst — übrigens, die haben doch unsere oder vielmehr Eure zwei Kriegsschiffe „Göben“ und „Breslau“ gekauft, was? Und ich habe gehört, Ihr sollt das Gold waggonweise nach der Türkei schaffen? Die legen wohl los, was? Frrreund — Kreuz und Islam gegen die Unkultur und die Macht der Finsternis — das hätte Tolstoi noch erleben sollen! Aber warrrum bist du denn nun in Wien und willst gleich weiter nach Konstantinopel?“
Alle lachten.
„Na ja“, meinte Januschek. „Aus dem ist schwerrer etwas herauszukriegen wie von den Russen ein in Czernowitz gestohlener Silbertaler! Übrigens, Frrreund, weißt du schon? Wir marrrschieren in Czernowitz ein — morgen, übermorgen, nächste Woche — und ich will dabei sein. Morgen schon melde ich mich wieder, nachdem mich Fräulein Anny gesund gepflegt hat. . .“
Seine Stimme wurde plötzlich leise. Jesco sah jetzt erst, dass er sich noch schwer auf einen Stock stützte. Und es war ihm, als dringe unter der braunen Hautfarbe des Gesichts eine tiefe Blässe durch.
Doch das war schnell überwunden.
„Also weshalb bist Du nun in Wien?“ fragte Januschek unter dem erlösenden Lachen seiner Freunde zum zehnten Male, und jetzt endlich antwortete der Freund: „Das ist eine mysteriöse Geschichte. Aber da ich dir darüber geschrieben habe, so wirst du den Zusammenhang begreifen. Also ich hatte im Sommer oder besser schon im Herbst, als unsere Truppen von Czenstochau aus gegen die Weichsel vorrückten, um den linken Flügel der russischen Armee zu umfassen, ein merkwürdiges Abenteuer. Ich hatte eine Dame kennen gelernt, die sich als Gräfin ausgab und für die ich eine große Schwäche hatte. Ich muss es gestehn, obgleich ich mich später dessen schämte. Das Schloss gehörte dem alten Geschlecht der Grafen Sybieski. Durch Vermittlung eines russischen Obersten aus der gleichen Familie, der die Hand in allerhand Spionagegeschichten hat, hatte sich die falsche Gräfin, wie sich später herausstellte, das Schloss widerrechtlich für kurze Zeit angeeignet. Denn sie war in Wirklichkeit Türkin und — Spionin. Sie verriet uns — aber rechtzeitig deckte sie selber den Plan der Russen in einem an mich gerichteten Briefe auf. In diesem Briefe enthüllte sie mir auch das Geheimnis ihres Lebens: dass der eine der beiden Brüder Buxton sie zur Spionage erzogen hatte, nachdem er die Mutter verführt, und dass sie sich an England rächen wolle, indem sie — scheinbar — für England Spionage treibe, um es desto sicherer zu verderben. Sie floh damals nach Konstantinopel, und ich hatte die Affäre, die mich tief erschütterte, beinahe vergessen, als ich in den Generalstab nach Belgien befohlen wurde. Ich reiste hin. Man sagte mir dort, der damalige Kommandeur in Czenstochau habe über meine nahen Beziehungen zu einer Frau M. von S. berichtet. Von dieser Frau sei aus Konstantinopel ein Kurier eingetroffen, der sehr genaue und überraschende Enthüllungen über Geheimverträge zwischen Belgien und den Ententemächten machen konnte. Auf Grund des Berichtes der Frau M. v. S. ließ das deutsche Kommando in Brüssel Ende Oktober gewisse Geheimschränke aufbrechen und fand die unwiderleglichen Beweise und Dokumente dafür, dass der Dreiverband zusammen mit Belgien den Neutralitätsbruch längst vorbereitet hatte und seit Jahren gemeinsame Spionage gegen Deutschland trieb.
Es lag jetzt klar zu Tage, dass Frau M. v. S., die uns so viel Schaden zugefügt hatte, entschlossen war, alle von England erlangten Geheimnisse an uns zu verraten, dass sie an dem Vernichtungswerke gegen die verschlagenste Nation des Erdballes mitarbeiten wollte. Ihr Aufenthalt in der Türkei kann nun für uns von unschätzbarer Wichtigkeit sein, denn sie ist in alle Schliche der internationalen Spionage eingeweiht. Sie hält Fäden in der Hand, von deren Existenz sich die manchmal recht bedenkliche Naivität unserer Diplomatie nie etwas hat träumen lassen, und die deutsche Regierung ist entschlossen, sie mit einer bestimmten Geheimmission zu betrauen. Ihr die Einzelheiten derselben zu übertragen, bin ich ausersehen, gleichzeitig, um den leitenden Persönlichkeiten des osmanischen Reiches persönlich anzukündigen, dass von der Goltz Pascha demnächst wieder nach Konstantinopel reisen wird, nachdem er die Verwaltung Belgiens niedergelegt hat.“
Sie hatten aufmerksam der Erzählung des deutschen Offiziers zugehört. Er wusste, dass unter diesen Menschen Niemand war, der Missbrauch mit seinen Worten treiben konnte.
Rittmeister Januschek legte ihm die Hand auf die Schulter: „Das ist eine Mission, mein Freund, die sich hören lässt. Sie wird dir Ehren und Auszeichnungen bringen. Ich sag es ja: Glück muss man haben. Was sagt denn deine Braut zu alledem?“
„Aber Januschek! Die weiß davon nichts. Und heute bin ich Frau v. S. gegenüber nur mehr der preußische Oberleutnant Jesco von Sandern!“
Anny sah ihn so merkwürdig an. Januschek ging schnell über seine kleine Taktlosigkeit hinweg: „Aber heute bleibst du doch in Wien? Bis zum Abend, ja? Da wollen wir uns noch zusammen zeigen!
Ich kann mir denken, dass man dir förmliche Ovationen auf den Straßen gebracht hat!
Hast du eine Ahnung, welche Hochachtung wir vor Euch Deutschen haben! Donnerwetter! Der Marsch bis vor Warschau! Und der Kampf am Yserkanal und um Lille! Gigantisch! Und Eure Emden! Na überhaupt!“ — . . . Es war Nachmittag geworden. Januschek gab nicht nach, bis Jesco, Rudi, Anny und er in der „Tabakspfeife“ zu Mittag aßen.
Jesco war nur einmal kurz in Wien gewesen, und er konnte bei dem Gang zu dem altertümlichen Lokal gleich einen Blick auf den Dom werfen, auf den alten, geliebten Stephansdom und die Kärntnerstraße, und dann machten sie alle einen Bummel zum Graben und tranken dort Kaffee.
Und der Oberleutnant konnte nicht genug staunen, wie sich hier das Leben abwickelte. Wie in Berlin. Als ob es keinen Krieg gäbe und Niemand darein verwickelt sei mit Gut und Blut.
Doch in der Luft lag’s. Ja, da fühlte man’s auf Schritt und Tritt.
Die Sonnenfäden schienen ein phantastisches Garn davon zu spinnen, die kahlen Bäume schienen davon zu sprechen, die Luft schien getränkt zu sein von dem einen Gedanken, und alle Menschen atmeten ihn, alle Menschen sahen das Sonnengespinst in dem blauen Äther:
Den durchsichtigen Teppich voll märchenhafter Farben, in denen die neue Zeit sich spiegelte, in denen Hekatomben von Blut und Weh und Jammer und himmeljauchzender Freude zu einem einzigen Bildnis einer großen, gewaltigen Zeit zusammenflossen, in der alles anders war, größer, erhabener, in der Gott die Menschheit nach qualvoller Prüfung küsste, auf dass sie wieder ihm ähnlich werde . . .
Und dann gingen sie nach kurzer Fahrt bis Kitzing durch den Park von Schönbrunn, um Abschied zu nehmen. Wie Kulissen standen die prachtvollen Bäume da, einige noch im späten Herbstschmuck, obgleich der Winterwind schon durch den Park fegte.
Januschek hatte noch einen Freund getroffen: Den Leutnant Konsfelder, der morgen wieder gegen die Serben ins Feld musste. Mit dem und Rudi ging er voraus. Konsfelder war bei der Infanterie und hatte noch den linken Arm in der Binde, aber er ging wieder vor den Feind, er hielt es nicht länger aus in Wien.
Anny hing sich bei Jesco ein.
Erst sprachen sie nichts.
Dann begann sie:
„Haben Sie Jemanden beim Roten Kreuz in Deutschland, Herr Oberleutnant?“
„Ja freilich. Meine Schwester, Elsa von Sandern, geht als Schwester in der nächsten Zeit wieder ins Feld. Sie hat ihren Bräutigam Franz Scholz gesund gepflegt.“
Das ist ja nun wohl die heiligste Aufgabe der Frauen geworden, gesund pflegen, “ antwortete Anny mit einem Blick in die Ferne.
„Ja. Es sind ruhmlose Heldinnen, die mithelfen, zu siegen. Aber in dieser Aufopferung liegt eine neue Gewähr für die Zukunft, gnädiges Fräulein. Was würden uns Deutschen alle Siege, alle Blutopfer nützen, wenn nicht die deutsche Frau auf dem geschaffenen Fundament weiterbauen würde?“
„Sie haben Recht. Wir können nicht genug tun. Und eigentlich müssen alle persönlichen Interessen zurücktreten vor der Gesamtheit. Aber wir sind doch nun einmal Frauen — und — und —“
Er sah sie von der Seite an. Sie wollte etwas von ihm, und wagte nicht, sich ihm anzuvertrauen. Er sagte also:
„Sprechen Sie ganz offen mit mir. Wir, die wir im Feuer gestanden, die wir durch so viel Leid und Elend gegangen sind, wir verstehen mehr als andere. Uns ist nichts mehr fremd. Sie sorgen sich um einen Mann, den Sie lieben?“.
„Ja, Herr Oberleutnant. Viktor Oberländer — oh Gott, nun habe ich gleich seinen Namen verraten!“
Jesco horchte auf.
„Viktor Oberländer? Warten Sie — ist er nicht Reserveleutnant bei den Fliegern?“
„Ja. Im Zivilberuf Fabrikleiter und Bayer.“
„Fabrikleiter und Bayer?“ lachte der Offizier, um seine eigene Verlegenheit zu verbergen.
Sie lachte nun auch. Die Scheu war überwunden. „Kennen Sie ihn?“
„Freilich kenne ich ihn. Der steht augenblicklich bei Lille!“
„Ja, er steht bei Lille“, rief sie voll Begeisterung! „Oh, Sie kennen ihn!“
Er blieb stehen und sah ihr in die Augen. In die Augen ohne Fehl und Falsch, in denen die Tränen schimmerten. Und bei sich sagte Jesco von Sandern:
Braves Mädel voll Treue! Der ist Deiner nicht wert — aber er schwieg. Und sie fuhr fort:
„Er war in Wien an einer Fabrik bei Meidling. Da lernte ich ihn kennen. Mutter und Rudi wissen nichts davon. Das heißt, Rudi ahnt es. Aber er verrät mich nicht. Wir sind heimlich verlobt, das heißt, so gut wie verlobt. . .“ „Also sagen wir kurz: Anny liebt den Viktor Oberländer, und der hat ihr gesagt . . .“
„Nein, gesagt hat er mir gerade nichts. Aber ich weiß, dass er mir gut ist, und ich. . ich hab’ ihn lieb!“
Sie gingen eine Weile schweigend nebeneinander. — Ich hab’ ihn lieb!
Wie das nachklang in den Ohren des Offiziers, der seit Monaten nichts hörte als Schlachtendonner und den Mordgesang der Maschinengewehre.
Und dieser Viktor Oberländer — ja, den kannte er freilich! Neben ihm war er im Quartier gelegen, vor Lille, um das seit Wochen erbittert, rasend gekämpft wurde. Und einmal, als die Feldpost kam, hatte Oberländer einen Brief aus München bekommen. . . durch Zufall hatte ihn Jesco gesehen. Nur flüchtig.. aber er hatte gleich auf den ersten Blick alles begriffen. Der Brief stammte von der Hand einer Frau, die auch nach Flandern Briefe schrieb, wo Jesco einen guten Freund hatte, den Artilleriehauptmann Eisenfeld. Der lag seit Monaten in harten, jetzt eisigen Schützengräben und kämpfte gegen den übermächtigen Feind. Und seine Frau in München schrieb an den Leutnant Viktor Oberländer Briefe, aus denen die heiße Sehnsucht schrie.
Und die Sünde.
Und an diesen Viktor Oberländer, der eine andere Frau liebte, hatte diese kleine Anny ihr goldenes Herz verschenkt!
Er wurde aus seinen Träumen gerissen.
„Ich denke mir nun, wenn er einmal verwundet werden würde, dann käme er in fremde Hände. Wäre ich nun Schwester vom deutschen Roten Kreuz, dann hätte ich ein Anrecht darauf, ihn zu pflegen. Und deshalb — deshalb möchte ich mich zum deutschen Roten Kreuz versetzen lassen, und wollte Sie bitten, mir Ihre Hilfe und die Fürsprache Ihres Fräulein Schwester zu leihen. . .“
Goldiges Mädel, dachte der Oberleutnant. Durfte er Schicksal spielen? Das Leben mochte es nach seiner Weise machen. Er versprach, gleich von Konstantinopel aus Schritte zu tun. Seine Schwester Elsa hatte ja Einfluss, da würde sich das schon machen lassen . . .
„Vielen, vielen Dank“, sagte Anny. „Und weil ich schon beim Betteln bin — ich habe so große Sorge um meinen Bruder — ach, lieber Herr Oberleutnant, möchten Sie nicht auch mal mit ihm ein paar Worte reden?“
„Was soll ich ihm sagen? Er ist ein schmucker Bursch . . .“
„Er wollte Theologe werden. . .“
„Theologe? Der? Mit den blitzenden Augen?“
„Das ist nur in letzter Zeit so. Seit. . . seit Vater tot ist. Oder eigentlich, seit der Krieg ausbrach. Ja. Seitdem ist er ganz verwandelt. Früher war er das Gegenteil. Ach, was muss man überhaupt an Wandlungen erleben und selber durchmachen! Früher war er immer so still und in sich gekehrt. Ach, wenn da Jemand von Massenmord gesprochen hätte! Aufgefahren wäre er! Und jetzt . . . . Aber er ist nicht zum Soldaten geboren. Ganz und gar nicht! Er ist Mutters Stolz. Der Vater fiel. . und nun denkt die arme alte Frau immer nur an Rudi. Und ich fürchte. . er wird nicht zurechtkommen da draußen. Er wird sich nicht gut schlagen. Er taugt nun einmal nicht dafür. Und wenn er vielleicht . . wenn ihn die Nerven im Stich lassen sollten. . wenn er nun nicht tapfer wäre. . . ich kann mich nicht recht ausdrücken. Sie verstehen mich schon. Reden Sie mit ihm. Vielleicht können Sie ihm einen Rat geben. Der Herr Rittmeister hat ihm ja von Anfang an abgeredet. Aber der tut alles mit so einem heimlichen Spott, und da hat sich der Rudi gerade gemeldet. Erstrecht!“ Oberleutnant von Sandern sah eine Weile zu Boden. „Gehen Sie mit den beiden Herren Kameraden, Fräulein Anny. Ich will ihn mal ins Gebet nehmen.“
Dann also ging Anny mit den Offizieren und Rudi kam an die Seite des Deutschen.
Es lag so ein heißer Glanz in den Augen des Jungen, wenn er zu dem Offizier aufsah. Der beobachtete ihn eine Weile.
„Sie wollten Theologe werden, Herr Rudolf?“
„Ja. Nennen Sie mich einfach Rudolf, Herr Oberleutnant. Und nur nicht Rudi. Es ist etwas Schreckliches um die Muttersöhnchen. Man will ihnen die Kinderschuhe auch mit achtzehn Jahren nicht ausziehen!“
„Nun sagen Sie mir, Rudolf: Ihr Glaube, ich meine, ihr tiefstes religiöses Bekenntnis, das sträubt sich doch gegen den Gedanken, Menschen zu töten? Sie müssen sich das recht vorstellen. So ein Kampf, das ist keine Theorie mit pfeifenden Flintenkugeln, theatralisch sterbenden Männern und ewig fliehenden Feinden. So ein Kampf auf Leben und Tod ist etwas Fürchterliches, und nur, wer das reine Gewissen des Soldaten hat, kann da bestehen.“
„Ich habe das reine Gewissen, Herr Oberleutnant, “ sagte Rudi kurz, ohne weiter auf die Frage einzugehen.
Aber der Ton, die Haltung des Jungen beruhigten den Offizier. „Dann tun Sie, was Sie leisten können. Aber prüfen sollen sie sich vorher noch, ob in Augenblicken, da die Dämonen der Hölle ausgespieen werden, um Menschenhirne zu peinigen, Ihre innere Kraft nicht versagen könnte. . .“ Er sah den Jungen scharf an. Der blickte nachdenklich zu Boden. „Das weiß ich nicht, Herr Oberleutnant. Wenn es aber geschähe, so wäre es eine Todsünde. Und die würde ich durch eine andere wettmachen, die in solchem Augenblick Gott mir verzeihen sollte: Ich würde mein Gewehr umdrehen und mir eine österreichische Kugel durch den Kopf jagen.“
Der Oberleutnant lächelte milde. Den Theologen durfte man in die Schlacht ziehen lassen. . .
„Sie haben ja schon so viel mitgemacht“, sagte Rudi nach einer Weile. „So viel! Ach, wie ich Sie beneide! Was haben sie alles gesehen! Was haben Sie erlebt! Und wie sind Sie Gott nahe gestanden!“
„Sie meinen: Dem Tode?“
„Dem Tode und Gott. Wer in diesem Kampfe gegen die Finsternis stirbt, Herr Oberleutnant, der sühnt für Geschlechter. Auch wir haben viel gefehlt. Ich kann und darf nur von Österreich sprechen. Wir haben unendlich gesündigt. Ich meine, in politischer Hinsicht. Und solche Sünden gegen das Gedeihen der Völker, gegen die Enkel, die im Vertrauen auf uns das Werk fortsetzen, das wir begonnen, die die blutige Ernte halten müssen, die wir als Frucht in den Boden gelegt, solche Sünden sind auch Sünden gegen den heiligen Geist. Darum müssen wir sühnen, indem wir die Vorfahren rächen, uns selber absolvieren und die Enkel in das gelobte Land einer reinen Zukunft führen. Österreich — schauen Sie, Herr Oberleutnant, wie viel Segen liegt in dem Wort! Wie viel herrliche Bilder tauchen aus der Vergangenheit auf, wie leuchten die Edelsteine der Geschehnisse in der Geschichte der Habsburger. Wie viel Poesie, wie viel Kultur umschließt das Wort: Österreich! Ein Bollwerk ist es für Deutschland in zweifacher Hinsicht. Darum kämpfen wir beide für das Gleiche: Sie für Österreich, wir für Deutschland, beide vereint für ein Ziel: Für den deutschen Gott. Das ist ein Wort, Herr Oberleutnant, das mehr sagt und sagen will, als die da draußen im Lande sich träumen lassen!“
Der Oberleutnant reichte dem Jungen die Hand.
„Ziehen Sie ruhig in den Kampf, Rudolf. Sie haben die Weihe dazu, ich merke es wohl. Und sollten Sie irgendwo in Polen einen lieben Freund von mir finden. . einen Oberleutnant von Elmingen — Grafen Elmingen . . merken Sie sich den Namen wohl. . dann grüßen Sie ihn von mir. . herzlich. . und sagen Sie, er soll Freundschaft mit Ihnen schließen. Denn auch er ist einer, der durch diesen Krieg geweiht wurde.“
Rudolf notierte sich den Namen. Sandern wurde schweigsam. Seine Gedanken schweiften zu dem fernen Freunde, an den ihn plötzlich, wie eine Eingebung, die Erinnerung mahnte.
Wirklich — diese beiden Menschen, die sich scheinbar so ferne standen, der junge Priesterkandidat und der Graf, hatten Ähnlichkeit im Schicksal der Seelen.
Der Graf ein Draufgänger vor dem Kriege, ein Duellant, ein Frauenjäger, aber reich und gut im Kern — und jetzt, im Krieg, ein Mann aus Stahl, voll Pflicht gegen sich und andere. Ein Ritter deutschen Blutes. Und der junge Priesterkandidat hier ein Mensch, jeder fleischlichen Regung abhold, ein echt österreichischer Träumer und Schwärmer, ein Tatenloser, der darauf brannte, sein Leben schlicht und einfach auf vier Klostermauern zuzuschneiden. . . und der nun die Welt zu klein findet für seinen Tatendrang, von heiliger Begeisterung durchlocht — zu töten!
Die Todsünde zum Evangelium zu machen!
Oh du heiliger Krieg! —
Es war Abend geworden. Der Leutnant reiste mit dem deutschen Oberleutnant ab. Januschek wollte am nächsten Tage zur Front nach Galizien.
Sie schritten zu dritt zum Bahnhof.
Und da nahm Januschek den Freund noch auf die Seite:
„Du weißt, dass Jeder von uns seine heimliche Sonne in der Seele hat“, sagte er. „Sieh mal, Frrreund, ich habe nie gewusst, was lieben heißt. In Prag gibt’s junge Mäderln, no ja, man ist jung, man fährt mit dem Frühling, und man nimmt die Liebe, wo sie sich bietet. Aber seit ich Anny näher kennen gelernt habe — seit der Zeit, wo ihr Vater unter mir gestanden hat, wie wir gegen die Serben fochten — also seit der Zeit ist alles anders geworden. Weißt, Freund, der Krieg reißt alles, was sich im Laufe der Jahre an Unkraut festgenistet hat, aus dem Herzen. Es gibt für Jeden nur mehr Eines, und das muss was Großes sein. Nichts Halbes mehr. Ein großes Glück, ein großes Leid! Und ich hab’ die Anny lieb. Mit dir hat sie den ganzen Nachmittag geredet. Du kannst mir vielleicht sagen, Kamerad, ob sie mich lieb hat. Keine Flausen und Ausreden, Jesco. Ja oder nein!“
Die kohlschwarzen Augen des Rittmeisters funkelten in die des Oberleutnants. Der dachte: Keine Halbheiten! Lieber ein großes Leid als ein halbes Glück, und sagte:
„Sie hat einen andern lieb, Januschek.“
Da wurde der Januschek, der morgen oder übermorgen als Held mit in Czernowitz einziehen wollte, bleich wie ein Stück Tuch.
Und lachte.
„Hast mir einen guten Dienst erwiesen, Jesco“. Dann redeten sie von etwas anderem.
Der Zug war schon im Anfahren, da packte der Januschek noch einmal die Hand seines Freundes:
„Leb wohl, lieberrr Frrreund! Leb wohl! Leb wohl!“
Jesco wollte noch etwas sagen, denn plötzlich packte ihn eine dunkle Ahnung. Aber da legte sich schon der schwere Rauch der Lokomotive zwischen ihn und den schwarzen Rittmeister, und Wien und ein Stück Leben versank.
2. Kapitel.
Nach amtlicher Bekanntmachung der Admiralität wurde S. M. S. „Emden“ am 9. November früh bei den Cocos Inseln im Indischen Ozean, während eine Landungsabteilung zur Zerstörung der englischen Funken- und Kabelstation ausgeschifft war, von dem australischen Kreuzer „Sidney“ angegriffen. Nach hartnäckigem, verlustreichem Gefecht ist S. M. S. „Emden“ durch die überlegene Artillerie des Gegners in Brand geschossen und von der eigenen Besatzung auf Strand gesetzt worden. (W. T. B.)
Die Emden.
Und soll man es glauben? Millionenschwer
Ist schon der Schaden! Die Kreuz und Quer
Fährt Englands Geschwader im Ozean
Und kommt nicht ran!
‘S ist wie ein böser Geisterwahn!
So was muß die Nation befremden!
Wohin man schaut, da klingt es: „Emden!“
Und wo man liest, da liest aufs Neu
Man irgend eine Kaperei!
Millionenfach ist schon der Schaden, ach!
Millionenfach! —
Eine ganze Flotte flog hinterher
Der Emden nach in das Indische Meer.
Bei jeder Insel, bei jedem Riff
Vermuteten sie das verhexte Schiff.
Von Müller aber, froh und gesund,
Senkt wieder ein Schiffchen in den Grund.
Da ward er gestellt! Da hörte die Welt
Den deutschesten Heldensang,
Der Emden letzter Ruf erklang
Vom Indischen Meer bis zum Belt.
Wild schrie sie auf mit Kanonengebrüll,
In Flammen und Feuer gehüllt,
Und lief auf den Strand — ein dämonisches Bild —
Und sank — und wurde still.
Nun ist es zu Ende, das Heldenlied,
Die Emden ist nicht mehr.
Doch wo ein deutsches Herz noch glüht,
Da tönte es über das Meer
Von Sydney bis Southampton:
„Hurra Emden!“
Der Krieg marschierte hierhin und dorthin. Im fernen Osten wetterleuchtete es. Japan, Sieger über ein Häuflein Helden in Tsingtau, streckte seine Tatzen eroberungsgierig nach China hinüber. Noch gab es keine offenkundige Trübung, aber man fühlte kommende Ereignisse von ungeheurer Tragweite voraus. In der Türkei kam es zu erregten Auseinandersetzungen zwischen den englischen Vertretern und dem türkischen Kriegsminister.
England verlangte, die Türkei solle alle deutschen Matrosen von türkischen Schiffen entfernen. Die Antwort lautete stolz ablehnend.
Wenige Tage später brach der Krieg aus, den man längst erwartet hatte: Die Türkei stellte sich auf die Seite Deutschlands, der Halbmond wehte neben dem Kreuz der Christenheit, die mächtigsten Symbole des Glaubens wandten sich gegen die rohe Gewalt, die für die Finsternis kämpfte.
Ein türkischer Kreuzer bombardierte Feodosia. Odessa wurde beschossen. Und während auf der einen Seite die japanische Fahne nach furchtbaren Verlusten über einem Fleckchen deutscher Erde wehte, während die Emden heldenkühn in die Nacht des Ozeans sank, tot wund durch erdrückende Übermacht, reihten sich die Siege der Verbündeten.
Coronel kam, der englische Kreuzer Hermes fiel im Kanal einem Unterseeboot zum Opfer, deutsche Kriegsschiffe erschienen siegreich vor Yarmouth.
Und im ganzen deutschen Volke sang man noch immer von U 9 und es ging ein Raunen von Mund zu Mund, das in dem einen geheimnisvollen Satze gipfelte: Unsere Unterseeboote.
Jesco schrieb aus Konstantinopel an seine Schwester mit der Bitte, Schritte zu tun, dass Fräulein Anny Niedermeier aus Wien ins Deutsche Rote Kreuz aufgenommen würde.
Elsa von Sandern war noch in Berlin. Sie wollte sich mit ihrem Bräutigam, Hans Scholz, der von schwerer Verwundung kaum genesen war, trauen lassen, um dann mit ihm ins Feld zu ziehen.
Der Rittmeister von Januschek erhielt auch ein Schreiben.
Hier geht alles nach Wunsch, ließ sich Jesco vernehmen. Die Türkei marschiert gegen England, der Suezkanal wird das nächste Ziel der kriegerischen Operationen sein, gleichzeitig wird gegen Russland die Entscheidung im Kaukasus gesucht.
Ich führe wichtige Verhandlungen und hoffe, bald nach Deutschland zurückzukehren. Hoffentlich sehen wir uns auf den Schlachtfeldern Galiziens oder Polens, mein Freund. Schulter an Schulter wollen wir durch gemeinsam vergossenes Blut unsere Freundschaft besiegeln. .
Das war, als der machtvoll gegen Warschau angesetzte Angriff der Verbündeten abgebrochen wurde. Als die erdrückende russische Übermacht Hindenburg zur plötzlichen Änderung seiner Pläne und zur Umgruppierung seiner Streitkräfte zwang.
Als die Riesenfront der deutschen und österreichischen Heere langsam den Rückzug antrat Aus Iwangorod und Nowogeorgiewsk brachen die ungezählten russischen Regimenter hervor, Menschen, Bataillone, die nicht zu zählen waren, denen die viel, viel schwächeren deutschen und österreichischen Truppen nicht gewachsen blieben.
Und da hub ein Schlagen an, von dem man noch singen wird in späten Tagen.
Der schwarze Januschek kam noch nach Czernowitz, wie er es sich gewünscht. Einen Kuss hatte ihm die schöne Anny mit auf den Weg gegeben. Und auf der Fahrt erhielt er die Nachricht, dass die Serben zurückgeschlagen werden, in breiter Front, in wildem Kesseltreiben. Und er sah im Geiste den kleinen Leutnant, der dabei sein durfte, wie diese Horde von Räubern und Mordbrennern in ihre Grenzen zurückgejagt wurden.
Das arme Czernowitz, dachte er auf der Fahrt, das liebe Czernowitz! Seit dem zweiten September hausten die Russen darin! Und nicht möglich war es, das Kronjuwel Galiziens zurückzuholen aus den gierigen Räuberhänden der asiatischen Horden.
Nun rückten die Österreicher wieder ein mit klingendem Spiel. Freilich, viel war es nicht an Truppen, was nun rings um Czernowitz zusammengezogen werden konnte, um dem Andrang der flutenden Übermacht des Feindes Stand zu halten.
Wohl ihm, dem schwarzen Januschek, dass er nicht mehr sah, wie die Russen zum zweiten Male gegen Czernowitz kamen und es den Österreichern — bis zum Aschermittwoch 1915 — von neuem entrissen.
Die Österreicher verteidigten nun im allgemeinen Z6den Teil des Kronlandes, der im Norden vom Pruth, im Westen von Czeremosch begrenzt wird. An dieser Linie standen von nun an die österreichischen Landstürmer und hielten die Wacht an der Bukowina, befehligt von dem unvergleichlichen Gendarmerieobersten Fischer, der mit einer kleinen Truppe und vier alten Geschützen in den folgenden Kämpfen fünf Wochen lang eine 90 Kilometer breite Front gegen fünfzigfache Übermacht hielt.
Fünf Wochen lang — bis zum 26. November!
Doch da war der schwarze Januschek schon weit!
Bei Tuska war er dabei, bei dem heißen Schlagen und Streiten, als er den Befehl erhielt, mit seiner Truppe nach Polen zu reiten.
Januschek kämpfte nun bei Ostrowiece.
Schnee war gefallen, dichter, schwerer Schnee, der das Land einhüllte und oben in den Bergen, weit drüben in den Karpathen, bereits die Schneeschuhtruppen in Tätigkeit treten ließ. Hier am San sah man seltsam gespenstische Kompagnien in weißen Hemden, Schneehemden, dahinmarschieren. Es war bitter kalt geworden.
Irgendwo, wo noch vor Wochen ein schmuckes kleines Dorf gestanden, da sah man eine Reihe von Zigeunerwagen. Sie standen zwischen verkohlten Trümmern, die noch wohnlich gemacht worden waren, so gut es ging. Man sah Pferde in ausgebrannten Zimmern und man sah Menschen in Schweineställen.
Die Ordonnanz wies den schwarzen Rittmeister nach einem Zigeunerwagen:
„Hierhin, Herr Rittmeister.“
Drei Offiziere hatten es sich bereits in dem Quartier bequem gemacht. Januschek stieg die kleinen Holztreppen hinauf. Ein Mann salutierte:
Ein Gefreiter mit blitzenden Augen und scharfgeschnittenem Gesicht, verwildert schon von kurzem, hartem Kampf.
„Den sollte ich doch kennen“, murmelt der Rittmeister. „Gefreiter!“
„Jawohl, Herr Rittmeister, “ sagt Rudi.
„Rudi — Teufelsbrraten — du?“
„Zu Befehl, Herr Rittmeister!“
„Soforrrt, wenn du abgelöst bist, kommst rrrein in den Wagen da, verrrstanden?“
„Zu Befehl, Herr Rittmeister!“
Indessen machte sichs Januschek bequem. Die Kameraden lagen ganz hinten und schliefen schon. Aber vorne, wo Januschek war, da sah es so ganz merkwürdig aus. . .
Komischer Wagen, das, dachte der Rittmeister. Hat wohl eine Dame früher hier gewohnt. . .
Vor ihm ein Toilettentisch . . mit einem Spiegel und in der Eile zurückgelassenen Gegenständen . . . Kamm . . Bürsten . . Nagelfeilen . . alles sehr nobel . . sehrrrr nobel . . und ein Kostüm . . Flitter . . . eine Reitpeitsche . . silberner Griff . . eingraviert: Selma von Waklowski. . .
Himmel, den Rittmeister riss es in die Höhe. . . die Selma. . . die. . .
Er suchte fieberhaft weiter. In einem Koffer, da lag noch ein Kleid. . und ein Federhut . . den kannte er. . das war die Selma. . natürlich . . . die Selma . . .
Er setzte sich wieder. Und dachte nach. Damals, wie er in dem mährischen Nest in Quartier gelegen, zog sie durch. Ein Teufelsweib. Jede Geste war Rasse. Er liebte sie. Sie liebte ihn wieder. Und der Zirkus blieb sechs Wochen.
Ja, die Selma. Beinahe hätte er sich ihretwegen erschossen. Nun saß er vor ihrem Spiegel und sah sich an:
Ja, ja, Herr Rittmeister Januschek, damals saßen Sie auch so vor dem Spiegel, den Revolver in der Hand, und dachten an die Selma, wie sie lachend weitergezogen war. . irgendwohin.
Zigeunerblut.
Das hatte sich auch in Ihnen geregt. Erst wollten Sie gar Kunstreiter werden und der Selma nach. Aber der Kommandeur des Regiments und die Vernunft siegten.
Und dann kam eine reine Liebe. . .
Doch auch diese Liebe hat dem Rittmeister Januschek nur Leid gebracht, Sehnsucht und Leid.
Ach . . die Sehnsucht!
Und die Selma . . ja, die . .
Rudolf trat ein.
„Herr Rittmeister!“
„Brauchst nicht stramm stehen, Rudi. Setz dich her! Hast du den Zigeunerwagen aufgegabelt, Rudi?“
„Der stand schon da. Die Kunstreiterin, die hier herinnen gewohnt hat, ist geflüchtet und soll von den Russen gefangen genommen worden sein. Man weiß nichts Genaues. Eine Patrouille meldete, sie hätten das Weib ermordet und irgendwo in einem Wald, barbarisch zugerichtet, liegen lassen“
„So, so ...“ sagte der Rittmeister und strich sich den Bart, während es in seinen Augen blitzte. „So, so. Wenn wir die russischen Aasgeier kriegen, Rudi, wollen wir es ihnen heimzahlen.“
„Ja, das wollen wir!“
Dann war es lange still. An wen dachte der schwarze Januschek?
Er sagte endlich: „Rudi, morgen wirrd es heiß hergehen. Ich weiß es. Du hast bis jetzt nur Gefechte mitgemacht. Aber morgen gibt es eine Schlacht. Es gibt vielleicht eine Reihe von Schlachten, denn wir dürfen die Russen nicht durchlassen, und die sind in der Überzahl. Deine Schwester hat mir in Wien eine Rose geschenkt. Wenn ich fallen sollte, dann tauchst du die Rose in mein Blut und schickst sie ihr. Rudi, willst es verrsprechen?“
Rudi versprach es. Und dann trennten sie sich.
Der Rittmeister blieb wach. Er musste an den Rudi denken, was für ein prachtvoller Kerl das geworden war.
Und er musste an sich denken, an sein ganzes Leben, und an die dumpfe Ahnung von etwas Unerhörtem, Prachtvoll-Gewaltigem, das ihn bedrückte, das ihn nicht losließ . . . und er trat hinaus und sah über die Felder in die Nacht.
Es war still. Alles schlief nach endlos anstrengenden Märschen. Nur die Wachen hörte man, und die Pferde wieherten.
Langsam ging der Rittmeister wieder in den Wagen der tollen unglücklichen Selma und holte die Rose hervor. Sie war vertrocknet. Aber kein Blatt hatte sie verloren. Er steckte sie sich fest an den Waffenrock. Und dann schrieb der schwarze Januschek auf den Knien seinen Abschied an das Leben.
Indessen saßen der Gefreite Rudi und mehrere Unteroffiziere und Leutnants beisammen. Man konnte nicht schlafen in der Nacht, die erfüllt war von heißen Ahnungen und grauenvollen Möglichkeiten, und vertrieb sich die Zeit mit Erzählen, bis die Wachtfeuer niederbrannten. Rudi berichtete, dass früher sein Traum ein Kloster mit grauen Mauern und dunklen Wandelgängen gewesen war. Dass es wohl nach dem Kriege wieder so sein werde. Aber jetzt . .
„Jetzt muss jeder das Blutzeugnis ablegen, dass er Kulturmensch ist und nicht Barbar. Barbaren sind es, die über uns hergefallen sind! Ich habe sehr viel von Russland gehört! Mein Vater war Kaufmann und hatte viel dort zu tun. Da hatte er natürlich auch Geschäftsfreunde drüben, und so lebte man halb und halb mit, was sich jenseits der Grenzen alles ereignete. Die Judenmassakres, die ungesetzlichen Einkerkerungen, die Schandtaten gegen Studentinnen —“
„Ja, gegen die Aufklärung des Volkes sind sie am meisten“, warf ein Leutnant ein. „Weil eben die Regierung von Russland eine kleine, verbrecherische Minorität ist, und die große Masse einfach geknechtete Hunde sind und bleiben sollen!“
„Und solche Barbaren“, rief Rudi voll Verzweiflung und Hass, „solche Barbaren wollen gegen uns zu Felde ziehen, um die Kultur gegen die Deutschen zu verteidigen! Sie, die ihre Studentinnen zwingen, die gelbe Karte zu nehmen, damit sie studieren dürfen“.
„Die gelbe Karte? Was ist das?“ fragte einer.
„Das ist die Karte, welche jede staatlich angemeldete Prostituierte hat und haben muss. Solche Karten müssen die Studentinnen in Russland lösen. Und die Regierung beauftragt ihre Polizeiorgane, darauf zu achten, dass die Studentin auch zu Recht die gelbe Karte hat . . .“
Ein Schweigen wortloser Empörung folgte.
„Ist das wahr, Rudi?“ fragte ein Leutnant.
„Das ist wahr, so mir Gott helfe. Ich weiß es aus verschiedenen untrüglichen Quellen. Und darum . . darum darf es keinen Unterschied zwischen uns geben, darum ist der Krieg gegen den Osten ein heiliger Krieg, und jeder, jeder muss sein Blutzeugnis ablegen. . jeder!“
Sie schwiegen lange. Sie hörten den Rudi immer gerne reden. Da fühlte sich jeder so groß, so stark, so rein im Glauben, wenn man ihn angehört hatte.
Nach einer Weile sagte ein Leutnant:
„Blutzeugnis. Das ist das rechte Wort. Ob Adel oder Bürger, ob Christ oder Jude — jeder muss sein Blut hergeben, und das ist das Wundervolle an dem Krieg: Alles, was Kaste und Schema hieß, fällt ab. . nur das Reine am Menschen bleibt zurück. Als ich bei der Befreiung von Przemysl dabei war, erlebte ich so etwas. .“
„Erzählen, Herr Leutnant!“ hieß es in der Runde.
Der Leutnant sah auf die Uhr.
„Gegen Morgen muss ich auf Ronde. Solange habe ich Zeit. Ich lag mit einem Konvedleutnant in so einem kleinen galizischen Nest. Wir spielten Billard in dem einzigen Café. Und da erzählte mir der arme Teufel seine Geschichte. Er war nämlich immer so traurig. . und ich fragte ihn aus.
„Ich bin im Zivilberuf Redakteur“, erzählte er mir. „In Böhmen oben leitete ich ein oppositionelles Blatt. Auf einem Balle lernte ich die Komtesse von Szölny kennen. Das Verhängnis wollte, dass wir eine tiefe und aufrichtige Neigung zu einander fassten. . aber der Herr Major von Szölny machte der Idylle ein rasches Ende.
Als ich meine Werbung vorbrachte, erwiderte er:
„Mein Herr, ich achte das Gefühl, das Sie meiner Tochter entgegenbringen; ich bedaure sehr, dass ich Ihnen nicht meinen Segen geben kann, denn ich habe persönlich nichts gegen Sie einzuwenden. Aber Sie wissen, dass unsere Familie zum alten Adel zählt. Sie sind Bürgerlicher, und Sie vertreten sogar eine Partei, die ganz anderen Ansichten huldigt als wir. Meine Tochter würde an Ihrer Seite nicht glücklich werden, denn sie würde alsbald Unterschiede bemerken, die eben einmal im Blute liegen. Unsere Vorfahren waren alle Offiziere, das Blut unserer Familie floss auf vielen Schlachtfeldern für Kaiser und Reich. Sie — schreiben. Nun wohl, das ist eine sehr edle Beschäftigung, aber keine für den zukünftigen Gatten meiner Tochter.“
Damit drückte er mir die Hand. In meiner Verwirrung sagte ich:
„Herr Major, ich wollte, ich könnte mit meinem Blute dafür zeugen, dass ich nicht schlechter bin als die Szölnys“. Der Alte sah mich durchdringend an und erwiderte: „Das wird Ihnen wohl nie gelingen“.
„Nun, fuhr der Leutnant fort“, die kleine Szölny wurde zu entfernten Verwandten geschickt und ist später, wenn ich nicht falsch berichtet wurde, als Krankenpflegerin bei dem Korps, zu dem ihr Vater gehört, eingetreten. „Der Krieg, Herr Kamerad“, schloss mein Freund, „verbietet dem einzelnen, an sein kleines Leid zu denken, und ich bitte um Entschuldigung, dass ich angesichts der großen Stunde, die uns bevorsteht, Sie mit meiner Geschichte gelangweilt habe. . .“
„Aber, lieber guter Freund“, erwiderte ich ihm, gerührt durch die Treuherzigkeit seiner Worte, „wenn ich irgendetwas für Sie tun kann . . . übrigens wo steht denn der Herr Major?“
„Er liegt mit seinen Truppen in Przemysl und wehrt sich wie ein Löwe gegen die Russen.“
„Vielleicht haben wir recht bald das Vergnügen, ihn zu sehen, wenn — holla!“ unterbrach ich mich. „Ist das nicht Alarm?“
Ta—ta—Ta—ta—Ta—tal
Trompetengeschmetter — und dumpfer Trommelton.
Alarm!
Das Städtchen verwandelte sich in Minuten in einen Bienenstock. Auf allen Seiten eilten die Truppen zu den Sammelplätzen, und draußen, wo die Armee im Biwak lag, sammelten sich die Regimenter, um zu marschieren.
Die Toten von Lemberg galt es zu rächen, und den heldenmütigen Verteidigern von Przemysl Luft zu schaffen!
Ein Nachtmarsch!
An Kolonnen und toten Russen, die die Straßengräben füllten, zogen die endlosen Linien der Bataillone vorüber — Deutsche und Österreicher in treuer Waffenbrüderschaft. Vorne an der Straße nach Dymow war schon gekämpft worden. Die Spitze der österreichischen Truppen war hier mit den vorgeschobenen Linien des Feindes handgemein geworden.
Der Tag graute — blutrot stieg die Sonne im Osten auf — da machten die Regimenter Halt, die Spitzenkolonnen aber marschierten weiter, während die Artillerie in Stellung ging . . .
„Ein Bataillon erkundet gegen die nächste Ortschaft!“ lautete der Befehl.
„Schwärmen!“ In aufgelösten Linien ging eine Patrouille längs der Straße vor.
Ein Flieger kam mit knatterndem Motor pfeilschnell über unsere Linien geflogen . . .