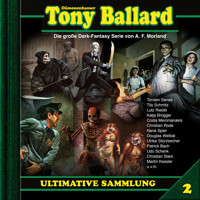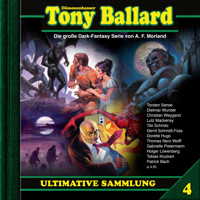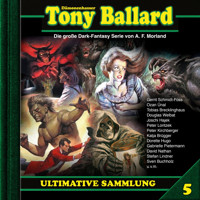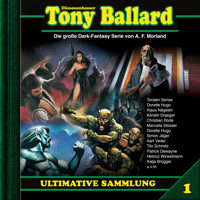1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Er trank ihr süßes, warmes, klebriges Blut. Es schmeckte unbeschreiblich köstlich, versetzte ihn in höchstes Verzücken und in einen überaus gefährlichen Rausch. Ohne dass er es wollte, wurde er mehr und mehr zur grausamen Bestie. Der dicke Lebenssaft, den das Herz seines jungen Opfers mit jedem wilden Schlag hoch pumpte, sprudelte ihm unaufhörlich in die unersättliche Kehle. Er wusste, dass er schon längst hätte aufhören müssen, dass er die junge Frau - gerade mal achtzehn Jahre alt - umbringen würde, wenn er noch weiter so maßlos an ihrem Hals saugte, schaffte es aber nicht, von ihr abzulassen.
Hunger, Durst und Gier raubten ihm komplett den Verstand. Er konnte sich einfach nicht beherrschen. Das war ihm noch nie passiert. Und es wurde ihr zum Verhängnis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Böses Blut
Special
Vorschau
Impressum
Böses Blut
Ein Tony Ballard Romanvon A.F. Morland
Er trank ihr süßes, warmes, klebriges Blut. Es schmeckte unbeschreiblich köstlich, versetzte ihn in höchstes Verzücken und in einen überaus gefährlichen Rausch. Ohne dass er es wollte, wurde er mehr und mehr zur grausamen Bestie. Der dicke Lebenssaft, den das Herz seines jungen Opfers mit jedem wilden Schlag hoch pumpte, sprudelte ihm unaufhörlich in die unersättliche Kehle. Er wusste, dass er schon längst hätte aufhören müssen, dass er die junge Frau – gerade mal achtzehn Jahre alt – umbringen würde, wenn er noch weiter so maßlos an ihrem Hals saugte, schaffte es aber nicht, von ihr abzulassen.
Hunger, Durst und Gier raubten ihm komplett den Verstand. Er konnte sich einfach nicht beherrschen. Das war ihm noch nie passiert. Und es wurde ihr zum Verhängnis ...
Er spürte, wie Chiara Cingolani erschlaffte, und wusste im selben Moment, dass sie tot war. Satt, aber mit denkbar schlechtem Gewissen, ließ er sie los.
Da lag sie nun. Entsetzlich bleich und erschütternd blutleer.
»Tut mir leid, Liebes«, murmelte er höchst schuldbewusst. »Das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte dich zu meiner Gefährtin machen und dir zur gleichen Unsterblichkeit verhelfen, wie sie mir – mit einigen wenigen Einschränkungen – gegönnt ist. An meiner Seite hättest du ewig leben sollen. Wir hätten zusammen eine nicht enden wollende Zukunft gehabt. Das hatte ich geplant. Und nun bist du – tot. Ich kann nicht sagen, wie sehr ich das bedauere. Es hätte nicht geschehen dürfen. Ich hatte unser großes, langes, gemeinsames Glück in der Hand und habe alles verdorben.«
Plötzlich flog die Tür auf und knallte laut gegen die Wand. Der Blutsauger richtete sich auf – eine hoch gewachsene, stattliche Erscheinung, gut aussehend.
Mitte dreißig. Seit vielen hundert Jahren schon. Mehrere Männer stürzten in den Raum. Allen voran Silvio Cingolani, Chiaras Vater. Er starrte den Vampir, dessen Gesicht blutverschmiert war, entsetzt an, sah seine leblose Tochter, bekreuzigte sich mehrmals und stieß erschüttert hervor: »Heilige Madonna, was hast du getan, Matteo Ruffallo?«
Der Untote antwortete nicht.
»Ich hab's geahnt«, krächzte Silvio Cingolani. »Ich hab's befürchtet. Meine Freunde haben mich vor dir gewarnt. ›Lass Chiara mit dem nicht allein‹, haben sie gesagt. ›Er ist schlecht. Er ist gefährlich. Er hat keinen Schatten. Er meidet die Sonne. In seinen Adern fließt böses Blut.‹ Warum nur habe ich nicht auf sie gehört?« Er zeigte auf Ruffallo und schrie: »Auf ihn! Packt ihn! Fesselt ihn! Wir werden dieses Scheusal vernichten!«
Matteo Ruffallo verfügte zwar, wie alle Vampire, über übernatürliche Kräfte – vor allem dann, wenn sie gerade Blut getrunken haben –, aber gegen diese aufgebrachte Überzahl war er machtlos.
Er stieß einen Angreifer hart zurück, schleuderte einen andern wild zu Boden, konnte aber nicht verhindern, dass ihm jemand die Beine unter dem Körper wegriss und ihn damit schwer zu Fall brachte.
Fäuste droschen gnadenlos auf ihn ein. Er spürte keinen Schmerz – war ja untot. Aber die Schläge und seine verbissene Gegenwehr schwächten ihn.
Er schaffte es irgendwie, wieder auf die Beine zu kommen. Doch sie warfen ihn noch einmal nieder, und kaum lag er auf dem Boden, war die »Meute« über ihm, presste ihn atemlos nieder und fesselte ihn mit Stricken, die so dick waren, dass er sie nicht zerreißen konnte.
Er versuchte die Männer abzuwerfen, bäumte sich auf, fauchte wie ein gereiztes Raubtier und biss zornig um sich, doch sie ließen ihm keine Chance, wanden ihre Stricke um seine Beine und zurrten sie mehrmals kräftig fest.
Mit seinen Armen verfuhren sie genauso. Sie schnürten ihn zu einem lebenden Paket zusammen und schleiften ihn aus Silvio Cingolanis Haus.
Wenn Matteo Ruffallo immer nur wenig von Chiaras Blut getrunken hätte, wäre sie langsam dahingesiecht, schließlich bleich und durchsichtig an Schwäche, Blutarmut und allgemeiner Entkräftung gestorben und danach schon bald als Vampirin wieder auferstanden. Doch ihr Ableben war zu schnell gegangen. Das hatte sie getötet und ihr die Chance zur Wiederkehr in einer neuen Lebensform genommen.
Matteo Ruffallos Häscher warfen ihn auf einen schäbigen, alten Pferdekarren. Die Tiere wieherten und stampften ängstlich mit den Hufen.
Sie witterten das abgrundtief Böse, das den Gefangenen prägte und beherrschte. Silvio Cingolani setzte sich auf den Kutschbock. Seine Freunde kletterten auf das ächzende und knarrende Gefährt. Cingolani trieb die nervösen Gäule an.
Abseits aller Häuser banden sie den verhassten Blutsauger dann an eine solitär stehende tote Eiche, deren abgebrochene Äste sich wie schwarze Arme zum Himmel streckten, als müssten sie ihn stützen.
Zuvor ließen sie ihre Wut, ihren Hass, ihren Ekel und ihren Widerwillen aber noch sattsam an ihm aus. Sie traten und schlugen so lange erbarmungslos auf ihn ein, bis er sich nicht mehr rührte. Dann schwärmten sie aus, trugen trockenes Holz zusammen und schichteten es um ihn herum auf.
Ihnen war bekannt, dass Vampire weder grelles Sonnenlicht noch fließendes Wasser, den Geruch von Knoblauch oder Eisenkraut vertrugen, und dass man sie vernichten konnte, indem man ihnen einen Holzpfahl durchs Herz trieb oder ihnen das Genick brach. Aber auch mit Feuer konnte man das Dasein eines Nosferatu – wie diese blutgierigen Bestien in Transsilvanien genannt wurden – für immer beenden.
Und genau das hatten sie vor. Matteo Ruffallo, der Vampir, sollte brennen und verbrennen. Und auf seine Asche wollten sie zu guter Letzt, während sie sich wiederholt bekreuzigten, voller Abscheu und Verachtung spucken. Sobald genügend Holz aufgeschichtet war, setzte es Silvio Cingolani ringsherum in Brand.
Und dann warteten sie ...
†
Enzo Lamballo kratzte sich nach einer Weile am struppigen Kopf, als hätte er lästige Läuse in seiner verfilzten »Wolle«. »Das verstehe ich nicht«, sagte er mit belegter Stimme.
Alberto Fausti rieb sich seinen schwammigen Säuferzinken und nickte zustimmend. »Ich, ehrlich gesagt, auch nicht.«
Enzo Lamballo sah Cingolani an. »Kannst du uns das erklären, Silvio?«
Der Gefragte schüttelte ratlos den Kopf. »Kann ich nicht. Normalerweise vernichten Flammen alles Böse.«
»Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu«, brummte der untersetzte, bärenstarke Federico Tinti, von dem behauptet wurde, er hätte schon mal einen Elefanten umgehauen. In Indien. Da, wo die schweren Rüsseltiere kleinere Ohren haben.
»Das Dreckschwein brennt nicht«, stellte Fausti völlig verstört fest.
»Ich sage euch, den Bastard schützt ein schwarzer Zauber«, kam es dunkel über Enzo Lamballos wulstige Lippen. »Ein Höllenzauber. Irgendeine unsichtbare Kraft. Sie lässt das Feuer nicht an ihn heran, schirmt ihn ab.« Lamballo ahnte nicht, wie richtig er mit seiner Vermutung lag. »Die Flammen können dem Blutsauger aus einem unerklärlichen Grund nichts anhaben.«
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte Federico Tinti, dem die ganze Sache nicht mehr geheuer war.
Obwohl er ein bärenstarker Mann war, hatte er ein ängstliches Prickeln im Bauch, wäre dafür gewesen, alles so zu lassen, wie es war, und auf der Stelle nach Hause zu gehen. Sollten die Flammen den Vampir fressen oder nicht. Egal. Wenn Matteo Ruffallo nicht zu vernichten war, blieb er halt am Leben. Vampire sind eben – wie sich hier sehr augenscheinlich zeigte – nicht so leicht auszulöschen.
Wenn sie Glück hatten, war Ruffallo das heutige Erlebnis eine Lehre und er zog weiter, um anderswo sein widerwärtiges Unwesen zu treiben.
Vielleicht hatten andere dann mehr Erfolg, das gefährliche Scheusal für immer zur Strecke zu bringen. Mit Feuer klappte das jedenfalls nicht – wie man sah. Der unheimliche Vampir hob hinter der züngelnden Flammenwand langsam den Kopf. Seine Augen schienen in Blut zu schwimmen.
Grauenvoll sah das aus. Soeben kerbte sich ein seltsamer Ausdruck um seine schmalen Lippen, an denen noch immer Chiara Cingolanis Blut klebte.
»Seht ihn euch an«, krächzte Enzo Lamballo aufgewühlt. »Seht euch den Widerling genau an.«
»Das tun wir schon die ganze Zeit«, bemerkte Alberto Fausti mürrisch.
»Worauf willst du uns aufmerksam machen, Enzo?«, fragte Federico Tinti. Er hatte sich noch nie so unbehaglich gefühlt.
»Der verfluchte Blutsauger scheint sich selbst nicht erklären zu können, wieso ihm das Feuer nichts anhaben kann«, behauptete Lamballo. »Ich habe den Eindruck, dass er sich nicht selbst schützt ...«
»Sondern wer?«, fragte der Tinti fröstelnd.
Lamballo zuckte mit den Schultern. So genau wusste er das nicht. »Jemand anders.«
»Wer denn?«, wollte Silvio Cingolani wissen. »Außer uns ist doch keiner da.«
»Vielleicht ein unsichtbarer Geist«, mutmaßte Lamballo. »So etwas wie ein ... Keine Ahnung ... Wie ein satanischer Schutzengel. Von der Hölle ausgesandt, um Ruffallo zu retten.«
Fausti schüttelte unwillig den Kopf. »Sei mir nicht böse, Enzo, aber einen größeren Schwachsinn habe ich noch nie gehört.«
Lamballo zeigte auf das unbegreifliche Flammenschauspiel, das sich ihnen nun schon minutenlang bot. »Hast du eine bessere Erklärung für das hier, Alberto?«, fragte er mürrisch.
»Lasst uns verschwinden«, schlug Tinti aufgeregt vor. Er spürte instinktiv, dass man – selbst wenn man noch so stark war – gegen schwarze Kräfte nichts ausrichten konnte. Nicht einmal Samson, Herkules und Ursus zusammen (die mächtigsten Kraftprotze aller Zeiten, wenn man den mannigfaltigen Überlieferungen Glauben schenken konnte) hätten sich gegen das, was die Hölle zu bieten hatte, behaupten können.
Silvio Cingolani schüttelte aufgebracht den Kopf. »Dieses Scheusal hat mein Kind getötet. Matteo Ruffallo darf nicht am Leben bleiben.«
»Aber du siehst doch, dass er nicht verbrennt«, erwiderte Federico Tinti.
»Dann pfählen wir ihn eben«, stieß Silvio Cingolani aufgewühlt hervor. »Oder wir schneiden ihm den Kopf ab. Wir waren uns doch einig, dass Chiaras schrecklicher Tod gesühnt werden muss. Wieso hast du deine Meinung geändert, Federico?«
Tinti sah Chiaras Vater fest in die Augen. »Das kann ich dir erklären, Silvio. Weil ich Angst habe. Ja, ich schäme mich nicht, zuzugeben, dass ich mich ganz schrecklich fürchte. Ich hab die Hose gestrichen voll. Du kannst mir glauben, es tut mir entsetzlich leid und ich bedauere zutiefst, was dieser grausame Teufel deiner Tochter angetan hat. Ich habe Chiara sehr gemocht. Aber nun ist sie tot, und ich spüre, dass wir es auch bald sein werden, wenn wir nicht schnellstens das Weite suchen.«
»Na schön«, blaffte Silvio Cingolani verächtlich. »Wenn du gehen willst, geh. Ich habe dich, offen gestanden, für mutiger gehalten. Aber ich werde dir nichts in den Weg legen und dich nicht daran hindern, den Schwanz einzuziehen und wie ein feiger Hund davonzurennen. Geh, Federico! Verschwinde! Lass uns im Stich! Ich dachte, wir wären Freunde. Einer für alle. Alle für einen. Männer, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Die niemals kneifen. Selbst dann nicht, wenn wir es mit einer Ausgeburt der Hölle zu tun bekommen. Aber ich habe mich geirrt. Du bist bloß ein jämmerlicher Maulheld, spuckst gerne große Töne, und in Wahrheit ist nichts dahinter. Das ist zwar sehr schade, aber bedauerlicherweise nicht zu ändern.« Silvio Cingolani streckte den Arm aus und zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. »Geh!«, sagte er scharf.
Es war das letzte Wort, das ihm über die Lippen kam, denn plötzlich ...
†
Enzo Lamballo, Alberto Fausti, Federico Tinti und all die andern, die mitgekommen waren, um den Vampir brennen zu sehen, erstarrten vor Angst und Schrecken, als etwas Schwarzes durch die Luft pfiff und sich blitzschnell um Silvio Cingolanis Hals schlang.
Eine Riesenschlange? Eine Monsterzunge? Eine Dämonenpeitsche? Der leidgeprüfte Mann, der in dieser schicksalsträchtigen Nacht seine geliebte Tochter verloren hatte, bekam schlagartig keine Luft mehr.
Alle Umstehenden wichen verstört zurück. Als hätte er eine ansteckende Krankheit. Cingolani röchelte schaurig. »Chrck! Chrck! Chrck!«
Das war alles, was er hervorbrachte. Er riss entsetzt die Augen auf. Sein Gesicht war schmerzverzerrt. »Chrck! Chrck! Chrck!« Die Zunge quoll dick zwischen seinen zuckenden Lippen, die sich violett verfärbt hatten, hervor.
Er versuchte verzweifelt die Finger unter dieses gnadenlos würgende Etwas zu schieben. Es gelang ihm nicht. »Chrck! Chrck! Chrck!«
Ihm drohten die Sinne zu schwinden. Niemand wagte ihm zu Hilfe zu eilen. Jeder war heilfroh, dass sich dieses schwarze Etwas nicht um seinen Hals gewickelt hatte. Wenn man sich's genau überlegte, konnte es sich nur um eine Peitsche handeln. Wer hatte damit zugeschlagen?
Wem gehörte sie? Enzo Lamballos verdatterter Blick wanderte die straff gespannte, würgende, schwarze Peitsche entlang – bis zu ihrem Besitzer.
Ein entsetztes »Allmächtiger!«, gefolgt von einem verstörten »Grundgütiger!«, entrang sich seiner Kehle, die – ohne Peitsche – beinahe genauso zugeschnürt war wie jene seines Freundes Silvio Cingolani. »Santa Madonna! Dio mio!«
Chiaras Vater kämpfte verzweifelt um sein arg bedrohtes Leben. Keiner glaubte mehr, dass er diesen Kampf noch gewinnen konnte. Inzwischen stand für alle fest, dass diese Nacht nach seiner Tochter auch ihm zum Verhängnis werden würde. »Chrck! Chrck! Chrck!«
Er sank auf die Knie. Die Peitsche würgte ihn, als wäre sie von unheimlichem Leben erfüllt. Gnadenlos. Seine Atemnot wurde immer akuter.
Sein Herz raste. Seine Lungenflügel brannten, als hingen sie in siedendem Öl. Vor seinen flackernden Augen begannen schwarze Flocken zu tanzen.
Sie schlossen sich sehr rasch zusammen, verklumpten mehr und mehr und ihm wurde klar, dass das das unausweichliche Ende war. Er hörte auf, sich zu wehren, konnte nicht mehr kämpfen, hatte keine Kraft mehr.
Als sich die Flocken zu einer undurchdringlichen schwarzen Einheit verdichtet hatten, kippte er wie ein nasser Sack nach vorn.
Er schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf, doch das spürte er nicht mehr, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Zu Stein erstarrt, hatten ihm seine Freunde beim Sterben zugesehen. Unfähig zu reagieren oder ihm gar beizustehen. Sie konnten nur entsetzt verfolgen, was geschah und mussten den barbarischen Dingen ungehindert ihren Lauf lassen.
Der Vampir stand nach wie vor unversehrt im Feuerkreis und Enzo Lamballo starrte noch immer den unheimlichen Besitzer der schwarzen Peitsche an, die Silvio Cingolani zum Verhängnis geworden war.
»Oh mein Gott!«, flüsterte er, von einer Furcht gequält, wie er sie noch nie verspürt hatte. Am Ende der Peitsche stand ein grauenerregendes Wesen.
Gedrungen, ghoulähnlich (Lamballo hatte noch nie einen Leichenfresser gesehen, aber annähernd so stellte er sich diese widerlichen Kreaturen vor), mit grüner, glänzender Haut, stumpfen Hörnern auf dem kahlen Schädel und gelben Rattenzähnen. Soeben löste das barbarische Scheusal die Peitsche mit einem harten Ruck von Silvio Cingolanis Hals und rollte sie mit träger Gelassenheit zusammen.
Gleichzeitig machte Enzo Lamballo die schockierende Entdeckung – sie traf ihn mit der Wucht eines Keulenschlags –, dass hinter diesem Monster zwei weitere standen, die genauso aussahen wie Nummer eins. Als kämen sie alle aus derselben unbegreiflichen Höllenretorte.
†
Als auch Lamballos Freunde die unheimlichen Kreaturen bemerkten, brach Panik aus und die Männer stürmten in alle Himmelsrichtungen davon.
Rette sich, wer kann ...
Keiner kümmerte sich mehr um den andern. Jedem war es nur noch wichtig, sich selbst in Sicherheit zu bringen, die eigene Haut zu retten.
Zurück blieben ein von den Flammen unversehrt gebliebener Vampir, Silvio Cingolanis Leiche und die drei kahlköpfigen Geschöpfe mit den stumpfen Hörnern und der grün glänzenden Haut. Höllenwesen.
Das stand für Matteo Ruffallo völlig außer Zweifel, obwohl er ihnen noch nie begegnet war. So etwas spürt man, wenn man selbst ein Geschöpf der Finsternis ist.
Er blickte durch den tanzenden Flammenschleier, der ihn umgab, und sagte: »Ihr habt mich gerettet. Das Feuer hätte mich gefressen.«
Die hässlichen Wesen kamen näher.
»Könnt ihr das Feuer löschen und mich losbinden?«, fragte der blutgierige Untote.
»Können wir nicht«, gab der zur Antwort, der Silvio Cingolani das Leben genommen hatte.
»Soll ich etwa für alle Zeiten an diesen Baum gefesselt bleiben?«, fragte Matteo Ruffallo mit unterdrücktem Ärger.
»Sie tun nur, was ich will«, sagte plötzlich eine Stimme aus dem Nichts.
Ein Unsichtbarer etwa?
In der nächsten Sekunde erlebte der Vampir ein Spektakel ganz besonderer Art. Hinter den gedrungenen Gestalten baute sich ein feuerroter Lichtkegel auf, und in diesem erschien eine mysteriöse Gestalt.
Hager, mit granitgrauer Gesichtshaut und spitzen Ohren. Die Erscheinung trug ein braunes Lederwams. Sobald sie aus dem Lichtkegel getreten war, fiel dieser in sich zusammen und war nicht mehr zu sehen.
»Habe ich dir den Fortbestand meiner untoten Existenz zu verdanken?«, erkundigte sich der Blutsauger.
Der andere nickte. »Das hast du.« Seine Zunge war gespalten, deshalb lispelte er.
»Wer bist du?«, erkundigte sich der Vampir.
»Ich bin Mago.«
»Der Schwarzmagier.«
»Ganz recht.«
»Der Jäger abtrünniger Hexen«, sagte Matteo Ruffallo. »Ich habe schon viel von dir gehört.«
»Und ich von dir«, gab Mago zurück. »Aber begegnet sind wir einander noch nie.« Er zeigte auf die gedrungenen Wesen. »Das sind meine Schergen. Sie gehorchen mir aufs Wort. Selbst jeden geistigen Befehl führen sie unverzüglich und bedenkenlos aus. Aber sie wären nicht in der Lage gewesen, dich vor dem Feuer zu schützen. Das habe ich mit meiner Zauberkraft bewirkt. Ich habe dich damit gewissermaßen ummantelt. So konnten die Flammen dir nichts anhaben.«
»Warum hast du das getan?«
Mago zuckte mit den schmalen Schultern. »Wir stehen schließlich auf derselben Seite, gehören dem großen Heer der schwarzen Macht an und ich war zufällig in der Nähe.«
Matteo Ruffallo griente. »Was für ein Glück.«
»Ich konnte nicht zulassen, dass sie einen ›schwarzen Bruder‹ verbrennen.«
Mago ging an seinen kraftstrotzenden Schergen vorbei. Er hob die Hände. Das Feuer begann zu knistern, zu fauchen und zu zischen. Es schien sich nicht löschen lassen zu wollen.
Doch der Jäger der abtrünnigen Hexen zwang den Flammen seinen Willen auf. Sie duckten sich, wurden rasch kleiner und verpufften schließlich.
Nachdem der Schwarmagier den Vampir von seinen harten Fesseln befreit hatte, lispelte er: »Jetzt schuldest du mir was, Matteo Ruffallo.«
Der Untote breitete die – endlich wieder freien – Arme aus. »Sag, was ich für dich tun soll und ich tu's.«
Der hagere Schwarzmagier machte mit seinen dünnen Händen eine dämpfende Geste. »Im Moment brauche ich deine Unterstützung nicht. Ich werde dich irgendwann an deine Schuld erinnern und sie einfordern. Nicht heute. Nicht morgen. Irgendwann. Wir schwarzen Wesen haben keine Eile. Wir sind keine Menschen, rechnen mit anderen Zeitmaßen.« Er grinste. »Schließlich leben wir ewig – wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt.«
Ruffallo zeigte grimmig auf die abgestorbene Eiche, an der sich sein Schicksal hätte erfüllen sollen. »Wie das hier.«
Mago nickte. »Zum Beispiel.«
Matteo Ruffallo bleckte sein kräftiges Vampirgebiss. »Ich werde die Rädelsführer für das, was sie mir antun wollten, grausam bestrafen.«
»Aber sei vorsichtig«, warnte ihn der Schwarzmagier. »Es ist nicht immer ein Höllenbruder in der Nähe, der dir zur Seite steht, wenn du in Bedrängnis gerätst.«
†
All das hatte sich vor langer Zeit zugetragen. Genauer gesagt vor dreihundert Jahren.
Im Jahre des Herrn 1722. Irgendwo im damaligen Fürstentum Venedig.
Als dieses Herrschaftsgebiet noch von Dogen regiert wurde und Antonio Vivaldi, ein bedeutender Komponist und Violinist dieser Periode, seine »Vier Jahreszeiten«, dieses einmalige, grandiose und mit Fug und Recht hochgelobte Meisterwerk, das im Original »Le Quattro Stagioni« hieß, der Welt geschenkt hatte ... Die Zeit blieb natürlich nicht stehen.
Sie ging – einem für Menschen unbegreiflichen kosmischen Zwang gehorchend – unaufhaltsam weiter. Zuerst brach ein neues Jahrhundert an.
Dann ein neues Jahrtausend.
Und schließlich schrieb man das Jahr 2022.