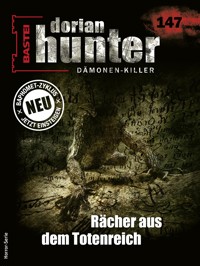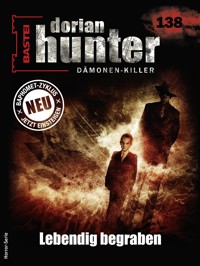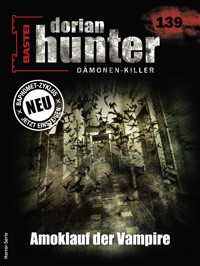1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Im Banne der weißen Göttin
Philippe de Smet packte den brennenden Ast und stürmte aus der Hütte seiner Missionsstation, als er die Trommeln hörte. Heiliger Zorn erfasste den hünenhaften Jesuitenmissionar mit dem graubraunen Vollbart.
Er wagte es also wirklich, der Dämonendiener Lukole, Medizinmann des Bangalastammes!
De Smet stürmte zwischen den Hütten des Dorfes hindurch. Alle Einwohner von Kalabangi hatten sich verkrochen, nur auf dem Dorfplatz vor dem Totempfahl schlugen ein paar Männer die Trommeln. Ihre Augen waren vor Furcht so weit aufgerissen, dass das Weiße darin im Mond- und Sternenlicht schimmerte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Im Banne der weißen Göttin
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati/BLITZ-Verlag
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8867-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Im Banne der weißen Göttin
von Earl Warren
Philippe de Smet packte den brennenden Ast und stürmte aus der Hütte seiner Missionsstation, als er die Trommeln hörte. Heiliger Zorn erfasste den hünenhaften Jesuitenmissionar mit dem graubraunen Vollbart. Er wagte es also wirklich, der Dämonendiener Lukole, Medizinmann des Bangalastammes.
De Smet stürmte zwischen den Hütten des Dorfes hindurch. Alle Einwohner von Kalabangi hatten sich verkrochen, nur auf dem Dorfplatz vor dem Totempfahl schlugen ein paar Männer die Trommeln. Ihre Augen waren vor Furcht so weit aufgerissen, dass das Weiße darin im Mondlicht schimmerte.
Der Pater erreichte die Hütte des alten Zaidi, wo er dessen hagere, grauköpfige Gestalt im Schatten stehen sah. Er packte Zaidi mit einer Hand an der Schulter und schüttelte ihn.
»Deine Tochter!«, schrie er ihn an. »Was ist mit Noami? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich verständigen, wenn Lukole kommt?«
Zaidi zitterte, und seine Zähne klapperten vor Furcht, sodass er kaum ein verständliches Wort hervorbringen konnte.
»Lukole hat die Dämonen der Göttin geholt!«, stieß er hervor. »Geh, Pater, du kannst Noami nicht mehr helfen.«
De Smet stieß ihn weg, dass er taumelte. Er lief zu der Hütte, bückte sich und trat durch den niederen Eingang. Ein blakendes Holzkohlenfeuer erhellte spärlich das Innere der Hütte. In dem einen Raum lag Noami auf einem Felllager in der Ecke. Neben ihr stand Lukole, der Medizinmann.
Er war bemalt und trug ein Leopardenfell. Das Oberteil des Schädels mit den spitzen Zähnen bedeckte seinen Kopf. Lukole schwang eine Rassel in der Rechten. Voller Wut über die Störung starrte er Philippe de Smet an.
So gefährlich, wild und drohend der Medizinmann auch aussah, de Smet hatte nur einen flüchtigen Blick für ihn. Dann wurde seine Aufmerksamkeit von etwas anderem gefesselt.
Über Noami oder auf ihr lag etwas, dessen Umrisse der Pater in der unsicheren Beleuchtung der Hütte nicht richtig ausmachen konnte. Es war schattenhaft, und trotzdem hatte de Smet den Eindruck von etwas Dämonischem, Bösem und Abscheulichem. Ihm war, als hätte dieses Ding Zähne und Klauen, obwohl er es nicht genau erkennen konnte, und als glotze es ihn mit großen Augen an.
De Smet, ein Mann der Kirche und alles andere als eine ängstliche Natur, erbebte bis ins Innerste. Mit Noami war eine furchtbare Veränderung vor sich gegangen. Ihr Haar war weiß, ihre Haut faltig und runzlig.
Und am Nachmittag hatte der Pater sie noch als junges, kaum fünfzehnjähriges Mädchen gesehen, als sie Wasser am Brunnen holte!
Als de Smet näher treten wollte, stellte sich ihm Lukole in den Weg. Er fuchtelte und klapperte mit seiner Rassel. Sein Gesicht war zornverzerrt.
»Frevler!«, schrie er im Bantudialekt. »Du wagst es, den Diener der weißen Göttin zu stören? Das wirst du mit dem Leben bezahlen.«
»Du elender Lump!«, schrie de Smet, und seine Halsmuskeln traten wie Stricke hervor.
Der hünenhafte Pater ließ die Fackel einfach fallen und schlug Lukole die Rassel aus der Hand. Er packte den Medizinmann an der Kehle und schüttelte ihn durch, dass der Leopardenrachen auf seinem Kopf auf und zu klappte.
»Was hast du mit dem Mädchen gemacht? Schick diesen Dämon den du her beschworen hast in den Urwald zurück, oder ich vergesse, dass die Hände eines Dieners Gottes zum Segnen bestimmt sind, und zerschlage dir alle Knochen im Leibe.«
Lukole war ein ganzes Stück kleiner und nicht so breit wie der einsfünfundneunzig große, hünenhaft gebaute Pater. Aber er war stark und gewandt wie der Leopard, dessen Fell er trug. Zudem hatte er seinen Oberkörper eingefettet. Er glitt aus Pater de Smets Griff.
Bevor der Pater ihn wieder packen konnte, stieß Lukole einen hallenden. Schrei aus, der im ganzen Dorf gehört wurde. Er endete mit dem Fauchen eines Leoparden.
Nun überstürzte sich alles. Die Fackel des Paters war zur Seite gerollt, und die aus Holz und Flechtwerk errichtete Seitenwand der Hütte hatte Feuer gefangen. Schon züngelten die Flammen empor. De Smet wollte Noami oder vielmehr die Greisin, die einmal das blutjunge Mädchen Noami gewesen war, packen und aus der Hütte tragen, mitsamt der schattenhaften Schreckensgestalt, die ihr das Leben aussaugte.
Aber Lukole sprang den Pater an, und die beiden ungleichen Männer wälzten sich kämpfend über den Boden. Ein paar kräftig gebaute Schwarze vom Stamm der Balanga drangen in die Hütte ein. Sie rissen die Kämpfenden auseinander und schleppten und stießen den Pater aus der Hütte.
De Smet erhaschte einen letzten Blick auf Noami. Sie war jetzt zu einer uralten Frau geworden, und gerade im Augenblick huschte der Schatten von ihr weg und verschwand durch die Hüttenwand. Dann stand der Pater vor der Hütte, an deren einen Seite die Flammen inzwischen aus dem Dach züngelten.
Ein Dutzend Männer fielen über de Smet her. Lukole tanzte um die brennende Hütte, schwang seine Rassel, die er wieder aufgehoben hatte. Er sah im Flammenschein selbst wie ein böser Dämon aus.
»Jagt den weißen Teufel aus dem Dorf!«, schrie er in eigenartig skandierendem Ton. »Er bringt Unglück und Unheil über euch alle. Die Göttin will ihn hier nicht haben. Sie spricht durch meinen Mund. Seht das Fanal der brennenden Hütte!«
De Smet schüttelte die Männer ab, die ihn gepackt hatten. Doch schon sah er ein paar Speerspitzen auf seine Brust gerichtet. Auch hinter ihm standen Männer, die ihn mit Speeren bedrohten. Andere hielten schwere Buschmesser.
Mindestens zwanzig Männer umringten den Pater, weitere Männer und Frauen hatten eine Eimerkette zum Brunnen gebildet. Wasserfluten ergossen sich auf die brennende Hütte. Aber das trockene Holz und das Flechtwerk brannten wie Zunder. Die Hütte war nicht mehr zu löschen.
Die Balanga hatten alle Hände voll zu tun, wenn nicht das ganze Dorf niederbrennen sollte. Überall kamen jetzt Männer und Frauen aus den Hütten, Kinder schrien, und Vieh brüllte. Es war ein totales Durcheinander. Lukole, vom Feuerschein rot angestrahlt, genoss die Verwirrung.
»Jagt den weißen Teufel in den Urwald!«, rief er wieder.
»Verlasse das Dorf, Bwana Pater«, sagte ein älterer Mann. »Wir können dich nicht hier behalten. Verschwinde auf der Stelle, sonst müssen wir dich töten.«
De Smet sah die drohenden Speerspitzen in der Runde, die funkelnden Messer und die verschlossenen, abweisenden Gesichter. Er konnte es noch nicht fassen, dass diese Menschen, für die er so viel getan und die er immer als seine Kinder angesehen hatte, sich gegen ihn wandten, dass sie sich für den Medizinmann Lukole entschieden.
Aber es gab keinen Zweifel.
»Noami verbrennt in der Hütte«, sagte de Smet hilflos.
Ein paar jüngere Männer rückten drohend näher.
»Geh, Pater«, sagte einer, »sonst trifft uns der Zorn der weißen Göttin. Noami ist nicht mehr zu helfen, wir müssen an uns selbst denken.«
Eine Speerspitze drang leicht in de Smets Fleisch. Er sah den Medizinmann triumphierend tanzen und umherhüpfen.
»Ich will meine Sachen holen«, sagte de Smet.
»Du musst ohne alles gehen«, entgegnete der ältere Mann. Der Pater kannte ihn gut, sein Name war Moango. Pater de Smet hatte ihm erst vor ein paar Wochen ein großes Nackengeschwür aufgeschnitten und ausgeheilt. »Lukole sagte es, wir müssen ihm gehorchen, denn er ist der Diener und das Sprachrohr der weißen Göttin.«
Philippe de Smet sah, dass er nicht länger zögern durfte. In ihrer abergläubischen Furcht waren die Eingeborenen unberechenbar. Er drehte sich um und ging los, durch das zu nächtlichem Leben erwachte Dorf, ein Stück die primitive Straße entlang am Ufer des Tschuara und auf den nächtlichen Urwald zu.
Zwölf mit Speeren und Buschmessern bewaffnete Männer flankierten ihn schweigend. Über dem Balangadorf erhellte roter Feuerschein den Himmel, und der Mond schien bleich und kalt herab.
»Geh!«, sagte einer der Balanga, hob den Speer und deutete auf den tropischen, von vielfältigem nächtlichem Leben erfüllten Urwald.
»Ihr macht einen großen Fehler«, begann Pater Philippe de Smet.
Drohend rückten die Eingeborenen näher. Pater de Smet hob traurig die Schultern und nickte.
»Ich vergebe euch«, sagte er. »Ihr wisst nicht, was ihr tut.«
Er wandte sich um und ging ohne ein weiteres Wort in den Urwald. De Smets Kutte blieb an einer dornigen Ranke hängen, er riss den groben Stoff los. Der Pater hatte die Absicht, zwischen den Bäumen und im Unterholz verborgen zu warten, bis die Schwarzen ins Dorf zurückgekehrt waren, und dann auf der Straße weiterzumarschieren.
Zwar war die unbefestigte Straße nicht mehr als ein ganz miserabler Feldweg, aber immerhin war sie doch einem Marsch durch den nächtlichen Urwald mit seinen Schlangen, Raubtieren und tausend anderen Gefahren bei Weitem vorzuziehen.
Aber die mit Lendenschurzen und Fellumhängen bekleideten Balanga machten keine Anstalten, unverzüglich ins Dorf zurückzukehren. Pater de Smet machte sich auf eine Wartezeit gefasst. Er kauerte vor einem Busch, dessen Blüten in der Dunkelheit weiß leuchteten.
Da beschlich ihn unvermittelt ein Entsetzen, das er nicht beschreiben konnte. Es war, als presse eine eiserne, eisige Faust sein Herz zusammen und schnüre ihm die Luft ab. Philippe de Smet hatte es immer für dumme Redensarten gehalten, dass jemand vor Entsetzen gelähmt sein konnte, dass ihm die Haare zu Berge standen und eine Gänsehaut seinen ganzen Körper überzog vor Angst und Schrecken.
Jetzt erlebte er es am eigenen Leib. Etwas beschlich ihn in der Dunkelheit, etwas unvorstellbar Grausiges und Entsetzliches. Plötzlich wusste Pater de Smet instinktiv, dass es derselbe Dämon war, das gleiche Schattenwesen, das Noami das Leben ausgesaugt und sie in ein uraltes Wrack von einem Menschen verwandelt hatte.
Zitternd sah de Smet sich um, doch er konnte nichts entdecken unter der Finsternis des dichten Laubdachs der Urwaldriesen. In der Ferne schrie ein Urwaldvogel. In de Smets Nähe aber war es still, obwohl der Urwald vor Leben hätte vibrieren müssen. Etwas hatte die Stimmen des Dschungels zum Schweigen gebracht, hatte selbst den streifenden Leoparden und die zeternden, lebhaften Affen vertrieben.
Grauenvoll sickerte die Stille in de Smets Gehirn ein. Schon wollte er sich zu den Balanga flüchten, wollte lieber ihren Speeren trotzen, als das Grauen im nächtlichen Urwald weiter aushalten, da packte es ihn.
De Smet wusste nicht, was ihn ansprang und woher es kam. Er bäumte sich verzweifelt gegen die Berührung auf, und er begann furchtbar zu schreien.
Die Balanga hörten sein Gebrüll, das allmählich in ein Röcheln überging, und ihre Gesichter wurden grau vor Furcht. Sie zogen sich langsam vom Rand des Urwalds zurück, und als sie eine gebührende Entfernung zurückgelegt hatten, rannten sie los, auf ihr Dorf zu, als wären tausend Teufel hinter ihnen her.
✞
Zweieinhalbtausend Kilometer Fahrt über Straßen, die man eigentlich gar nicht als solche bezeichnen konnte, lagen hinter Franklin O’Haras Expedition. Was die Expeditionsmitglieder erlebt hatten, seit sie vor dreieinhalb Wochen mit zwei Land Rovers und einem Kleinlastwagen von Nairobi aufgebrochen waren, das hätte ein Buch gefüllt.
Franklin O’Hara, einer von den steinreichen Wallstreet-O’Haras, hatte sich in den Kopf gesetzt, Forscherruhm zu ernten. Seine Theorien, im Kongo hätte es eine prähistorische weiße Kultur gegeben, hatten ihm schon viel Spott eingebracht, aber das konnte ihn nicht erschüttern.
O’Hara, ein fünfundvierzigjähriger Mann von robustem Äußeren, hatte gut daran getan, den Afrikakenner Pierre Valois als Führer der Expedition anzuwerben. Valois, ein früherer Medizinstudent, hatte wegen irgendeiner dunklen Affäre Frankreich verlassen. Er war nach Afrika verschlagen worden und hatte als Söldner zunächst unter Black Jacques Schramme gedient, später aber eine eigene Abteilung befehligt.
Valois ging aus dem Desaster am Kongo als ein Mann ohne alle Illusionen und von einigem Vermögen hervor. Nur von seinem Sold, wenn dieser auch nicht unbeträchtlich war, konnte er sein Vermögen nicht erworben haben. Aber in den Kriegswirren bot sich einem entschlossenen und cleveren Mann manche Gelegenheit, zu Geld zu kommen.
Valois galt als hart, aber er genoss die Achtung und den Respekt nicht nur seiner Söldnerkameraden, und es war allgemein bekannt, dass er kein Halunke, Verbrecher und Rohling war wie manch anderer aus der Söldnertruppe.
Ende der Sechziger Jahre hatte Valois sich vom Söldnergeschäft zurückgezogen und sich mit einer Export-Import-Firma in Nairobi, Mombasa und Daressalam versucht. Sein Partner hatte ihn schändlich betrogen, das gesamte Geld des hochverschuldeten Unternehmens in Diamanten angelegt und war geflohen.
Valois war nicht der Mann, so etwas hinzunehmen. Er verfolgte seinen flüchtigen Partner und stellte ihn endlich im Matabeleland. Was da genau vorgegangen war, wusste kein Mensch, jedenfalls tauchte Pierre Valois eines Tages mit einer Schusswunde in der Schulter und den Diamanten in der Tasche in Salisbury auf.
Danach hatte Valois die Teilhaberschaft an einer Safarifarm am Ostufer des Viktoria-Sees gekauft. Sechs Monate im Jahr leitete er den Betrieb auf der Safarifarm, schlug sich mit finanzkräftigen Touristen und ihren Sonderwünschen herum und bewahrte Waschmittelkonzernerbinnen und ihren Anhang davor, in der Serengeti von Löwen aufgefressen zu werden. Das restliche halbe Jahr ging Valois seinen Interessen nach; er reiste oder tat nichts, oder er ließ sich auf irgendwelche Abenteuer ein, mit denen kein vernünftiger Mensch etwas zu tun haben wollte und die ihm als Herausforderung erschienen.
Unter Valois’ Führung war die Expedition von Nairobi nach Kampala gelangt, von dort an der Ruanda-Grenze entlang weiter durchs Berggebiet des Virunga-Vulkan-Massivs am Westufer des Kiwu-Sees entlanggefahren und über die Grenze nach Zaire eingereist. Die Einreise nach Zaire erfolgte bei Bukavu, und sie war nicht schwierig.
Nach ewiger Warterei in glühender Sonne rückten die Expeditionsfahrzeuge in der Karawane der Wartenden bis zum aus Holz errichteten Abfertigungsgebäude vor. Ein schwarzer Major mit Shorts, beachtlichem Bauch und von amerikanischem Dosenbier blutunterlaufenen Augen brüllte herum, wollte die Fahrzeuge beschlagnahmen und die neun weißen Expeditionsmitglieder und die fünf eingeborenen Träger und Arbeiter verhaften.
Er erhielt einige Banknoten in Dollarwährung, vom Zairegeld wollte er nichts wissen. Danach brüllte er schon weniger laut und wollte nur noch die Fahrzeuge beschlagnahmen. Weitere Dollarscheine ließen ihn auch darauf verzichten, und als er noch einige letzte Banknoten bekam, verzichtete er selbst auf die Kontrolle der Fahrzeuge und Pässe und kehrte in seine Holzhütte zum Dosenbierkarton zurück.
Die Expedition konnte weiterfahren. Erhebliche Umwege mussten in Kauf genommen werden, denn an ein ausgebautes Straßensystem war nicht zu denken. Durch tropischen Urwald führte die Strecke zum Kongo und folgte diesem ein Stück. Acht Tage lag der Kleinlastwagen mit gebrochener Hinterachse auf der Strecke, während die beiden Land Rover nach Kisangani, dem früheren Stanleyville, vorausfuhren. Valois hatte Glück, kurz zuvor hatte knapp vor Stanleyville ein Dodge-Kleinlaster seinen Motor aufgegeben, und dessen Achse ließ sich verwenden.
Valois kehrte mit seinen Begleitern zurück, der Lastwagen wurde repariert, die Fahrt ging weiter. In Kisangani warb Valois zehn weitere Eingeborene an. Franklin O’Hara rechnete fest mit Ausgrabungsarbeiten. Er sah sich schon als zweiten Heinrich Schliemann und Forschergröße mit Weltruhm.
Oberhalb der Stanley-Fälle überquerte die Expedition den Kongo und erreichte auf einer Schlammstraße mehr schwimmend als fahrend den Lomami. Hier zogen sich die Verhandlungen mit dem Fährmann, der ein erpresserisches Wuchergeld verlangte, zwei Tage hin und endeten erst erfolgreich, als Pierre Valois zusammen mit dem gleichfalls zur Expedition gehörenden Ex-Schwergewichtsboxer und Ex-Söldner Lino Gemma zum Fährmann ein ernstes Wort gesprochen hatte.
Durch tropischen Regenurwald ging es zum Tschuara. Das Klima in der Äquatorgegend war mörderisch. Am Tschuara lag die Expedition drei weitere Tage mit einem Motorschaden an beiden Wagen, und dann ging es endlich über einen Weg, der alle bisher befahrenen in den Schatten stellte, zum Dorf Kalabangi weiter, wo man Pater Philippe de Smets Missionsstation aufsuchen wollte.
Das Dorf war da, die Missionsstation auch, nur vom Pater fehlte jede Spur. Pierre Valois stieß auf eine Mauer des Schweigens. Angeblich sollte de Smet im Dschungel verschollen sein, aber sein Jeep stand noch in der Wellblechgarage bei der Missionsstation. Mbangu, sein eingeborener Helfer, ein geschickter Mechaniker und Handwerker, war auch nicht aufzutreiben.
Die Dorfbewohner, Angehörige des Balangastammes, sagten, er habe schon drei Tage vor dem Verschwinden des Paters das Dorf verlassen.
Valois’ Fragen nach einer geheimnisvollen Ruinenstadt im Dschungel, von der Pater de Smet an die Zentrale der amerikanischen Ordensprovinzen der Jesuiten in Washington geschrieben hatte, wurden mit einem Kopfschütteln oder Achselzucken beantwortet. Die Einwohner von Kalabangi verhielten sich zwar nicht gerade feindselig, aber es war klar zu erkennen, dass sie die Expedition lieber heute als morgen wieder hätten verschwinden sehen.
Den Möchtegern-Schliemann Franklin O’Hara konnte das aber nicht abhalten.
»Ich harre hier aus«, schwor er, »bis ich entweder die Stadt im Dschungel gefunden habe oder definitiv weiß, dass es sie nicht gibt.«
Er ahnte nicht, wie sehr er diesen Schwur noch bereuen sollte.
✞
Über Funk nahm Pierre Valois Verbindung mit Mbandaka auf, der Hauptstadt der Provinz Équateur. In Mbandaka gab es ein paar Handelsstationen, und zwischen hundertfünfzig und zweihundert Weiße lebten hier. Auch der Jesuitenorden besaß hier eine Niederlassung, die allerdings nicht von einem Ordensbruder geleitet wurde.
Der Mann in Mbandaka, von Valois durch vierhundert Kilometer wildesten Dschungel und unwegsame Sümpfe getrennt, konnte nicht viel tun. Er bedauerte Pater de Smets Verschwinden, sagte, er wolle die Meldung weiterleiten und wünschte der Expedition Glück.
Nach dem Funkgespräch ging Valois zu O’Haras Zelt. Die Expedition hatte am Rande des Dorfes Kalabangi, das sich am rechten Ufer des Tschuara befand, ihr Lager aufgeschlagen. Das Dorf war von einigen kümmerlichen Mais- und Maniokfeldern umgeben, hinter denen wie eine massive grüne Mauer der Urwald stand. Es beherbergte nicht mehr als dreihundertzwanzig Menschen.