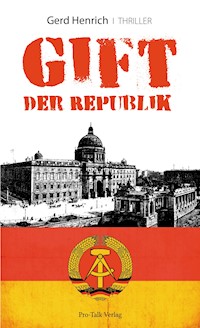
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pro-Talk Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Geheime DDR-Labore entwickeln ein verheerendes Gift, welches in den Wirren der Wendezeit verschwindet. Als das tödliche Serum Jahre später von der Tochter des einstmals leitenden Forschers wiederentdeckt wird, ist das der Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung. Das Gift wird zum Spielball mächtiger Organisationen. Bis es schließlich in die völlig falschen Hände gerät... Ein fulminanter Thriller um eine schreckenerregende Geheimwaffe und zugleich eine spannende Tour de Force durch die Geschichte Berlins und seines Schlosses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Henrich
GIFT
DER REPUBLIK
Vorwort
Im Archiv der Stasi-Hauptverwaltung XXII wurden Akten mit einem Umfang von mehr als 4000 Seiten von der Gauck-Behörde entdeckt. Die Dokumente der AGM/S (Arbeitsgruppe Minister im Ministerium für Staatssicherheit) umfassen Jahrespläne, Ausbildungsunterlagen und Befehle der DDR, die von 1964 bis in die Zeit kurz nach der Wende reichen. Diese belegen den Verdacht, der von MfS-Generälen stets zurückgewiesen wurde, die Stasi habe eigene „Spezialkämpfer” für Mord- und Terroranschläge ausgebildet.
Aus zahlreichen Berichten in Tageszeitungen, Magazinen und Büchern, die auf diesen Belegen sowie Zeugenaussagen basieren, geht hervor, in welchen Fertigkeiten diese sogenannten Tschekisten ausgebildet wurden. So trainierte die Eliteeinheit unter anderem das Liquidieren von Personen, erhielt Unterricht zu Sprengstoff- und Giftanschlägen sowie eine Ausbildung im Schießen und tödlichen Nahkampf. Ziel des Trainings war die physische Vernichtung von Einzelpersonen und Personengruppen. Dies geht aus einem Dokument des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) von 1973 hervor. Die Methoden zur Tötung umfassten das Erschießen, Erstechen, Verbrennen, Sprengen, Strangulieren, Erschlagen, Ersticken oder Vergiften. Besondere Aufmerksamkeit wurde insbesondere der lautlosen Annäherung und dem lautlosen Töten gewidmet.
Ende der 1980er Jahre wurde die Ausbildung weiter „optimiert”. Der Leiter des Dienstbereichs zwei der AGM/S, Heinz Stöcker, verantwortete 1984 die Bereitstellung aufgabenbezogener operativ-technischer Einsatz- und Kampfmittel. Diese waren unter Zuhilfenahme aller verfügbaren wissenschaftlich-technischen Kenntnisse zu entwickeln. Dabei wurden neue, geheimdiensttaugliche Spezialwaffen getestet. Das Training umfasste die Anwendung von Aerosolen und Gasen, Narkotika und Giften sowie auch den Einsatz radiologischer Kampfstoffe. Zur Entwicklung dieser Stoffe unterhielt die DDR Geheimlabore, die nur einem kleinen Kreis von Funktionären und Mitarbeitern bekannt waren.
Die bis heute im Zusammenspiel aller, auch westlicher, Geheimdienste übliche Strategie, einerseits mit Diensten befreundeter Nationen zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, sich andererseits aber gleichzeitig gegenseitig auszuspionieren, war auch schon vor der Wende Usus, beispielsweise zwischen KGB und Stasi. Einen Einblick in dieses schmutzige Geschäft erhielt die breite Öffentlichkeit dieser Tage nicht zuletzt durch die Enthüllungen Edward Snowdens.
Was aber, wenn geheime Erfindungen aus den Mord-Laboren der DDR in den Wirren der Wende vertuscht wurden? Und sie dann später in verbrecherische Hände gerieten? Davon handelt diese Geschichte.
Einige Personen der Zeitgeschichte, die in diesem Buch Erwähnung finden, leben heute noch. Die Geschichte selbst ist jedoch frei erfunden, vermutlich …
Überall geht ein frühes Ahnen dem späteren Wissen voraus.
Alexander von Humboldt
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
Kapitel 128
Kapitel 129
Kapitel 130
Kapitel 131
Kapitel 132
Kapitel 133
Kapitel 134
Kapitel 135
Kapitel 136
Kapitel 137
Kapitel 138
Kapitel 139
Kapitel 140
Kapitel 141
Kapitel 142
Kapitel 143
Kapitel 144
Kapitel 145
Kapitel 146
Kapitel 147
1
1571
Berlin, 1571DIE WEISSE FRAU
Nachdem er mit seiner Jagdgesellschaft über den Jahreswechsel tage- und nächtelang ausufernd gefeiert hatte, verstarb am 3. Januar 1571 Kurfürst Joachim II. Hector plötzlich und unerwartet. Unglücklicherweise war sein Leibarzt Paul Luther gerade nicht anwesend.
Sein Leben verbrachte Joachim II. Hector in Prunk und Protz. Im Stile der Renaissance-Fürsten glaubte er sich über die Gebote gesellschaftlicher Moral erhaben. Schon während seiner ersten Ehe mit Magdalena von Sachsen verbrachte er unzählige Nächte mit den unterschiedlichsten Frauen. Er führte ein ausschweifendes Leben und frönte insbesondere seiner größten Leidenschaft, der Jagd. So ließ er eigens einen Weg vom Berliner Stadtschloss bis zu seinem Lieblings-Jagdschloss „Zum Grünen Walde” bauen. Dieser Dammweg sollte später Kurfürstendamm benannt werden und zu Weltruhm gelangen.
Nach dem frühzeitigen Tod seiner Frau 1534 heiratete er wenig später erneut. Als seine zweite Frau, Hedwig von Polen, 1549 bei einem Unfall einen schweren Beckenbruch erlitt, nahm sich der Kurfürst gar eine bürgerliche Geliebte, die er in aller Öffentlichkeit präsentierte. Anna Dietrich, geborene Sydow, war die Frau eines Geschützgießers. Mit ihr zeugte der Kurfürst mehrere Kinder. Nicht einmal er selbst wusste genau, wie viele uneheliche Kinder zu seinem ehelich gezeugten Nachwuchs hinzukamen.
Das erste Mal traf Anna auf den Fürsten, als dieser in der Werkstatt ihres Mannes neue Geschütze inspizierte. Von Anfang an schien er sich deutlich mehr für die Ehefrau des Gießers als für dessen kunstvoll aus Eisen gefertigte Feuerwaffen zu interessieren. Joachim II ließ Anna vortreten und betrachtete sie unverhohlen von allen Seiten, während seine Entourage peinlich betreten zur Seite schaute. Der Eisengießer schäumte innerlich vor Wut. Noch am selben Abend ließ der Fürst die Frau zu sich ins Berliner Schloss bringen. Ihrem Mann wurde zu verstehen gegeben, dass es besser für ihn wäre, sich zu fügen.
Man führte Anna in das Zimmer Joachim Hectors, wo er sie zu sich treten ließ und sie mit seinen lüsternen Augen begutachtete.
„Wie heißt du, mein Kind?”, fragte er. In Schockstarre stand sie regungslos vor ihm. „Nun, mein Kind, du willst nicht reden und mir deinen Namen nennen? Ich bin sicher, du wirst ihn später vor Freude herausschreien. Bis dahin werde ich dich eben meine schöne Gießerin nennen.”
„Herr…”, stammelte sie.
„Du musst jetzt nicht reden, meine Kleine”, unterbrach er Anna. „Ich habe Verständnis für deine Schüchternheit. Ich finde sie geradezu erregend”
Eine Zeitlang saß er schweigend vor ihr, den Blick auf sie gerichtet.
„Du gefällst mir. Du wirst eine Zeitlang hierbleiben dürfen.”
„Aber Herr…”, platzte es entsetzt aus ihr heraus.
„Kein Aber”, unterbrach er sie erneut. „Sieh mal, meine schöne Gießerin. Meine Frau ist schwer verletzt. Sie kann ihren ehelichen Pflichten nicht nachkommen. Ich aber bin ein Mann. Ich benötige dringend Ersatz für meine Lenden. Ich suche schon seit vielen Wochen. Aber diese aufgeplusterten Weiber um mich herum stoßen mich ab. Ich suche so etwas wie dich. Einen frischen Wind. Eine zarte, schüchterne Rose. Ein scheues Reh. Eine Frau, die natürliche Schönheit ausstrahlt. Wenn dir deine Familie lieb ist, solltest du mir stets zeigen, wie sehr du dich darüber freust.”
Anna ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie die nächsten 22 Jahre mit diesem Mann verbringen würde. Bis zu seinem Tod.
Es waren keine schlechten Jahre an der Seite des Fürsten. Die Bediensteten lasen ihr die Wünsche von den Augen ab. Sie erhielt alles, wonach sie verlangte. Hin und wieder konnte sie auch ihre Familie besuchen, der es, zumindest finanziell, an nichts mehr fehlen sollte. Schwierig wurde es nur, wenn sie auf den Sohn des Kurfürsten, Johann Georg, traf. Obwohl Johann Georg seine Mutter Magdalena bereits im Alter von neun Jahren verlor, vermisste er sie Zeit seines Lebens sehr und ließ alle weiteren Frauen an der Seite seines Vaters spüren, wie sehr er sie verachtete.
Je älter Johann Georg wurde, desto mehr erzürnte ihn diese „bürgerliche Schlampe”. Anna begann zu ahnen, dass ihr, sollte Joachim Hector vor ihr sterben, durch seinen Sohn Schlimmes widerfahren könnte. Mehrfach sprach sie den Kurfürsten auf ihre dunkle Ahnung an. Doch dieser beruhigte sie, indem er seinem Sohn das Versprechen abnahm, Anna nach seinem Tod zu schonen.
In einer kalten Januarnacht 1571 brachten Boten Johann Georg die Nachricht vom Tode seines Vaters. Der neue Kurfürst sorgte am darauffolgenden Tag in einer seiner ersten Amtshandlungen dafür, dass man Anna unter einem Vorwand in die Zitadelle Spandau bringen und im Juliusturm einschließen ließ. Das Verlies im Keller des Wachturms war kalt und feucht. Der Sockel des Turmes bestand aus 3,6 Meter dicken Wänden. Es stank nach Ausscheidungen und unter dem Stroh, das Anna als Schlaflager diente, kroch Ungeziefer hervor. Die Wärter im Turm waren grobschlächtige Männer. Besonders einer von ihnen wurde für Anna im Laufe der kommenden Jahre zum Teufel auf Erden. Der nach Bier und Schweiß stinkende behaarte Riese, der von den anderen Wächtern Frans gerufen wurde, verging sich mehrmals in der Woche an ihr. Immer, wenn die schweren Schlüssel in die eiserne Gittertür gesteckt wurden und sich die Scharniere quietschend drehten, wusste sie, was auf sie zukam.
Immer öfter dachte Anna daran, ihn umzubringen. Es wäre leicht für sie. Sie war darauf vorbereitet. Aber was dann? Mehrere Wächter hausten im Turm. Bevor sie eine Treppe geschafft hätte, hätte man sie mit ihrer zierlichen Figur schon überwältigt. So wartete sie auf den rechten Augenblick.
Unmittelbar nach der Nachricht vom Tod Joachim Hectors hatte Anna Arsenpulver in ein kleines Gefäß aus Ton gefüllt und es mit einem Wachskorken versiegelt. Sie hatte es mit dünnem Leder umwickelt und in den Saum ihres Unterkleides eingenäht. Das Arsenpulver hatte sie gleich nach der Entführung durch den alten Fürsten von ihrem Mann erhalten, „für alle Fälle”. Als Kanonengießer hatte es ihrem Gatten keine Schwierigkeiten bereitet, dieses heimlich herzustellen, indem er arsenhaltiges Erz erhitzte und den Rauch zu einem Gift-Pulver verdichtete. Zwar fühlte sich Anna mit einer solchen Waffe sicherer, nur geholfen hatte sie ihr bisher nicht. Das Gefäß lag noch ungenutzt in einer Ritze des dicken Mauerwerkes.
Als ihr nach vier endlosen Jahren der Krankheit und des Hungers zunehmend die Kräfte schwanden und sie für immer längere Zeiträume in Bewusstlosigkeit versank, beschloss sie, ihrem Elend ein Ende zu machen. Aber Anna hatte nicht vor, den Weg in die Dunkelheit alleine zu beschreiten.
Der widerwärtige Frans würde für seine Sünden büßen müssen.
Sie legte das Pulver bereit und wartete auf seinen nächsten Besuch. Endlich, dieses Mal konnte es nicht schnell genug gehen, öffnete sich das eiserne Tor zu ihrer Unterwelt. In den letzten Jahren hatte sie schmerzhaft lernen müssen, dass Gegenwehr bei seinen Übergriffen nutzlos war. Dies gereichte ihr nun zum Vorteil. Nachdem er die Tür wieder von innen verschlossen hatte, legte Frans sich auf das selten gewechselte und verschmutzte Stroh, um sich bedienen zu lassen. Seine Hose hatte er schon bis auf die Knöchel heruntergelassen.
Anna hielt das Giftfläschchen verborgen in der Hand und setzte sich auf seinen schmachtenden Körper. Mit dem Daumen drückte sie den Wachsverschluss der Flasche beiseite. Frans, der mit geschlossenen Augen seinen Gelüsten freien Lauf ließ, sah nicht, wie sie sich das Pulver in den Mund schüttete. Sofort beugte sich Anna nach vorne und ihre Lippen landeten auf seinen. Freudig erregt öffnete der Riese seinen Mund, um ihre Zunge zu empfangen. Diesmal musste Anna ihre Übelkeit nicht zurückhalten und übergab sich unmittelbar, nachdem sie den fauligen und alkoholhaltigen Geruch seines Atems in die Nase bekam. Durch den bitteren Geschmack des Arsens unterstützt, schoss ein breihaltiger, tödlicher Schleim in den Rachen des Mannes. Er kam nicht umhin sofort zu schlucken, um nicht zu ersticken, weil Anna mit aller verbliebenen Kraft seinen Mund mit dem ihren verschlossen hielt.
Wutentbrannt wollte Frans sie abschütteln und seinen Zorn an ihr auslassen, als schlimme Krämpfe seinen Körper schüttelten. Ihm wurde speiübel, und er musste erbrechen. Er konnte auch nicht verhindern, dass sich sein Darm entleerte. Frans begann zu schreien, während die Koliken immer heftiger wurden. Er fing an gleichzeitig zu schwitzen und zu frieren. Was hatte diese Hexe nur mit ihm gemacht? Wieder wollte er sich auf sie stürzen, konnte aber nur noch verschwommen sehen. Endlich hatte er Anna erblickt und sah zu seinem Erstaunen, dass auch sie sich von Todeskrämpfen geschüttelt am Boden wälzte.
Verwundert stellte er fest, dass sie über ihre Schmerzen zu lachen schien. Oder über mich, dachte Frans, der mit diesem Gedanken in ein Koma fiel, aus dem er nicht mehr erwachen sollte. Anna hatte wirklich einen Moment lang gelacht, als sie sah, wie der große Frans sich gleich einem Kind in Krämpfen wandte. Aber das war nur ein kurzer Augenblick. Zu qualvoll gestaltete sich ihr eigener, selbstgewählter Todeskampf. Mit ihren letzten Gedanken beschwor Anna alle Geister, fortan die Mächtigen der Welt für ihre Verbrechen bestrafen zu dürfen. Anna Sydow starb im Jahre 1575.
Als das Gespenst der weißen Frau erschien sie in den kommenden Jahrhunderten immer wieder im Berliner Schloss, um den Tod der Herrschenden zu verkünden.
Hausarbeit von Katja Granow, Wintersemester 1992/1993Freie Universität Berlin, Fachbereich Geschichtswissenschaft
2
1984
Leipzig, Juli 1984
Die 13-jährige Katja drückte fest die Hand ihres Vaters und wollte sie nie mehr loslassen. Zu selten hatte er Zeit für sie. Wegen seines Berufes kam er häufig für längere Zeit nicht nach Hause. Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass sein Beruf Biochemiker sei. Sie wusste zwar nicht so richtig, was dieses Fachgebiet alles umfasste, aber scheinbar war seine Arbeit mit vielen Reisen verbunden. Schon bald, so hatte er ihr gesagt, müsse er wieder für lange Zeit eine wichtige Dienstreise antreten. Im Dienste des Vaterlandes.
Doch wenn er einmal Zeit für sie hatte, schenkte er Katja seine volle Aufmerksamkeit und Liebe. Häufig unternahmen sie dann Ausflüge, so wie heute in den Leipziger Zoo. Katja und ihr Vater liebten Zoobesuche. Am liebsten beobachteten sie die Raubkatzen, auch wenn diese häufig nur träge herumlagen. Doch heute war es im Tigergehege alles andere als ruhig. In der Luft lag eine ungewohnte Spannung und pures Adrenalin. Ein kleines Karnickel hatte sich, auf welche Weise auch immer, ins Gehege verirrt. Katjas Vater strahlte über das ganze Gesicht. Hatte er etwa dabei seine Finger im Spiel gehabt?
„Sieh mal, Katja”, rief er begeistert, „er hat es mit seinen Augen fixiert!”
Der Tiger kauerte sprungbereit auf dem sandigen Boden. Wenige Meter entfernt hockte der kleine zitternde Nager, wohl ahnend, dass seine letzte Stunde gekommen war. Ein Entkommen war unmöglich. Hinter dem Kaninchen lag ein tiefer Graben, der das Tigergehege begrenzte. Vor ihm versperrte das mächtige Raubtier jeden Fluchtweg. Wie paralysiert starrte das niedliche Langohr zum Tiger. Dieser ließ sich offensichtlich Zeit. Ob er wohl die Vorfreude genoss?
„Gleich wird er einen Satz nach vorne machen und es packen”, sagte ihr Vater. „So ist das Gesetz des Dschungels, wo er herkommt. Nur der Stärkere überlebt.”
Trotz dieser Ankündigung versetzte die plötzliche und tödliche Attacke des Tigers der kleinen Katja einen Schreck, während ihr Vater vor Vergnügen in die Hände klatschte. Nach einem kurzen Biss hielt die Raubkatze das Opfer zwischen ihren großen Vordertatzen und begann genüsslich das köstliche Mahl. Vom ersten Schreck erholt, beobachtete Katja fasziniert die majestätische Katze. Das Töten von Tieren bereitete ihr grundsätzlich kein Unbehagen. Als Tochter eines passionierten Jägers durfte Katja ihren Vater schon häufig bei gemeinsamen Jagdausflügen mit Onkel Erich begleiten. So hatte sie bereits viele Male Wild sterben sehen.
Da Onkel Erich nicht der beste Schütze war, hatte Katja mehrfach erleben müssen, wie die schlecht getroffenen Tiere sich in ihren Schmerzen wanden, bis sie endlich durch den Fangschuss erlöst wurden. Ihr Papa und Onkel Erich verstanden sich gut und lachten viel zusammen, deshalb konnte auch sie ihn ganz gut leiden. Ansonsten mochte sie, abgesehen von ihrer Mama, nicht allzu viele andere Menschen. Die meisten waren ihr einfach egal.
Sie beteiligte sich nicht an dem üblichen Kräftemessen ihrer Altersgenossen, dem okWer ist der Stärkste oder Erste, oder wer kennt das größte Geheimnis?”. Katja fand es viel erstrebenswerter, ständig neue Dinge zu lernen. Nicht nur das, was die Lehrer an Inhalten boten, sondern gerade Dinge, von denen sie nichts wussten oder die sie verschwiegen. Deshalb genoss sie es beispielsweise, wenn ihre Eltern Besuch hatten und sie zuhören durfte, was die Erwachsenen so erzählten. Besonders wenn sie sich über die BRD unterhielten.
Wie sie wusste, war Onkel Erich als Generalsekretär der wichtigste Mann im Land. Umso schöner fand sie es, dass ihr Vater mit einem so wichtigen Menschen befreundet war. Das wussten auch die anderen Kinder in der Schule und bei den Jungpionieren. Niemand wagte es, etwas zu ihr zu sagen oder zu tun, das sie nicht mochte. Eigentlich ganz praktisch.
Nachdem der Tiger seine Festmahlzeit beendet hatte, gönnten sich Vater und Tochter zum Abschluss dieses aufregenden Zoobesuchs noch ein Eis. Heute schmeckte es besonders gut.
3
1986
Berlin, 1986
Die Gründung des geheimen Forschungslabors „Biosphäre” war beschlossene Sache. Die Initialzündung hierfür war ein bilaterales Gespräch wenige Monate zuvor. An einem regnerischen Herbsttag hatten sich Erich Honecker und Dr. Frank Granow zu einer wichtigen Besprechung getroffen. Die Verabredung kam auf Granows Wunsch hin zustande, der seinem Freund und Mentor einen Plan unterbreiten wollte. Sie trafen sich in Honeckers Haus mit der Nr. 11 in der Waldsiedlung Wandlitz, in der sich insgesamt 23 Wohnhäuser für Politbüromitglieder befanden.
Granow, der die Abteilung Entwicklung und Erprobung von biologischen und chemischen Waffen im Dienstbereich zwei der AMG/S leitete, hatte zudem als persönlicher Berater des Generalsekretärs Zugang zu Akten aller Behörden, auch der geheimdienstlichen. Er hatte sich gut auf seinen Termin vorbereitet. Sein Plan würde bahnbrechend für die künftige Entwicklung der DDR sein.
Granow wusste von seinem Vater, dass Honecker bei seinem Einzug in den 1970er Jahren die Möbel übernommen hatte. Erich wies ihm einen der durchgesessen Stühle mit gepolstertem Stoffbezug zu und wandte sich zur Bar, die ihren Platz in dem hölzernen Einbauschrank hatte. Er schenkte beiden ein gut gefülltes Glas Cognac ein und setzte sich ihm gegenüber an den hölzernen Tisch.
Nachdem sie angestoßen hatten, begann Granow seinen Vortag:„Erich, ich habe mir den letzten Bericht aus dem Dienstbereich zwei der AGM/S angesehen, in dem von sehr beeindruckenden Entwicklungen berichtet wird. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, und ich will dir nur ein paar entscheidende Auszüge vortragen, bevor ich zu meinem Vorschlag komme.”
„Du hast Recht, Frank”, erwiderte Honecker, „meine Zeit ist knapp. Vor ein paar Tagen hat Erich (Erich Mielke, Leiter des MfS) mir noch am Rande einer Sitzung mitgeteilt, der Bereich zwei würde dringend zusätzliche Mittel benötigen. Ich habe ihn erst einmal vertröstet. Wir werden uns in Kürze dazu zusammensetzen. Er versprach mir einen umfassenden Bericht und wird mir diesen sicher dann in epischer Breite vortragen.” Honecker blickte gequält.
„Der Bericht ist jetzt fertig und ich habe ihn mir schon einmal vorgenommen”, sagte Granow. „Mielke war nicht erfreut, ihn vorab rausrücken zu müssen.”
„Dann schieß mal los, Frank.”
„Losschießen ist das richtige Stichwort. Wie du weißt, gibt es nichts Schöneres, als mit dir auf die Jagd zu gehen. Ich liebe das Schießen. Aber möglicherweise sind andere Vorgehensweisen manchmal weiser, mit Verlaub”, setzte er umständlich an.
„Na du machst es ja spannend, Frank.”
„Ich werde zunächst ein paar Stellen aus dem Bericht herausgreifen: Seit unsere Tschekisten vor ein paar Jahren erfolgreich einen Wartburg mittels elektrischen Impulses gesprengt haben, hat sich viel getan. Wir verfügen derzeit über ein Kräftepotential von rund 1100 Spezialkräften mit einsatzgerechtem Ausbildungsstand. Bereit für Mordanschläge sowie Brand- und Sprengstoffattentate. Natürlich wissen unsere Einheiten, dass unsere Ziele in erster Linie Verkehrsund Versorgungseinrichtungen wie Eisenbahnstrecken, Industrieanlagen, Kraftwerke und Trinkwasserbetriebe sind. In Ballungszentren der Verwaltungsapparate, Fernseh- und Hörfunkstationen sowie örtlichen Einsatzkräfte.
Klar ist aber auch, dass gerade in Friedenszeiten, im Zuge verdeckter Operationen, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien ebenfalls zu den potentiellen Angriffsobjekten gehören. Die Ausbildung dieser Kommandos ist brillant. Sie beherrschen Sprengstoff- und Giftanschläge, das Töten aus großer Entfernung durch Scharfschützen, aber auch den tödlichen Nahkampf. Auf das Vergiften komme ich gleich noch einmal zurück.
Unsere Guerilla-Kräfte haben den Angriff mit und ohne Waffen auf die empfindlichsten Stellen des Körpers und des Kopfes geübt. An Spezialpuppen wurde zum Beispiel der Angriff mit Stichwaffen aus verschiedenen Stichrichtungen trainiert. Unsere Ausbilder empfehlen die Verletzung von Schädeldach, Augen, Geschlechtsorganen, Schläfen und Halsschlagader. Die Ausbildungsrichtlinien beinhalten Methoden der diskreten Tötung von Zielpersonen.
Mein besonderes Augenmerk gilt aber der Anwendung von Aerosolen und Gasen, Narkotika und Giften. In diesem Bereich, und jetzt kommen wir zu meinem Punkt, kann noch wesentlich mehr geleistet werden.”
Honecker gähnte und blickte auf die Uhr. „Also sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, aber es gibt noch Steigerungspotential”, unterbrach er Granow.
„Ganz genau.”
Granow setzte noch einmal an, um den Generalsekretär von der Wichtigkeit seines Anliegens zu überzeugen.
„Erich, wir sind prinzipiell gut aufgestellt. Natürlich. Wir verfügen über eine schlagkräftige Truppe. Aber, mal Hand aufs Herz, wozu nützt uns das derzeit? Offen können wir in diesen Friedenszeiten nicht agieren, und bei verdeckten Operationen besteht ein immenses Risiko, erwischt zu werden. De facto treten wir in der Bekämpfung unserer Feinde auf der Stelle. Aber das kann sich ändern!” Er machte eine bedeutungsvolle Pause.
4
Nachdem Granow noch eine Weile mit Honecker gesprochen hatte, verwies ihn der Generalsekretär an einen Verbindungsoffizier des Ministeriums für Staatssicherheit weiter, um diesem seine Ideen zu erläutern. Da der Generalsekretär seine knappe Zeit für Regierungsgeschäfte benötigte, war es nicht angebracht, ihn unnötig mit Details zu behelligen, andererseits wollte Granow seinem Freund ungern zu viel versprechen, bevor nicht alle Tests abgeschlossen wären, um nicht sein Gesicht zu verlieren. Bevor Granow dazu kam, diesen Mann, ein bekanntes Mitglied des Politbüros, bei ihrem ersten Treffen zu begrüßen, wurde er gleich zurechtgewiesen. Der hohe Repräsentant der SED unterwies ihn, dass er zu diesem Projekt ausschließlich mit seinem Decknamen Horst Petrowski anzureden sei. Sollte sein richtiger Name in irgendeinem Dokument auftauchen, hätte Granow mit schwersten Konsequenzen zu rechnen. Nach dieser Einführung wurde besprochen, dass weiterhin weder Mielke noch andere Genossen eingeweiht werden sollten. Granow erhielt unter der schützenden Hand Petrowskis alle erforderlichen Vollmachten über einen von Petrowski eingesetzten Stab bei der Stasi.
So kannte nur eine Handvoll Eingeweihter den Auftrag der Abteilung „Biospähre”, für die Granow im gesicherten Umkreis von Honeckers Jagdsitz am Drewitzer See in Mecklenburg-Vorpommern ein großes Forschungsgebäude errichten ließ. Zu diesem unzugänglichen „Verwaltungsgebäude”, in dem sich ein hochmodernes Laboratorium verbarg, hatten nur handverlesene Wissenschaftler und Mitarbeiter Zutritt.
Einziger Auftrag von Biospähre war die Erforschung „geheimdienstlich verwendbarer Kampfstoffe”. Das definierte Ziel war die Herstellung unterschiedlicher „Aktivstoffe”, die mit praktikablen Methoden der „Zuführung” zu Abhängigkeit, körperlicher oder geistiger Versehrtheit oder aber zu letalen Folgen führen sollte.
Da Petrowski sich darüber im Klaren war, dass das Ministerium für Staatssicherheit, zuständig für den in- und ausländischen Geheimdienst und damit die erste Anlaufstelle für alle gegnerischen Dienste, von Maulwürfen unterwandert war, hatte er eine weitere, erhöhte Geheimstufe eingeführt.
Er stellte dieses wichtige Projekt unter seine direkte und alleinige Führung. Alle Berichte landeten, von Dritten ungefiltert, direkt auf seinem Schreibtisch. Er entschied, wann sein Stab bei der Stasi was erfuhr. Den ausgewählten Mitgliedern dieses exklusiven Kreises standen sämtliche Ressourcen der Deutschen Demokratischen Republik auf Anforderung zur Verfügung. Begründungen waren nicht erforderlich. Leiter und oberster Befehlshaber von Biospähre war der Biochemiker Dr. Frank Granow, Spezialgebiet Toxikologie.
5
1987
Dresden,November 1987
In der Bezirksverwaltung (BV) Dresden der Stasi beging man den 70. Jahrestag der Oktoberrevolution gemeinsam mit ausgewählten sowjetischen Kameraden. Die rund 150 hauptamtlichen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der Kreisdienststelle Dresden Stadt waren vollständig erschienen. Allerdings wussten sie, dass ein Fernbleiben von dieser Pflichtveranstaltung nicht ungestraft bleiben würde.
Generalmajor Horst Böhm, Leiter der BV Dresden, lief aufgeregt auf und ab. Der Parteiorganisator hatte schließlich angewiesen, „Cognacschwenker, gefüllt zum Anstoßen” bereitzustellen sowie stets frisches Festbier zu reichen. Dieses Fest sollte den sowjetischen Genossen unvergesslich bleiben.
Das Stasi-Protokoll sah 13 Auszeichnungen vor. Unter den Tschekisten, allesamt KGB-Mitarbeiter, die Ehrennadeln und Geschenke erhalten sollten, befand sich auch ein gewisser Oberstleutnant Dimitrij Puschkin. Er erhielt die „Ehrennadel der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft” in Gold. Doch in der BV kannte niemand seinen genauen Aufgabenbereich, da er autark mit einer Sondervollmacht agierte und direkt nach Moskau zu berichten hatte. Bekannt war lediglich, dass er großes Interesse für den anerkannten Wissenschaftler Manfred von Ardenne zeigte, der in einer Villa am Elbhang lebte. Ferner organisierte er Treffen mit Dresdner Studenten und russischen Soldaten.
Andererseits verschwand er oft tagelang, ohne sich abzumelden. Umso erstaunlicher war es, dass dieser Mann eine Auszeichnung erhielt. Möglicherweise in vorauseilendem Gehorsam, da niemand Zweifel hatte, dass er künftig eine wichtige Rolle spielen würde, welche auch immer. Abseits von Gerüchten beinhaltete es Puschkins Aufgabenbereich, die wissenschaftliche Szene zu eruieren und lohnende Ziele auszukundschaften. Einen Mann hatte er hierbei besonders im Fokus: Dr. Frank Granow.
Unter seinem Decknamen Aleksandr Melnikow, Diplomat an der russischen Botschaft, hatte Puschkin an unterschiedlichen offiziellen Feierlichkeiten teilgenommen. Bei einer dieser Gelegenheiten hatte er Granow das erste Mal getroffen, der nach Puschkins Beobachtungen eine enge Verbindung zu Honecker pflegte. Es war dann ein Leichtes herauszufinden, dass beide gemeinsam auf die Jagd gingen. Auch seine Arbeitsstätte blieb Puschkin nicht verborgen: ein Labor in der abgeschirmten Gegend des Jagdsitzes von Honecker.
Nur was trieb er da? Auch Befragungen in der mittleren Hierarchie des ostdeutschen Politbetriebes brachten ihn nicht weiter. Erst eine Beobachtung auf einem Jahresempfang ausländischer Diplomaten lieferte ihm eine ernsthafte Spur. Abseits der Festgemeinde sah er, wie ein hochrangiger Stasi-Verbindungsmann mit dem vietnamesischen Botschafter ungewöhnlich lange in ein vertrauliches Gespräch vertieft war. Sie steckten die Köpfe regelrecht zusammen. Mit dabei: Frank Granow.
Puschkin ging davon aus, dass sie irgendein geheimes Projekt besprachen, und nahm Kontakt mit der KGB-Außenstelle in Saigon auf. Schließlich flog er persönlich in die vietnamesische Hauptstadt, um gemeinsam mit dem dortigen KGB-Büro Nachforschungen anzustellen. Es war ein zähes Unterfangen, aber schließlich zahlte sich seine Mühe aus. Wie er herausfand, planten die Deutschen ein geheimes Urwaldlabor unter der Leitung von Dr. Frank Granow.
6
1988
Bamiyan-Tal, August 1988
Die Mudschahedin hatten sich in einer Höhle verschanzt. Hunderte dieser über 1000 Jahre alten Behausungen befanden sich in der bis zu 100 Meter hohen, nahezu senkrecht abfallenden Sandstein-Klippe, die das Tal prägte. Egal wohin man den Blick wandte, das eintönige Rotbraun der kargen Felslandschaft dominierte sowohl die Ebene des des weiten Hochtales als auch die angrenzenden kahlen Bergrücken des Hindukusch, die wie überdimensionierte steinerne Sanddünen die trockenen Weiten des Tales begrenzten.
Ihre Zuflucht lag etwa 150 Meter von der größeren der beiden gigantischen Buddhastatuen entfernt, die auf Anweisung Mullah Mohammed Omars wenige Jahre später als Götzenwerk zerstört werden sollten.
Auf Basis des Genfer Abkommens vom 14. April 1988 hatte im Mai der Abzug der rund 100.000 russischen Soldaten aus Afghanistan begonnen. Dennoch wurden die abrückenden Konvois immer wieder in Hinterhalte gelockt und angegriffen. Für die Mudschahedin hatte dieses Papier keine Bedeutung. Die Angriffe erfolgten stets in einer Guerilla-Taktik, und bevor sich die Russen ausreichend formieren konnten, waren die Angreifer meist schon wieder verschwunden. Die geschlagenen Invasoren sammelten lediglich ihre Verluste ein und zogen zügig weiter in Richtung der sicheren Grenzen Turkmenistans, Usbekistans oder Tschadschikistans.
Doch dieses Mal hatten die Gotteskrieger Pech gehabt. Ihr Ziel war ausgerechnet ein Aufklärungstrupp der Spezialeinheiten des Generalstabs (GRU). Mithilfe automatischer Maschinengranatwerfer wurde der Überfall mit nur einem Mann Verlust und zwei Verletzten abgewehrt. Schlimmer noch, die vermeintlich leichte Beute setzte den Angreifern wider Erwarten nach. Das Selbstverständnis der sogenannten Speznas ließ es nicht zu, dass der Tod eines Kameraden aus ihren Reihen ungesühnt blieb.
Ihre geringen Verluste hatten sie dem erst 23-jährigen Igor Koslow zu verdanken, der dem Team aus Tadschiken und Aserbaidschanern als KGB-Repräsentant zugeordnet war. Eine solche interne Kontrolle durch den KGB war Usus, doch im Kriegseinsatz hielten sie zusammen. Letztlich waren sie alle Russen.
Da Koslow, der dem Trupp als Späher Deckung gab, die heranrückenden Afghanen gemeldet hatte, waren sie vorbereitet. Er ärgerte sich dennoch, dass die Afghanen unbemerkt so nahe herankommen konnten. Sie mussten sich in Erdlöchern vergraben haben. Keine schlechte Leistung für geschätzte 80 Mann.
Über Funk informierte er den Befehlshaber seiner Einheit. Die Speznas feuerten aus allen Rohren und trieben die Flüchtenden auf die aufragende Klippe zu, wo sie in einer der Höhlen verschwanden. Der KGB-Mann lag nur 120 Meter vom Eingang entfernt im Schutz einer Felsformation. Nachdem der Letzte im dunklen Loch verschwunden war, kerbte er vier Striche in den hölzernen Handgriff seiner Kalaschnikow. Insgesamt waren es nun 17. Igor Koslow, dessen wahren Namen keiner seiner Kameraden kannte, strahlte vor Glück. Jeder Abschuss würde seiner Karriere förderlich sein. Und er war sich sicher, dass er eine große Karriere, bis in die Spitze des KGB, vor sich hatte.
Die heranrückenden Spezialkräfte sicherten den Ausgang der Höhle mit tödlicher Feuerkraft, während zwei Sprengstoffexperten ihre Ladungen am Felsen platzierten. Wenig später wurde der Höhlenausgang durch eine ohrenbetäubende Detonation versiegelt. Die siegreiche Truppe setzte ihren Weg in die Heimat fort.
7
Nationalpark Phong Nha-Ke Bàn,November 1988
Schwüle Hitze lastete auf dem Dschungelcamp. Dr. Frank Granow trat aus dem Laborgebäude und blickte in Richtung Himmel. Durch diese Waschküche konnte er nicht einmal die Spitzen der mittelhohen Bäume sichten. Geschweige denn die Kronen der Urwaldriesen, die 40 bis 50 Meter in die Höhe ragten. Das letzte Mal, dass er einen blauen Himmel gesehen hatte, war schon über drei Monate her, auf seinem Flug via Moskau nach Hanoi. Aber nur noch ein paar Tage, dann konnte er diesen Höllenort endlich verlassen.
Gegenüber dem Laborgebäude befanden sich die Käfige. Ihr Transport in diese abgelegene Region Vietnams war sehr aufwendig gewesen, doch aus Sicherheitsgründen hatte er darauf bestanden. Die vergitterten Stahlzellen hatten eine Grundfläche von eineinhalb mal eineinhalb Meter und waren einen Meter hoch. Gerade ausreichend für diese Kreaturen.
Alte Hubschrauber der vietnamesischen Luftwaffe hatten die Käfigzellen mitten in der unzugänglichen Urwaldregion abgesetzt. Das Tal war zu Fuß schwer zu erreichen, weil es durch massive Kalksteinfelsen umgeben war. Obwohl sie eher kleinwüchsige Gestalten waren, waren die Käfige größtenteils zu klein für diesen Abschaum, diese willfährigen Gehilfen der USA im Vietnamkrieg. Aufrichten konnten sie sich in ihren engen Behausungen nicht.
Die Insassen der Zellen waren in der Regel Angehörige der Montagnards, Bergvölkern aus dem Norden Vietnams, welche die Amerikaner offen im Krieg unterstützten. „Im Sinne der Gerechtigkeit” wurden dafür nach dem Sieg Ho Chi Mins ihre Ländereien enteignet und ins Eigentum des sozialistischen Nationalstaats überführt. Als verarmte Schmarotzer der arbeitenden Bevölkerung besaßen sie fortan keinen Wert mehr für die Gesellschaft. Gut wenn wieder mal ein Teil von ihnen entsorgt wurde und dabei noch einem guten Zweck zugeführt werden konnte.
Seine Gedanken schweiften weiter ab. Wie unmenschlich wäre es, ein wahrhaft majestätisches Geschöpf wie den Tiger in ein solches Verlies zu stecken. Unvorstellbar. Für ihn waren dies die wahrhaften Geschöpfe Gottes auf Erden. Er hatte schon mehrmals mit seiner Tochter Katja im Tierpark Leipzig die wunderbaren Raubkatzen beobachtet, wo sie glücklicherweise ein relativ großzügiges Gehege hatten.
Leider war die Population der Tiger in Vietnam nur noch sehr gering. Andererseits war er auch froh, dass dadurch die Chance minimal war, einem solch gefährlichen Raubtier hier auf freier Wildbahn zu begegnen. Der nächste Zoobesuch musste aber noch ein wenig warten. Zunächst musste er seine Aufgabe vollenden.
Die Experimente in den letzten Wochen waren ein voller Erfolg gewesen. Jetzt mussten sie nur noch durch mehrfache Wiederholungen verifiziert werden, 20 bis 30 weitere Versuche sollten ausreichen, um seine sensationelle wissenschaftliche Entwicklung abzusichern. Rund 700 solcher Experimente hatte er nun schon durchgeführt, mit stetig steigender Ergebnispräzision. Seine Forschungen würden die Welt verändern. Er konnte es kaum erwarten. Die DDR, sein Vaterland, würde dank seines Serums künftig über Leben und Tod jedes einzelnen Menschen verfügen können. Ohne dass man die Verantwortlichen je würde entlarven können.
Seine Entwicklung würde größere Auswirkungen haben als jedes moderne Kriegsgerät. Man konnte völlig unbemerkt zielgerichtet die Wurzeln allen Übels entfernen. Granow war überzeugt, dass seine Arbeit Millionen von Menschen das Leben retten würde, auch wenn ihn das ehrlich gesagt eher wenig interessierte. Es waren immer Einzelne, die den Befehl zum Abschuss gaben. Wenn diese vorher „einem Unfall” zum Opfer fielen, würde es eben nicht zum Abschuss kommen.
Seine Forschungen verdienten den Nobelpreis. Unglücklicherweise würde die degenerierte kapitalistische Jury diese niemals kennenlernen.
Gottgleich konnte er künftig über den Zeitpunkt des Ablebens eines Menschen bestimmen. Eine kurze Berührung genügte, um den toxischen Wirkstoff zu übertragen. Dieser konnte mittels der Trägerflüssigkeit so dosiert werden, dass er ohne körperlich spürbare Vorwarnung in einer Minute, einer Stunde oder gar erst in einigen Tagen wirken würde. Dann aber ultimativ tödlich. Das zentrale Nervensystem würde, wie durch eine Zeitschaltuhr gesteuert, plötzlich kollabieren.
Auch bei einer Obduktion wäre das organische Toxikum nicht nachweisbar, da es sich – Wunder der Natur – unmittelbar verflüchtigte. Man musste nur ein paar Recherchen über die Zielperson anstellen. Granows Lieblingsvariante wäre eine Verabreichung dreißig Minuten vor einem Fallschirmsprung. Welch köstlicher Gedanke, wenn alle Welt rätselte, wieso der erfahrene Springer nicht den Schirm entfaltet hatte. War es technisches Versagen? Selbstmord? Ein Attentat, ja wie denn?
Sein Plan war genial und simpel auszuführen. Missliebigen Regierungschefs, Ministern und Mitarbeitern auf Führungsebenen des kapitalistischen Erzfeindes würden nur noch kurze Amtszeiten vergönnt sein. Die Feinde des sozialistischen Vaterlands würden nach Belieben einen „natürlichen Tod” finden. Nicht nachweisbar und einfach zu bewerkstelligen. Meist würde es wie ein tragischer Unfall erscheinen.
Natürlich würde die verhasste Meute unabhängiger und unkontrollierbarer Medienvertreter nach und nach unhaltbare Anschuldigungen und Vermutungen äußern. Aber es würden sich keine Beweise finden und der Gegner wäre der tödlichen Gefahr völlig machtlos ausgeliefert. Mit der Zeit würden die Nachfolger der Nachfolger, wenn auch vielfach eher unbewusst, sehr genau darauf achten, keine Politik mehr gegen die DDR zu betreiben. Alle, die dies taten, würden auf unerklärliche Weise vorzeitig versterben. Ähnliches galt ebenso für Personen aus der Wirtschaft, einschließlich der Chefs der Rüstungsunternehmen.
Durch die zunehmende Durchsetzung aller wichtigen Lebensbereiche der imperialistischen Feinde mit DDR-freundlichen Führungskräften würde die politische und wirtschaftliche Kraft der DDR exponentiell gesteigert. Genau aus diesem Grund hatte man ihm unbegrenzte Mittel und Ressourcen zur Verfügung gestellt.
8
Dr. Frank Granow streifte sich die durchsichtigen Chirurgenhandschuhe über. Darüber ein zweites Paar. Man konnte nicht vorsichtig genug sein. Schließlich wurde das Gift per Hautkontakt übertragen.
Der Plastiküberzug war für Dimethylsulfoxid (DNSO) undurchlässig. Dieses organische Verbindungsmittel aus der Klasse der Sulfoxide war der perfekte Träger für die Verabreichung seiner tödlichen Berührungen. Die Plastikhandschuhe verfügten über kaum sichtbare Rillen, in denen das als Trägersubstanz genutzte DNSO in ausreichender Menge verabreicht werden konnte. Eine kleine Berührung reichte aus.
Die besondere Fähigkeit der Substanz war ihr leichtes Eindringen in die Haut und andere Zellmembranen. So konnte der Organismus in DNSO gelöste Substanzen leicht aufnehmen. Einzig ein schnelles und gründliches Abwaschen würde die Wirkung vermindern. Wenn man nur in diesem Moment wüsste, dass dies lebensnotwendig war…
Den Standort im Dschungel hatte Granow ausgesucht, weil hier eine wenig bekannte Art der gewöhnlichen Brechnuss, Strychnos vomica, wuchs. Aus den getrocknetem Samen dieses Baums konnte man Strychnin und Brucin isolieren, höchst wirksame Nervengifte. Hinweise des vaterländischen Geheimdienstes, dass die Armeeführung des vietnamesischen Bruderlandes medizinische Tests an „freiwilligen” Versuchsobjekten mit Ingredienzien dieses Baumes durchführte, waren für die Standortauswahl ausschlaggebend gewesen. Auf Basis dieser Informationen entwickelte er den Plan für das Urwaldlabor. Die Vietnamesen hatten gute Vorarbeit geleistet.
Auch wenn sich herausgestellt hätte, dass es für seine Ziele doch nicht tauglich wäre. Die Berichte schienen für eine Überprüfung interessant genug. Und wenn am Ende lediglich kaum nachweisbare Substanzen entdeckt worden wären, die stark verdünnt als Doping eingesetzt werden könnten: Zumindest die Sportfunktionäre hätten es ihm auf Knien gedankt. Schließlich gab es Dank Strychnin im Jahre 1904 schon einmal einen Marathon-Olympiasieger. Damals wurde dem Amerikaner Thomas Hicks während des Laufes ein Brandy mit Eiweiß und einem Milligramm Strychnin verabreicht, ganz legal.
Die ausschließlich in dieser begrenzten Region wachsende Unterart der Brechnuss enthielt jedoch noch eine weitere Substanz. Eines der vielen Wunder der Natur, das bisher unentdeckt war. Die Vietnamesen nannten es „cái chêt rùng”, den Urwaldtod. Heute würde er drei unterschiedliche Dosierungen verabreichen. Wirkungsdauer eine Stunde, zwölf Stunden und achtundvierzig Stunden. Es standen weitere Tests an, um zu überprüfen, ob sich seine Erkenntnisse wieder exakt bestätigen würden.
Dafür wurden je drei Versuchspersonen ausgewählt. Wie praktisch, dass man diese nicht einmal aus den Käfigen herausholen musste. Eine kleine Berührung reichte ja aus. Die Gefangenen mussten nur einen Arm durch das Gitter stecken. Es hatte sich bei ihnen bereits herumgesprochen was geschah, wenn ein Befehl verweigert wurde. Die Verweigerer und Querulanten erhielten einen schnellen Gnadenschuss vor den Augen der Anderen. In dieser Hinsicht waren die vietnamesischen Bewacher nicht zimperlich. In der Regel gab es demnach keinen Widerstand, zumal die Gefangenen keine Möglichkeit hatten, sich untereinander zu verständigen. Sie ahnten nicht, was ihnen bevorstand. Da die einzelnen Stahlgitterverschläge durch einen Sichtschutz aus Bambusmatten optisch voneinander getrennt waren, bekam der jeweilige Nachbar nichts mit. Auch wenn direkt neben ihm jemand durch Granows Behandlung krepierte.
Die Tinkturen befanden sich in kleinen Glasampullen, die je nach Dosierung beschriftet waren. Granow bedeutete der Wache, dass er den ersten Arm sehen wollte. Er öffnete den Verschluss mit der Aufschrift 1 Stunde, legte seinen Zeigefinger auf die Öffnung und drehte die Flasche. Die Rillen im Plastikhandschuh wurden befeuchtet. Mit diesem Finger berührte er kurz die Hand des Todeskandidaten. Er nahm sich eine Plastikhülle, mit welcher er die Chirurgenhandschuhe vorsichtig abstreifte. Anschließend wusch er sorgfältig seine Hände in einem bereitstehenden Becken. Die Plastikreste würden später im Ofen verbrannt.
Granow notierte Käfignummer, Dosierung, Verabreichungszeit und wiederholte die Prozedur drei Minuten später beim nächsten Käfig. Innerhalb einer guten halben Stunde waren so neun Personen kontaminiert.
Er hatte nun kurz Zeit für eine Erfrischung, bevor er sich die ersten Ergebnisse ansehen konnte. Eine knappe Stunde später postierte er sich so, dass er die drei ersten Käfige gut überblicken konnte, deren Insassen jetzt noch jeweils rund fünf, acht und elf Lebensminuten verblieben. Eine Stunde nachdem es von Granow berührt worden war, begann das erste Opfer hilflos zu zucken. Das zentrale Nervensystem brach zusammen. Der Tod folgte so schnell und überraschend, dass es keinem mehr gelang, sein Entsetzen herauszuschreien. Perfekt. Granow lächelte zufrieden.
9
Nationalpark Phong Nha-Ke Bàn,Dezember 1988
Drei Wochen später spürte Granow mitten in der Nacht eine Berührung an seiner Schulter. Erschrocken setzte er sich in seinem Bett auf und erblickte eine schemenhafte Gestalt vor sich.
„Hãy yên tïhn”, sei ruhig, hörte er eine Stimme flüstern, „all ok”.
Vor ihm stand Nam Kam, den er bisher nur von einem Bild kannte. Er war klein und muskulös und strahlte eine kalte Brutalität aus. Unbewegt fixierte er Granow mit seinen Augen. Diese Asiaten waren ihm unheimlich. Trotz der jahrzehntelangen solidarischen Unterstützung durch die DDR blieben ihm diese fernöstlichen sozialistischen Brüder, die inzwischen zu Abertausenden in seiner Heimat lebten, wohl immer fremd. Es war ihm nicht möglich, irgendeine Gefühlsregung in ihren Gesichtern zu entdecken.
Trotz der Wärme begann Granow zu frösteln. Eigentlich sollte Kam erst am nächsten Morgen erscheinen, nachdem Granow den Abschluss seiner Versuchsreihen gemeldet hatte. Er war der Chef der mächtigen Cholon-Triade. Diese vietnamesische Mafia, Ableger der chinesischen Triaden, war nach dem chinesischen Viertel von Ho-Chi-Minh-Stadt benannt, die mit 1,7 Millionen Einwohnern die größte Stadt Vietnams war.
Der Boss dieser Bande, Nam Kam, sollte ihn aus dieser grünen Hölle bringen. Hierfür wurde er fürstlich entlohnt, schließlich war es Teil seines Auftrags, auch die ihm unterstellten Wachleute und Mitglieder der regulären vietnamesischen Armee zu eliminieren. Anschließend sollte das Lager „vom Erdboden verschwinden”. Mitwisser waren nicht erwünscht.
Wie auch immer die Stasi dies eingefädelt hatte, Granow war natürlich in den Plan eingeweiht. Ursprünglich hatten ranghohe Vertreter der Stasi die Einrichtung des geheimen Urwaldlabors mit ihren vietnamesischen Kollegen ausführlich abgesprochen. Teil der Abmachung war, die Forschungsergebnisse brüderlich zu teilen. Die Vietnamesen mussten hierfür die „Labortiere” herbeischaffen. Weil diese auf Grund der gewünschten Ergebnisse nicht überleben würden, musste man offen über das Ziel der Forschungsarbeiten, die Herstellung eines biologischen Kampfstoffes, reden. Um sich die Unterstützung der Vietnamesen zu sichern, versprach man, den Stoff für beide Bruderländer zur Verfügung zu stellen.
Die Vietnamesen begrüßten es, auf diese Weise ihre militärischen Optionen preiswert erweitern zu können. Ihnen war allerdings nicht bewusst, dass von Beginn an eine alleinige Nutznießung durch die DDR beabsichtigt war.
Die Operation „Tusche”, die eine völlige Zerstörung des Labors inklusive Personal vorsah, war von Anfang an Teil des Plans gewesen. Für diese Operation konnte man, ohne viel Überzeugungskraft aufzuwenden, Nam Kam gewinnen, dem die grünen Dollarzeichen in den Augen standen.
Geplant war, kurz vor der offiziellen Auflösung des Labors und dem Rücktransport der Mitarbeiter einen Überfall zu inszenieren. Für die Mitarbeiter, Wachleute und sonstigen Insassen des Lagers würde dies keine Inszenierung, sondern eine Exekution bedeuten, ausgenommen den Leiter der Einrichtung. Granow selbst sollte dann über geheime Dschungelpfade via Laos nach Thailand gebracht werden, von wo er erstens die Heimreise antreten und zweitens den Großteil von Nam Kams Honorar freigeben würde. Auszuhändigen in bar von einem Stasi-Mitarbeiter der DDR-Botschaft in Saigon.
Dass Nam Kam sein Handwerk verstand, erfasste Granow sofort, als er aus seiner Hütte trat. In der Mitte des Lagers stapelte sich ein Leichenberg aus vietnamesischen Wachleuten und den verbliebenen Montagnards. Diese Säuberungsaktion, von der er in seinem Schlaf nichts mitbekommen hatte, nötigte Granow großen Respekt ab. Diesen Mann machte man sich besser nicht zum Feind.
Nam Kam bedeutete ihm, sich zu beeilen. Seine letzte Ausreise aus Vietnam würde beschwerlich werden. Während Kams Bandenmitglieder großzügig Brandbeschleuniger im Lager verteilten, suchte Granow hektisch seine Sachen zusammen. Neben seinen Aufzeichnungen waren dies vier große Kisten mit Ampullen, die in ausgeschäumten Einzelfächern bruchsicher verstaut waren.
Bevor er die Kisten zum Transport sicherte und verschloss, entnahm Granow mit einer Spritze etwas Flüssigkeit aus der Ampulle mit der Aufschrift T02 und füllte diese in ein kleines Plastikdöschen. Er steckte es sich, mit Folie umwickelt, in die Jackentasche. Die Kisten wurden von Trägern übernommen und in sichere Entfernung vom Lager gebracht. Plötzlich hielt der Trupp, man bedeutete ihm zu warten.
Kurze Zeit später drang Rauch aus Richtung des Lagers bis zu ihnen vor. Fast gleichzeitig erschien Nam Kam mit dem Rest seiner Truppe und sie begannen den langen Marsch durch den Dschungel Richtung Laos. Von einer verborgenen Dschungelpiste für Drogenschmuggel sollte Granow zu einem Provinzflughafen nach Thailand geflogen werden. Von dort mit Fahrzeugen nach Bangkok. In Bangkok würde er sicheren, geheimdienstlichen Begleitschutz der dortigen DDR-Botschaft erhalten und schließlich mit einem Diplomatenvisum ausreisen.
Bis zur Übergabe an die Stasi hatte Nam Kam für die Gesundheit Frank Granows zu sorgen. Nur so konnte er seine Entlohnung sicherstellen. Während Granow seinem Führer orientierungslos durch das Dickicht des Dschungels folgte, wurde ihm bewusst, wie abhängig er von diesem war. Er hoffte, dass er sich nicht in Kam getäuscht hatte. Einem Mann, der für ein paar Scheine die Seiten wechselte, sollte man immer mit Misstrauen begegnen.
10
Aufgeschreckt durch beißenden Rauch, entfernte sich die Krait in überraschend schnellem Tempo vom Gefahrenherd. 40 Meter vom Lager entfernt wähnte sie sich auf Grund ihrer Instinkte sicher. Dennoch kroch sie durch das dichte Unterholz weiter in die eingeschlagene Fluchtrichtung. Ihr ausgeprägter Geruchsinn meldete ihr eine neue Bedrohung. Etwas, das ihr in ihrem kurzen Leben bisher noch nicht begegnet war.
Huynh Bian konnte seine vor Angst weit aufgerissenen Augen nicht von der geringelten Natter wenden, die nur noch wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt weiter auf ihn zu kroch. Schon als kleines Kind hatte er gelernt, einen weiten Bogen um das gefährliche Reptil zu machen. Fast jeder in der Kleinstadt Chau-Doc, in der er aufgewachsen war, kannte jemanden, der einen Freund oder Angehörigen durch den Biss der giftigsten Schlangenart Südostasiens verloren hatte.
Der Angstschweiß lief ihm in Strömen herunter. Seine Lage war verzweifelt. Vermutlich hätte ihn nur noch eine blitzschnelle Flucht vor einer plötzlichen Bissattacke gerettet. Dann aber wären die Banditen auf ihn aufmerksam geworden, die nur wenige Meter entfernt an ihm vorbeigingen, nachdem sie zuvor seine Kameraden und die übrigen Camp-Insassen brutal getötet hatten. In diesem Fall wäre sein Tod erst recht unausweichlich.
Als er um 4 Uhr morgens seinem Drang nachkommen musste, sich zu erleichtern, ging er zu der primitiven Latrine, die sie etwas vom Lager entfernt ausgehoben hatten, eine Grube in einem Bretterverschlag. Er hatte die Mörder leise reden hören, als sie auf das Laborgelände zuschlichen. Da er unbewaffnet war, hatte er seine Kameraden nicht sofort alarmiert, um die Angreifer nicht auf sich aufmerksam zu machen. Dann ging alles sehr schnell.
Die Fremden drangen in die Behausung seiner Armeekameraden ein und schleppten kurz darauf ihre leblosen, blutigen Körper in die Mitte des gerodeten Areals. Huynh suchte sich schnell das bestmögliche Versteck und legte sich flach in ein dichtes Gestrüpp. Einige Zeit später sah er aus den Augenwinkeln einen hellen Schein durch das Blätterwerk. Sie hatten Feuer gelegt. Wieder hörte er Stimmen, die auf ihn zukamen.
Die Ausdünstungen des menschlichen Körpers vor ihr waren in den Genen der Schlange mit keinem Signal für Gefahr verbunden. Die Krait erklomm das seitlich auf den Boden gepresste Gesicht des Liegenden und suchte ihren Weg entlang der Wirbelsäule. Etwa in der Mitte verharrte sie, aufgeschreckt durch das Geraschel der vorbeieilenden Männer, die nun keinen Grund mehr sahen, sich lautlos zu bewegen.
Huynh Bian versuchte sein Zittern unter Kontrolle zu halten. Als die Giftnatter ihren Weg über sein Gesicht nahm, schien sein Herz auszusetzen. Nun lag sie auf seinem Rücken. Huynh begann zu beten: „Allahu Akbar…”
Der erst neunzehnjährige Soldat der vietnamesischen Armee gehörte zur Volksgruppe der Chiêm Thành, einem Volk von Reisbauern. Diese religiöse Minderheit pflegte den Glauben, den bereits ihre Vorfahren im 13. Jahrhundert angenommenen hatten, den Islam. Er schwor sich, falls er den heutigen Tag dank Allah überleben würde, eine Koranschule zu besuchen und sein Leben fortan der Lehre des Islam zu widmen.
Die Meuchelmörder waren nun nicht mehr zu hören. Glücklicherweise schien auch die Schlange aus ihrer Starre zu erwachen und kroch von seinem Rücken zurück ins Unterholz. Der junge Mann wartete noch ein wenig, bis er sich erhob, und entfernte sich schnell von diesem Platz. Er blickte Richtung Lager und nahm den einprägsamen süßlichen Geruch wahr, der beim Verbrennen von Menschenfleisch entstand.
11
Die Reise durch die tropische Schwüle zehrte an ihren Kräften. Erst nach fünf Tagen überquerten Granow und seine Begleiter die unsichtbare Grenze nach Laos. Nach weiteren zwei Tagen erreichten sie die kleine Landepiste im Busch, so dass Granow am Ende des siebten Tages endlich seine Landesgenossen begrüßen konnte.
Während der Reise hatte er sich immer wieder Plastikhandschuhe übergestreift und über einen längeren Zeitraum getragen. Auch wenn seine Hände hierdurch schweißnass wurden. Die Prozedur erfüllte zwei Zwecke zugleich: Erstens war es ein guter Schutz vor Moskitos, und zweitens würden sich seine Weggenossen so an seinen „Spleen” gewöhnen.
Bei der Verabschiedung Nam Kams legte Granow, der erneut die Plastikhandschuhe trug, größten Wert darauf, jedes einzelne Bandenmitglied per Handschlag zu verabschieden. Für sich interpretierte er es als goldenen Handschlag. Seinem Vaterland wurde so viel Geld gespart, weil Verblichene schlechterdings ausstehende Forderungen eintreiben konnten.
Der Inhalt von Ampulle T02, den er sich vor der Verabschiedung heimlich auf die Hand geträufelt hatte, sollte sich bei Nam Kam und seinen Bandenmitgliedern zum ersten Mal im Ernstfall bewähren, exakt zwei Tage bzw. 48 Stunden nach Verabreichung.
12
Berlin, Dezember 1988
Nach seiner Rückkehr aus Vietnam gönnte sich Granow erst einmal ein paar Tage Auszeit. Natürlich war Petrowski neugierig und erwartete schnellstens seinen Bericht. Granow vertröstete ihn jedoch auf später, es sei noch eine Menge Nacharbeit zu leisten. Er beabsichtigte, in den nächsten Monaten vorab die Ergebnisse seiner Forschungsreiche sauber zu dokumentieren und einen sinnvollen Einsatzplan auszuarbeiten. Insgeheim befürchtete er, dass der Verbindungsoffizier, zu früh über die einzigartige Waffe in Kenntnis gesetzt, nicht abwarten würde, bis eine gut durchdachte Einsatzstrategie vorläge.
Momentan war Granow der einzige Mann auf der Welt, der wusste, welche Sprengkraft die Waffe hatte, die sich in seinen Händen befand. Er musste dafür Sorge tragen, dass die Planungen strategisch durchdacht und klar definierte Ziele vorgegeben wurden. Erst mit Fertigstellung dieses Masterplanes würde er das Politbüro über die unglaublichen Einsatzmöglichkeiten seiner wissenschaftlichen Forschung unterrichten. Solange musste dieses sich in Geduld üben.
Seine Planungen sollten einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren umfassen und die jeweiligen wahrscheinlichen Auswirkungen unterschiedlicher Einsatzszenarien beleuchten. Der Arbeitstitel lautete „Anschluss der BRD an die DDR”. Für diese Mammutaufgabe würde Granow, so hatte er kalkuliert, einige Monate Zeit benötigen. Wie er aus leidvoller Erfahrung wusste, kamen auch immer wieder ungeplante Dinge dazwischen, die einen von der Arbeit abhalten würden. So musste er gleich Anfang Februar wieder einmal nach Moskau reisen. Allerdings freute er sich diesmal besonders auf den Besuch, weil er dort seinen alten Freund Jurij treffen würde.
13
1989
Moskau,Februar 1989
Die Iljuschin Il-62 der Interflug landete am 6. Februar pünktlich auf dem Flughafen Moskau-Domodedowo. Nachdem er drei Stunden später die Einreiseformalitäten erledigt und sein Gepäck erhalten hatte, wurde Frank Granow freundlich begrüßt. Er war einer Einladung des umstrittenen Wissenschaftlers Jurij Jandlewski gefolgt, der ihn persönlich im Ankunftsbereich erwartete.
„Mein lieber Frank!”, rief sein Gastgeber in einer Lautstärke, dass sich die Umstehenden reihenweise zu ihm umdrehten, „ein herzliches Willkommen!”
Granow trat aus der letzten Kontrollschleuse und steuerte auf seinen Gastgeber zu, der zehn Meter weiter mit ausgebreiteten Armen auf ihn wartete. „Lieber Jurij, ich freue mich so, dich zu sehen.”
Jandlewski war so etwas wie ein Popstar in der sowjetischen Wissenschaftsszene. Seine langen blonden Haare trug er meist als Zopf gebunden. Seine große Hakennase und die tief zurückliegenden Augen gaben ihm etwas vom Aussehen eines Adlers. Seit Granow den Biologen und Biochemiker vor einigen Jahren bei einem Kongress in Moskau kennengelernt hatte, pflegten sie eine Art Freundschaft, indem sie sich mindestens einmal im Jahr, abwechselnd in Russland und Deutschland, trafen.
Obwohl Granow auf Grund seiner Stellung Zugang zu geheimdienstlichen Quellen der Stasi hatte, war ihm nicht bekannt, dass der charismatische Wissenschaftler für den KGB arbeitete. Die Stasi war in diesem Falle ahnungslos. Erst im Jahre 2001 sollten ausländische Geheimdienste auf Jandlewski aufmerksam werden, als er in der Spionageaffäre um einen amerikanischen Studenten öffentlich als Zeuge für den FSB, den Nachfolgedienst des KGB, auftrat.
Wie bei seinen letzten Besuchen übernachtete Granow in einem Gästehaus der Akademie der Wissenschaften. Bevor sie am nächsten Tag ein obligatorisches Arbeitsgespräch angesetzt hatten, war zunächst ein gemeinsamer Abend geplant. Wie immer, wenn sie sich trafen, würde dieser feucht-fröhlich werden.
Jandlewski hatte diesmal den Besuch einer Party „nur für geladene Gäste” im Tsentralny Dom Literatow geplant. Das Dom Literatow war in Moskau bekannt als Treff für „Kunst, Kultur, Wissenschaft und Intelligenz”, womit man in Moskau gewöhnlich hochrangige Mitglieder aus Politik, Armee und Verwaltung bezeichnete. Holzvertäfelte Wände, schwere Teppiche und ein prasselndes Feuer im Kamin schufen eine angenehme Atmosphäre. Das alte Herrenhaus, von dem man sagte, Leo Tolstoi wäre hier ein- und ausgegangen, lag in der Powarskaja-Straße, die von einer Reihe herrlicher Jugendstilhäuser gesäumt wurde.
Jandlewski ließ die Limousine direkt vor dem Eingang halten. Der nachfolgende Verkehr würde eben warten müssen. Granow hielt dies für eine gute Idee, denn auch ein kurzer Weg bei knapp -20 Grad konnte im wahrsten Sinne des Wortes wehtun. Drinnen empfing sie eine wohlige Wärme. Ihre Mäntel wurden ihnen abgenommen und man führte sie zu einem Tisch in einer gemütlichen Nische.
„Zum Wohle, mein alter Freund”, begann Jandlewski das Gespräch, nachdem man ihnen unaufgefordert eine Flasche Wodka auf den Tisch gestellt hatte. „Ich freue mich, dass wir wieder einmal zusammengekommen sind und auf die alten Zeiten anstoßen können.”
„Es bereitet auch mir immer wieder große Freude, dich zu treffen, Jurij”, erwiderte Granow. „Was gibt es Neues im geliebten Bruderland?”
„Ach, lieber Frank, alles ist neu. Das Leben ist voller Wunder. Und damit meine ich nicht Gorbatschow.”
„Ich bin neugierig, was gibt es zu berichten?”
„Wir stehen vor radikal neuen Erkenntnissen”, dozierte Jandlewski, „ich habe In-Vitro-Studien an Wühlmäusen vorgenommen und werde zum Umdenken in der Evolutionstheorie beitragen. Noch in diesem Jahr wird ein anerkanntes Fachmagazin darüber berichten. Meine wissenschaftlichen Studien werden belegen, dass alles, das Universum, das Leben und die Lebewesen auf dieser Welt nur durch den Eingriff Gottes in natürliche Vorgänge möglich geworden sind.”
Granow runzelte die Stirn und wollte gerade zu einer Erwiderung ansetzen.
„Aber, mein lieber Frank, das ist eine lange Geschichte, mit der wir uns heute nicht beschäftigen wollen. Bevor wir anfangen zu diskutieren, was mit dir stets ein großes Vergnügen ist: Wir haben etwas zu feiern!”
„Das freut mich, Jurij!”, sagte Granow interessiert. „Du machst mich neugierig, erzähl schon. Was gibt es Interessantes?”
„Zunächst einmal die Frauen!”, rief Jandlewski laut.





























