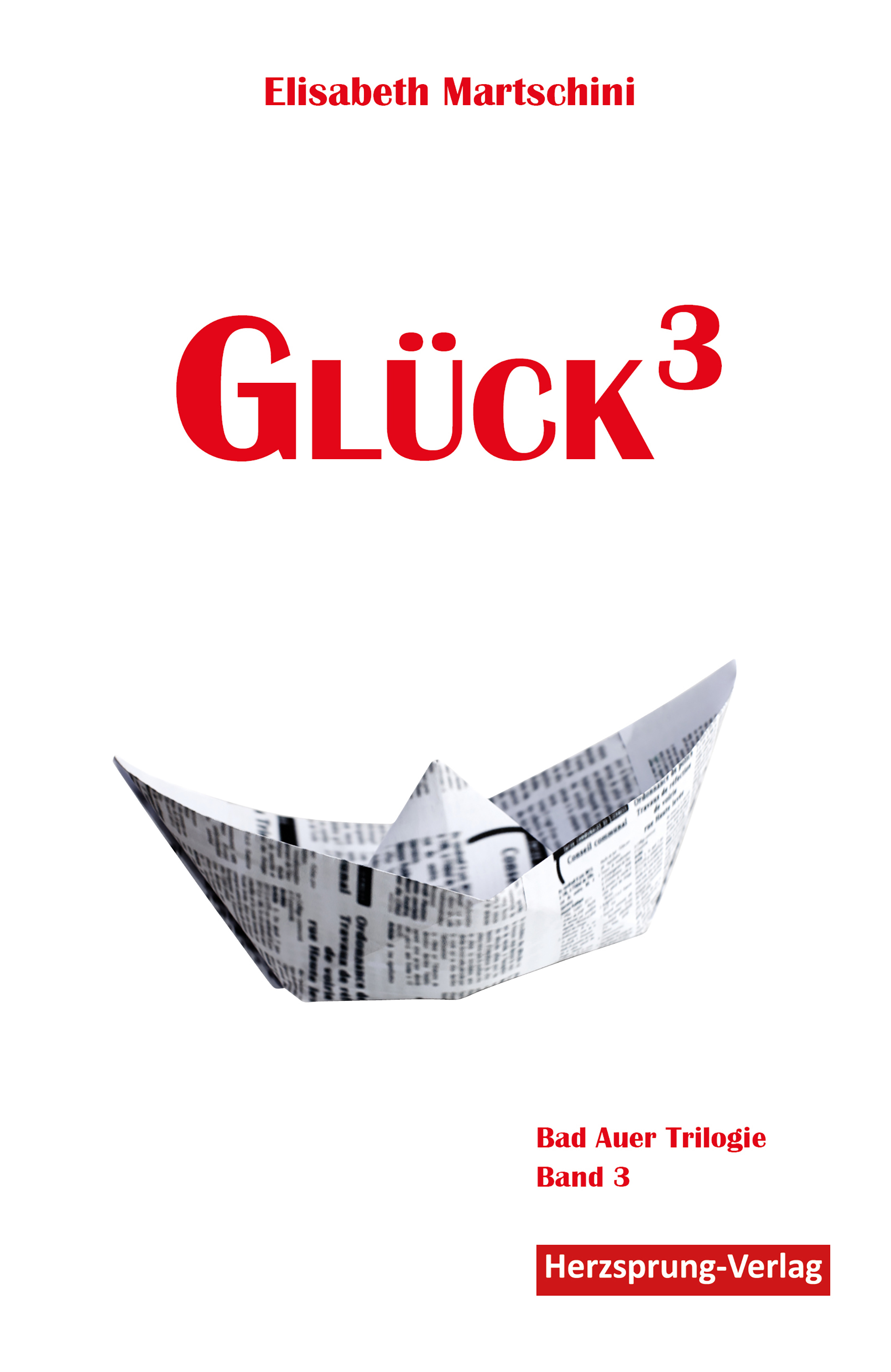
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herzsprung Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bad Auer Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein Mord kommt selten allein denkt sich Waltraud Kranzlbauer, Geschichtelehrerin am Gymnasium in Bad Au, als sie beim Durchstöbern alter Zeitungen auf immer mehr mysteriöse Todesfälle stößt. In ihrer Kollegin, der Deutschlehrerin Maria Liliencron, hofft sie, auch eine Partnerin in Sachen Mörderjagd zu finden, doch die hat andere Sorgen. Derweil braut sich über dem Kopf einer weiteren Person neues Unheil zusammen.Im dritten und letzten Band der Bad Auer Trilogie versuchen die Bewohner des kleinen Kurorts, allerlei verzwickte Familienangelegenheiten auf zum Teil recht ungewöhnliche Weise zu lösen. Die Schatten reichen bis weit in die Vergangenheit zurück, doch am Ende ist es die Zukunft, der die Lebenden sich zuwenden.Beides, Vergangenes wie Zukünftiges, bespricht man wie immer am besten bei Kaffee und Kuchen im altmodischen, aber umso liebenswürdigeren Café Sisi. Bis sich auch dort eine entscheidende Veränderung ankündigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
o
Glück3
Bad Auer Trilogie
Band 3
Elisabeth Martschini
o
Impressum:
Alle weiteren Personen und Handlungen des Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.herzsprung-verlag.de
© 2017 – Herzsprung-Verlag GbR
Oberer Schrannenplatz 2, D- 88131 Lindau
Alle Rechte vorbehalten.
Erstauflage 2017
Lektorat: Melanie Wittmann
Herstellung: Redaktions- und Literaturbüro MTM
www.literaturredaktion.de
Coverillustration: © auryndrikson - lizenziert Adobe Stock Foto
ISBN: 978-3-96074-015-5 – Taschenbuch
ISBN: 978-3-96074-166-4 – E-Book
o
Inhalt
Im Café Sisi
Kirschen, Kuchen und Kolleginnen
Geständnisse
Fäden spinnen
Gruben graben
Muttertage
Nachrichten
Bis zum Hals
Der verlorene Sohn
Schuss. Aus
Im Café Sisi
o
Im Café Sisi
Das war das Ende. Er saß alleine an einem Tischchen im Café Sisi. Die Spitzen seines Milchschaumoberlippenbarts zeigten traurig nach unten. Was einmal Somlauer Nockerl gewesen waren, lag als unansehnlicher Haufen auf dem Dessertteller, jedoch hatte von Biskuitteig, Vanillecreme und Schokoladensoße kein bisschen den Weg in seinen Magen gefunden. Genauso wenig wie von den Rumrosinen. Nicht einmal die Melange, gerade noch stolze Trägerin jenes Milchschaums, der jetzt die kraftlose Oberlippe zierte, wollte dem alten Herrn schmecken.
„Darf es noch etwas Süßes sein, Herr Hirschhauser?“, fragte Petra Sandor, die an das Tischchen herangetreten war, ihn trotzdem scheu, während sie verstohlen den Teller mit der verschmähten Spezialität an sich nahm. Alois Hirschhauser schüttelte stumm den Kopf, woraufhin sich die junge Frau leise wieder hinter die Theke zurückzog, um ebenso leise die Spuren des Nockerlmassakers zu beseitigen.
Dabei hätte sie gar nicht so still zu sein brauchen, die Gruppe junger Männer im hintersten Winkel des Café Sisi, an dem Tisch gleich beim Fenster, war es auch nicht. Immer wieder drang Lachen durch den Raum, begleitet von Gesprächsfetzen wie „Darth Vader zieht sein doppeltes Lichtschwert“ oder „Die dunkle Seite der Macht wendet sich gegen Prinzessin Leia“. Reizworte für Filmliebhaber oder Kaffeehausbesucher, je nachdem.
Allein Alois Hirschhauser hörte nichts oder wollte nichts hören, weder von einem Stück Dobostorte noch von irgendwelchen intergalaktischen Sternenkämpfern. Auch nicht von jungen Männern. Seine Gedanken waren im Gegenteil bei einer alten Frau, einer Dame, wie sie sich selbst bezeichnet hätte, wobei der Konjunktiv eigentlich fehl am Platz war, denn Frau Hildegard Binsen, Pardon, Frau Doktor Hildegard Binsen hatte sich des Öfteren ganz ungeniert eine Dame genannt. Nicht aufgrund irgendeines Adelstitels. Der Doktor ihres Gatten ‒ Gott hab ihn selig ‒ reichte vollauf. Mit diesem Gatten war Frau Doktor Binsen, seit sie so hieß, sein Leben lang verbunden gewesen. Mit Alois Hirschhauser, einem nunmehr pensionierten Friseur, war sie hingegen ihr Leben lang verbunden gewesen seit der Zeit, als sie noch auf den Namen Hildegard Bauernfeind gehört hatte.
Und sein oder nicht sein ‒ ihr Leben nämlich! ‒, das machte schon einen Unterschied. Nicht so sehr wegen der Jahre vor der Hochzeit, die im Vergleich so zahlreich nicht gewesen waren, sondern wegen der Jahre, fast schon Jahrzehnte, die Hildegard ihren Gatten überlebt hatte. Alte Liebe rostet nicht und alte Freundschaft noch weniger. Für beide galt in diesem Fall jedoch: bis dass der Tod sie scheide. Und der Tod hatte sie geschieden ‒ zuerst Hildegard und Kurt Binsen und kürzlich auch Hildegard Binsen und Alois Hirschhauser.
Mit anderen Worten: Frau Doktor Hildegard Binsen, gern gesehener Stammgast im Café Sisi, war gestorben. Hatte die Kuchengabel abgegeben und in die hellblaue Papierserviette gebissen, um sich die Tortenteller von unten anzusehen, was nichts mit dem Stempel irgendeiner bayerischen oder tschechoslowakischen Porzellanmanufaktur zu tun hatte. Dabei hatte die eine gerade erst ihr 250-jähriges Jubiläum gefeiert, wohingegen die Heimat der anderen ... Aber lassen wir das. Das hatte schon vor ihrem Tod nichts mit Hildegard Binsen zu tun gehabt und hatte es danach noch viel weniger, weil Scherben zwar Glück, nicht aber das Leben zurückbringen.
Im Übrigen war das mit den Scherben und dem Glück so eine Sache. Teller, Gläser und Kaffeetassen waren im Café Sisi in den vergangenen sieben, acht Jahren natürlich schon einige kaputt gegangen. Aber dass das in irgendeiner Beziehung zum Glück gestanden wäre, hätte Petra Sandor nicht sagen können. Doch nicht deshalb schüttelte die Konditorin jetzt ebenso stumm den Kopf, wie es zuvor Herr Hirschhauser getan hatte. Mit dem das Kopfschütteln denn auch ursächlich zusammenhing. Das hatte es nämlich in besagten sieben, acht Jahren, die Petra Sandor nun schon mit ihrem Mann Istvan das Café Sisi betrieb, noch nicht gegeben: dass Herr Hirschhauser die Mehlspeise verweigerte. Er, der bisher sogar vor einem deftigen Mittagessen den stadtbekannten Somlauer Nockerln nicht hatte widerstehen können.
Nicht, dass die kleine, einstmals mondäne, jetzt aber schon etwas in die Jahre gekommene Kurstadt Bad Au ein breiteres Wissen über Somlau hätte vorweisen können. Bestimmt kannten 99 Prozent der Bad Auer dieses westungarische Städtchen nicht einmal vom Hörensagen und wären deshalb nie auf die Idee gekommen, dass die Bezeichnung der von ihnen so geliebten Nockerl, die in der Hauptsache aus hellem und dunklem Biskuitboden bestanden, irgendwas mit dem zwischen Neusiedlersee und Plattensee gelegenen Berg Somlau, der auch dem Städtchen seinen Namen gegeben hatte, zu tun haben könnte. Das wäre zu weit hergeholt gewesen. Bei Malakoff und Molotow und Kalaschnikow dachte ja auch niemand mehr an die ursprünglichen Namensgeber.
Über die Herkunft der Somlauer Nockerl machte sich einzig Petra Sandor Gedanken. Nicht nur, weil deren Zubereitung im Café Sisi in ihren Zuständigkeitsbereich fiel, sondern auch und vor allem, weil sie dieses eine Rezept der ungarischen Großmutter hinüber nach Österreich gerettet hatte. Die Großmutter selbst war damals zurückgeblieben, als der Rest der Familie zu neuen Donauufern aufbrach, hatte den Weg ins gelobte Österreich gescheut und darauf beharrt, in ihrem geliebten Ungarn zu bleiben, zumal dieses endlich den aus tiefster Seele verabscheuten Kommunismus losgeworden war. Da halfen kein Drängen und später auch kein Ziehen. Die alte Frau blieb in ihrer Heimatstadt, die schon ihre Geburtsstadt gewesen war und bald auch ihre Sterbestadt werden sollte.
„Nagymama, szeretem Ómama“, dachte Petra Sandor und wischte sich beim Gedanken an ihre geliebte Großmutter mit dem Zipfel ihrer Schürze eine Träne aus den Augen. Der Verlust Frau Doktor Hildegard Binsens hatte auch sie sentimental werden lassen.
Darth Vader und R2-D2 im hintersten Winkel des kaffeehäuslichen Universums wussten davon freilich nichts, weder von Hildegard Binsen noch von Petra Sandors Großmutter oder gar von Somlauer Nockerln, die nicht auf der regulären Karte standen, sondern nur einmal im Monat angeboten wurden.
„Fallt bitte nicht aus der Rolle“, ließ sich eine Stimme vernehmen. „Davon krieg ich langsam Magenschmerzen.“
Die Bemerkung „R2-D2 kann sich nicht über Magenschmerzen beschweren, er ist eine Maschine, verdammt. Der kann nicht mal reden“ sorgte vorübergehend für Schweigen.
Da fehlte etwas, fand Petra Sandor. Das Leben war doch nur noch die Hälfte wert, wenn einer wie Alois Hirschhauser keine Mehlspeisen mehr mochte. Es musste ja nicht gleich eine Dobos- oder Herren- oder Malakofftorte sein, aber ein Stück Marmorguglhupf ging immer.
„Der geht aufs Haus“, sagte sie leise zu Herrn Hirschhauser, als sie das Tellerchen mit dem Kuchen vor ihn auf die Marmortischplatte stellte. Marmorkuchen auf Marmortischplatte. Vielleicht hatte diese Kombination mehr Erfolg als die armen Somlauer Nockerl.
„Ist lieb von Ihnen“, antwortete der alte Herr ebenso leise. Seine Linke zuckte, als wollte sie der jungen Frau über den Arm streichen oder wenigstens die Hand drücken, berührte stattdessen aber nur zaghaft die Kuchengabel. So blieb Alois Hirschhauser sitzen, während Petra Sandor sich dezent zurückzog. Man kannte einander.
„Die dunkle Seite der Macht schlägt zurück“, kam es aus der hinteren Ecke des Gastraums.
„Mach ein bisserl leiser, Mann, sonst bekommt unser Universum unerwünschten Zuwachs“, tadelte eine andere Stimme.
„Das dehnt sich sowieso immer weiter aus“, verteidigte sich die erste Stimme.
„Vielleicht. Vielleicht zieht es sich danach aber auch wieder zusammen und die dunkle Macht fliegt raus, weil sie die Grenzen der Realität nicht anerkennt.“
„Der Fiktion, du Nuss“, gab die dunkle Macht zurück.
Aus den Augenwinkeln beobachtete Petra Sandor, wie Herr Hirschhauser sich mit der Kuchengabel die von schütterem Haar nur notdürftig bedeckte Kopfhaut kratzte. „Er ist alt geworden“, dachte sie, „das wäre ihm früher nicht passiert, dafür hätte Frau Doktor Binsen schon gesorgt.“ Womit die von keinem Titel belastete Konditorin zweifellos recht hatte. Für Hildegard Binsen wäre es ein schwerer Fauxpas gewesen, in aller Öffentlichkeit – und sei es nur die eigentlich sehr private Öffentlichkeit im Café Sisi – mit einem Mann gesehen zu werden, der sich mit einer Kuchengabel am Kopf kratzte wie ein ordinärer Bauarbeiter. Dass Bauarbeiter selten Kuchengabeln zur Hand hatten, hätte Hildegard Binsen geflissentlich übersehen.
Petra Sandor lächelte. Doch es war kein glückliches Lächeln, das ihre schmalen Lippen umspielte, vielmehr ein trauriges, melancholisches. Ein Lächeln, das seinen Zwilling auf dem faltigen Gesicht des Herrn Hirschhauser fand. Ein Lächeln, das in einem Akt der resignativen Verzweiflung die entschwindende Vergangenheit festzuhalten versuchte, sich der Vergeblichkeit seines Bemühens aber schmerzlich bewusst war, weil die so belächelte Vergangenheit längst entschwunden war.
„Hildegard“, seufzte Herr Hirschhauser in seinen Gedanken, als hätte er die der Petra Sandor erraten. Er ließ die Kuchengabel sinken. Was hätte er nicht für diese Frau – also für Hildegard, Hildegard Binsen – gegeben? Alles. Alles, was er hatte. Aber dieser Kurt Binsen, dieser aufgeblasene Medizinstudent, hatte mehr zu geben gehabt. Zumindest theoretisch, denn was davon seine, Alois Hirschhausers Hildegard tatsächlich bekommen hatte und was ihr, wie dem Esel die Karotte, nur lockend vorgehalten, schlussendlich aber verweigert worden war, ließ sich nur erahnen. Hildegard selbst hatte darüber höchstens andeutungsweise gesprochen. Weil es unmöglich gewesen wäre zuzugeben, dass sie, Frau Doktor Binsen, in den Augen der Welt einen Fehler gemacht und den falschen Mann geheiratet hatte. Oder besser gesagt: einen falschen Mann, weil die Auswahl an falschen Männern in der Regel weit größer als die an richtigen zu sein schien. Weshalb man den Frauen auch keinen Vorwurf machen durfte, musste sich der von ihnen gewählte Mann doch beinahe zwangsläufig als ein falscher herausstellen.
Aber gerade zu jener Riege der mit einem falschen Mann gesehenen und verehelichten Frauen hatte Hildegard, geborene Bauernfeind, nicht gehören wollen, war also mit ihrer Wahl zufrieden gewesen oder hatte sich zumindest damit zufriedengegeben, indem sie sich selbst nahm, was sie bekommen konnte. Den Doktortitel ihres Gatten zum Beispiel.
Den brauchte er nach seinem Tod ohnehin nicht mehr. Wobei sie diesen Titel zugegebenermaßen bereits vor seinem Tode geführt hatte, wohingegen sie nach dem Tod des Göttergatten auch alle anderen seiner Besitztümer geerbt hatte, da gemeinsame Kinder nicht gegeben oder genommen, auf jeden Fall nicht geboren worden waren.
„Anakin Skywalker bekämpft die fremde dunkle Macht mit seinem Lichtschwert“, war vom Tischchen in der hinteren Ecke des Gastraums zu hören.
„Du bist schizophren“, unterbrach eine andere Stimme.
„Und bei dir piept’s wohl“, sagte die erste ärgerlich.
„Logisch, reden kann ich ja nicht.“
„Dafür faselst du aber eine ganze Menge“, mischte sich eine dritte Stimme ein.
Alois Hirschhauser fasste entschlossen seine Kuchengabel und stach die drei Zinken in das bis dahin noch jungfräuliche Stück Guglhupf. Petra Sandors Lächeln verlor für einen Moment seine Wehmut.
Hildegard Binsen war an einem nasskalten Tag Anfang März gestorben. Kälte und März beherrschten noch immer das Wetter beziehungsweise den Kalender, aber wie zum Hohn lachte nun die Sonne vom wolkenlos blauen Himmel und lockte die ersten Frühlingsblumen aus der zum Teil noch gefrorenen Erde. Hildegard Binsen konnte diese Blumen nicht mehr sehen. Schade, denn Blumen waren das Einzige gewesen, woran sich ihr mitunter hitziges Temperament nicht entzündet hatte. Mit Blumen hatte man sie immer besänftigen können, selbst wenn die Lage ganz und gar aussichtslos zu sein schien.
Im Unterschied zu Kurt Binsen, Pardon, Herrn Doktor Kurt Binsen hatte Alois Hirschhauser jedoch selten zu diesem letzten Mittel greifen beziehungsweise es Hildegard Binsen selten überreichen müssen. Ihm gegenüber war die liebe Hildegard nur in Ausnahmefällen wirklich aus der Haut gefahren. Oder lag das daran, dass die Blumen weniger das Temperament der hitzigen und jetzt toten Dame als vielmehr das Gewissen der jeweiligen anderen Partei besänftigen sollten? Diesen Schluss ließen zumindest die zu Kränzen gewundenen oder in gewundene Kränze gesteckten Blumen – vor allem Rosen und Gerbera – zu, die den Sarg der Verstorbenen geschmückt hatten und jetzt auf ihrem Grab vor sich hin welkten.
Das Temperament Hildegard Binsens war mit ihrem Tod erloschen, vielleicht sogar ein wenig früher, vielleicht schon mit dem Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr erholen sollte. Das Gewissen der Hinterbliebenen drückte diese jedoch über Hildegard Binsens Tod hinaus oder begann eigentlich erst da, so richtig zu drücken, bis es die Angst hervorgepresst hatte. Die Angst vor den Gerüchten, die klatschsüchtige Mäuler über mangelnde Pietät und so weiter verbreiteten. Oder verbreiten konnten, weshalb die Blumen auf dem Grab also vielleicht weder das hitzige Temperament der Frau Doktor Binsen noch das Gewissen der Hinterbliebenen beruhigen, sondern vielmehr die Mäuler der – weiblichen genauso wie männlichen – Klatschweiber stopfen sollten. Weil Schweigen doch Gold und so.
Wobei die Sache mit den Blumenkränzen auch nicht ganz risikofrei war. Weil so ein Kranz im Grunde die Liebe zum Verstorbenen ausdrücken sollte. Die Größe dieser Liebe richtete sich jedoch nicht selten nach der Größe der Erbschaft. Weil deren Größe und Wert zum Zeitpunkt eines Begräbnisses aber oftmals noch gar nicht feststanden, konnte so eine Grabwanderung schon mal zur Gratwanderung werden. Frei nach dem Motto: Werde ich mir Mutters Kranz noch geleistet haben können, nachdem ich die restlichen Begräbniskosten bezahlt und die Notarrechnung beglichen haben werde? Das Futur exakt ließ sich leider nur sehr ungenau vorhersagen.
Auf Hildegard Binsens Grab waren, zugegeben, nicht viele Kränze gelegen, dafür aber umso größere. „In Schmerz und Trauer. Heinrich und Luise“ war auf dem einen gestanden, dessen dunkelviolette Rosen alles andere als natürlich gewirkt hatten. „In Liebe. Deine Familie“ hatte Alois Hirschhauser auf einem anderen gelesen, auf dem sich rote mit hellrosafarbenen Gerbera duellierten. Und einen Kranz hatte sogar die Stadtgemeinde geschickt. Weil Kurarztgattin und so. Wer sich von den jetzigen Gemeindebonzen noch an den lange verstorbenen Doktor Kurt Binsen erinnern konnte, hatte Herr Hirschhauser sich gefragt.
Er selbst hatte keine Blumen auf den Friedhof mitgebracht, weder einen Kranz noch eine einzelne Rose, die er seiner Hildegard ins offene Grab hätte werfen können. Über die Köpfe der wenigen anderen Begräbnisteilnehmer hinweg, hinter denen er sich während der ganzen Zeremonie nicht hervorgewagt hatte. Wer war er schon? Ein Jugendfreund, mehr nicht. Doch die Jugend lag lange zurück, sehr lange.
Und wer hätte sich bei einem Begräbnis schon nach vorne gedrängt und gerufen: „Ich, bitte, ich hab sie all die Jahre geliebt, obwohl sie mich nicht hat heiraten wollen, sondern lieber diesen eingebildeten Schnösel von einem Arzt genommen hat, sodass ich mein Glück bei einer anderen hab suchen müssen, aber trotzdem nicht von ihr, Hildegard, losgekommen bin!“ Niemand hätte das gerufen, zumindest nicht im richtigen Leben. Und Alois Hirschhauser schon gar nicht. Der hatte still seine Tränen geschluckt und Haltung bewahrt, wie er es all die Jahre über getan hatte.
Und so schluckte er auch jetzt, nicht Tränen, sondern ein Stück von Petra Sandors Marmorguglhupf, den ihm die junge Frau in mütterlicher Fürsorge vor die Nase gestellt hatte. Er bemühte sich, diese Geste zu würdigen, bemühte sich, den Kuchen zu schmecken, von dem er wusste, wissen musste, dass er ganz ausgezeichnet war. Dass die beinahe kitschige Süße des hellen Teiges mit dem bitteren Kakao der dunklen Stellen die perfekte kulinarische Kombination abgab, so perfekt, dass keine Cupcakes und Tartes und anderes neumodisches Backwerk, das es im Café Sisi ohnehin nicht gab und das Herr Hirschhauser darum auch noch nie probiert hatte, damit konkurrieren konnten. Mit anderen Worten: Alois Hirschhauser befahl sich, den Kuchen zu schmecken, weil der ihm bisher noch immer geschmeckt hatte.
„Wenn du als Mann deine Gefühle nicht unter Kontrolle halten kannst, bist du in der Rolle falsch“, ließ sich aus der hinteren Ecke des Café Sisi vernehmen.
„Wieso ich als Mann?“, folgte die verwunderte Reaktion.
„Bist keiner?“
„Sicher bin ich einer, war’s zumindest heute in der Früh beim Duschen noch ...“
„Du duschst? Und das nennst du männlich?“ Man hörte Gekicher.
„Der Mann von heute hat auch Gefühle“, verteidigte sich der in seiner Ehre merklich Gekränkte.
„Aber die Maschine von morgen hat keine, Herrgott noch mal. R2-D2 ist eine Maschine, der kriegt wegen irgendwelcher Gefühlsduseleien nicht gleich die Krise.“
„Doch, kriegt er. Du hast wirklich keine Ahnung.“
„Muss ich auch nicht. Deine ganzen Außerirdischen können mir, ehrlich gesagt, gestohlen bleiben. Denk dir vielleicht mal was anderes aus, eine eigene Story mit Menschen drin.“
„Wenn dir meine Storys nicht zusagen, sei halt das nächste Mal du Spielleiter. Ich reiß mich eh nicht um den Job.“
„Womit auch das gesagt wäre“, mischte sich eine vierte Stimme entschieden ein. Entschieden und entscheidend, denn die Streithähne ließen voneinander ab, um in ihr Paralleluniversum zurückzukehren.
„Was für ein Kontrast“, dachte Petra Sandor kopfschüttelnd. Dieses Häufchen junger, ein bisschen verrückter Männer und der alte, jeder Lebensenergie beraubte Mann, der mechanisch ein Stück Marmorguglhupf nach dem anderen in den Mund schob. Gemeinsam war den fünfen nur das etwas verwahrloste Aussehen. Bei Herrn Hirschhauser hatte sich diese Stilnuance erst in den letzten Wochen herausgebildet. Wie lange sie die vier jungen Männer an dem für so viele Personen eigentlich viel zu kleinen Tischchen beim Fenster schon umgab, wusste Frau Sandor nicht zu sagen, sie kannte die vier erst seit ein paar Wochen.
Sehr höflich hatten sie sich bei der Konditorin vorgestellt. Eine Rollenspielgruppe seien sie, hatten sie gesagt und, einer nach dem anderen, sehr artig ihre Vornamen genannt. Wie zu groß gewordene Schulbuben. Petra Sandor hatte schon abwinken wollen, denn für Laientheateraufführungen fehlte es dem Café Sisi sowohl an Platz als auch an Geld. Aber damit war sie ganz falsch gelegen, denn nicht um Aufführungen und Vorstellungen ging es den jungen Männern, sondern lediglich um einen Raum, ein Räumchen für ihre informellen Zusammenkünfte zum Zweck des Rollenspiels. Da Petra Sandors eigentlich noch junge Stirn weiterhin in Falten gelegen war, hatte einer der Männer erklärt, man schlüpfe bei so einem Treffen in eine Rolle und entwickle auf diese Weise mit den anderen Spielern eine Geschichte. Rein gedanklich. Die Vorstellung fände also ausschließlich in den Köpfen der Teilnehmer statt und habe nichts mit einer öffentlichen Aufführung zu tun. Aufführen täten sie sich selbstverständlich gar nicht, dazu seien sie alle miteinander zu wohlerzogen, hatte der junge Mann mit den sehr kurzen dunklen Haaren hinzugefügt und gezwinkert. Damit hatte er Petra Sandors Herz gewonnen und zugleich die Erlaubnis, sich mit seinen Kollegen oder Freunden zweimal pro Woche im Café Sisi einen Vormittag lang der Fantasie hinzugeben.
Das war natürlich rein grundsätzlich jedem Gast gestattet. Aber der normale Gast fühlte sich, wenn er drei, vier Stunden im Kaffeehaus zubrachte, zumeist doch dazu genötigt, mehr als einen Kaffee oder eine kleine Flasche Mineralwasser zu konsumieren. Ein junger Gast, der regelmäßig zwei Vormittage pro Woche zu diesem Zweck aufwenden konnte, verfügte hingegen tendenziell eher nicht über die finanziellen Mittel, seinen Kaffeehausbesuch mit zwei Tassen Kaffee und zwei Stücken Mehlspeise ‒ mindestens! – zu rechtfertigen. Darum die höfliche Frage bei gleichzeitiger Versicherung, das Lokal sofort zugunsten zahlungskräftigerer Kundschaft zu räumen, sollte dies einmal erforderlich sein. Man versteht, warum Petra Sandor in diesem Fall unmöglich Nein sagen konnte.
Sie hatte ihre Gutmütigkeit bisher auch nicht bereut. Allein die Unterhaltung war’s wert, fand sie. Denn mochte es sich beim Spiel dieses seltsamen Grüppchens auch nicht um eine Vorstellung für andere, außerhalb ihres Universums Stehende handeln, konnte Petra Sandor doch nicht umhin, den Dialogen der jungen Männer des Öfteren zu lauschen – und sich vor Vergnügen ins Schürzchen zu lachen. Die vier waren einfach zu liebenswürdig. Obwohl sie dem heute mehrmals zur Ordnung gerufenen Mann in der undankbaren Rolle des piepsenden und blinkenden Roboters R2-D2 insgeheim recht gab: Eine etwas innigere Beziehung zu Mutter Erde hätte den gespielten Geschichten ihrer Meinung nach nicht geschadet.
Nichtsdestoweniger trat sie augenblicklich an den Tisch der vier Sternenkrieger, als der heutige Spielleiter, auf sich aufmerksam machend, die Hand hob. Womit er dieses Mal eindeutig die hinter der Theke wartende Konditorin und nicht einen ungehorsamen Mitspieler gemeint hatte.
„Was darf es denn sein, Herr ... Andreas?“, fragte sie.
Herr Andreas. Die Anrede kam Petra Sandor auch nach zwei oder drei Wochen noch nicht flüssig über die Lippen. Die vier jungen Männer hatten sich, wie gesagt, jeder einzeln mit Vornamen vorgestellt. Und dabei war es geblieben. Frau Sandors zaghafte Versuche, die Nachnamen der werten Herren in Erfahrung zu bringen, waren freundlich, aber bestimmt abgewiesen worden. Andreas, Walter, Daniel und Justus. Das reiche, hatte der heutige Spielleiter gemeint und niemand hatte ihm widersprochen. Nicht einmal Petra Sandor, weil einem Gast zu widersprechen nur in wirklich dringenden Fällen geraten schien. Und das war kein solcher Fall, war überhaupt kein Fall, war eine Rollenspielgruppe und damit außerhalb jeder Normalität. Oder auch Realität.
Auf die Anrede Herr zu verzichten, hatte Petra Sandor trotzdem nicht über sich gebracht. So leger wollte man sich im Café Sisi doch nicht geben. Vor allem sie wollte sich nicht so leger geben, denn wo käme man denn hin, wenn jeder jeden nur mit dem Vornamen anspräche? Womöglich würde man sie selbst dann auch nur noch Petra rufen. Nicht, dass sie etwas gegen diesen Namen hatte, ganz und gar nicht, aber Petra konnte jeder heißen. Oder besser: jede. Was natürlich auch Vorteile hatte, weil sich zum Beispiel die nationale Herkunft einer Petra gut verschleiern ließ. Petra konnte eine Österreicherin genauso heißen wie eine Tschechin. Oder eben eine Ungarin. Nein, Petra Sandor war keine Ungarin mehr, nicht von der Staatsbürgerschaft her. Und Staatsbürgerschaft ist viel, wenn auch nicht alles. Vor einem sogenannten Migrationshintergrund konnte man nicht davonlaufen, den wurde man nicht los, besonders nicht heutzutage, wo er so sehr in den Vordergrund gestellt wurde. Im Guten wie im Schlechten. Da war Petra eigentlich ganz praktisch, das musste sie zugeben. Trotzdem, Frau Sandor war besser.
Nachdem sie Herrn Andreas, der den Ärger über seine Mitspieler heute offenbar mit einem zweiten Kaffee hinunterspülen musste, noch einen kleinen Braunen gebracht und den – leeren! ‒ Kuchenteller vom Tisch des Herrn Hirschhauser abserviert hatte, zog Frau Petra Sandor sich wieder hinter die Theke zurück, wo ihre Gedanken unweigerlich zu Hildegard Binsen zurückkehrten. Und zu anderen ehemaligen Gästen des Café Sisi.
Sie erinnerte sich an Karl August Graf, einen wortgewaltigen Stammgast im Café, bis, ja, bis er tragisch verunglückt war. Eine Erleichterung für Petra Sandor, noch mehr als für die anderen Gäste, das natürlich, aber trotzdem.
Oder Eckart Glück. Herr Graf war wenigstens alt gewesen, aber dieser Glück war noch jung, als ein Unfall ihn dahinraffte, gerade als Petra Sandor zu hoffen begonnen hatte, dass sich da etwas anbahnen könnte zwischen dem eigenbrötlerischen Musiklehrer und seiner hübschen Kollegin, in deren Begleitung er ein paarmal im Café Sisi aufgetaucht war. Doch dann hatte ausgerechnet die junge Kollegin den Mann überfahren. Wums und vorbei. Die Frau war nach einiger Zeit wiedergekommen, allerdings nicht mehr in Begleitung des Kollegen, sondern zusammen mit einer älteren, dickeren Frau. Maria Liliencron und Waltraud Kranzlbauer hießen die beiden, das wusste Petra Sandor und machte sich so ihre Gedanken. Das Leben und Sterben in Bad Au spiegelte sich en miniature im Café Sisi wider.
Und jetzt hatte es also auch Hildegard Binsen erwischt, die zu den ältesten Gästen gehört hatte. So alt, dass sie bereits regelmäßig das Café Franz Joseph besucht hatte, wenn man ihren Erzählungen aus der Zeit nach der mit einer Namensänderung einhergegangenen Übernahme des Kaffeehauses durch das Ehepaar Sandor Glauben schenken wollte. Ja, es hatte sich einiges verändert in den letzten Jahren, wobei sich besonders die letzten Monate auf die Kundschaft des Café Sisi ausgewirkt hatten. Geblieben waren von den alten Stammgästen Alois Hirschhauser und drei Damen, Maria Calloni, Gertrude Haberhauer und Elisabeth Vrabec. Nicht zu vergessen der treue Inspektor Obermayer, Franz Obermayer, dessen Argusaugen sich in der Regel allein auf Petra Sandors Kuchen und Torten richteten.
Auf der noch jungen Stirn der Konditorin zeigte sich eine steile Falte. Wie idyllisch wäre es ohne die alten Geschichten doch gewesen.
o
Kirschen, Kuchen und Kolleginnen
Das Gymnasium in Bad Au schien nicht zur Ruhe kommen zu wollen. Zu Beginn der großen Ferien, die jetzt freilich schon ein gutes oder eher schlechtes halbes Jahr zurücklagen, der von manchen lang ersehnte, wiewohl doch sehr unerwartete Weggang des seit Jahren pensionsreifen Direktor Dippelbauer. Dann der mindestens genauso unerwartete, hingegen von niemandem, nicht einmal dem unmusikalischsten Schüler ersehnte Unfalltod des Musiklehrers Eckart Glück, dicht gefolgt von den Aufregungen um die neue Direktorin Bettina Glaunigg-Althoff. Und, vorläufiger Schlusspunkt, deren nur scheinbar unmotiviertes spurloses Verschwinden kurz vor Ende des Wintersemesters. Das war ganz schön viel für den Lehrkörper, der doch irgendwie das Wesen einer Schule ausmachte, in der die Schüler wechselten, selbst wenn einzelne Exemplare sich alle Mühe gaben, bis zu zehn Jahre am selben Gymnasium zu verbringen. Ob das für die Atmosphäre einer Schule sprach, sei dahingestellt.
Nach all den Aufregungen hatte kurz vor den Semesterferien auf beinahe allgemeinen Wunsch der Kollegen Alfred Kuntz interimsmäßig die Leitung des Bad Auer Gymnasiums übernommen. Weil solch eine Schule auch oder gerade in Krisenzeiten einer starken Hand bedurfte, damit sich das Wissen nicht am Ende unkontrolliert unter den Schülern ver- beziehungsweise auf ihnen ausbreitete und sie unter sich begrub.
Alfred Kuntz also, Anglist und Geograf, der durch die Übertragung dieser ehrenvollen Aufgabe seine Power zurück und neuen Aufwind bekommen hatte. Das tat ihm sichtlich gut. Nach einem langen Wintersemester, während dessen seine Haare ihre karottenrote Farbe und der ganze Mann seine Kraft verloren zu haben schienen, strotzte Herr Kuntz jetzt wieder vor Energie. Herr Direktor Kuntz, wie seine zum Teil langjährigen Kollegen ihn scherzhaft anredeten, wenn sie sich nicht gar zu einem Herr Direktor Fred verstiegen. Der auf diese Weise Angesprochene wehrte sich ebenso scherzhaft gegen die übertriebene Ehre, was nichts daran änderte, dass die Schmeicheleien runtergingen wie Öl. Da lief das Werkchen, genannt Psyche, einfach besser als mit dem Sand, den die alte neue Direktorin so gern in sein Getriebe gestreut hatte.
„Fred“, sagte da ganz unverblümt Kuntz’ junge Kollegin beziehungsweise Untergebene Maria Liliencron und riss den interimsmäßigen Direktor damit aus seinen Gedanken. „Fred“, sagte sie noch einmal, da der Angesprochene nicht sofort reagierte, „hast du einen Moment für dich?“
Diese Frage war ein bisschen seltsam. Nicht in erster Linie deshalb, weil die Formulierung normalerweise eher eine Einleitung zu einer Bitte denn eine Frage darstellte, sondern seltsam vielmehr deswegen, weil Maria Liliencron sie tatsächlich so gestellt hatte – einen Moment für dich.
Diese Merkwürdigkeit schien Alfred Kuntz jedoch überhört zu haben. Als Direktor einer Mittel- und Oberschule hatte man so viel um die Ohren, dass man unmöglich allem und allen Gehör schenken konnte, zumal man mit Geschenken in dieser Position ohnehin sparsam umgehen sollte. Damit das Personal, also besonders der Lehrkörper, nicht unverschämt wurde.
Deshalb wunderte Alfred Kuntz sich nicht über die Worte der Kollegin, sondern beantwortete deren seiner Meinung nach rhetorische Frage mit einer Gegenfrage. „Was kann ich für dich tun, Maria?“
Das war nett gemeint vom interimsmäßigen Herrn Direktor, aber nett gemeint ist bekanntlich das Gegenteil von nett und nett ist sowieso ... Aber lassen wir das, zumal sich das Sprichwort genau genommen ohnehin auf das Adjektiv gut bezieht. Das erste jedenfalls.
Maria Liliencron sah oder vielmehr hörte aus dieser Frage heraus, dass der liebe Herr Direktor ihr nur ungenügend zugehört hatte, weshalb es einer Korrektur und Konkretisierung bedurfte.
„Für dich, lieber Fred“, sagte sie darum, „nicht für mich.“
Da zogen sich nun doch ein paar Falten oder besser Runzeln durch das ansonsten verjüngte Gesicht unter der leuchtend roten Haarpracht. Obwohl Haarpracht vielleicht doch ein wenig übertrieben war, da der interimsmäßige Herr Direktor den Haarschnitt der Bedeutung seines Amtes angepasst hatte und die von Natur aus eher wirren Wirbel und Kringel akkurat gestutzt und streng frisiert trug. Was nichts an ihrer Farbe änderte. Und noch weniger an den Runzeln, in die Kuntz’ Stirn sich bei den Worten der Kollegin gelegt hatte.
„Warum für mich?“, wollte er wissen. „Ich bin nicht Direktor geworden, damit ich Zeit für mich habe. Dafür fehlt sie mir sowieso. Die Schule geht vor. Außerdem“, fügte er hinzu, „schaue ich eh auf mich.“
Auf ihn schaute auch Maria Liliencron, allerdings ein bisschen skeptisch. Was in gewisser Weise wieder einen Gleichstand herbeiführte, weil somit jeder der beiden Kollegen den anderen mit Skepsis beäugte. Quasi unentschieden.
Entscheidend war aber, dass Maria Liliencron sich nicht mit der Antwort des lieben Herrn Direktor Fred zufriedengab und sogar noch eine dritte Person ins Spiel brachte. „Bist du sicher, Fred, dass du genug auf dich schaust? Auf dich und vor allem auch auf die Claudia?“
Claudia war Alfred Kuntz’ Lebensgefährtin, die in den vergangenen Monaten allerdings kaum noch lebendig, weil schwer depressiv gewesen war. Alfred Kuntz hatte das, wahrscheinlich, zu ändern versucht und war gescheitert, hatte sogar gedroht, selbst aus einer depressiven Verstimmung heraus in eine Depression abzurutschen. Daraufhin hatte Maria Liliencron versucht, die Situation beider gefährdeter Lebenspartner zu ändern und war ... nun, genau das wollte sie wissen.
„Claudia geht es gut“, gab Alfred Kuntz sofort bereitwillig Auskunft. „Die war gleich nach Neujahr bei dieser ... dieser ... Psychotan...“
„Frieda Hirschhauser“, half Maria Liliencron ihm weiter.
„Richtig, danke. Also bei dieser Hirschhauser. Und die hat sie zu einem anderen Psych...“
„Zu einem Psychiater, meinst du?“, unterbrach ihn die Kollegin.
„Ja, richtig. Dort ist sie hingegangen und hat endlich Tabletten bekommen und jetzt läuft’s wieder“, sagte Alfred Kuntz hörbar erleichtert, wobei er offen ließ, ob das apostrophierte s als sie oder es zu denken war. Damit wollte er das Gespräch ... nun, vielleicht nicht abwürgen, aber doch in eine andere Richtung lenken, denn er sagte ein paar floskelhafte Worte zu Maria Liliencron, die ein näheres Interesse an ihrem Befinden vermitteln sollten.





























