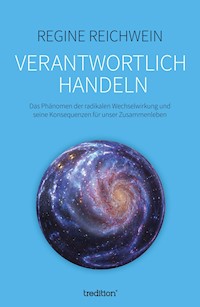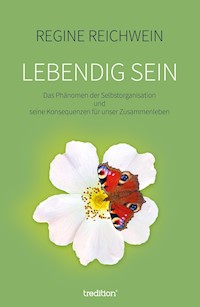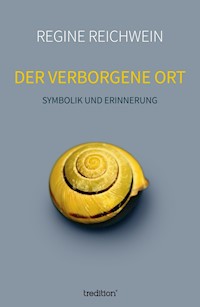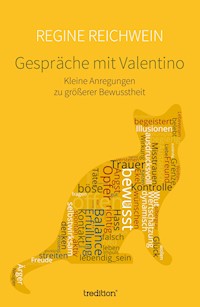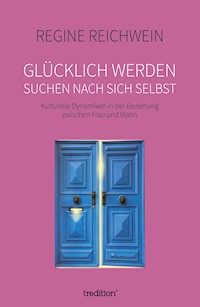
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist in seiner Struktur ungewöhnlich: Es ist sowohl ein Roman als auch eine theoretische Auseinandersetzung über kulturell erzeugte destruktive und konstruktive zwischenmenschliche Verhaltensmuster, insbesondere die zwischen Frau und Mann. Eine Tochter-Vater-Mutter-Beziehung und als deren Konsequenzen das geringe Selbstwertgefühl und die inneren Entwertungsprozesse der Tochter, kindliche Erinnerungen an einschneidende Erziehungsmaßnahmen und zugehörige Träume und Phantasien, kritische Fragen der Tochter an die geistige Welt des Vaters und eine beginnende Liebes-geschichte bilden den Inhalt des Romans. Kulturkritische theoretische Überlegungen begleiten jedes Kapitel des Lernprozesses der Ich-Erzählerin, die sich allmählich dazu entschließt, sich dem Leben und ihrer neuen Liebe auf eine für sie bisher ungewohnte Art zuzuwenden, um glücklich zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
© 2019 Regine Reichwein
Umschlaggestaltung, Innenteil: Angela Herold, www.herolddesign.de
Foto: www.pixabay.com
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-8541-4
Hardcover:
978-3-7439-8542-1
e-Book:
978-3-7439-8543-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
REGINE REICHWEIN
GLÜCKLICH WERDEN
SUCHEN NACH SICH SELBST
Kulturelle Dynamiken in der Beziehung zwischen Frau und Mann
Über die Autorin
Ich habe Mathematik und Physik, aber auch Psychologie, Philosophie, Pädagogik und Politik studiert und war mehr als zwanzig Jahre Professorin an der Technischen Universität Berlin.
Durch die Arbeit mit den Studierenden wurde mir bewusst, dass ich zusätzliche Qualifikationen brauche, um meinen eigenen Ansprüchen an ein umfassendes Angebot in der Lehre zu genügen. In diesem Zusammenhang habe ich eine Ausbildung als Gestaltpsychotherapeutin gemacht und setze mich bis heute mit den jeweils neuesten Ergebnissen der Forschung, insbesondere der Hirnforschung auseinander.
Ich arbeite mit großem Vergnügen als Trainerin, Beraterin und Supervisorin für Einzelpersonen, Gruppen und verschiedene Institutionen.
Von Mai bis Oktober lebe ich in Portugal und schreibe dort meine Bücher, male und entwerfe und nähe Kleider. Den Rest des Jahres lebe ich in Berlin. In dieser Zeit halte ich Vorträge, mache Workshops und was mir sonst noch so Spaß macht.
Genaueres kann man auf meiner Webseite www.reginereichwein.de erfahren. Dort gibt es auch viele pdf´s von Artikeln und Vorträgen zum kostenlosen Herunterladen. Seit 2010 sind fünf sehr unterschiedliche Bücher von mir erschienen. (Siehe dazu „Bestellmöglichkeiten“ am Ende dieses Buches). Dieses Buch ist eine Neuauflage bei Tredition des 2012 im Amani-Verlag erschienenen Romans „Glücklich werden – suchen nach sich selbst “.
Für Miriam
Inhalt
Vorwort
Kap. 1 Fragen ohne Antworten
Kap. 2 Erwartungshaltungen
Kap. 3 Unterwerfung
Kap. 4 Angst vor Berührung
Kap. 5 Kein Platz
Kap. 6 Widersprüche
Kap. 7 Flächenhaftes Denken
Kap. 8 Fehlende Existenzberechtigung
Kap. 9 Anpassungen
Kap. 10 Fallen gelassen
Kap. 11 Frauenrollen
Kap. 12 Möglichkeiten der Kontrolle
Kap. 13 Moralisch minderwertig
Kap. 14 Regeln und Strafen
Kap. 15 Noch mehr Widersprüche
Kap. 16 Spiegelungen
Kap. 17 Verbundenheit und Liebe
Kap. 18 Männliche Wissenschaft
Kap. 19 Selbstkritik und Widerstand
Kap. 20 Unberührbarkeit
Kap. 21 Phantasmische Begegnungen
Kap. 22 Sehnsucht
Kap. 23 Unterwerfung
Kap. 24 Keine Antworten
Kap. 25 Richtungen
Kap. 26 Angst vor Wiederholungen
Kap. 27 Überfremdung
Kap. 28 Vernichtung
Kap. 29 Unterschiedliche Wirklichkeiten
Kap. 30 Verlassen sein
Kap. 31 Schmerzhafte Defizite
Kap. 32 Überraschungen
Kap. 33 Märchenhafte Erinnerungen
Kap. 34 Das eigene Reich
Kap. 35 Ansprüche
Kap. 36 Irritationen
Kap. 37 Entlastung
Kap. 38 Männliche Sozialisation
Kap. 39 Geschlechterrollen
Kap. 40 Trauer um unerfüllbare Wünsche
Kap. 41 Verzweiflung
Kap. 42 Lähmung
Kap. 43 Neue Erfahrungen
Kap. 44 Böse Stimmen
Kap. 45 Selbstablehnung
Kap. 46 Wachsen
Kap. 47 Selbstausdruck
Kap. 48 Solidarität mit dem Täter
Kap. 49 Zugehörigkeit
Kap. 50 Angst
Kap. 51 Leben lernen
Kap. 52 Aneignung
Kap. 53 Gegenwart
Kap. 54 Hilfe aus dem eigenen Inneren
Kap. 55 Liebe und Wunscherfüllungen
Kap. 56 Lernprozesse
Kap. 57 Trennung
Kap. 58 Patriarchale Verhaltensweisen
Kap. 59 Der Preis illusionärer Macht
Kap. 60 Emotionale Distanz
Kap. 61 Veränderung
Kap. 62 Risiko
Literatur
Weitere Veröffentlichungen und Bestellhinweise
Vorwort
Es ist ein Irrtum, anzunehmen, Männer und Frauen seien grundverschieden. Dieser Glaube ist zwar weit verbreitet und wird durch viele Veröffentlichungen immer wieder gestützt. Aber auch wenn Männer wie Frauen die Erfahrung machen, dass diese Vorstellung zu stimmen scheint, ist sie weitgehend kulturell produziert und hat sehr destruktive Wirkungen sowohl auf Frauen als auch auf Männer – wenn auch sehr verschiedene - und auf die Beziehungen zwischen den Geschlechtern.
Diese immer wieder - sowohl von wissenschaftlichen Untersuchungen als von den Medien - vertretene Vorstellung in Bezug auf die grundlegende Verschiedenheit von Frauen und Männern verfestigt meiner Ansicht sowohl entscheidende Problematiken persönlicher Beziehungen als auch bestehende kulturelle Herrschaftsverhältnisse.
Mit Erschrecken habe ich festgestellt, wie viele - gerade auch junge - Frauen sich anstrengen, manchmal bis zur Selbstaufgabe, das „Wohlwollen“ der jeweiligen Männer zu gewinnen, und dann auch noch glauben, sich ihr Scheitern an der emotionalen Distanz ihrer Partner selbst zuschreiben zu müssen. Sie setzen sich dem Urteil der Männer aus, ohne sich bewusst zu sein, wie viele Jahrhunderte der Konditionierung von Frauen ihrem Verhalten vorausgegangen sind. Sie stylen sich, geben ihr meist mühsam verdientes Geld für die sogenannten „Must have´s“ aus usw., um dazuzugehören, um akzeptiert zu sein und um begehrenswert zu erscheinen. Die Medien unterstützen meist völlig unkritisch diese Verhaltensweisen. Die große Verunsicherung der Frauen, die sich dadurch ausdrückt, wird damit - vor allem im Interesse der Wirtschaft - weiter verstärkt.
Aber nicht nur viele Frauen haben den Eindruck, sie selbst - mit ihrer weiblichen Persönlichkeit - reichen nicht aus, um den gesellschaftlichen Erwartungen zu genügen.
Auch Männer sind vielfach in Bezug auf ihre männliche Rolle verunsichert, auch sie haben immer häufiger den Eindruck, sie müssten ihre Männlichkeit künstlich durch zusätzliche Attribute verstärken. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich Männer immer stärker als fremdbestimmt erleben und sich weniger und weniger verantwortlich für ihre eigenen Gefühle, ihre Gedanken und ihr Handeln fühlen. Sie scheinen in vielen Fällen nicht bereit oder in der Lage zu sein, die Rolle eines erwachsenen Mannes zu übernehmen.
Nach sich über viele Jahre hinziehenden Recherchen in den verschiedenen Wissenschaftsbereichen wurde mir immer deutlicher, dass sowohl Frauen als auch Männer in den vergangenen Jahrhunderten durchaus sukzessive an Fähigkeiten hinzugewonnen, aber auch auf wesentliche Aspekte menschlicher Existenz verzichtet haben.
Sowohl Frauen wie auch Männer verfügen zwar über die genetische Ausstattung, sich ihrer persönlichen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Verantwortung bewusst zu werden, nehmen diese Verantwortung jedoch häufig aufgrund der internalisierten kulturellen Muster nicht wahr. Beide Geschlechter zeichnen sich daher häufig durch eine - allerdings individuell unterschiedlich starke - emotionale Unberührbarkeit und damit durch fehlendes Mitgefühl aus. Während Frauen sich überwiegend bemühen, mit ihren empathischen Fähigkeiten ihre Mitmenschen – vor allem ihre Partner und Kinder - zu manipulieren und zu kontrollieren, verwenden Männer ihre empathischen Möglichkeiten eher, um sich emotional distanziert als Opfer - unschuldig und ohne Verantwortung - aus kritischen Situationen heraus zu argumentieren.
Kulturelle Muster aller Art bleiben meistens lange erhalten, auch wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse darauf verweisen, dass viele althergebrachte Vorstellungen nicht mehr haltbar sind. Jede Kultur braucht solche Muster, um die eigene Kontinuität zu sichern, und sie sind für jeden einzelnen Menschen dringend erforderlich, um sich orientieren und in komplexen Situationen des Lebens zurechtfinden zu können.
Aber einige dieser kulturellen Muster entfalten Wirkungen, die sich bis heute nicht nur auf Frauen, Männer und Kinder, sondern auch auf gesellschaftspolitische, ökonomische und ökologische Bereiche zerstörerisch auswirken.
Dazu gehören die von vielen Menschen internalisierten Vorstellungen über die Möglichkeiten und das Recht, Kontrolle über andere Menschen auszuüben und eigene Interessen rücksichtslos gegen andere durchzusetzen, Menschen auf Grund ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer sozialen Situation oder ihrer religiösen Überzeugungen usw. zu diskriminieren und vieles andere mehr.
Aber auch die Vorstellung, Menschen lebten in ein und derselben Wirklichkeit, die von allen in gleicher Weise erkennbar ist, und in der sich das, was richtig ist, von dem, was falsch ist, zweifelsfrei unterscheiden lässt, führt oft zu eskalierenden Auseinandersetzungen, unter denen alle Beteiligten leiden.
Es gibt noch mehr solcher kulturellen Vorurteile oder Muster, die auf immer noch vorherrschenden patriarchalen Wunschvorstellungen basieren.
Und diese kulturellen Muster sind es, die unseren alltäglichen Umgang mit uns selbst und anderen vergiften. Sie führen nur dazu, dass Menschen wechselseitig ihre besten Feinde bleiben.
Das müsste nicht so sein, wenn wir diese Muster erkennen würden und durch bewussten Umgang mit ihnen ihre Wirkungen reduzierten.
Während meiner langjährigen Arbeit als Therapeutin und Beraterin habe ich die Probleme vieler Frauen und Männer kennengelernt. Besonders beeindruckend war für mich immer wieder die Erfahrung, wie groß die Empfindsamkeit sowohl bei Frauen als auch bei Männern in Bezug auf das Verhalten von anderen und wie groß die Sehnsucht nach befriedigenden sozialen Beziehungen ist.
Bedenkt man die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, so ist dies nicht verwunderlich. Menschen sind ausgesprochen soziale Wesen und die Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten ist genetisch verankert.
Diese genetische Grundlage ermöglicht es uns, zugewandt, hilfsbereit, verständnisvoll und neugierig zu sein. Männer wie Frauen sind mit Spiegelneuronen und weiteren besonderen Neuronen ausgestattet, die ihnen intuitives und empathisches Verhalten ermöglichen. Beide Geschlechter sind daher wahrscheinlich mit der gleichen Empfindsamkeit ausgestattet. Männer wie Frauen nehmen von ihnen unerwünschtes Verhalten von anderen wahr, gehen aber aufgrund der kulturellen Muster unterschiedlich und teilweise sehr zerstörerisch damit um.
Jeremy Rifkin schreibt in seinem Buch „Die empathische Zivilisation“:
„Wenn wir Menschen von Natur aus soziale Kreaturen sind, die sich nach Gemeinschaft sehnen und durch die empathische Erweiterung ihres Selbst ihre eigene Bedeutung in der Beziehung zu anderen finden, wie erklären wir uns dann die unglaubliche Gewalt, die wir uns gegenseitig sowie unseren irdischen Mitgeschöpfen antun? Keine andere Spezies hat so viel Zerstörung auf der Erde angerichtet wie der Mensch.“ (Rifkin, S. 28)
Solche zerstörerischen Prozesse aber können wir uns angesichts der beobachtbaren Probleme nicht leisten, weder im Privatleben noch in lokalen oder globalen Zusammenhängen.
Es ist entscheidend, dass wir uns die Fähigkeiten wieder bewusstmachen, die durch kulturelle Einwirkungen nur als destruktive Verhaltensweisen ans Tageslicht treten.
Und dazu gehört meiner Ansicht nach, sich die Prozesse, die so destruktive Auswirkungen haben, noch einmal genauer zu betrachten.
Vielleicht besteht durch zunehmende Bewusstheit die Möglichkeit, dass die besonderen sozialen Fähigkeiten, über die Menschen aufgrund ihrer biologischen Ausstattung verfügen, sich zugunsten eines befriedigenden zwischenmenschlichen Zusammenlebens und zunehmender Achtung vor lebendigen Prozessen auswirken.
Alle Menschen sind – wie andere Lebewesen auch - in gleicher Weise empfindsam und auf wechselseitige Achtung, Akzeptanz und Zuneigung – in welcher Form auch immer - angewiesen und sie gehen auf unterschiedliche Weise damit um, wenn ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden.
Insbesondere diejenigen Menschen, die in ihrer Kindheit unter den Erwachsenen gelitten haben, neigen unbewusst dazu, durch ihr Verhalten das eigene Leiden - vor allem dann, wenn sie ihren eigenen Schmerz verdrängt haben – an andere Menschen und auch an ihre Kinder weiter zu geben.
Erst die Erinnerung an vergangene prägende kindliche Situationen, die damit verbundenen Gefühle, Gedanken und Wünsche und deren Akzeptanz können diese ständigen Wiederholungen unterbrechen.
Meine langjährigen Erfahrungen als Hochschullehrerin und als Therapeutin haben mir immer wieder gezeigt, dass kognitive Anregungen meist keine Veränderung innerhalb des eigenen Systems eines Menschen bewirken. Für die Aktivierung bedeutsamer eigener Erinnerungen, durch die in einem Menschen verändernde Prozesse entstehen können, brauchen Menschen die Möglichkeit, sich emotional identifizieren zu können, um das eigene Selbst in ein anderes Gegenüber projizieren und damit das eigene Selbst erweitern zu können.
Das ist der Grund, weshalb ich mich entschlossen habe, die folgenden Texte einer inneren Auseinandersetzung und Veränderung in der „IchForm“ zu schreiben.
Ich hoffe, dass sich bei den Lesenden mit diesen Texten - in die viele Erfahrungen meiner weiblichen und männlichen Klienten eingegangen sind - diese Prozesse des sich Erinnerns und Akzeptierens aktivieren und sich ihnen damit Möglichkeiten eröffnen, sich selbst aus dem Griff der kulturellen Muster zu befreien.
Kapitel 1
Fragen ohne Antworten
Warum fragen sich manche Menschen immer wieder, ob sie von ihrer Mutter oder ihrem Vater geliebt wurden, ob sie eine Bedeutung für sie hatten, wichtig für sie waren und hören oft bis ins hohe Alter nicht auf zu fragen. Und wenn sie vor sich selbst nicht mehr verleugnen können, dass sie ungeliebte Kinder waren, unwichtig und bedeutungslos für ihre Eltern, hören sie nicht auf zu fragen. Nur ändert sich die Frage. Sie lautet dann: Warum hat mein Vater, meine Mutter mich nicht geliebt, warum war ich ihnen nicht wichtig, warum haben sie sich nicht gekümmert, warum hatte ich keine Bedeutung für sie.
An den Eltern – den in Kinderaugen Übermächtigen, Allwissenden, Allmächtigen – kann es ja nicht gelegen haben.
Und dann können sich die meisten der Schlussfolgerung nicht entziehen: Sie selbst sind es, die nicht liebenswert, die unwichtig und bedeutungslos sind.
Und dann kommt die nächste Frage: Warum bin ich, wie ich bin?
Vielleicht bin ich so geworden, weil meine Eltern so waren, wie sie waren. Ein Produkt der Wechselwirkung.
Sie will es jetzt genauer wissen.
Ich weiß genau, dass ich das, was ich tun will, nicht tun sollte. Alles spricht dagegen. Deswegen habe ich auch niemandem davon erzählt.
Ich habe einfach allen gesagt – ich verreise. Alle haben es geglaubt. Natürlich, der Tod ihres Vaters hat sie sehr mitgenommen. Wie gut, dass sie sich entschlossen hat, zu verreisen.
Wo fährst du denn hin, haben sie mich gefragt. Ich weiß es noch nicht, habe ich gesagt, ich fahre einfach los, und bleibe, wo es mir gefällt.
Schreib uns eine Karte, damit wir wissen, dass es dir gut geht.
Das wollen sie immer von mir, dass es mir gut geht. Mein Vater wollte das auch. Es ist ihm lange Zeit sehr schlecht gegangen, aber nie hat er jemanden damit belasten wollen. Er wusste, wie wichtig es ist, dass es einem gut geht. Er konnte es nur schwer ertragen, wenn es einem schlecht ging. Er hatte viel dazu getan, dass es anderen gut ging. Und nun ist er tot – tot und begraben. Aber seine Wohnung lebt, noch.
Sollen wir dir helfen. Was machst du jetzt mit der Wohnung. Meine Güte, die ganzen Bücher und Papiere. Wo willst du denn damit hin. Deine Wohnung ist doch viel zu klein.
Ich war gekränkt, als sie das sagten. Als hätten sie gemeint, was willst du mit dem ganzen Wissen deines Vaters anfangen, dein Kopf ist doch viel zu klein.
Aber vielleicht haben sie das ja auch gemeint, nur nicht so deutlich ausgesprochen.
Meine Wohnung ist wirklich zu klein. Die meines Vaters ist sehr groß. Ich sitze im Moment in seiner Küche, selbst die ist größer als meine und frage mich, was ich hier will.
Ich habe allen gesagt, ich überlege mir, was ich mit der Wohnung machen will, wenn ich zurückkomme. Und dann habe ich ein paar Sachen gepackt und bin in die Wohnung meines Vaters gefahren.
Und jetzt sitze ich in seiner Küche und komme mir wie ein Einbrecher vor. Als täte ich etwas Verbotenes mit dem, was ich vorhabe.
Ich weiß es genau. Was ich will. Denke ich.
Ich will wissen, wer mein Vater war. Und wer seine Väter waren. Wie er geworden ist, wie er ist. Wie er war. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass er ein bekannter Wissenschaftler war und offensichtlich einiges mit seinen Forschungen bewegt hat.
Es ist, als erwartete ich, er käme gleich zur Tür herein. Ich habe oft, jedenfalls in letzter Zeit, mit ihm in dieser, in seiner Küche gesessen. Ich habe etwas gekocht und er hat gesagt, ich sehe dir so gerne zu, mein Kind, wenn du etwas für mich tust. Ich lasse mich so gern verwöhnen. Manchmal habe ich es vermisst, dass er nicht zu mir sagt: Von dir verwöhnen.
Aber wenn ich ihn so am Küchentisch sitzen sah, mit seinen blass gewordenen Augen und seinem so verzichtend wirkendem Lächeln, so bleich und überarbeitet, dann spürte ich, wie sehr er es auch brauchte, das frische Gemüse und den ausgepressten Orangensaft. Mich eigentlich nicht. Er schien niemanden zu brauchen.
Nur seine Bücher. Niemals fuhr er ohne Bücher in die Ferien, ich kann mich nicht erinnern, meinen Vater jemals ohne Papier in seiner Nähe gesehen zu haben. Irgendwo hatte er immer Papier, bedrucktes oder leeres und das leere blieb meist nicht lange leer. Aber meistens war er weg, in seinem Labor.
Ein paar Mal habe ich meinen Vater auch dort besucht.
Besucht, ist schon zu viel gesagt.
Ich stand sozusagen an der Tür und wartete auf seine Entscheidung oder seine Antwort auf meine Frage.
„Was machst du denn da eigentlich“, habe ich einmal an der Tür seines Labors gefragt; ich war, glaube ich, vierzehn damals.
„Ach, Kind“, hat er gesagt und meinen Kopf gestreichelt, „wie soll ich dir das erklären. Also, weißt du, es hat etwas mit…, ach, ich glaube, du verstehst das noch nicht. Und überhaupt, seit wann interessieren sich denn kleine Mädchen für so etwas.“
Ich fühlte mich, ja wie fühlte ich mich eigentlich. Ich weiß es gar nicht mehr, so viel war es auf einmal. Ich weiß noch, dass ich dachte, irgendwie bin ich nicht in Ordnung, aber ich war auch enttäuscht und wütend. Glaube ich, wenigstens heute.
Nein, das stimmt nicht. Ich war nicht wütend. Ich war auch nicht traurig. Ich habe es einfach akzeptiert. So etwas ist nichts für Mädchen. So ist ein Mädchen nicht. Ich erinnere mich jetzt genau. Ich fühlte gar nichts in diesem Moment, ich habe nur gedacht, ich wollte, ich wäre ein Junge 1). Mehr nicht.
Während ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir die Formulierung auf. Ich wollte.
Ich hatte schon aufgegeben. Daran, dass ich ein Mädchen war, habe ich nicht gedacht. Ich habe damals mit dem in der Vergangenheit angesiedelten Wunsch „Ich wollte, ich wäre ein Junge“ auch die Tatsache verleugnen, dass ich ein Mädchen war.
Heute bin ich eine Frau. Was immer das bedeutet.
Kapitel 2
Erwartungshaltungen oder die Zugehfrau
Viele Frauen erfüllen häufig mit großer Selbstverständlichkeit die Erwartungen von Männern und viele Männer erwarten ziemlich selbstverständlich die Erfüllung ihrer Wünsche. So selbstverständlich, dass sie meist nicht einmal darum bitten, geschweige denn sich bedanken.
Wunscherfüllung ist oft für sie das Entscheidende. Wer die Person ist, die sie erfüllt, ist meist nicht von Bedeutung: die Ehefrau, die Geliebte, die Haushälterin, die Tochter oder wer auch immer.
Ob Männern die Bedeutung der Zuwendung aus Liebe eigentlich bewusst ist?
Sie hat auch Wünsche. Ihre Erwartungen werden nicht von anderen erfüllt, das muss sie alleine machen. Es wird ihr klar, dass von der Doppelbelastung der Frauen2) nur die Männer profitieren.
Während ich so am Küchentisch sitze, fällt mir die Zugehfrau meines Vaters ein. Offensichtlich hat sie alles sauber gemacht, während mein Vater auf Reisen war. Die Küche blitzt geradezu. „Man muss vom Fußboden essen können“, das sagte meine Mutter immer. Mein Vater lächelte dazu. Ihm war es recht, aber verlangt hat er es nie, das hatte er nicht nötig, meine Mutter machte es von allein. Fast alles machte sie von alleine.
Nie beklagte sie sich darüber, dass sie alles alleine machen musste. Obwohl alle es wussten. Nur sie schien es nicht einmal zu ahnen.
Die Zugehfrau, jedes Mal, wenn ich das Wort ausspreche, kriege ich merkwürdige Assoziationen.
Ich denke an ein Bild von Dali3), die Frau, die voller Schubladen ist, und stelle mir vor, wie alle ihre offenstehenden Schubladen sich plötzlich schließen, gefüllt mit allem Müll, allem Staub und Dreck, der vorher die Wohnung erfüllte. Ich sehe die Frau gebückt und schwer voll aller Last, die nicht ihre ist, aus der Wohnungstür heraus und die Treppe herunter gehen, langsam, schleichend, eng an das Geländer gepresst, eine Stütze in ihrer Nähe suchend, aber keinen Gebrauch davon machend.
Ich sehe, wie diese Last selbst ihre Augenlider herunterzieht und ihren Mund zu einem Strich werden lässt, mit dem sie eine Grenze zu dem unteren Teil ihres Körpers zieht.
Die Zugehfrau kam regelmäßig, seitdem meine Mutter nicht mehr lebt, aber mein Vater konnte die Vorstellung kaum ertragen, dass sie für Geld die Wohnung putzte, die Wäsche wusch, die Lebensmittel einkaufte und das Essen kochte. Sonst sprach er oft von seiner Wohnung, seinem Bett, seinen Anzügen. Im Zusammenhang mit ihr verwendete er niemals besitzanzeigende Fürwörter. Sie putzte die Wohnung und sie bekam das Geld dafür. Sonst hätte er ihr vielleicht einmal danke sagen müssen.
Er verließ meist die Wohnung, wenn sie kam, und kam erst zurück, wenn sie mit allem fertig und gegangen war. Er verbrachte die Zeit, arbeitend im Institut oder zeitungslesend im Cafe. Nicht einmal diese Zeit war seine Zeit. Er verbrachte sie, von hier nach da, wie eine zu transportierende Ware, die ihm dann irgendwie unterwegs verlorenging.
Warum hat er nie mit ihr eine Tasse Kaffee getrunken. „Es gehört sich nicht, jemand anderen für sich arbeiten zu lassen, man darf den eigenen Dreck nicht anderen überlassen. Aber Kind, ich kann es nicht, ich habe es nie gelernt. Seit dem Tode deiner Mutter ist alles so schwierig.“
Merkwürdig, bei Mutter hat es ihn nie gestört. „Aber sie hat es doch aus Liebe getan, das ist etwas ganz anderes“, sagte er.
Bei mir kommt keine Frau mit Schubladen vorbei, um den Dreck einzusammeln, selbst den Staubsauger muss ich selbst in die Hand nehmen.
Als meine Mutter älter wurde, hatte sie auch eine Putzfrau, einmal in der Woche. Mein Vater nannte sie die Aufwartung.
Mir klang das immer sehr galant in den Ohren. Sie war seine Aufwartung für seine Frau. Die Aufwartung wartete seiner Frau auf und er bezahlte sie. Mit ihm hatte die Aufwartung nichts zu tun. Er genoss es, dass alles gemacht war, wenn er nach Hause kam und sagte zu seiner Frau: „Wie schön du alles wieder gemacht hast“, obwohl beide wussten, die Hauptarbeit hatte die Aufwartung getan. Jedenfalls hörte ich ihn so reden, als ich schon erwachsen und aus dem Hause war.
Früher, als wir Kinder klein waren und unsere Spielsachen über die ganze Wohnung verteilten, kam er oft nach Haus, sah sich irritiert um und fragte, ohne seine Frau anzusehen, in die Gegend: „Was hast du eigentlich den ganzen Tag getan?“ Es war ein Vorwurf, wir alle hörten ihn deutlich, aber er hätte es abgestritten, wenn man ihn darauf aufmerksam gemacht hätte. „Aber nein, so habe ich es nicht gemeint.“
Mein Vater war lieb, nie hat er etwas so gemeint. „Seid friedlich“, sagte er zu uns, wenn wir uns stritten.
Warum wir das taten, war nicht wichtig für ihn. „Regt eure Mutter nicht auf“, sagte er. „Stört Vater nicht“, sagte sie. Sie liebten sich wirklich. Meine Mutter war nun schon lange tot. An ihre Stelle ist die Zugehfrau getreten. Seit über zehn Jahren ist sie bei meinem Vater, jeden Tag für einige Stunden. Sie macht nicht nur den Haushalt, sie nimmt Telefongespräche entgegen, schreibt ihm ausführliche Berichte über deren Inhalt auf große weiße Zettel und bereitet kleine kalte Essen für seine Freunde vor. Manchmal auch warme, nur in den Backofen zu schieben, mit genauer Angabe der Zeiten fürs Vorheizen und fürs Aufwärmen und bereits gedecktem Tisch und bereitgelegtem Korkenzieher und in der Thermoskanne heißgehaltenem Mocca.
Mein Vater legt Wert darauf, ihr niemals irgendwelche Anweisungen zu geben. Er teilt ihr nur schriftlich mit, es kämen sechs oder acht Personen zum Abendessen und ob sie vielleicht eine Kleinigkeit richten könne.
Sie tut es.
Sie wählt und kauft die Weine und den Aperitif passend zum Essen, schreibt ihm minuziös auf, was zuerst und was zuletzt kommt und was er wo findet.
Selbst die Abrechnung verläuft schriftlich.
Ich habe sie ein paarmal gesehen. Sie ist eine Frau mit ernsten Gesichtszügen, klaren direkten Augen und einem ausgeprägten schön geschwungenen, festen Mund. Sie sieht nicht aus wie die Schubladenfrau, die ich die Treppe herunterschleichen sah. Sie wirkt offen und selbstbewusst.
Einmal habe ich sie gefragt, und sie hat mir erzählt, sie würde allein leben und habe ein Kind zu ernähren. Ihre Tochter sei spastisch gelähmt und sie würde in dem Vorstand der entsprechenden Elternvereinigung mitarbeiten.
Mein Vater hat mir nie etwas von ihr erzählt. Ich denke, er wusste gar nichts von ihr und ich weiß auch nicht viel von ihr. Der Rechtsanwalt hat ihr geschrieben und ihr eine Traueranzeige geschickt, damit sie nicht erst aus den Medien erfährt, dass mein Vater in seinem Urlaub tödlich verunglückt ist.
Es hat in der Zeitung gestanden. Fünf verschiedene große Anzeigen. Und sie war auch auf der Beerdigung.
Ich denke, sie hat meine Adresse nicht. Mein Vater und sie haben offensichtlich fast nie miteinander gesprochen und sicher hat er nie etwas von mir mitgeteilt. Aber der Rechtsanwalt hat mir gesagt, dass sie in einer Erdgeschosswohnung im Gartenhaus wohnt.
Während ich an seinem Küchentisch sitze – er riecht immer so angenehm, sie hat ihn mit irgendeiner Spezialmischung, in der Bienenwachs ist, eingerieben – wird mir plötzlich klar, wie groß der Unterschied, nein, wie klein der Unterschied zwischen Geld und Liebe ist.
Wie denn nun?
Ich glaube, dass Männer sich schon immer getraut haben, klarer zu denken als Frauen und ich denke an den berühmten Nationalökonomen4), der – soweit ich mich erinnere – , auf die Nützlichkeit der Erfindung der Hausfrau hingewiesen hat.
Mein Vater hat, glaube ich, meiner Mutter nie verziehen, dass sie ihn durch ihr Sterben unversorgt allein zurückgelassen hat und dass er sich diese Versorgung seit mehr als zehn Jahren kaufen muss.
Und er hat wohl auch der Zugehfrau nie verziehen, dass er sie für ihre Arbeit bezahlen muss. Denke ich.
Aber vielleicht war es ja auch anders, ganz anders.
Nur, warum hat er nie mit ihr gesprochen, sich nie für sie und ihr Leben interessiert?
Wie oft hat er zu mir gesagt: „Ach, Kind, ich habe an so viele Sachen zu denken.“
An Sachen.
Auch sie wäre eine Sache mehr, eine Sache zu viel gewesen, oder?
Ich habe Angst, ich bin ungerecht.
Sicher hat er den Satz nicht so gemeint.
Nur, wie hat er ihn gemeint.
Ich habe damals nicht weiter gefragt. Aber nun will ich es wissen. Und ich werde die Antwort suchen. In all dem toten Papier liegt die Antwort vergraben. Die Antwort auch auf die Frage, was unterscheidet die Zugehfrau von meiner Mutter. Wo sie ihr doch so ähnlich ist.
Kapitel 3
Unterwerfung oder die Worte
Worte haben kein Eigenleben, wenn sie nicht gehört werden. Sie verdorren sehr schnell und vergiften dann nur den Ort, von dem sie herkamen, außer man verleiht ihnen durch andere Maßnahmen eine Wirkung. Aber welche Möglichkeiten bleiben einer Frau, wenn sie liebt?
Sie schreit nicht, sie schmeißt nicht mit Gegenständen, sie verbrennt nicht das Essen, sie verweigert nicht die Erfüllung der ausgesprochenen und der unausgesprochenen Erwartungen.
Sie funktioniert weiter. Wenn sie sich nicht wehrt, tötet die kulturelle Konditionierung langsam die Worte in ihrer Seele.
Nur wie sie sich wehren kann, hat sie nicht gelernt.5)
Ich sitze immer noch in der Küche und rieche das Bienenwachs, das sie in das Holz gerieben hat. Sie hat noch mehr Gerüche hinterlassen, diese Frau. Ich war inzwischen im Badezimmer. Sie hat die Seifen ausgesucht, die das ganze Bad mit ihrem Duft erfüllen. Sie hat auch das Rasierwasser gekauft, die weichen, dunkelroten, großen Badetücher sowieso. Als ich mir mit ihrer flauschigen Weichheit die Hände abgetrocknet habe, wusste ich es. Sie hat ihn geliebt. Auf eine stumme, unbefriedigt bleibende Art hat sie meinen Vater geliebt.
Plötzlich stutze ich. Wieso benutze ich das Wort „stumm“. Als ob man nur mit Worten reden, ich meine, etwas ausdrücken könnte.
Ich weiß, warum ich denke, ihre Art zu lieben sei stumm gewesen.
Für meinen Vater zählen nur Worte. Was nicht in Worte zu fassen war oder in Zahlen und Symbole, existierte für ihn nicht. „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“6) war seine Devise.
Und Schweigen ist NICHTS. Frauen hatten zu schweigen. Sei schön und halte den Mund.
Schweigen bedeutet, man hatte nichts zu sagen.
Wer was zu sagen hatte, war wer. Wer nichts zu sagen hatte, war nichts. Mein Gott, was habe ich zu sagen und wem habe ich etwas zu sagen? Niemanden.
Nur mir. Mir selbst.
Mir habe ich etwas zu sagen.
Ich sage mir, wie ich bin, wie ich etwas zu tun habe, was ich tun sollte, was ich falsch gemacht habe, wie ich versagen werde, was ich nicht kann und was ich nicht tun sollte.
Außer mir habe ich niemandem etwas zu sagen. Nicht einmal meinen Kindern. Meinem Mann, von dem ich schon lange getrennt bin, hatte ich auch nie etwas zu sagen.
Auch meine Mutter hatte mir nichts zu sagen. „Warte, ich sage es Vati“, sagte sie. Und sie sagte es ihm und er sagte uns, was er uns zu sagen hatte. Er hatte etwas zu sagen.
Nicht nur uns.
Meine Mutter war auch stumm.
„Weißt du, und dann habe ich deiner Mutter gesagt“, so fingen seine Sätze noch lange nach ihrem Tode an, wenn wir abends nach seiner Arbeit, zusammensaßen und ich versuchte, ihm von meinen Problemen mit meinem Mann zu erzählen.
Meine Mutter fing ihre Sätze anders an.
Sie sagte: „Weißt du, Vati hat gesagt…“. Was Vati gesagt hatte, war immer das Wichtigste und zu allem hatte Vati bereits etwas gesagt.
Wenn ich mich jetzt daran erinnere, merke ich, wie gerührt ich gleichzeitig darüber bin.
Ich weiß es genau, ich bin gerührt darüber, wie sehr sie sich geliebt haben. Und ich merke auch, wie ironisch ich mich fühle, wenn ich sage, „geliebt haben“.
Während mir das bewusst wird, werde ich zornig und bitter. Diese Rührung ist ihr Erbe. Und dieses Erbe hat mein ganzes Leben vergiftet, vergiftet es heute noch.
Es hat eine Sehnsucht in mir erzeugt, deren Erfüllung meine Vernichtung bedeutet. Ich habe es zweimal erfahren und bin knapp davongekommen. Wie konnte mein Vater das tun. Wie konnte meine Mutter das zulassen oder umgekehrt, wie konnte mein Vater das Tun zulassen und meine Mutter das tun. Aber was. Selbst das weiß ich immer noch nicht genau. Aber ich werde es herausfinden.
Warum haben sie das einander angetan. Was haben sie einander angetan, wie konnte es dazu kommen und was haben sie sich davon versprochen. Dabei haben sie gar nichts wirklich getan. Sie haben sich geliebt, zusammengelebt, Kinder bekommen, gearbeitet, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch.
Sie leben. Heute noch. Weil ich noch lebe.
Was soll ich bloß tun. Wie ich mich hasse.
Diesen Satz „Was soll ich bloß tun“, kenne ich von meiner Mutter. „Was soll ich bloß tun.“ Und ich weiß von mir, dass ich heute noch den Satz „tu doch, was du willst“ als Lieblosigkeit empfinde. Warum bloß.
Ich wollte doch immer tun, was ich wollte. Was ich wollte. Vergangenheitsform. Was ich wollte, ist ungefährlich und ohne Risiko, immer schon vorbei. Ich wollte. Ich wollte. Ich wollte doch bloß. Immer alles in der Vergangenheit. Welche Konditionierung.
Was wird sein, wenn ich endlich einmal etwas will. Ich höre schon die Stimme meiner Mutter: „Aber Kind“, und ich sehe den Zeigefinger meines Vaters „ich sage dir“ … .
Aber jetzt will ich auch einmal etwas sagen.
Ich will etwas sagen zu dem, worüber man nicht reden kann, sondern schweigen soll. Und ich werde herausfinden, was es ist.
Kapitel 4
Angst vor Berührung oder Das Bett
Die Angst der Väter vor der erotischen Anziehung der Töchter ist ein Ergebnis der Ausgrenzung von Sinnlichkeit in unserer Kultur. Sinnlichkeit als die wunderbare Möglichkeit, sich mit der eigenen Umwelt verbunden zu fühlen, ist uns weitgehend verloren gegangen. Stattdessen hat Sexualität ihren Platz eingenommen. Mütter und Väter können sich häufig nicht mehr auf eine sinnlich-erotische Weise aneinander und an ihren Kindern erfreuen, diesen Platz haben oft ihre Haustiere eingenommen.
Nur selten können Väter ihren Töchtern sagen, wie schön und begehrenswert sie sind, nur selten Mütter ihren Söhnen, wie attraktiv und männlich sie auf sie wirken. Und selbst zwischen den Liebespaaren verschwindet die miteinander – auch mit Worten – geteilte Sinnlichkeit. Erotische Anziehung wird mit sexueller gleichgesetzt. Die Poesie in zwischenmenschlichen Beziehungen geht verloren.
Das hat für alle Beteiligten destruktive Folgen.7)
Ich muss schlafen gehen.
Warum befehle ich mir eigentlich ununterbrochen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich muss nicht. Ich will und ich werde schlafen gehen. Und ich stehe auf und gehe still durch die Zimmer der Wohnung meines Vaters. Es ist eine große Eckwohnung. Von der Haustür komme ich in den vorderen Flur. Rechter Hand, zur Straße hin, gehen drei vom Flur aus zugängliche und miteinander verbundene Zimmer ab, die von meinem Vater zum Wohnen und Arbeiten genutzt werden. Genutzt wurden, muss ich ja jetzt sagen. Auf der linken Seite kommt erst das Gästebad, dann ein größerer Raum, in dem Besprechungen stattfinden können und bis zu zwölf Personen essen können und die große Küche. Alle Räume haben Türen zum Flur und sind auch untereinander verbunden. Am Ende hat der vordere Flur zwei weitere Türen, die rechte führt in eines der Arbeitszimmer, die linke in ein rechtwinklig dazu gelegenes Durchgangszimmer, durch das man in den hinteren Flur, aber auch in die Küche kommt. Im hinteren Flur gibt es drei Türen, eine geht in die ehemalige Mädchenkammer, eine in das Bad und eine in das Schlafzimmer meines Vaters. Ich bin einmal durch alle Räume gegangen und stehe plötzlich wieder an der Eingangstür der Wohnung. Ich habe sie geöffnet, als wollte ich gehen.
Als hätte ich keinen Platz zum Schlafen in dieser Wohnung und müsste dort schlafen gehen, wo ich hingehöre. In meine kleine Wohnung, in der ich alleine lebe, seit Jahren. Meine Kinder sind groß. Meine Männer sind weg. Meine Liebhaber manchmal da.
Ich schließe die Wohnungstür und frage mich, warum ich plötzlich Herzklopfen habe.
Ich kann doch nicht im Bett meines Vaters schlafen. Ich gehe in das erste Zimmer, alle sagen immer „die Bibliothek“, obwohl in den anderen Räumen und in dem Durchgangszimmer, in beiden Fluren und im Schlafzimmer meines Vaters fast alle Wände bedeckt sind mit Regalen voller Bücher. Im ersten Zimmer, welches mit einer kleineren Tür mit den beiden Arbeitszimmern meines Vaters verbunden ist, steht ein kleines braunes Ledersofa, mit ein paar Seidenkissen in verschiedenen grünen Tönen und einer Mohairdecke, auch in grün und blau gehalten, passend zu den grünen Glasschirmen der Lampen in diesem Raum. Ich mache alle Lichter an, auch in den benachbarten Räumen, zwischen denen große Flügeltüren sind, und erkläre mir, warum ich auf diesem Ledersofa schlafen werde. Gleichzeitig höre ich meinen eigenen Erklärungen verwundert zu.
Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann nicht glauben, was ich mir selbst erzähle.
Ich kann nicht in dem Bett meines Vaters schlafen, höre ich mich sagen, weil ich offensichtlich immer noch so eifersüchtig auf meine Mutter bin, dass ich mir nicht vorstellen kann, nicht vorstellen will, wie mein Vater und meine Mutter in diesem Bett, in dem sie immer gemeinsam geschlafen haben, Liebe machten. Ich kann mir meinen Vater als leidenschaftlichen Liebhaber nicht vorstellen. Bilder von hageren, verspannten Körpern, gefalteten Händen, versteckten Brüsten, halberigierten Gliedern mit tröpfelndem Samenerguss, gesichtslos und ohne Ausdruck, ziehen in meinem Kopf vorbei, so schnell, dass ich nicht eines der Bilder deutlich erkennen kann.
Ich merke, wie verspannt ich selber bin und denke mir, Freud hätte seine Freude an mir. Ich sehe an den Büchern entlang, wo er steht. Blaugrau, die Gesamtausgabe. Wo finde ich, was er über den Ödipuskomplex geschrieben hat. Morgen werde ich es nachlesen. Morgen werde ich darüber nachdenken, warum ich nicht in das von der Zugehfrau frisch bezogene Bett meines Vaters gehen kann. Trotzdem gehe ich noch einmal zurück in sein Schlafzimmer und betrachte es von der Tür aus.
Früher war es unser Kinderzimmer. Die Eltern schliefen in dem Zimmer, wo jetzt das Ledersofa steht. Und nun bin ich erst recht in meinen Phantasien gefangen. Ich spüre die Beklemmung. Und ich erinnere mich. Ich erinnere mich an den Geruch meines Vaters und daran, dass es eine Zeit gab, als ich noch ganz klein war, in der ich zu ihm in die Badewanne durfte. Das Bad war damals nicht dunkelrot gekachelt und voller Spiegel und Licht wie heute. Es war alles ganz anders. Eine andere Wohnung. Dort gab es damals noch einen Badeofen, der geheizt werden musste. Und ich erinnere mich, wie ich eines Tages vor der verschlossenen Badezimmertüre stand, schreiend und allmählich leiser weinend. Ich durfte nicht mehr zu ihm in die Badewanne.
„Nein, das geht jetzt nicht mehr. Hör auf zu schreien. Geh in Dein Zimmer. Sei still. Du störst. Vati will alleine sein. Frag nicht immerzu. Gehorche und sei lieb.“
Gehorche, sei lieb, wurden für mich zu einer unauflöslichen Einheit. Etwas an mir war schmutzig und durfte nicht mehr in das gleiche Badewasser wie mein Vater.
Meine Mutter badete zu Zeiten, in denen ich schlief oder nicht da war. Ich habe sie erst, als ich schon fast erwachsen war, nackt gesehen. Ihre Weichheit stieß mich ab, ich war selbst so. Ich bin so. Verflucht.
Morgen lese ich Freud und heute weiß ich nicht, wo ich schlafen soll. Wieder „soll“. Was „soll“ ich tun. Ein solcher Satz würde meinem Vater nicht über die Lippen kommen. Warum ihm nicht und warum mir so leicht, dass er alle anderen Sätze verdrängt.
Ich muss es herausfinden. „Muss“. Auch so ein Wort, das er nicht benutzt hätte, außer im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Da musste er. Aber es war ein müssen aus ihm heraus. Ein innerer Zwang, der der Wichtigkeit seiner Arbeit entsprach. Wer sonst hätte es getan, hätte es tun können. Getan werden musste es, also musste er.
Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Wessen Notwendigkeit? Meine? Ich verbessere meine Sprachgewohnheit. Ich muss nicht schlafen. Ich will jetzt schlafen. Ich will auf dem kleinen braunen Ledersofa, umgeben von dem grünen Licht und den vielen Büchern schlafen. Zusammengekrümmt und still, um niemanden zu stören, niemanden zu verdrängen, niemandem etwas streitig zu machen, niemandes Platz einzunehmen. Ich nehme niemandes Platz ein, ich bin niemand, wenn ich nur das tue, was kein Tun ist.
Ich liege auf dem Ledersofa und merke, wie unbequem es ist, darauf auf der Seite zu liegen. Es ist gedacht, darauf auf dem Rücken liegend zu lesen oder bequem darauf zu sitzen. Nicht zum Schlafen. Stunden später stehe ich auf und ich fühle mich zerschlagen. Ich will nicht mehr niemandem einen Platz wegnehmen.
Ich bin auch ein Mensch. Auch mein Vater würde mir meinen Schlaf nicht streitig machen. Er wollte immer nur mein Bestes.
Das hat er ja auch gekriegt, denke ich noch zynisch einen Moment hinterher.
Dann beschließe ich, auch das Denken auf morgen zu verschieben, mache die restlichen Lampen in allen Zimmern an, während ich mich langsam auf das Schlafzimmer meines Vaters zu bewege. Und dann öffne ich die Tür zum zweiten Mal, mache die kleine Lampe neben dem Bett auch noch an und lege mich angezogen in sein Bett. Ich prüfe noch einmal kurz, ob ich etwas riechen kann, aber da ist nur der künstliche Wiesengeruch kuschelweich gespülter Wäsche. Ein weiterer Geruch, den die Zugehfrau hinterlassen hat.
Der Geruch meines Vaters ist verschwunden. Und ich schlafe irgendwann ein.
Ich wache so zerschlagen auf, als hätte ich die ganze Nacht auf dem Ledersofa verbracht. Der Wecker zeigt halb sieben. Die übliche Zeit für mich aufzustehen. Aber heute brauche ich nicht aufzustehen. Ich bin verreist, ich bin sozusagen gar nicht da.
Freud will ich lesen, erinnere ich mich und plötzlich werde ich mir schamhaft meines eigenen wollüstigen, so sagt man wohl, Körpers unter der weichen Daunendecke bewusst. Ich streichle mich und bemerke, dass ich mich streichle, als täte dies jemand anderes.
Ich prüfe den Schwung von meiner Taille zu meinen Hüften, die Weichheit meiner Haut unter meinem Hemd, meine vollen Brüste, meine zarten, sich aufstellenden Brustwarzen, prüfe mich wie eine Ware. Gut genug. Noch gut genug. Ich höre auf damit. Ich hasse mich.
Warum eigentlich. Wieso habe ich das Gefühl, mein Körper gehört nicht mir, meine Vergnügungen müssten durch jemand anderen verursacht werden, die Berührung meiner Haut durch meine eigenen Hände sei eine Sünde, schmutzig, aber abwaschbar.
Wasch dich auch da unten, höre ich meine Mutter sagen. Waschlappen gab es immer zwei, auf manchen war der Zweck ihres Daseins aufgedruckt. Weibliche Waschlappen.
Wieder fällt mir ein, ich wollte Freud lesen. Aber ich merke, dass mir allein die Vorstellung, aufzustehen und mich mit den Büchern meines Vaters zu befassen, in einen Zustand völliger Lähmung versetzt. Meine Anziehsachen kneifen. Warum nur habe ich mich nicht ausgezogen in das Bett meines Vaters gelegt. Als hätte ich Angst gehabt, eine Grenze würde überschritten. Mir ist nur nicht deutlich, wessen Grenze. Meine, oder die meines Vaters. Dabei fällt mir etwas ein, – ich fühle mich gedemütigt, und mag mich kaum daran erinnern, wie es wirklich war, – aber plötzlich fühle ich mich wie das kleine Mädchen von damals. Ich bin nackt und nass unter dem großen grünen Badetuch und renne auf meinen Vater zu. Er sitzt in seinem Sessel neben dem Schreibtisch und liest. Er blickt auf, als er mich kommen sieht, mühsam das große, um meinen Körper gewickelte Handtuch festhaltend. Ich sehe, wie er mich ansieht. Ich werde diesen Blick nie vergessen und angezogen von diesem Blick versuche ich, auf seine Knie zu klettern, da schiebt er mich weg und sagt mit einem Blick auf meine Mutter: „Das Kind macht mir meine Bügelfalten ganz kraus.“ Ich war nicht ganz vier Jahre alt und habe seitdem nie mehr auf den Knien meines Vaters gesessen.
Seine Bügelfalten waren wichtiger als ich und was ich wollte. An das, was danach geschah, kann ich mich nicht erinnern.
Aber seitdem ich mein eigenes Geld verdiene, habe ich mir nur noch weiße – nie mehr grüne – Handtücher gekauft, bis auf die kurze Periode, in der ich die Farbe orange bevorzugte.
Aber die ging schnell vorbei, wie so viele, in denen ich die Auflehnung probte.
Probte, welch ein scheußliches Wort: „probte“.
Probehandel im Kopf, das waren meine Auflehnungen, logischerweise habe ich es meist dabei belassen.
Kapitel 5
Kein Platz oder Überflüssiger Raum
Frauen halten sich zurück. Führungspositionen8) in allen gesellschaftlichen Bereichen sind überwiegend von Männern besetzt. Meistens nehmen Männer die gesellschaftlichen, aber auch die privaten Räume ein. Männer haben meist ein Arbeitszimmer, Frauen vielleicht ein kleines Eckchen.
Die gesellschaftliche Situation ändert sich derzeit, Frauen erheben inzwischen Ansprüche auf Positionen und Räume, die sie ausfüllen wollen. Aber die Chancen sind eingeschränkt und freiwillig werden keine Privilegien aufgegeben.
Leider wehren sich auch Frauen gegen die Quote, mit deren Hilfe mehr Frauen in führende Positionen kommen sollen. Sie wollen – als nicht genug wertgeschätzte Töchter ihrer Väter – nur wegen ihrer Kompetenz, ihrer Qualifikationen, ihrer Leistungen eine Position bekommen, aber nicht wegen einer Quote. Ihnen ist meistens nicht bewusst, dass niemand ohne Zwang auf Herrschaftsbefugnisse und Macht verzichtet.
Wenn eine Frau einen Raum einnehmen will, auf den auch Männer einen Anspruch erheben oder der bereits besetzt ist, hat das immer Konsequenzen, allerdings unterschiedlicher Art.
Sie macht die Erfahrung, wie gut es sich anfühlt, etwas anderes zu verdrängen und selbst den freiwerdenden Raum einzunehmen.
Ich stehe auf, setze die Kaffeemaschine in Gang, gehe ins Bad und lasse mir Badewasser einlaufen. Ich schütte zu viel von dem blauen Zeug in die Wanne, setze mich auf den Toilettendeckel und betrachte das Geschehen in der Wanne. Wie viel Schaum sich aus so einem bisschen blauer Flüssigkeit entwickeln kann, ist erstaunlich.
Ich kann den Blick nicht abwenden, es ist, als beobachtete ich ein tiefgründiges symbolisches Geschehen.
Alles in mir sehnt sich danach, in diesem immer dichter werdenden weißen Schaum zu verschwinden.
Als die Wanne ganz voll ist, steige ich hinein. Wasser und Schaum schwappen über und setzen das Badezimmer unter Wasser. Ich freue mich wie ein Kind und tauche meinen Kopf in das Wasser. Während ich unter Wasser höre, wie das Wasser gurgelnd die Wanne durch den oberen Ausfluss verlässt, fühle ich mich merkwürdig. Ich fühle mich mächtig.
Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, Raum einzunehmen, mir selbst Platz zu schaffen, etwas anderes, was vor mir da war, zu verdrängen.
In meiner eigenen Wanne hatte ich dieses Gefühl nie. Es muss daran liegen, dass es jetzt die Wanne und das Wasser aus dem Hahn meines Vaters ist.
Ich hole nur kurz Luft zwischendurch und bleibe so lange mit dem Kopf unter Wasser, bis alles überflüssige Wasser abgeflossen ist und das Gurgeln in Stille übergeht. Nicht ich, etwas anderes war überflüssig und ist aus der Gegenwart, diesmal aus meiner, verschwunden. Ich habe es verdrängt, ich ganz allein. Ich allein, mit meinem nackten Körper.
Dabei fällt mir ein, dass ich erst, seit ich alleine lebe, ohne Mann, ein eigenes Arbeitszimmer habe.
Ich beschließe, genug von symbolischen Handlungen zu haben, wasche meine Haare, trockne mich ab und wickele mich in eines der riesigen dunkelroten Handtücher.
Ich renne nirgends wo hin, auf niemanden zu. Ich habe meine Lektion gelernt.
Ich gehe in die Küche. Der Kaffee ist schon lange fertig. Ich will jetzt frühstücken und das tue ich auch. Ich hatte der Zugehfrau geschrieben, dass ich eine Zeitlang in der Wohnung meines Vaters wohnen würde, um seinen Nachlass zu ordnen. Und sie hat für mich eingekauft. Im Kühlschrank liegen ein Toastbrot, ein Stück Butter, zwei Sorten Käse, Schinken, Eier, zwei Sorten Konfitüre, frische Milch, Joghurt und Erdbeeren. Ich fühle mich ihr gegenüber dankbar. Am Kühlschrank hängt ein Zettel mit ihrer Telefonnummer und ihrer Email-Adresse. Ich beschließe, ihr eine Mail zu schreiben oder sie anzurufen, nach dem Frühstück. Und nachdem ich das Bad wieder trocken gelegt habe.
Während ich frühstücke, denke ich darüber nach, ob ich in meinem bisherigen Leben mir schon einmal Raum dadurch verschafft habe, dass ich etwas anderes verdrängt habe. Schließlich handelt es sich um ein evolutionäres Prinzip. Mit Hilfe von Revierkämpfen sichern sich die meisten Lebewesen ihren Lebensraum und freiwerdender Raum wird sofort durch andere besetzt. Wann habe ich mich für meinen Lebensraum eingesetzt? Ich glaube, ich habe nie mehr Raum beansprucht, als ich mit meinem Körper einnehme. Wenn jemand mit größeren, stärkeren Ansprüchen kam, bin ich ausgewichen. Es gibt eben Menschen, die können in einer Fußgängerzone einfach geradeaus gehen. Ich gehe meist in Schlangenlinien. Heute habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie gut es sich anfühlt, etwas zu verdrängen und den freiwerdenden Platz bewusst einzunehmen. Ich glaube, ich möchte dieses öfter fühlen.
Kapitel 6
Widersprüche oder Dornröschens andere Zeit
Unsere Kultur hat das Phantasma des guten Herrschers9) hervorgebracht, die Inkarnation des Patriarchen. Der gute Herrscher weiß, was richtig und was falsch ist, verhält sich niemals parteilich, sondern immer gerecht. Er ist prinzipiell allmächtig und unsterblich und will nur das Beste für alle anderen.
Der gute Herrscher tritt in vielerlei Gestalt auf. Viele Männer, auch eine Reihe von Frauen, aber auch Wissenschaftler und die von ihnen vertretenen Wissenschaften fühlen sich in der Rolle des guten Herrschers wohl, aber vielen wird die Rolle auch angedient. Besonders Väter sollen diese Rolle für ihre Töchter einnehmen und viele verhalten sich auf Grund der kulturellen Erwartungen auch so. Leider wird dabei meistens vergessen, dass es sich dabei nur um ein Phantasma handelt und keineswegs um eine Möglichkeit für reale Menschen.
Auch der Schatten des Phantasmas des guten Herrschers, nämlich das Phantasma der bösen Herrscherin10), entfaltet seine destruktive Wirkung, allerdings eher aus dem Untergrund.
Keine Frau möchte eine „böse Herrscherin“ sein.
Und die meisten Frauen wissen, dass sie dem guten Herrscher nicht widersprechen sollten. Es hat sowieso keinen Zweck, denn ein guter Herrscher ist immer im Recht.
Aber es geht nicht wirklich ums Recht, es geht darum, wer die Macht hat. Wir leben immer noch in einem Patriarchat.
Aber ihr ist das noch nicht sehr bewusst.
Ich stehe vor dem Schreibtisch meines Vaters und versuche herauszufinden, womit er sich zuletzt beschäftigt hat. Einladungen zu Tagungen, zu Vernissagen, Informationen verschiedenster Institute liegen neben einem Stapel ungeöffneter Briefe und einem Stapel von während seiner Abwesenheit eingetroffener Fachzeitschriften.
Es findet sich nicht ein Hinweis darauf, woran er zuletzt gearbeitet hat. Und jetzt erinnere ich mich auch. Immer hat mein Vater vor einer Reise – und sei es nur über ein Wochenende – seinen Schreibtisch leer und aufgeräumt hinterlassen. Alles hatte er in den unzähligen, nach Jahrgängen, manchmal Monaten und Themenbereichen bezeichneten Ordnern abgeheftet und gleichzeitig in seinem Gehirn abgespeichert.
Er wusste immer, wo etwas war. Karteikarten hat er nie benutzt. Er wusste, wann er etwas gelesen, wann es erschienen war und wie er es nach dem Datum des Erscheinens und der entsprechenden Problematik eingeordnet hatte. Zeit war seine wichtigste Ordnungskategorie. Bei sich überschneidenden Problembereichen heftete er Kopien in die anderen Ordner.
Warum gerade Zeit. Vielleicht, weil Zeit die unabhängigste Kategorie des ordnungsgemäßen linearen Ablaufs des Geschehens war, die unbeeinflussbar, unbestreitbar, Punkte wissenschaftlicher Ereignisse festhielt und nie wieder los ließ.
Vielleicht wiederholte er damit die Ordnung, die – sowieso schon geschehen – nicht mehr verrückbar war und außerdem die genaue Reihenfolge, wer wann was gedacht und geschrieben hatte, einhielt.
Zeit als Ordnungs- und Konkurrenzkategorie, denke ich.
Plötzlich bin ich mir ganz sicher, dass diese Art, Wissenschaft zu speichern, dem Kampf um die Sekunden beim Leistungssport entspricht.
Ich wundere mich, dass ich das denke. Ich habe meinen Vater nie vorher als konkurrenzorientiert wahrgenommen. Nie hat er ein abfälliges Wort geäußert, weder über seine Kollegen noch über diejenigen, welche die Aufsätze in den Büchern geschrieben hatten, die er las. Er konnte sich ereifern, das stimmt: Über ungenau verwendete Begriffe, unsaubere Methoden, fahrlässige Hypothesen, unzulässige Ableitungen, kategoriale Irrtümer, voreilige Schlussfolgerungen.
„Wie konnte der nur …“ oder „Was hat der sich nur dabei gedacht …“, so fingen seine empörten Sätze an, immer in der Frageform.
Man blieb ja Wissenschaftler.
Wie rede ich denn plötzlich über meinen Vater, als hätte ich etwas gegen Wissenschaft und Wissenschaftler. Wo doch der Strom aus der Steckdose kommt, füge ich noch ironisch hinzu. Dann mache ich mich auf die Suche nach einem Krimi. Irgendwo wird er doch auch so etwas haben, denke ich.
Ich finde auch einen, mit dem bezeichnenden Titel „Dornröschen war ein schönes Kind“. Ich setze mich mit einem Kaffee auf den Küchenbalkon in die Sonne. Die Zugehfrau hat Stiefmütterchen in die Balkonkästen gepflanzt. Viele verschiedene Farben mit großen duftenden Blüten. Ich betrachte sie, ich rieche sie, ich spüre die Sonne auf meiner Haut, ich lese nicht.
Wie merkwürdig, dass Zeit auch ohne zu lesen, ohne zu arbeiten, ohne
Anstrengung, ohne sie zu vertreiben, vergeht.
Vielleicht hat mein Vater doch recht, Zeit ist die unabhängigste Kategorie. Es gibt sie in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und ihr sind wir alle unterworfen. Und trotzdem stört mich irgendetwas daran, dass ich denke, Zeit vergeht. Sie vergeht doch gar nicht. Sie ist doch da. Immer. Eingebunden in den Erinnerungen, in der Bewusstheit dessen, was gerade jetzt geschieht und reicht mit dem Wünschen und Wollen in die Zukunft. Schmerzhaft wird mir bewusst, es ist nicht die Zeit, die vergeht, es ist mein Leben. Ich will nicht mehr mit mir streiten, ich sollte etwas Sinnvolles mit meinem langsam, aber sicher vergehenden Leben anfangen.
Es ist kalt und dunkel geworden. Ich merke es daran, dass ich vor Kälte zittere. Ich stehe auf und gehe in die Wohnung zurück. Ich mache überall Licht an, auch im Schlafzimmer und dann sehe ich auf dem Nachttisch meines Vaters Niklas Luhmanns „Soziale Systeme“ liegen.
Ich schlage es auf und es öffnet sich wie von selbst. An einer Stelle, die meinen Vater offensichtlich interessiert hat. Ich lese das von ihm Unterstrichene:
…„ist es nicht nötig, dass man das, was dem Gewohnten widerspricht, kennt; dass man sich darum bemüht, zu erkennen, was es an sich ist; oder gar: dass man das Widersprechende in seinem Eigenrecht würdigt.“ (Luhmann, S. 505)
Merkwürdig, dass gerade das ihn so angesprochen hat, er hat doch in seinem ganzen Leben versucht, Widersprüche zu vermeiden. Wenn ich an die nur angefangenen Auseinandersetzungen mit meiner Mutter denke, die nie welche wurden, weil es entweder angeblich gar keine Widersprüche gab oder weil das, was meine Mutter dazu zu sagen hatte, entweder abwegig, von zu weit hergeholt und meist zusätzlich noch, seiner Ansicht nach „Unsinn“ war.
„Jeder vernünftige Mensch sieht das doch ein…“, pflegte er zu sagen. Meine Mutter hatte die Entscheidung, entweder einzusehen und vernünftig oder unvernünftig zu sein.
Natürlich wählte sie das Erstere. Er widersprach ihr nie, stattdessen teilte er ihr mit, was das Richtige, das Angemessene, das Logische, das Wichtige, das Vernünftige war.
Ihr Widerspruch entsprang doch nur ihrem unvernünftigen noch nicht
Einsehen wollen.
Meinte er.
Ihre Widersprüche verteilten sich in dem gemeinsamen Leben wie langsam einsickerndes und vertrocknendes Wasser in einem Flussdelta in heißer Zeit.
Die Ebenen seines Denkens wurden nur kurz von ihren Argumenten befeuchtet, um letztlich doch nur unfruchtbares Land zwischen den Armen seiner Gedanken hervorzubringen.
Sein Denken blieb, wie es war, unberührt von den Einwänden und Widersprüchen meiner Mutter.
Von uns Kindern ganz zu schweigen.
Er wusste es besser. Immer. Bis zuletzt.
Er unterstrich eigentlich nie das, was für ihn selbstverständlich war, er schien eine Unterstützung seiner Gedanken durch Gleichdenkende nicht zu brauchen. Er war anders als andere Männer, die ihre Gedanken nur äußerten, wenn sie sich durch weitere Komplizen oder Autoritäten und entsprechende Zitate und Fußnoten abgesichert hatten.
Was also hat ihn an diesem Text so fasziniert, dass er den Satz unterstrichen hat.
Es musste also von Seiten meines Vaters etwas anderes gewesen sein als nur Zustimmung.
Zwei Seiten später lese ich:
„Das System immunisiert sich nicht gegen das Nein, sondern mit Hilfe des Nein; es schützt sich nicht gegen Änderungen, sondern mit Hilfe von Änderungen gegen Erstarrung in eingefahrenen, aber nicht mehr umweltadäquaten Verhaltensmustern.“ (Luhmann, S. 507)
Auch das hat er unterstrichen.
Hat er bereut, so wenig bereit gewesen zu sein, sich mit Widersprüchen zu beschäftigen?
Wurde er durch Luhmann aufmerksam, wie notwendig sie zum Überleben sind?
Oder war er mit dessen Aussage einfach nur nicht einverstanden? Vielleicht war er weiterhin der Ansicht, dass Widersprüche sich sowieso von alleine erledigen und dass man sich nicht mit ihnen auseinandersetzen muss.
„Das gehört nicht dazu“, höre ich ihn sagen, „das ist unwichtig, komm doch nicht immer mit Nebensächlichkeiten, bleib doch mal bei der Sache, sei doch nicht so emotional, reg dich nicht immer gleich auf, das ist doch unlogisch, wie kannst du nur so irrational sein, mein Gott, verstehe du die Frauen… “
Meine Mutter hatte dann oft Tränen in den Augen. Wenn er sie bemerkte, sagte er: „Sei doch nicht so empfindlich, ich habe es doch nicht so gemeint, nun lächle schon wieder, siehst du, so habe ich dich viel lieber. Du bringst aber auch alles durcheinander, na ja, einer muss ja den Überblick behalten. Siehst du, es ist ja alles wieder in Ordnung, was du dir aber auch immer für Gedanken machst. Da kommst aber auch nur du drauf.“
Und dann legte er begütigend und lächelnd den Arm um ihre Schulter und schickte sie mit liebevollen Bemerkungen weg: „Guck doch mal, was die Kinder machen, hast du nicht noch etwas von dem köstlichen Kuchen in der Küche, nun geh erst mal ins Bad und mach dich wieder schön. Sicher hast du schon einen Kaffee für mich gekocht, was gibt es denn zum Abendessen, ich hab noch was zu tun oder übrigens, ich muss dir noch erzählen…“, und dann erzählte er ihr und sie hörte zu, nickte mit dem Kopf, stimmte zu, ergänzte, fragte, ermunterte, beschwichtigte, beruhigte, erklärte, verstand, lächelte wieder und er war zufrieden und sie, so schien es, auch.
Widersprüche zergingen schneller, als man brauchte, um zu begreifen, dass es welche waren.
Er konnte Widersprüche nicht leiden. Aber er konnte es auch nicht leiden, Kollegen zuzustimmen. Also musste er den Satz von Luhmann aus anderen Gründen als der Zustimmung unterstrichen haben. Was hat er sich dabei gedacht?
Ich denke darüber nach, welche Erfahrungen ich mit Widersprüchen gemacht habe. Erfahrungen mit Männern und Erfahrungen mit Frauen. Viele Männer, die ich kenne, besitzen die Fähigkeit, alles auf einer Ebene abzuhandeln, alles, was nicht auf die Fläche, die sie gerade betrachten, passt, wird davon abgewischt.
Viele Frauen, die ich kenne, verhalten sich anders. Sie bleiben nie auf einer Ebene, sie springen von einer zur anderen, behaupten, es sei dieselbe und erzeugen oft ein solches Chaos, dass niemand mehr weiß, wovon die Rede ist.
„Wir müssen doch dabei berücksichtigen, wie realistisch die Idee eigentlich ist“, sagt die eine. Und die andere sagt: „Wir können doch nicht einfach darüber hinweggehen, was wir eigentlich wollen.“ „Mach doch nicht alles so kompliziert“, ist die nächste Antwort, woraufhin mit Sicherheit eine sagt: „Musst du denn immer gleich so aggressiv sein.“ Und meist findet sich auch noch eine, die zu vermitteln versucht und darauf hinweist, dass wir doch darüber diskutieren müssen, wie wir strategisch vorgehen sollen. Und eine andere, die daraufhin meint, wir sollten doch nicht immer diese militaristische Sprache verwenden. „Du darfst das doch nicht immer gleich wörtlich nehmen“, sagt die Nächste. Wahrscheinlich gibt es dann immer noch eine Frau, die sich empört und laut loslegt: „Du kannst uns doch nicht vorschreiben, wie wir uns hier zu verhalten haben.“
Sie eröffnen einen Kriegsschauplatz nach dem nächsten und ich muss zugeben, das ist eine sehr effektive Vermeidungsstrategie. Dabei fallen mir nun auch einige Männer ein, die ebenfalls mit dieser Strategie die Fokussierung auf ein zu lösendes Problem erfolgreich verhindern.
Ich halte das Buch von Luhmann aufgeschlagen in der Hand und fühle mich merkwürdig zerrissen. So will ich es nicht und so will ich es auch nicht, ohne dass ich genau weiß, was ich damit meine. Ich denke, ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken.
Kapitel 7
Flächenhaftes Denken oder Angst vor der Tiefe
Viele Menschen vermeiden ihr Leben lang, sich die schon lange von ihnen verdrängten Erlebnisse bewusst zu machen. Ihre eigene Tiefe wird für sie immer bedrohlicher. Schmerz und Wut, Trauer und Hass wohnen in diesem Untergrund, verstecken sich in verborgenen Orten, die sie nie wieder aufsuchen wollen.
Eine Ebene ist übersichtlich, auf einer Fläche lässt sich nicht viel verstecken. Auf Flächen können herankommende Gefahren schnell entdeckt werden. Aber Gefühle reichen tief unter die Oberfläche.
„Sei doch nicht so emotional“ ist eine häufige Botschaft an Frauen. Männer sollten am besten gar keine haben. Gefühle müssen in unserer Kultur kontrolliert werden. Rationalität ist gefragt. Flächenhaftes Denken ermöglicht es – scheinbar – die Übersicht und die Kontrolle zu behalten und der Welt auf rationale Weise zu begegnen.
Sie bemerkt die Vorteile dieses Denkens.
Ich erinnere mich voller Bewunderung an ein Bild11) von Escher. Er bringt es in diesem Bild fertig, eine Teichoberfläche zu zeigen, in der nicht nur ein Fisch, der von unten in Richtung der Oberfläche schwimmt, den Betrachter mit großen Augen ansieht, sondern sowohl die Blätter – von der Oberflächenspannung des Wassers festgehalten – als auch die sich im Wasser spiegelnden Pflanzen und Bäumen, und der alles überdeckende Himmel zu sehen sind. Alles vereinigt sich in einer Fläche.
Alles, was sich unter, auf und über der Wasseroberfläche befindet, bekommt von Escher auf diese Weise seinen angemessenen Platz auf der Wasserfläche, so als hätte alles niemals eine andere Existenz als die Flächenhafte kennengelernt. Die Tiefe hat keine eigenständige Existenz mehr, alles wird zu einer Projektion auf eine Fläche, wird flach. Verblüffend daran ist, dass diese ins Zweidimensionale verfrachteten Elemente des Bildes für den dreidimensional orientierten Beobachter so aussehen, als seien sie sowohl dreidimensional als auch in ihrer Existenz im Zweidimensionalen vollständig abgebildet.
Die Fläche reicht offensichtlich aus, um die Tiefe und die Höhe zu erfassen. Die Fläche scheint das Entscheidende zu sein, alles, was sich darüber und darunter befindet, kann auf ihr abgebildet werden.
Und ich erinnere mich an das zweidimensionale Bild eines vierdimensionalen Würfels12). Der Prozess der Abbildung war einleuchtend. Ein Punkt hat keine Dimension im Zustand der Ruhe, aber wenn er sich bewegt, erzeugt er eine Linie. Eine Linie oder eine Gerade hat eine Dimension. Und die Bewegung dieser Geraden erzeugt eine Fläche, die bereits zweidimensional ist. Und bewegt man eine begrenzte Fläche durch den dreidimensionalen Raum, so erhält man ein dreidimensionales Gebilde. So erzeugt die bewegte Fläche den Raum, und dieser weiß um seine Rückbezüglichkeit zum Nichts: Um die Art seiner Hervorbringung aus dem bewegten Punkt, der keine Dimension hat, der „nichts“ ist.
Verschiebe ich nun einen durch die Bewegung einer quadratischen Fläche entstandenen Würfel noch einmal durch den imaginierten Raum und halte gleichzeitig dessen Bewegung auf der Fläche fest, so erhalte ich das zweidimensionale Modell eines vierdimensionalen Würfels. Fortsetzung folgt, denke ich noch.
Aber wir enden mit unseren Fortsetzungen viel zu oft wieder auf der Fläche.
Ich erinnere mich vage an das Buch über das Land der Flächenwesen13), dass ich als Kind gelesen habe oder von dem mir erzählt wurde. Nichts existierte für sie außerhalb der Fläche, die Fläche war ihr Universum. Und eines Tages kam eine Kugel zu Besuch. Die Flächenwesen bemerkten ihre Ankunft durch die Anwesenheit eines bisher noch nie da gewesenen Punktes, der sich langsam durch das Absenken der Kugel in immer größere und von einem gewissen Zeitpunkt wieder kleiner werdende Kreise verwandelte.
Als die Kugel durch das Flächenland durchgesunken war, konnte sie sich für eine lange Zeit nicht trennen, so dass ihr letzter Berührungspunkt mit dem Flächenland noch lange sichtbar war. Aber keines der Flächenwesen nahm Kontakt zu dem Punkt auf, zu groß war die Angst vor den erst größer und dann wieder kleiner werdenden Kreisen gewesen. Jedenfalls erinnere ich mich so an das Buch. Ich erinnere mich auch, dass alle Flächenwesen froh waren, als der Punkt endlich verschwunden war. Keiner von ihnen wusste, dass sich eine ganz eigene Welt in ihrer Totalität durch ihr Land hindurchbewegt hatte. Sie vermissten nichts, ein Zuviel war endlich wieder verschwunden und Ruhe war eingekehrt. Und ich weiß noch, dass ich Mitgefühl mit der Kugel hatte.