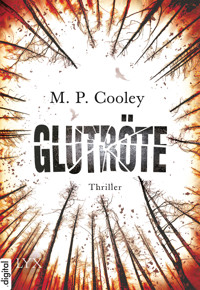
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hopewell Falls
- Sprache: Deutsch
Jane Lyons ist Polizistin in Hopewell Falls. Am Rande der Kleinstadt stehen verlassene Fabrikanlagen, die schon öfter Brandstiftung zum Opfer fielen. Als eines Tages wieder eines der Gebäude in Flammen aufgeht, kann Jane in letzter Sekunde eine Frau retten, die bei lebendigem Leibe verbrennen sollte. Bei ersten Untersuchungen findet die Feuerwehr außerdem ein Fass mit einer Frauenleiche. Die Spuren führen Jane zu dem größten Verbrechen, das je in Hopewell Falls begangen wurde - und das ihr Vater einst nicht aufklären konnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Danksagungen
Die Autorin
Die Romane von M. P. Cooley bei LYX
Impressum
M. P. COOLEY
Glutröte
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Karin Kremmler und Lisa Kuppler
Zu diesem Buch
Als Polizistin in der Industriestadt Hopewell Falls behält June Lyons auch die verlassenen Gebäude entlang des Mohawk River im Auge. Eines Tages entdeckt sie eine Benzinspur auf dem Parkplatz einer alten Textilfabrik und überprüft sogleich das Gebäude: Drinnen lodern schon die Flammen, und eine Frau liegt bewusstlos am Boden. June kann sie retten, doch die Fabrik brennt bis auf die Grundmauern nieder, und die schwer verletzte Frau fällt ins Koma. Niemand weiß, wer sie ist oder was sie dort zu suchen hatte. Die Fabrik war schon einmal vor dreißig Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Damals nahm Junes Vater den Besitzer der Fabrik wegen Mordes an dessen Frau und Kind fest. Die Leichen der Opfer wurden jedoch nie gefunden. Als June mit ihrem Partner Dave die Fabrikruine durchsucht, finden sie in einem Fass eine Frauenleiche. Wider Erwarten handelt es sich dabei aber nicht um die ermordete Frau des Fabrikbesitzers, sondern um Daves Mutter, ein unstetes Party-Girl, das verschwand, als Dave noch klein war. June wird klar: Hinter der reizenden Fassade von Hopewell Falls lauern einige unerträglich hässliche Geheimnisse. Um sie zu lüften, bittet June das FBI um Hilfe. Gemeinsam müssen sie Antworten finden, bevor jeder, den June liebt, untergeht.
Für Bridget und Mary
Ein Fremder trieb allein im Schwarzen MeerUnd niemand hört’ sein Flehen um Vergebung.
– »Sturm auf dem Schwarzen Meer«,Ukrainisches Volkslied
Jeden Morgen welkte das Samttäschchenmeiner Mutter erschöpft auf einem Stuhl,der Mitternachtsfüllung ledig: Rubinrot für die Lippen,des Taschenspiegels kleiner Teich.
– »Fancy«, Jehanne Dubrow
1
Der Regen war gnadenlos.
Dave stellte sich ausgesprochen dämlich dabei an, seine Hälfte des Hauses festzuhalten. Meine Arme schmerzten vom Gewicht des Geburtstagsgeschenks für seine Nichte – ein riesiges Spielhaus für den Garten –, und auf dem Weg zu meinem Wagen kamen wir nur langsam voran. Der Frühlingsregen war bereits durch die Pappkartonschichten gedrungen, und da, wo die Schachtel in Auflösung überging, schrammten die harten roten Plastikplatten mir die Knöchel auf.
»Weißt du was«, sagte ich, »dieses Spin-Art-Gerät, was sie da hatten, hätte ganz locker auf den Rücksitz gepasst.« Ich hievte das Spielhaus hoch und stieß es mit aller Kraft nach vorn, aber es verkantete sich mit dem Minisafe in meinem Kofferraum, in dem ich meine Dienstwaffe aufbewahrte. »Und ich wette, mit der Kostümkiste hätte Tara auch jede Menge Spaß gehabt.«
»Meine Nichte ist nicht der Typ für Prinzessinnenkleider.«
Ich erstarrte, als ein roter Subaru vorbeiraste und sich von hinten ein nasser Sprühregen über meine Beine ergoss. »Da sind auch falsche Schnurrbärte und Groucho-Marx-Augenbrauen drin. Die passen doch gut zu ihren rosa Glitzersandalen.«
»Bis sie damit stolpert und sich den Schädel bricht. Alles voller Blut und so.« Jetzt versuchte er im Rückwärtsgang, die Schachtel in den Kofferraum zu bekommen. »Geht’s links noch etwas höher?«
Ich hob sie auf Schulterhöhe.
»So wird’s gehen«, sagte er.
So ging es nicht, und der Karton rutschte mir aus der Hand und fiel auf den Boden.
»Du da. Geh mir aus dem Weg«, sagte ich. Geschlagen trat er beiseite. Vom unablässigen Regen klebten seine schwarzen Locken platt am Kopf, und der nasse weiße Karton hinterließ aufgeweichte Pappfetzen an den Ärmeln seiner Windjacke mit dem Schriftzug der New York Jets. Ich hievte den Kasten halb auf den Rand des Kofferraums, nutzte den Schwung aus und stieß ihn zum größten Teil hinein. So ließ der Kofferraumdeckel sich nicht mehr schließen, und ich musste den Karton mit Gewalt zusammenquetschen, um ihn vor dem Regen zu schützen. Nicht, dass es an diesem Punkt noch darauf angekommen wäre. Dann spurtete ich um den Wagen herum nach vorne und stieg in meinen trockenen Wagen. Ich ließ den Motor an, damit die Heizung anging, und entriegelte die Tür für Dave, der sich mit einem deutlichen feuchten Schmatzgeräusch in den Beifahrersitz fallen ließ.
»Ich sag’s dir ja nur ungern«, sagte ich, als ich aus der Parklücke zurücksetzte, »aber von einem großen durchweichten Pappkarton wird Tara nicht direkt aus dem Häuschen sein.«
»Sie wird total aus dem Häuschen sein von einem großen durchweichten Pappkarton, weil sie und ihr Dad dann nämlich ein gemeinsames Projekt haben«, sagte Dave. »Ist es eigentlich schon zu spät, um noch mal zurückzugehen und den Kinder-Werkzeugkasten zu kaufen?«
»Allerdings.« Ich fuhr aus der Parklücke und hoppelte voll durch ein Schlagloch. Mein dreizehn Jahre alter Saturn würde wohl bald das Zeitliche segnen. »Entschieden zu spät.«
»Ach, auf die Kinderversion würde sie sowieso nicht stehen. Ich sollte dran denken, ihr Geschenk nächstes Jahr gleich beim Baumarkt zu kaufen.«
Langsam fuhr ich vom dem brechend vollen Parkplatz und manövrierte mich durch den Kreisverkehr, vorbei an den Ausfahrten nach Colonie, Latham und Cohoes. Die nach Hopewell Falls verpasste ich und musste eine zweite Runde drehen. Dave gluckste.
Am Stadtrand kamen wir am Friedhof St. Agnes vorbei, wo mein Mann beerdigt war. Im ersten Jahr nach seinem Tod hätte ich darauf bestanden, dass wir dort haltmachten. Im zweiten Jahr wäre ich durch den Friedhof gefahren, um sein Grab zu sehen. Dieses Jahr schickte ich in Gedanken eine Nachricht an ihn: »Du fehlst mir, Schatz. Wir sehen uns Donnerstag. Warte, bis du Lucys Theorie hörst, wo die Babys herkommen. Sie ist definitiv deine Tochter.« Kevin würde nie aufhören, Teil meines Lebens zu sein.
Die Landschaft stieg leicht an und fiel dann zur Stadt hin steil ab. Hopewell Falls lag unten im Tal. Der Mohawk River begrenzte die Stadt im Osten und der Hudson im Süden; der Wasserfall, der sich einst gebildet hatte, wo die beiden Flüsse aufeinandertrafen, hatte der Stadt ihren Namen gegeben. Durch das frische Grün der ausschlagenden Bäume und den Nebel vom Regen konnte ich in der Ferne mein Haus ausmachen. Dad passte auf Lucy auf, während ich erst Dave half und dann von drei bis elf Streifendienst hatte. Bei diesem Wetter wäre ich viel lieber zu Hause. Heute Abend würde es reichlich Verkehrsunfälle geben, aber die größere Gefahr waren die Leute, die an einem Samstagabend mit »ihren Lieben« zu Hause festsaßen, besoffen und, wenn ich sehr großes Pech hatte, bewaffnet.
Die Straßen wurden kurvenreicher, je näher wir dem Fluss kamen. Wir blieben an einer Ampel stehen und warteten, bis wir die Interstate 787 überqueren konnten. Vor uns führte eine kurze Brücke über eine kleine Wasserstraße, die letzten Wehen des Mohawk River, bevor er in den gewaltigen Hudson mündete.
Dave machte ein finsteres Gesicht, den Blick auf die Ukrainische Kirche gerichtet, ihre Kuppel glänzte golden und himmelblau gegen den trostlosen Nachmittagshimmel.
Ich berührte ihn am Arm. »Alles gut bei dir?«
»Besser denn je, Lyons.« Er schüttelte meine Hand ab. Da stimmte etwas nicht – normalerweise konnte ich mich kaum retten vor all den Umarmungen, Klapsen und Streicheleinheiten, die Dave ständig an alle Welt verteilte, besonders aber an mich.
»Bist du sicher? Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Das Topfschlagen haben wir eh schon verpasst, dazu kann dich keiner mehr zwingen. Aber wenn du wirklich kneifen willst, kannst du gern meine Schicht übernehmen … dich in die blaue Kluft werfen und acht Stunden in der Gegend herumfahren.«
»M-hm.«
»Und deinem Bruder geht es doch besser.« Sein Bruder Lucas war eine Zeit lang arbeitslos gewesen und hatte sich letztes Jahr zum vierten Mal scheiden lassen, was mit einer Anzeige wegen Ruhestörung und Trinken in der Öffentlichkeit vor dem Haus seiner neuesten Exfrau geendet hatte. Glücklicherweise hatte die Verhaftung Lucas einen solchen Schrecken eingejagt, dass sein Verhalten seither mustergültig war.
»Lucas geht es bestens, aber heute hat er vor, seine Ex auszustechen. Ich schätze, Felicia hat eine Riesen-Rollschuh-Party für Taras Schulfreundinnen gegeben, und Lucas hat darauf bestanden, eine zweite Party für alle Kinder der Kirchengemeinde zu schmeißen. Ich rechne mit Luftballontieren.«
»Und?«
»Was und?«
»Warum bist du so angespannt?«
Er antwortete nicht. Die Ampel schaltete auf Grün, und keine zehn Sekunden später hatten wir den Highway und die Brücke vom Festland zur Insel überquert.
»Es ist nur, die Insel ist so abgeschieden von allem«, sagte Dave schließlich. Ich verbiss mir ein Auflachen. Vom selben holländischen Siedler in Besitz genommen, der im siebzehnten Jahrhundert Hopewell Falls erschlossen hatte, war die DeWulf-Insel alles andere als ein isolierter Außenposten. Der Kanal, der sie vom Festland trennte, war so schmal, dass ich ihn mit Anlauf wahrscheinlich überspringen konnte, und wenn ich auf der Durchgangsstraße weiterfuhr, wären wir nach einer halben Meile schon in Troy. Statt über den Hudson weiterzufahren, bog ich rechts ab, vorbei an Reihenhäusern, gebaut von ukrainischen und polnischen Immigranten, die zuerst vor den Sowjets, dann den Nazis, und dann wieder den Sowjets geflüchtet waren. Die Trümmer der vor zwei Jahren abgebrannten Golden-Wheat-Bäckerei lagen zu unserer Linken, und wir fuhren an einem kleinen polnischen Lebensmittelgeschäft vorbei, wo es Cheetos, Cola, tiefgekühlte Piroggen und eingelegte Rote Beete zu kaufen gab.
»Hier links«, sagte Dave, und wir bogen in eine Straße ein, die von mehr Bäumen als Häusern bestanden war, die Pflanzen üppig und grün vom Frühlingsregen der letzten Tage. Die Straße endete in einer Sackgasse neben einem bescheidenen Haus, umgeben von einigen Morgen Land. Die Fassade war aus Ziegeln, mit einer weißen Veranda und schwarzen Fensterläden. Lila Luftballons wehten wild in der Brise, vier Autos parkten vor dem Haus. Die Bank auf der vorderen Veranda war frisch gestrichen, und ein Fliederbusch erhob sich auf dem Rasen, sorgfältig geschnitten und in voller Blüte. Wir waren bei Lucas’ Haus angekommen. Oder vielmehr dem seiner Tante Natalya.
Dave und ich kämpften uns mit dem Spielhaus den schmalen Weg zur Haustür hinauf und klingelten. Lucas begrüßte uns mit einem Bier in der Hand.
»Himmel, Davey. Musst du so spät kommen?«, sagte er. »Und Tante Natalya bringt dich um, wenn du dreckige Pappflocken im Haus verteilst. Oh, hallo June.« Er kam heraus, stellte sein Bier auf die Armlehne der Bank und nahm mir mein Ende des Kartons ab. Zum ersten Mal sah er den Inhalt und zog eine Grimasse.
»Oh, na wunderbar. Endlich mal ein Bauprojekt für mich allein.«
Lucas, so groß wie Dave mit seinen eins neunzig, wirkte heller als sein Bruder, sein hellbraunes Haar war schon etwas grau, ohne Locken und eher dünn. Er hatte über zwanzig Jahre lang beim Bau gearbeitet, bis er nach einer unklaren Verletzung eine Menge Schmerzmittel nehmen musste. Sein neuer Job als Barmann sagte ihm zu. Dave und Lucas zankten sich über das Geschenk, als sie um das Haus herum in den Garten gingen, wo die Party schon in vollem Gang war.
»Garten« war eigentlich untertrieben. Dave nannte ihn zum Spaß »unsere kleine Farm«, das Grundstück erstreckte sich drei Morgen weit nach Norden. Auf dem Rasen war Platz für eine Hüpfburg mit zwei Ebenen und eine Schaukel. Dahinter lag ein Obst- und Gemüsegarten, vermutlich groß genug, um alle Leute auf der Insel zu ernähren, und an seiner Grenze zur Wiese am hinteren Ende des Grundstücks sprossen Sonnenblumen.
All dem weiten, offenen Raum zum Trotz grillten und aßen die Erwachsenen auf der Veranda, sie drängten sich unter dem schmalen grünen Blechvordach zusammen, um dem Regen zu entgehen. Der Turm der Hüpfburg hatte Schlagseite nach links, und vom Gewicht des Regenwassers, das sich auf dem Dach sammelte, war sie kurz davor, zur Seite zu kippen. Dass sich eine Horde Kinder gegen die Seiten warf, machte es nicht besser. Ich war mir ziemlich sicher, dass diese Geburtstagsparty in Tränen enden würde, entweder weil diese aufgepumpte Monstrosität zur Seite kippen würde, oder weil die Kinder endgültig ins Haus beordert wurden.
»Dad!«, schrie das Geburtstagskind, »Das Dach sinkt ein!«
Lucas Batko gab mir den Karton zurück. »Das wird eine Katastrophe«, sagte er und joggte über den Rasen zur Hüpfburg, die wackelte wie ein Korb voller Welpen. Auf dem Weg hob er eine Spielzeugaxt auf, die vor der Tür auf dem Boden lag. Kreischen ertönte, als er das aufblasbare Gebäude betrat, und die Hüpfburg wogte und schlingerte, als Lucas über den aufgepumpten Boden stapfte, der für ein Kind von zwanzig Kilo gemacht war, nicht für einen Mann von neunzig. Er nahm den Axtstiel und presste ihn von unten gegen das Dach, sodass das Wasser vom ersten Turm über die Seite spritzte. Dave und ich bugsierten unseren Karton die Verandatreppe hinauf.
Daves Tante Natalya fing uns ab. Sie bewegte sich schnell, trotz ihres ausgeprägten Hinkens. Beim Gehen verdrehte sie ihre linke Hüfte nach vorne und schwang dann den rechten Fuß vor.
»David, wie konntest du! June zu zwingen, mit schwerem Karton durch schlammiges Gras zu marschieren.« Dave sagte mir, dass sie seit den späten Vierzigern in den Vereinigten Staaten war, aber ihr ukrainischer Akzent war immer noch unüberhörbar, ihre G-s sprach sie kehlig aus, und ständig vergaß sie Artikel. Sie war eine kleine Frau mit scharfem Blick, das schwarze Haar von Grau durchzogen. Natalya stützte die Hände auf ihre asymmetrischen Hüften, die linke etwas höher als die rechte. »Du bist kein Gentleman.«
Dave musste sich in die Hälfte zusammenklappen, um seine Tante zu küssen. »Für Lyons ist das nichts Neues, teta.«
Dave und ich luden das Haus vor dem Geschenktisch auf dem Boden ab, und Dave zog eine Schleife mit grünen Punkten aus der Tasche und klatschte sie auf die Ecke des Kartons. Natalya runzelte die Stirn, aber nicht der Geschenkverpackung wegen.
»Du willst deinen Bruder mit großem Geschenk bloßstellen?«
Dave hob kapitulierend die Hände. »Mit einem Fahrrad kann ich nicht mithalten, teta.«
Obwohl sie fast achtzig war, riss Natalya mich an sich und umarmte mich fest. Ich roch Haarspray und Puder, die beiden Dinge, die sie in diesem feuchten Wetter frisch und präsentabel hielten.
»Esst jetzt«, sagte sie. »Die Kinder stopfen sich mit Junkfood voll, was Lucas gebracht hat« – sie beäugte die frittierten Pizza-Röllchen mit Widerwillen – »aber ich habe Würste gegrillt, und Salat habe ich selbst geerntet.«
Dave hakte Natalya unter. »Gute Idee. Lyons schlägt uns hier noch alles kurz und klein, wenn sie nichts zu essen kriegt.«
Dave stellte unser Mittagessen nach Natalyas sorgfältigen Anweisungen zusammen. Er kam zurück mit zwei Tellern, hoch beladen mit perfekt gegrillter Kielbasa, Teigtaschen und Salat, und ganz oben balancierte je ein Pizza-Röllchen. Er hatte ein Bier in einer Hand und sich eine Wasserflasche unter den Arm geklemmt. Wir setzten uns auf zwei Stühle an der Verandabrüstung.
»Wir grüßen den siegreichen Helden«, sagte Dave zu seinem Bruder, als er zurückkam, und prostete ihm mit seinem Bier zu. Lucas streckte die Hand danach aus, schnappte es sich und nahm einen kräftigen Schluck. Daves Protest war nur schwer zu verstehen, er hatte den Mund voll Teigtasche.
»Schmeckt, was?«, sagte Dave. Es war köstlich. Die Piroggen waren hausgemacht, und die perfekt gegrillte Wurst kam von einem hiesigen Metzger, der sie selbst herstellte. Schweres Essen, aber einfach wunderbar.
»Tante Natalya hat das beste Essen auf dem Tisch für dich ausgesucht«, erklärte mir Dave zwischen zwei Bissen Piroggen.
»Typisch«, sagte Lucas. »Daves Freundinnen werden immer hofiert.«
Dave verschluckte sich. »Ich habe keine Ahnung, wie sie auf so eine Idee kommt.«
»Wunschdenken.« Lucas zog ein Feuerzeug hervor. »Ich geh mal besser. Wir haben mit der Torte auf Taras Lieblingsonkel gewartet« – Dave salutierte, und Lucas fuhr fort: »und da er sich dazu herabgelassen hat, uns mit seiner Anwesenheit zu beehren, schaue ich mal, dass ich die Kerzen noch vor ihrem nächsten Geburtstag angezündet kriege.«
»Bring mir ein frisches Bier mit, ja?«, rief Dave seinem Bruder nach, doch Lucas war schon im Haus verschwunden. Dave stieß seine Knöchel gegen meine. »Du hast gleich Dienst, aber willst du auch eins?«
Auf mein Nein ging Dave sich selbst eins holen. Ich machte mich über meine Mahlzeit her.
Ich war fast fertig, als Dave mich aus meiner vom Essen verursachten Entrückung holte. »Ich und Special Agent Bascom waren gestern Abend ein Bier trinken.«
»Du und Hale?«, sagte ich.
»Jep. Ich habe unseren Regierungsagenten auch hierher eingeladen. Als ich ihm von der Hüpfburg erzählt habe, hat er sofort zugesagt.«
Ich wischte mir den Mund ab und bereitete mich darauf vor, die Flucht zu ergreifen, bevor Hale eintraf.
»Warum jetzt die Eile? Ihr zwei habt doch das Kriegsbeil begraben.«
»Weitgehend.« Ich sammelte meinen Müll ein und stand auf, um zu gehen. »Er ist immer noch ein Hai, wenn auch ein netter.« Was ich Dave nicht erzählen wollte, war, dass ich Hale aus dem Weg ging, weil er auf meine Antwort drängte: Würde ich als Beraterin zum FBI kommen oder nicht? Es war fast vier Jahre her, seit ich gekündigt hatte, und ich war mir noch nicht sicher, ob ich wieder dort arbeiten wollte. Außerdem kam ich einfach nicht dahinter, warum die mich haben wollten. Warum Hale mich haben wollte.
Als ich gerade meine Verabschiedungsrunde machen wollte, kam Lucas mit der größten Torte heraus, die ich seit meiner Hochzeit gesehen hatte. Streichen Sie das, sie war noch größer. Eine Prinzessin saß auf ihr, die oberste Ebene bildete ihren Rock, rosa und aufwendig mit Zuckerguss und Süßkram verziert, umgeben von vier Geburtstagskerzen. Die unteren Ebenen waren ihr Königreich, dekoriert mit Figuren der Zeichentrickserie Dora the Explorer.
»Tara, komm Kerzen ausblasen!«, rief Lucas. Die Kinder ließen sich Zeit damit, sich von der Hüpfburg zu lösen, und Lucas tigerte ungeduldig auf und ab, ein Bier in der Hand, und prüfte ständig, ob die Kerzen noch brannten, während er Tara zurief, dass sie sich beeilen sollte.
»Nur die Ruhe«, sagte Dave zu seinem Bruder. »Ich geh sie holen.«
Dave tat so, als wäre er ein Riese, und sagte, dass er langsame Kinder fressen würde, und die Kinder kamen die Treppe hochgerannt und wurden zum Singen versammelt. Das Geburtstagskind, zuerst überglücklich, begann zu weinen, als die Torte angeschnitten werden sollte.
»Aber sie ist so schön!«, sagte Tara. Ich machte mir Sorgen, dass ihre Tränen Lucas verärgern würden, aber stattdessen hob er sie schwungvoll hoch, küsste sie auf beide Wangen und versprach ihr, um die Spielzeugfiguren auf der Torte herumzuschneiden.
Natalya hielt mich auf, als ich gehen wollte. »Sie müssen ein paar Reste mitnehmen für Ihre Freunde auf Polizeiwache.«
Von wegen ein paar Reste. Bis ich die vier voll beladenen Tabletts in meinem Kofferraum verstaut hatte, blieben mir nur noch 45 Minuten bis zu meinem Schichtbeginn. Bis ich meine Uniform angezogen, mir den Bericht der letzten Schicht geholt, das Essen auf dem Tisch im Pausenraum aufgebaut und mich dann an der Meute vorbeigekämpft hatte, zu denen der Ruf gedrungen war, dass Daves Tante ihre hausgemachten Teigtaschen geschickt hatte, war die Zeit extrem knapp geworden. Sobald ich die Leute auf den Weg ins Verdauungskoma gebracht hatte, fuhr ich los.
Von der Zentrale lag nichts vor. Ich behielt beim Fahren den Gehsteig ebenso im Blick wie die Straßen, hielt Ausschau nach Unregelmäßigkeiten aller Art. In der Vergangenheit hatte ich jede Menge Kriminelle am oder beim Verlassen des Tatorts geschnappt – erst letzten Donnerstag hatte ich jemanden aufgegriffen, der zwei Fleischschneidemaschinen und einen Pfefferschinken aus der Metzgerei abräumen wollte. Aufzupassen war mein Job.
Als ich in den Reed Way einbog, kam der Streifenwagen auf der gekiesten Straße leicht ins Schleudern. Ich roch das Problem, bevor ich es sah: Benzingeruch überlagerte den Geruch von Frühlingsgras. Während ich mich der lange stillgelegten Sleep-Tite-Fabrik näherte, wurde er stärker. Brandstiftung kam in dieser Gegend leider allzu oft vor. Zu stehlen gab es nichts – die Unternehmen hatten vor Jahrzehnten Konkurs gemacht oder die Produktion nach China verlegt – aber Teenager, die sich langweilten, oder professionelle Brandstifter, die bei der Versicherung abkassieren wollten, zündelten hier mit ärgerlicher Regelmäßigkeit. Keine Privatwirtschaft hatte die Fabriken ersetzt. Die Kommunen rissen viele aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ab und asphaltierten die Gelände. Ich meldete der Zentrale einen Brand, denn wenn es jetzt noch keiner war, würde es schon bald einer sein. Ich gab Gas und preschte auf den großen Parkplatz, hielt weit genug entfernt, dass ein etwaiges Feuer den Streifenwagen nicht zerstören konnte, falls die Sache außer Kontrolle geriet.
Mit dem Feuerlöscher in der Hand rannte ich auf die Fabrik zu, durch eine neonblau-grüne Benzinspur, die sich über Rasen und Gehsteig, über die Straße und hinunter zum Fluss zog. Der Rauch war schwach, nur ein Hauch lag in der Luft, aber die Luft war schwer von Benzin, und ich bemühte mich, flach zu atmen, damit mir nicht schwindlig wurde. Mein Streifenwagen verschwamm hinter einem Dunstschleier – die Benzindämpfe verzerrten das Nachmittagslicht. Sogar die Sirenen in der Ferne klangen verzerrt, ihr Rhythmus wie Schluckauf hinter dem Schleier der Benzindämpfe. Aus meinem Funkgerät konnte ich Lorraine von der Zentrale hören, die Ersthelfer anforderte: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, alle.
»Zehn-Fünfzig«, sagte Lorraine ruhig und beharrlich, gab den Code für einen Brand durch. »Zehn-Fünfzig.«
Die Fabrik war seit fünfundzwanzig Jahren geschlossen, lange genug, dass die Bretter, mit denen man die Löcher in den Fenstern vernagelt hatte, selbst Löcher hatten. Weil ich auf meiner Streife regelmäßig hier vorbeikam, wusste ich, dass das Gebäude normalerweise gesichert war. Heute hing die Kette lose herab, das Vorhängeschloss aufgebrochen. Es war ein zweiteiliges Schiebetor aus Metall, knapp fünf Meter breit. Ich schob es auseinander, und die Flügel glitten problemlos auf und öffneten sich zur Fabrikhalle.
Der Raum war leer bis auf einen Transporter mit immer noch laufendem Motor, auf seiner Tür stand in Schablonenschrift »CAR F«, anscheinend mit Grundierfarbe. Die Hecktür des Wagens stand weit offen, Benzin war von dort über den Boden verspritzt worden. Die Spur zog sich bis zu der Tür am anderen Ende der Halle. Der hintere Teil des Gebäudes stand bereits in Flammen, jetzt loderte dort eine brennende Matratze auf, angefacht vom Sauerstoff, der durch die Löcher in der Decke und dem darüberliegenden Dach drang. Das Feuer folgte einer klaren Route, nämlich der Benzinspur, die sich über den Boden voll weißem Taubendreck schlängelte, sie entflammte fauchend und ging ohne Brennstoff schnell wieder aus. Benzinfeuer brennen schnell und hell und verpuffen fast so schnell wieder, wie sie sich entzünden, aber die Flammen näherten sich dem Transporter und einem Stapel Textilmaterial dahinter, den die letzten Mieter hier entsorgt hatten. Dagegen kam ich mit meinem Feuerlöscher nicht an.
Der Lautstärke der Sirenen nach waren die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nur noch wenige Straßen entfernt, und ich wich zurück in Richtung Eingang. Die Flammen schossen unter den Transporter, versengten eine Ecke, ließen ihn aber ansonsten unberührt. Das Feuer erreichte den Textilstapel. Ich sah, wie seine Ränder aufloderten, und dann ging das ganze Ding in Flammen auf. Sie schossen an die sechs Meter in die Höhe und trafen die hölzernen Dachbalken, und eine schmerzhafte Hitzewelle breitete sich aus, die mein Haar sogar aus zehn Metern Entfernung ansengte. Es gab ein brausendes Geräusch, als das Feuer den Sauerstoff verzehrte, fast sofort gefolgt von einem Schrei.
Aus den Flammen erhob sich eine Frau.
Sie stieg aus dem Herzen der Feuersbrunst, wirbelte gehetzt nach links und rechts, versuchte, sich von den Flammen zu befreien, die sie umschlossen, das helle Licht zeichnete ihre Bewegungen in der Luft nach, als sie verzweifelt um sich schlug. Ich rannte los, stürmte auf sie zu. Der Rauch wurde dicht. Ich duckte mich tief und zog meinen Mantel aus, um damit auf die Flammen einzuschlagen. Ich hätte mich nicht damit aufzuhalten brauchen – bis ich sie erreicht hatte, waren ihre Kleider fast vollständig verbrannt, und sie stand winzig und nackt vor mir, die Haut rot und schwarz vom Ruß, das Haar abgebrannt. Durch den Rauch erschien das Fabriktor in fast unerreichbar weiter Ferne. Ich hob sie hoch und strebte auf das schwache Tageslicht zu, das zum Eingangstor hereindrang. Sie schrie, laut und lange.
»Tut mir leid, tut mir leid, Ma’am«, sagte ich. Sie wog höchstens fünfundvierzig Kilo, aber meine Knie wankten unter der Last, und ich musste Haken schlagen, um dem Feuer auszuweichen. Unter dem Prasseln der Flammen hörte ich Benzin tropfen, es sickerte durch den Holzboden in die Etage, die unter uns lag, und das stete Tröpfeln zählte wie ein Countdown jede Sekunde, die ich noch im Gebäude blieb. Ich wuchtete die Frau höher und lief schneller.
Durch den Rauch und ihr Schreien hatte ich die Ankunft der Feuerwehr nicht mitbekommen. Vier Feuerwehrleute schleppten einen Schlauch ins Gebäude. Zwei davon kamen auf mich zugelaufen, hoben mir die Frau von der Schulter, rannten mit ihr zu den beiden wartenden Krankenwagen und Sanitätern und legten sie sanft auf eine Transportliege.
»Machen Sie, dass es aufhört!«, weinte die Frau, bevor ein Hustenanfall sie schüttelte. Nachdem ich gesehen hatte, wie sie in Flammen aufging, schien es unmöglich, dass sie noch am Leben war oder gar etwas sagte. Selbst hier draußen, außerhalb des Feuers, konnte ich nicht erkennen, wie schwer ihre Verbrennungen wirklich waren, aber unter dem Ruß sah ich hellrote Haut, und auf ihrem Gesicht begannen sich Brandblasen zu bilden. Der Sanitäter schnitt einen Gummizug durch, der letzte Rest ihrer verschmorten Kleider, und versuchte ihr eine Infusion zu legen.
»Es tut weh«, sagte sie schwach und verstummte, als einer der Sanitäter ihr eine Sauerstoff-Nasenbrille anlegte, damit sie leichter atmen konnte.
»Ich finde keine Vene«, sagte der zweite Sanitäter leise. Ein schlechtes Zeichen: Je bedrohlicher die Lage, desto stiller wurden die Sanitäter, glichen mit ihrer Ruhe die Hysterie um sie herum aus. »Wegen der Verbrennungen kriege ich keine Vene. Bringen wir sie ins Memorial-Krankenhaus.«
Sie schnallten die Frau auf die Bahre und hoben sie in den Krankenwagen, und ich sah sie mit heulender Sirene davonfahren.
Eine Hand schloss sich um meinen Arm.
»Tag, Lyons«, sagte Greg, ein Sanitäter, mit dem ich auf zahllosen Einsätzen gearbeitet hatte. »Kommen Sie mit uns.«
Nachdem er meine Lungen abgehört und meine ungeschützte Haut inspiziert hatte, diagnostizierte Greg mich als »angesengt«. Er sagte mir, dass ich eine Weile husten würde, und dass ich mir die Spitzen schneiden lassen müsste. Ich weigerte mich, ins Krankenhaus zu gehen, also bestanden sie darauf, mich an Ort und Stelle mit Sauerstoff zu versorgen. Aus dem Heck eines Krankenwagens sah ich zu, wie ein halbes Dutzend Feuerwehrleute tiefer ins Gebäude vordrangen und dunkler Rauch sie einhüllte. Scharfer Brandgeruch erfüllte die Luft, und Flammen leckten zum Himmel auf, flackerten und sprangen, gierig nach Sauerstoff, nach Zunder – nach allem, was sie kriegen konnten.
Das Feuer würde sich alles nehmen.
2
Das Feuer brannte schnell, und die Feuerwehrleute zogen sich zurück, als das Gebäude das Obergeschoss verlor. Inzwischen waren Einsatzkräfte aus Waterford, Colonie, Half Moon und Troy eingetroffen, auch aus Menands und Albany war schon Verstärkung im Anmarsch. Im Erdgeschoss wurde mit Schläuchen gelöscht, und Feuerwehrleute auf Leitern ließen Wasser auf das Dach prasseln. Ein Helikopter des Landverwaltungsamtes des Staates New York raste auf uns zu, vollgetankt mit Flammschutzmittel. Zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr wässerten die ehemalige Textilfabrik Harmony Mill auf der anderen Straßenseite, damit sie nicht durch Funkenflug auch noch in Flammen aufging. Da alle Gebäude so nah beieinander lagen, waren die Löscharbeiten enorm aufwendig.
Die Sonne war untergegangen, so wirkte das Feuer noch höllischer, es warf rote, orangefarbene und gelbe Schatten auf die Hügel, die sich dahinter erhoben, sodass es aussah, als stünde die ganze Stadt in Flammen. Sogar noch in über einem Block Entfernung, wo ich den Verkehr umleitete, lief mir vor Hitze der Schweiß den Rücken hinunter.
Lisa Jones, die Feuerwehrchefin von Menands, die den Brand am westlichen Perimeter überwachte, informierte mich: »Viele dieser alten Fabriken sind praktisch Holzlager mit vier Wänden drumherum. Sie wissen schon, Gebäudeklasse III.«
Ich hatte keine Ahnung, was Gebäudeklasse III war, und sagte es ihr.
»Die alte Holzrahmenbauweise. Holzböden, Holzdecken, hölzerne Tragebalken, alles aus Holz, außer den Wänden. Und weil die durch den langjährigen Betrieb mit Chemikalien gesättigt sind, brennen die Gebäude schnell.«
»Und wenn noch Benzin dazukommt?«
»Nicht zu löschen.«
Nicht, dass die Feuerwehr es nicht versucht hätte. Fast eine Stunde lang kippten sie alles drauf, was sie hatten. Ich übernahm Absperrung und Verkehrskontrolle und machte nur kurz Pause, um ein paar Stiefel überzuziehen, die mir eine Einheit der Feuerwehr geliehen hatte, so groß, dass meine Füße mitsamt Schuhen hineinpassten. Sie machten das Gehen schwierig, waren aber notwendig, weil sich meine benzingetränkten Schuhe in meinen persönlichen Scheiterhaufen verwandeln würden, wenn Funken sie trafen. Dave traf an der Brandstelle ein, winkte mir zu und joggte los, um zwei Straßen weiter vorne den Verkehr umzuleiten. Die Flammen schlugen höher, und wir mussten den ganzen Hügel absperren.
Chief Donnelly in einem unserer Streifenwagen hielt neben mir.
»Ist die verbrannte Frau unser Feuerteufel?«, fragte er.
»Habe sonst niemanden vor Ort gesehen, und sehe hier auch niemanden«, – ich suchte die Menge der Gaffer ab, weil Brandstifter ihrem Werk oft gerne zusahen – »der ungewöhnliches Interesse an dem Feuer zeigt.«
»Dieses Feuer hat Massen angelockt«, sagte der Chief. »Wahrscheinlich stellen sie sich vor, es war der Geist von Luisa Lawler.«
Die Sleep-Tite-Fabrik galt bei den meisten Leuten als verflucht. Sie hatte Bernie Lawler gehört, ein Name, der bei mir zu Hause von besonderer Bedeutung war. 1983 hatte Bernie Lawler seine Frau Luisa und ihren dreijährigen Sohn Teddy ermordet. Die Leichen waren nie gefunden worden, aber es gab jede Menge Indizienbeweise: Zeugenaussagen über Misshandlung, Blutspritzer überall an den Kellerwänden, und das Schlimmste, blutige Handabdrücke auf der Unterseite von Bernies Kofferraumdeckel, aus dem Luisa vergeblich zu fliehen versucht hatte. Es war meinem Dad zu verdanken, dass Bernie gefasst wurde und ins Gefängnis kam. Er war immer noch dort.
Aus einigen Meilen Entfernung sah ich, wie auf dem Dach des Memorial-Krankenhauses ein Helikopter landete, der mein Verbrennungsopfer innerhalb von zehn Minuten zur regionalen Verbrennungsklinik in Albany bringen würde. Wie es hieß, hatte man es im Memorial geschafft, ihr eine Infusion zu legen, und sie mit Flüssigkeit vollgepumpt. Die Diagnose lautete auf Verbrennungen zweiten und dritten Grades, aber ansonsten blieb man vage und überließ die ausführliche Diagnose den Experten in Albany.
Als ich den Himmel betrachtete, sah ich einen Scheinwerfer über dem Hudson, der sich schnell näherte. Der Helikopter des Landverwaltungsamtes. Das Flammschutzmittel, das er brachte, war unsere größte Hoffnung. Gleich würde hier alles von rotem Schaum überzogen sein – das Gebäude, der ganze Block und auch die Menge, wenn es mir nicht gelang, sie zurückzudrängen.
Ich hatte es etwa fünf Meter weit geschafft – mehrere Hundert Gaffer waren angesichts einer Katastrophe dieser Größenordnung nur schwer zum Gehen zu bewegen. Das Feuer schoss abrupt in die Höhe wie ein helles römisches Licht und verschwand dann aus der Sicht. Das Gebäude ächzte wie ein sterbender Dinosaurier, und dann stürzte das Dach ein, gefolgt von einem Krachen, als Dach und erster Stock ins Erdgeschoss durchbrachen, woraufhin mit einem Schlag wie Donnerhall alles in den Keller darunter krachte. Ich hatte eine Ascheschicht im Mund und spuckte aus. Dann sah ich zu, wie die Wände des Gebäudes, jetzt nicht mehr abgestützt, schwankten und nach innen einstürzten, zuerst die beiden am Hügel, eine Minute später die zur Straße.
Das Feuer war besiegt. Nicht komplett gelöscht, aber kontrollierbar. Der Helikopter versprühte seine Ladung, der rote Schaum platschte genau in die Mitte der Ruine, und alle Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten vor und löschten einzelne Stellen, wo Flammen durch den Ziegelschutt leckten, das Feuer zu einem langsamen Schwelbrand reduziert.
Es war vorbei, wenn auch noch nicht überstanden.
Nachdem wir den größten Teil der Menge zerstreut hatten, trafen State Trooper ein, um die Verkehrskontrolle zu übernehmen, und Dave und ich nutzten die Gelegenheit und fuhren zur regionalen Verbrennungsklinik nach Albany. Wir wollten nach unserem Verbrennungsopfer sehen und wenn möglich auch mit ihr reden.
»Ich sollte meinen Bruder anrufen. Lucas würde glatt die Triumphparade anführen«, sagte Dave und fuhr von der 787 ab, auf das St. Peter-Krankenhaus zu.
»Parade?«
»Er hat früher mal bei Sleep-Tite gearbeitet und hätte praktisch alles getan, um da rauszukommen. Jobs in geschlossenen Räumen machen ihn verrückt.«
»Dann muss er es ja lieben, Barmann zu sein.«
»Na ja, Alk liebt er noch mehr als Frischluft.« Er lächelte. »Er hat bei Sleep-Tite die Frühschicht gemacht, und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich davon aufgewacht bin, dass mein Dad an seine Tür klopfte und Lucas sagte, er solle seinen faulen Arsch aus dem Bett kriegen. Natürlich hätte mein Dad nie diese Worte benutzt. Geflucht hat er auf Ukrainisch.«
Wir hielten an einer Kreuzung, die Kathedrale im neogotischen Stil links von uns, das hässliche moderne Hochhaus der Landesbehörden zu unserer Rechten. »Ging es deinem Vater darum, ihm eine gute Arbeitsethik beizubringen?«
»Schon, aber es war auch wegen … Mom machte damals die Nachtschicht bei Sleep-Tite, und mein Dad ließ sie nach Schichtende nicht gern warten. Er machte sich Sorgen, dass ihr langweilig würde, und wenn das passierte, war sie imstande, loszuziehen und sich auf Teufel komm raus zugrunde zu richten. Er hatte recht damit. Als sie zum letzten Mal verschwand, kam sie von der Arbeit. Sie ist auf Sauftour gegangen, dann hat sie Tante Natalyas Wagen geklaut und ist damit losgebraust.« Er fuhr auf den Parkplatz des St. Peter-Krankenhauses, ließ sein Fenster herunter und drückte auf einen Knopf. Das Gerät spuckte einen Parkschein aus, Dave klemmte ihn hinter die Sonnenblende. »Ich schätze, ich hasse Sleep-Tite auch ein wenig.«
Ich verspannte mich, als wir durch die Gänge von St. Peter gingen. Im Endstadium von Kevins Krankheit war es mir gelungen, Krankenhäuser zu meiden, aber bevor die Lage hoffnungslos wurde, waren die Tage meines Mannes mit Arztterminen ausgefüllt gewesen, einer nach dem anderen: Onkologen, Lungenspezialisten, Schmerzspezialisten und die ganze diagnostische Maschinerie, MRT, Röntgen, Blutuntersuchungen – die Liste war endlos.
Wir gelangten zur Verbrennungsintensivstation, und ein Schild an der Tür wies uns an, uns im Schwesternzimmer zu melden. Dort angekommen, erklärten wir einem Pfleger in weißer OP-Kleidung, wer wir waren und warum wir gekommen waren.
»Ich habe Gayle angepiepst. Es ist ihre Patientin«, sagte er. »Ich nehme an, Sie wollen die Patientin sehen?«
»Für ein paar Fragen.«
Er reichte uns Krankenhauskittel aus Papier, Überschuhe und OP-Hauben. »Ziehen Sie das an.«
Eine Schwester Mitte fünfzig eilte aus einem Krankenzimmer. Auch sie trug den weißen Kittel des Pflegepersonals auf dieser Station, und ihre Crocs quietschten bei jedem Schritt.
»Sie sind wegen unserer namenlosen Patientin hier?«, fragte sie.
Ich griff unter meinem Kittel nach meiner Dienstmarke.
»Man sieht Ihnen schon vom anderen Ende des Ganges an, dass Sie Cops sind«, sagte sie. »Wie können wir Ihnen helfen?«
»Das Verbrennungsopfer hat große Schmerzen, das wissen wir«, sagte ich. »Aber wir müssen ihr einige Fragen stellen.«
»Wir konnten sie gerade erst einigermaßen stabilisieren. Ihr Blutdruck spielt immer noch verrückt …«
»Eine Frage«, sagte Dave. »Wir brauchen ihren Namen.«
»Sie ist bewusstlos«, sagte Gayle. »Schon seit ihrer Einlieferung.«
»Ihre Gesundheit gefährden ist das Letzte, was wir wollen«, sagte ich. »Aber könnten Sie vielleicht die Dosis ihrer Medikamente reduzieren? Wir müssen sie nur eine Minute wecken und nach ihrem Namen fragen, und vielleicht noch, wer benachrichtigt werden soll.«
Über der Tür eines der Krankenzimmer ging eine Lampe an, gefolgt von einem leisen Signalton.
»Dan, kannst du das übernehmen?«, fragte Gayle.
Der junge Mann stimmte zu, zog sich eine OP-Haube über und band sich eine Gesichtsmaske um, während er zu dem Patienten eilte.
»Hören Sie«, sagte Gayle, »das ist kein künstliches Koma. Ja, sie bekommt Schmerzmittel, aber die Lage ist nun mal, dass ihr Körper beschlossen hat, alle nicht lebenswichtigen Funktionen einzustellen. Verbrennungsschock. Ihre ganze Haut, einschließlich ihrer Lungenoberfläche, kämpft gerade darum, zu heilen, und wir pumpen sie mit Flüssigkeit voll, ohne ihre Lungen zu überschwemmen und sie zu ertränken. Sie könnte aufwachen …«
»Ein Foto«, sagte ich. »Können wir ein Foto von ihr machen, für den Fall, dass wir eine Vermisstenmeldung reinkriegen?«
Gayle überlegte. »Das dürfte klargehen, denke ich.«
Das Opfer lag auf dem Krankenhausbett, ihre Lippen blass unter dem Ventilator, ihr Haar fort. Was von ihrer Haut zu sehen war, glänzte von einer Lotion, die etwas von der verlorenen Feuchtigkeit ersetzen sollte. Sie lag nackt unter einem Zelt, ein gazeartiger Stoff hing etwa dreißig Zentimeter über ihrem Körper. Nichtsdestotrotz sah sie überraschend gut aus, die Verletzungen kaum schlimmer als ein sehr böser Sonnenbrand, nur ihr Gesicht war von Brandblasen überzogen.
»Wenn man Verbrennungspatienten aus dem kritischen Zustand heraus hat und von Ruß und Asche säubert, sehen sie wieder etwas gesünder aus. Aber systemisch … die Haut ist eins unserer größten Organe, und Verbrennungen, wie sie welche hat, sind so schwerwiegend wie eine Stichverletzung in die Nieren«, sagte Gayle.
Dave zog eine Kamera heraus. »Darf ich?«
Gayle erlaubte es ihm.
»Also, wie sind ihre Aussichten?«
Gayle erklärte, dass die Frau Verbrennungen unterschiedlichen Grades auf diversen Körperteilen hatte. Einige Bereiche waren verschont geblieben, oder die Verbrennungen waren ersten Grades – »wie die an ihren Füßen, komisch eigentlich« – aber der größte Teil ihres Körpers hatte Verbrennungen zweiten Grades erlitten, wo die oberste Hautschicht weggebrannt war.
»Benzin brennt schnell«, sagte sie. »Ihre Kleider langsamer, und genau da haben wir auch die Verbrennungen dritten Grades.«
Ich versuchte, die schlimmsten Stellen zu erkennen. »Wie viel davon ist dritten Grades?«
»Zwanzig Prozent. Schulter- und unterer Rumpfbereich. Gott sei gedankt für Naturfasern, die schneller brennen als synthetische oder, Gott behüte, Plastik.« Ein grimmiger Ausdruck huschte über ihr Gesicht. »Plastik kann wirklich übel sein.«
»Also zwanzig Prozent«, sagte Dave und steckte die Kamera weg. »Das ist nicht so schlimm, oder?«
»Oh doch. Besonders für jemanden in ihrem Alter.«
»In ihrem Alter?«, fragte ich. »Sie wissen, wie alt sie ist?«
»Nun, ausgehend von der Osteoporose, die wir beim Röntgen entdeckt haben, schätze ich sie auf Mitte fünfzig, möglicherweise Mitte sechzig. Es lässt sich nicht pauschal sagen, aber Daumenregel ist, wenn man das Alter eines Menschen zum Prozentsatz der Verbrennungen dritten Grades addiert, bekommt man das prozentuale Sterberisiko. Wenn sie über fünfzig ist, besteht also ein Sterberisiko von fünfundsiebzig Prozent, wenn sie über sechzig ist, schon eher fünfundachtzig Prozent.«
Dave machte ein langes Gesicht. Gayle fuhr unerbittlich fort. »Und jegliche Begleiterkrankung – Diabetes, Herzkrankheiten, Asthma – kann die Chancen weiter verschlechtern.«
Die Atmung der Frau wurde schwer. Ich sah keine Echozeichen auf den Monitoren, aber Gayle nahm den Katheterbeutel und musterte kritisch den Urin.
»Überhydrierung«, sagte sie. »Womöglich ertränken wir sie gerade. Sie müssen gehen. Ich rufe Sie auf jeden Fall an, wenn sie aufwacht, und wenn auch nur für eine Sekunde. Ich verspreche Ihnen, dass ich einen Namen aus ihr herauskriege.« Gayle stellte die Infusion der Frau neu ein, drosselte die Flüssigkeitszufuhr. »Wir wollen genauso gern herausfinden wie Sie, wer unsere Freundin hier ist.«
3
Ich machte drei Tage Doppelschichten an der Brandstelle. Nach Hause kam ich nur zum Schlafen und um von meiner siebenjährigen Tochter gesagt zu bekommen, dass ich komisch roch. Die Asche des Großbrands setzte sich in meine Kleider und mein blondes Haar, sodass ich schon dachte, ich würde grau. Obwohl ich immer lange duschte, mir das Schwarze unter den Nägeln herauskratzte und meine Kleider zweimal wusch, hing der Geruch hartnäckig an mir. Ich rechnete damit, dass ich noch eine Woche vor mir hatte, bis das Leben wieder normal würde, aber als ich an Tag vier an der Brandstelle ankam, waren die Räumarbeiten gestoppt worden.
»Chemikalien«, sagte Dave. »Ein ganzer Haufen Fässer voller Chemikalien, versteckt hinter einer illegal eingezogenen Kellerwand.«
Meine Haut begann zu kribbeln, als ich mir all die Toxine in der Luft vorstellte. »Illegal?«
»Der Brandinspektor sagte, die Wand ist auf keiner der im Rathaus hinterlegten Baupläne verzeichnet.«
Ich sah zu, wie das Gefahrgut-Einsatzteam der Feuerwehr Schutzfolien durch die Berge von Ziegelschutt trug, die das Gebäude umgaben.
»Die Feuerwehr sagt, das ist TRIS …«
»Tris?«
»Ja, irgendeine Chemikalie, mit der früher Pyjamas behandelt wurden, bis man merkte, dass Kinder davon Leberkrebs bekamen. Wurde in den späten Siebzigern verboten. Statt Geld für fachgerechte Entsorgung auszugeben, hat der gottverdammte Bernie Lawler das Zeug fässerweise hinter einer dünnen Wand im Keller deponiert.«
»So viel dazu, falls du nach dem Mord an seiner Frau noch irgendwelche Zweifel daran hattest, dass er ein absolut mieser Dreckskerl war«, sagte ich. Bernie Lawler war nur einer von vielen Fabrikbesitzern, die Chemikalien in unseren Boden und unser Wasser verklappten, bevor sie sich aus dem Staub machten. Normalerweise verlegten sie die Unternehmen in den Süden oder nach Übersee, statt im Gefängnis zu landen, wie es die meisten von ihnen verdient hätten.
»Ehrlich gesagt«, sagte Dave, »die Fässer hätten dort wahrscheinlich unbemerkt stehen können, bis die Kakerlaken den Planeten übernehmen – wenn der Laden nicht abgebrannt wäre. Hier geht es jetzt jedenfalls nicht weiter, bis die Feuerwehr das runde Dutzend Fässer katalogisiert und abtransportiert hat. Du wirst eine Weile Däumchen drehen.«
Die Arbeiten im Keller waren verborgen, Zeltplanen schirmten die Aktivitäten der speziell ausgebildeten Feuerwehrleute ab, die die Fässer öffneten, den Inhalt untersuchten und fotografierten und die Fässer dann für den Transport in Schutzfolie verpackten. Sie hatten über der Grube mit den Chemikalien einen hell erleuchteten Arbeitsbereich eingerichtet, von dem verstärkten Gerüst aus hatte man einen Panoramablick auf den Giftmüll darunter. Eine Plattform, die sich heben und senken ließ – eine Art Lastenaufzug –, beförderte die Fässer aus der Grube an die Oberfläche, wo sie zu den wartenden Lastern transportiert wurden.
Ein Arbeiter in einem Ganzkörperoverall, der, wie ich vermutete, aus Blei gemacht war, versuchte, unsere Ängste zu beschwichtigen. »Es gibt bisher keinerlei Hinweise auf Kontamination durch die Luft.«
»Spitzenmäßig«, sagte Dave. »Ich spüre schon, wie meine Spermienzahl abstürzt.«
Da der Brandinspektor den Großteil der Ermittlung zur Brandursache leitete, blieb uns nicht viel mehr zu tun, als den Bereich weiterhin großräumig abzusperren, wie es die Feuerwehr verlangt hatte. Wir sprachen über die verbrannte Frau, die immer noch bewusstlos im St. Peter-Krankenhaus lag. Alle lokalen Nachrichtensender hatten ihr Foto gebracht, aber bislang waren keine echten Hinweise hereingekommen.
»Weil der Transporter zerstört wurde, hatten wir nur das unvollständige Kennzeichen. Kein Treffer im System«, sagte ich. »Es war ein Leihwagen mit Kennzeichen aus Nevada, und keine der großen Ketten – Hertz, National, Avis – hat vermisste Fahrzeuge gemeldet.«
Wir hörten auf zu reden, als sich ein Wagen näherte, und ich ging hinüber, um ihn anzuhalten. Das Fenster auf der Fahrerseite wurde heruntergelassen, und eine junge Frau lehnte sich heraus, mit dunkelbraunem Lippenstift, das Haar zu einem festen Knoten aufgesteckt.
»Sie ist die Eigentümerin«, sagte sie und zeigte mit einem blau lackierten Nagel auf die ältere Frau auf dem Beifahrersitz. Sie war klein und trug eine irische Strickjacke, cremefarben mit dunkelbraunen Knöpfen, und eine blaue Baskenmütze mit einer Claddagh-Brosche. Elda Harris.
Jeder nannte sie Bernie Lawlers Fabrik, aber alles in allem hatte sie ihm nur sechs Jahre gehört. Am 16. Juni 1978 hatte er die neunzehnjährige Luisa Harris geheiratet und den endgültigen Kaufvertrag für die Sleep-Tite-Fabrik unterschrieben, die er Luisas Eltern abkaufte. Im August 1984, nachdem Bernie für den Mord an Luisa und Ted verurteilt worden war, gewann Luisas Mutter eine Enteignungsklage wegen vorsätzlicher Tötung, und ihr wurde Bernies gesamter Besitz zuerkannt, der sein Haus, sein Boot und das Unternehmen umfasste. Im Juli 1986 ging die Sleep-Tite-Fabrik bankrott und stellte den Betrieb ein, aber Grundstück und Gebäude blieben auf Elda eingetragen. Das Feuer vollendete, was Rost und Zerfall nicht besorgt hatten.
Elda ließ ihr Fenster herunter und sah zu, wie der Kipplaster Ziegelschutt und Balken abtransportierte. Sie hatte fedriges Haar, das ihren Kopf wie ein Glorienschein umgab, und Triefaugen. Ihr Blick war konzentriert, aber wässrig. Sie schien weder mich noch Dave zu bemerken, nicht mal die junge Frau, die sie hergefahren hatte und ihr nun wiederholt »Mrs Harris! Mrs Harris!« zurief.
Schließlich sprach sie, mit durchdringenderer Stimme, als ich von einer so gebrechlichen Person erwartet hatte.
»Gut. Gut. Jetzt ist es erledigt. Bringen Sie mich nach Hause, Caitlin.« Sie drückte auf einen Knopf, das Fenster glitt hinauf, und die beiden fuhren davon.
»Wir werden sie sehr bald befragen müssen«, sagte ich.
»Glaubst du, sie hat die Fabrik abgefackelt?«, fragte Dave. »Ich meine, alle sagen, sie hätte den Laden damals absichtlich gegen die Wand gefahren. Dann hat sie ihn vielleicht auch angezündet.«
»Das bezweifle ich stark«, sagte ich. »Es sei denn, sie hat im Alleingang den Verfall des Produktionssektors in den Vereinigten Staaten organisiert, in welchem Fall sie wirklich ein kriminelles Superhirn wäre.«
»Weißt du, immer wenn ich gerade anfange zu glauben, dass du doch ein normaler Mensch bist, quatschst du auf einmal, als hättest du einen Mastertitel. Ach, nein, du hast ja wirklich einen!«
»Jetzt mach aber mal halblang. Du hast Soziologie studiert, Herrgott noch mal.«
»Aber, Special Agent Lyons, ich habe nicht jahrelang beim FBI malocht.« Er wackelte mit den Augenbrauen. »Vielleicht war Elda eine Terroristin, die die USA von innen heraus zerstörte. Ach, wo wir gerade davon reden …«
Erneut näherte sich ein Wagen, diesmal ein schwarzer SUV von der Größe eines Ozeandampfers. Er legte eine rasante Kehrtwendung hin, spritzte voll durch eine Pfütze, die sich in einem Schlagloch gebildet hatte, und parkte auf der anderen Straßenseite. Hale Bascom stieg aus, schick und adrett in einem Burberry-Mantel, in jeder Hinsicht das Gegenteil seiner überdimensionierten Dienstkarre. Ich kannte ihn seit unserer Zeit vor fünfzehn Jahren in Quantico, wo er der Typ war, dem keine Frau widerstehen konnte, mich eingeschlossen. Wir hatten unsere eine Nacht miteinander gehabt, dann zog er weiter zu seiner nächsten Eroberung, und ich zu meinem künftigen Ehemann. Ich war dabei entschieden besser weggekommen. Abgesehen von den Lachfältchen um die Augen und einer Spur mehr Einfühlungsvermögen hatte er sich seitdem kaum verändert.
»Special Agent Bascom«, sagte Dave. »Was verschafft uns das Vergnügen?«
»Ich habe gerade eine Ermittlung in Kinderhook abgeschlossen und dachte, ich schaue mal vorbei.«
Kinderhook hatte noch weniger Einwohner als Hopewell Falls, und ich fragte mich, was jemand dort anstellen konnte, um die Aufmerksamkeit des FBI auf sich zu ziehen.
»Ein Hedgefonds-Manager aus Connecticut hat Informationen über Geldwäsche für ein Drogenkartell in seinem Sommerhaus versteckt.« Hale schüttelte angewidert den Kopf. »Buchprüfung bei Wirtschaftskriminellen war noch nie meine Stärke.«
»Tabellen am laufenden Meter?«, fragte ich. »Klingt doch kurzweilig.«
»Oh, das ist es. Und dann dürfen wir Tabellen erstellen, um den Überblick über die Tabellen zu behalten. Spannung pur. Darum habe ich beschlossen vorbeizukommen, weil ihr anscheinend entschieden habt, uns nicht offiziell hinzuzuziehen, obwohl im Bericht steht, dass das Opfer da« – er winkte in Richtung des ausgebrannten Gebäudes, lässig, aber mit zusammengebissenen Zähnen – »einen Wagen mit dem Nummernschild eines anderen Bundesstaates hatte.«
»Genau gesagt war es ein Transporter«, sagte ich. »Ein Mietwagen. Schwer zu lokalisieren, weil sie Staatsgrenzen überqueren und nicht immer an dem Ort gemietet werden, auf den ihr Kennzeichen ausgestellt ist. Nach allem, was wir wissen, könnte das Opfer auch aus Schenectady sein.«
»Hast du das Kennzeichen gesehen, bevor es verbrannt ist?«
Ich sah in meinen Notizen nach. »Nevada 14 …, der Rest war nicht mehr zu erkennen.«
»Nicht zu erkennen oder hast du es vergessen?«
Hale hatte Erfolg im Leben, weil er nie lockerließ, aber im Moment hätte ich ihm am liebsten eine reingehauen. »Nicht zu erkennen. Schlamm auf dem ganzen Nummernschild.«
»Absichtlich?«
»Möglich. In Schenectady gibt’s jede Menge Schlamm.«
Der Vorarbeiter rief nach Dave. Er war sauer, weil das Gefahrgut-Einsatzteam der Feuerwehr die Arbeit eingestellt hatte und, noch wichtiger, seine Bauarbeiter schon Überstunden schoben. Er hatte bereits den größten Teil des Tages damit verbracht, sich bei Dave zu beschweren, der ihm immerzu versprach, dass die Abbrucharbeiten bald fortgesetzt werden könnten. In der Sekunde, als Dave außer Hörweite war, wechselte Hale das Thema.
»Also, ich hoffe wirklich …«, die Härte in seiner Stimme war wie weggeblasen, jetzt klang sie sanft und einschmeichelnd, »… dass du über mein Angebot nachgedacht hast, zum FBI zurückzukommen …«
»Ich habe mich noch nicht entschieden. Und wenn es dein Führungsstil ist, Leute zu überfahren, sollte ich vielleicht ablehnen.«
Obwohl in zehn Metern Umkreis von uns niemand war, trat Hale näher, und ich konnte sehen, wie seine Haarwirbel dem teuren Haargel entwischten, mit dem er sie zu bändigen versuchte. »Sei nicht voreilig, June. Lass uns nichts von vornherein ausschließen.«
»Du willst jetzt sofort eine endgültige Antwort?«
»Nur, wenn es ein Ja ist. Wenn es ein Nein ist, lass es dir ruhig noch eine Weile durch den Kopf gehen.«
»Einstweilen ist es ein Vielleicht«, sagte ich.
Hale sah zu Boden. »Ist es wegen unserer Vorgeschichte?«
Seine Frage überraschte mich. »Persönlich oder beruflich?«
»Sowohl als auch?« Er hob die Hand in den Nacken, und ich spannte mich an. Hale selbst wusste es nicht, aber er hatte eine verräterische Geste, wenn er log: Er legte sich die Hand in den Nacken. Diesmal allerdings wanderten seine Finger höher und massierten seinen Kopf, und mir wurde klar, wie schwer ihm dieses Gespräch fiel. »Ich weiß, dass ich euch kein besonders guter Freund war, als Kevin im Sterben lag, und wenn ich an einem Fall arbeite, bin ich wohl manchmal etwas …«
»Unsensibel?«
»Aggressiv.« Er blickte finster drein, doch dann lächelte er. »Und vielleicht sollte ich das Thema vorerst fallen lassen.«
»Solltest du vielleicht, Hale. Aber sieh es mal so, die Antwort ist noch kein Nein. An dem, was du erwähnt hast, ist manches problematisch, aber das wären für mich keine Hinderungsgründe.«
»Na, das klingt doch nach einem Etappensieg.« Hale zeigte auf Dave, der ein lebhaftes Gespräch mit dem Vorarbeiter führte. »Dann will ich mal davon absehen, das FBI in was auch immer da drüben los ist zu involvieren, und mich empfehlen, solange ich vorne liege.« Hale salutierte mir, während er schon auf den SUV zuging.
»Lyons!«, schrie Dave und winkte mich zur Ruine hinüber. Ich sah, wie der Vorarbeiter sein Walkie-Talkie ausknipste und hinter einem Ziegelhaufen verschwand. Dave folgte ihm.
Ich sprintete hin und wurde langsamer, sobald ich das zerstörte Gebäude erreichte. Die Ingenieure sagten zwar, der Weg ins Innere wäre gesichert, aber er war übersät mit gefallenen Backsteinen, und ich sah mich lieber höllisch vor, nicht die Mauerreste zu streifen und womöglich einen Erdrutsch auszulösen.
Das Zelt im Untergeschoss wimmelte von Mitarbeitern der Umweltschutzbehörde. Ein Typ in hellgelbem Schutzanzug hielt uns vom Rand der Grube fern.
»Jetzt bekommen Sie richtige Arbeit«, sagte er. »Wir haben eine Leiche gefunden.«
Wegen all der Chemikalien wussten wir, dass eine umfassende Spurensicherung anstand – das war Sache der Feuerwehr und der Umweltschutzbehörde. Doch wenn es eine Leiche gab, war es zuallererst unser Tatort. Die anderen Einsatzkräfte waren nicht überzeugt. Dave und ich wurden erst in die Grube hinuntergelassen, als wir in Schutzanzüge verpackt waren wie Michelinmännchen und schworen, dass wir nichts anrühren würden. Nur kurz nachdem wir im Keller gelandet waren, wurden wir auch schon wieder eilig hinaufbefördert, zusammen mit dem Fass, das unser Opfer enthielt. Oben erwarteten uns der Gerichtsmediziner Norm Finch und die Technikerin der Spurensicherung Annie Lin.
»Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen«, sagte Annie.
Wir hatten Fotos von der Leiche gemacht, aus den eingeschränkten Blickwinkeln, die uns zur Verfügung standen, aber Annie wiederholte unsere Arbeit noch zweimal. Das Opfer war eine Frau. Versiegelt im Fass, seit Jahren unberührt im kühlen Keller, war sie regelrecht mumifiziert statt verwest. Ihre Haut hatte die Farbe von altem Eichenholz, ihre ethnische Zugehörigkeit konnten wir vorerst nicht bestimmen. Ihr rotes Kleid war mit orangefarbenen Stellen überzogen, wo ihre Körperflüssigkeiten herausgesickert waren, ihre hochhackigen braunen Stiefel hingen lose um ihre eingeschrumpften Waden, die Haut spannte sich über den Knochen. Nicht einmal das Feuer hatte sie berührt, denn der Betonbunker hatte sie und das Tris hermetisch von der Zerstörung abgeschirmt. Das Opfer erinnerte mich an das alte Ultraschallbild von Lucy, in fötaler Haltung, eine Hand auf der Brust, Gesicht und Kopf halb hinter der anderen verborgen.
Norm spähte in das Fass. »Sie fällt uns auseinander, wenn wir sie rauszuheben versuchen.«
»Bringen wir sie ins Labor. Ich kann sie da in fünfzehn Minuten rausschneiden«, sagte Annie.
»Können wir das Fass untersuchen, bevor Sie es aufschneiden?«, fragte Dave.
»Außer der Leiche selbst gibt’s da nicht viel zu sehen, und auf oxidiertem Metall halten sich so gut wie keine forensischen Spuren«, sagte Annie. »Aber vielleicht hat das Fass ja sprechen gelernt. Wenn es Ihnen gesagt hat, wer die Frau hineingelegt hat, können Sie mit ihm über das aktuelle Zeitgeschehen plaudern. Es fragt sich sicher, wie die Friedensverhandlungen im Mittleren Osten stehen.«
»Sonst ist da unten gar nichts?«
»Fehlanzeige. Ich meine, ich werde alles noch auf Spurenmaterial untersuchen, aber Sie haben mehr davon, wenn Sie sich an Norm hängen und ihm auf den Wecker gehen.« Annie begann, ihre Instrumente sorgfältig in ihren Koffer zurückzustecken und sah auf, als niemand antwortete. »Er wird letztlich herausfinden müssen, was genau Luisa Lawler zugestoßen ist.«
Dave seufzte. »Die Tote ist noch gar nicht identifiziert, Annie. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen.«
»Was denn? Als hättet ihr alle nicht dasselbe gedacht. Eine Frauenleiche, in dieser Fabrik. Die, wenn ich euch daran erinnern darf, einem Kerl gehört hat, dessen ermordete Frau nie gefunden wurde.« Annie hob ihren Koffer auf. »Und ich will nicht herzlos klingen, aber ich hoffe, sie finden den Jungen in einem anderen Fass, damit die beiden endlich die Beerdigung kriegen, die ihnen zusteht.«
Wie immer sprach Annie laut aus, was der Rest von uns insgeheim dachte. Ich konnte nicht glauben, dass wir Luisa nach dreißig Jahren endlich gefunden hatten, und auf eine Art war ich froh darüber.
Wir traten unter der Abdeckung hervor und gingen vorsichtig einen Pfad entlang, der hilfreicherweise mit Leuchtfackeln markiert war. Der Himmel glühte, tief hängende Wolken reflektierten das Licht, und es hatte zu nieseln begonnen. Sobald wir aus dem Bereich der Trümmer heraus waren, fiel ich in Laufschritt, konnte es kaum erwarten, endlich nach Hause zu kommen.
Dave ließ sich Zeit. »Ist doch nett, zur Abwechslung mal einen Mord zu haben, wo der Täter schon seit dreißig Jahren hinter Gittern sitzt.«
Daves Bemerkung ließ mich innehalten. »Besteht die Möglichkeit, dass wir damit falschliegen?«
»Wer bin ich denn, dass ich Annie infrage stellen würde?« Er klickte mit seinem Autoschlüssel, und seine Scheinwerfer leuchteten kurz auf und blendeten uns. »Wie wär’s noch mit einem schnellen Drink, Lyons?«
»Muss nach Hause und meinen Bericht tippen. Und meine Tochter sehen.« Noch wichtiger, ich musste mit meinem Dad reden und ihm sagen, dass er jetzt beruhigt sein konnte. Wir hatten endlich Luisa Lawler gefunden.
4
Ich legte meine Glock in ihrem Minisafe hoch oben auf ein Bord in meinem Flurschrank.
»Hallo!«, rief ich. Niemand antwortete.
Ich spähte in die Küche. Lucy saß da und drückte auf einem iPad herum, ein Geschenk meiner Schwester an meinen Dad, dem es eher suspekt war. Lucy hatte solche Bedenken nicht und nahm das Gerät so oft in Beschlag, wie ich es ihr erlaubte, um Angry Birds darauf zu spielen.
Ich ging zu ihr hinüber und küsste sie. »Wo ist Opa?«
Sie nickte vage nach links. Das Haus war nicht groß, und ich nahm an, ich würde bald auf ihn stoßen.
Dad saß in seinem Lieblingssessel direkt vor dem Fernseher. Er hatte leichte Schlagseite, aber dafür konnte er nichts – dem mit blauem Cord bezogenen Fernsehsessel fehlten links ein paar Sprungfedern.
»Geh dich frisch machen, und wir bestellen uns Pizza«, sagte er, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen, wo die Reporter vor der Fabrik standen.
Luisa Lawlers Foto wurde eingeblendet. So viel zu meiner Absicht, es ihm schonend beizubringen.
»Wir haben den Scheißkerl.« Er strahlte mich an, und ich konnte kurz den jungen Cop in ihm sehen, begeistert, dass der Mörder zur Strecke gebracht war. Ohne den frischen Kummer, der normalerweise eine Mordermittlung begleitete, stand ihm die reine Schadenfreude ungetrübt ins Gesicht geschrieben.
Er wandte sich wieder dem Fernseher zu. Ein anderes Foto von Luisa wurde eingeblendet. Sie war klein und zierlich, ihr rotes Haar zu einem schlichten Pagenkopf geschnitten, eine recht konservative Frisur für die frühen Achtziger, als auftoupierte Mähnen angesagt waren. Dann folgten Archivaufnahmen von Bernie Lawler vor Gericht, er trug einen dreiteiligen Anzug und saß aufrecht da. Trotz der schlimmen Achtzigerjahre-Föhnfrisur und dem übergroßen Kragen war er ein gut aussehender Mann gewesen: Groß, mit einem markanten Kinn, hellbraunem Haar und hellblauen Augen, die sogar im Fernsehen zur Geltung kamen.
Wenn meine Familie heute noch etwas zu Abend essen sollte, war es an mir, es zu bestellen. Als ich den Anruf machte, tippte Lucy ohne hochzusehen auf dem Bildschirm herum, um die Vögel dazu zu bringen, in einem wackeligen Bauwerk zu landen, aber sie rief mir zu, dass sie Pizza mit Käse ohne alles wünschte. Ich gab es weiter.
Oben zog ich meine Sachen aus und ließ sie in einem Haufen auf dem Boden liegen. Sie in den Wäschekorb zu tun, hätte nur zur Folge, dass alles nach Asche riechen würde, wahrscheinlich für immer und ewig. Seit dem Brand kam ich jeden Tag völlig verdreckt nach Hause, über und über voller Ruß und feuchter Schmiere, die roch wie der Tod.
Ich berührte Kevins Foto, auf dem eine dreijährige Lucy in Papas Schoß zappelte, beide mit denselben lachenden blauen Augen. Er trug ein T-Shirt, seine FBI-Dienstmarke an einer lose hängenden Kette um den Hals. Mit ihren Pausbäckchen und den kurzen Beinchen war Lucy kaum als das Kind zu erkennen, das sie jetzt war.
»Du hättest gerade deinen Spaß an meinem Dad«, sagte ich zu seinem Foto. »Er freut sich wie ein Kind im Süßwarenladen.«
Ich kletterte unter die Dusche, der heiße Wasserstrahl tat gut. Ich drückte mir eine riesige Portion Shampoo in die Hände und wusch mir die Haare, und dann wusch ich sie nochmals, als das Wasser nicht klar wurde. Ich schrubbte mich gründlich unter den Fingernägeln und im Nacken, wo der Dreck sich besonders ablagerte. Das Wasser war nicht mehr schwarz wie am ersten Tag, sondern grau. Wieder spülte ich mein Haar aus und stellte dann den Wasserhahn ab.
Nachdem ich in eine Yogahose und eines von Kevins alten Flanellhemden geschlüpft war, packte ich meine schmutzigen Kleider in mein Handtuch und stapfte nach unten. Lucy nahm keinerlei Notiz von mir, als ich durch die Küche zum Wäscheraum ging. Ich kam in die Küche zurück und bat Lucy, den Tisch zu decken – mit diesem Job verdiente sie sich ihr Taschengeld. Sie drückte weiter auf dem iPad herum.
»Weg damit«, sagte ich. Lucy hörte mich nicht.
Ich ging zu ihr rüber und nahm ihr das iPad aus der Hand, und kurz bewegte sie sich mit ihm mit, wie angeleint.
»Tisch decken«, sagte ich.
Während ich Salat machte, sprachen wir über ihren Tag, der dank Angry Birds und einem Wettrennen in der Pause, das sie gewonnen hatte, total toll gewesen war, was sie betraf. Ich hatte den Salat fertig, noch ehe es an der Tür klingelte.
Der Pizzalieferant wagte mir nicht in die Augen zu sehen, nicht einmal, als ich ihm sein Trinkgeld gab. Ich hatte ihn schon ein paar Mal auf der Straße angehalten, als er allzu übereifrig gewesen war, die Pizza auszuliefern, solange sie noch heiß war, und mir war nicht entgangen, dass er auch heute Abend ziemlich fix gewesen war.
»Fahr vorsichtig!«, rief ich ihm nach.
Lucy stürzte sich auf die Schachtel mit der Käse-Pizza ohne alles, und ich musste sie an ihre Manieren erinnern. Sie kniete sich auf ihren Stuhl, hockte sich dann auf die Fersen, streckte die Arme aus und berührte die Pizza.
»Dad?« Im Wohnzimmer regte sich nichts, und ich ging hinüber. Mein Vater zappte durch die Kanäle. Mehrere Sender berichteten von einem College-Basketballspieler, der in seinem dritten Spiel über fünfzig Punkte gemacht hatte – ein Junge von hier, der zu Ruhm gekommen war –, aber mein Vater interessierte sich nicht dafür, er zappte hektisch weiter und hielt erst inne, als Luisa Lawlers Gesicht eingeblendet wurde. Das war noch schlimmer als Lucy mit ihren Angry Birds.





























