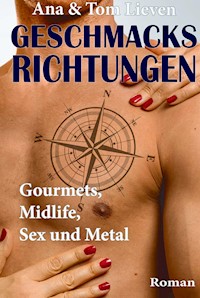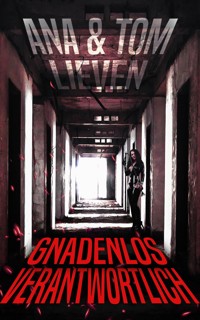
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein ganz normaler Beratungsjob. Mit den üblichen Kollateralschäden. Denken Bea, Michael und Fabian. Doch plötzlich verändert sich alles. Eine Organisation zieht sie gnadenlos zur Verantwortung. Und die weiß alles über sie, die kleinen, die großen, die schmutzigen, die peinlichen Geheimnisse, die jeder Mensch hat, und die am besten niemand kennt. Sie lässt die drei nicht entkommen, denn sie müssen für ihre Schuld bezahlen, ob sie wollen oder nicht. Ein Thriller über Schuld, Rache, Vergeltung, Buße, Sex und bigotte Moral.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ana & Tom Lieven
Gnadenlos verantwortlich
Erotikthriller
Copyright © 2022 Ana & Tom Lieven
Lektorat: Sabine Dreyer (www.tat-worte.de)
Coverdesign: Jaqueline Kropmanns (https://jaqueline-kropmanns.de)
ISBN Softcover: 978-3-347-76252-7
ISBN Hardcover: 978-3-347-76253-4
ISBN E-Book: 978-3-347-76254-1
ISBN Großschrift: 978-3-347-76255-8
Druck und Distribution im Auftrag der Autoren:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte sind die Autoren verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autoren, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Die Personen dieses Romans sind frei erfunden. Die fiktive Handlung ist eingebettet in einen zeitgeschichtlichen Kontext zwischen 1973 und 2021.
Es waren umfangreiche Recherchen zu etlichen Themengebieten erforderlich, um Authentizität zu erzeugen. Dabei wurden wir unterstützt von Alex und Stefan. Beim kniffligen Problem, dass sich Programme nicht selbst löschen können, sowie den Prüfungen der dargestellten Hacks und Software hat Frank maßgeblich geholfen.
Borislava, Horst, Ines, Kirsten, Petra, Sabine und Sabine haben das Manuskript kritisch gelesen und hinterfragt. Sie haben dazu beigetragen, dass aus einem recht ordentlichen Text ein weitaus besserer geworden ist.
Kirsten und Petra haben darüber hinaus tatkräftig bei Logik und Richtigkeit mitgeholfen.
Sabine Dreyer hat Lektorat und Korrektorat übernommen und so das Manuskript auf die Zielgerade gebracht.
Jaqueline Kropmanns hat das kongeniale Cover kreiert.
Ihnen allen gebührt unser Dank.
Sexualität ist für uns ein Thema, das untrennbar zum Leben dazugehört und es entscheidend beeinflusst. Wir klammern sie nicht aus, sondern stellen sie in ihrer Vielfalt dar. Deshalb weisen wir darauf hin, dass dieses Buch Beschreibungen sexueller Handlungen enthält, die für Personen unter 18 Jahren nicht geeignet sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bochum, 13. Juni 1975
Dieses Zimmer mochte Walter am liebsten. Die tiefen Teppiche, die getäfelten Wände, die schweren Ledersessel und das Sofa. Den scharfen Kontrast dazu bildeten die abstrakten Bilder. Sogar ein Miro und ein Kandinsky hatten hier bis vor einer Woche gehangen. Sie waren natürlich verkauft worden. Die Werke der unbekannten Künstler, die den Raum nun schmückten, hatten keinen messbaren monetären Wert.
Der Blick durch die französischen Fenster über das Ruhrtal bot eine Perspektive, wie es sie selten gab im Kohlerevier. Zu jeder Jahreszeit wechselte die Atmosphäre. Schade, er würde nicht mehr miterleben, wenn der Fluss aufgestaut wurde. Das versetzte ihm einen Stich. Manchmal verlor er sich hier in Träumereien, aus denen ihn entweder ein Telefonanruf oder eine Mitteilung seiner Privatsekretärin riss.
Nur noch die Unterschrift, dann würde er ein letztes Mal dieses Panorama genießen. Mit seiner gestochen scharfen, nach rechts geneigten Schrift unterzeichnete er den Brief, verschloss den Füllfederhalter und trocknete mit einem Löschblatt die Tinte. Das Schreiben faltete er in der Mitte und legte es auf die Schreibunterlage auf dem antiken Sekretär. Er liebte das Möbelstück, das sein Ururgroßvater in den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts aus dem Nachlass derer von Greifenau erworben hatte. Bestimmt hatte Gustav Palm, der Begründer der gleichnamigen Soda- und später Chemiewerke, Genugtuung empfunden, dass er als Bürgerlicher in der Lage war, sich so etwas Ausgefallenes leisten zu können. Er hatte auch dies Anwesen gekauft und weiter ausgebaut.
Als die chemischen Produkte, vor allem Schwefelsäure, immer relevanter wurden, stiegen die Palm’schen Werke zu einem der bedeutendsten Lieferanten im Ruhrgebiet auf. Diese Entwicklung verstetigte sich unter der Leitung von Sohn Wilhelm, dem Nachfolger von Gustav Palm. Er erkannte die Zukunft der Petrochemie und die Möglichkeiten, die der globale Handel bot. Als nach dem Verlust des Ersten Weltkriegs Reparationen zu leisten waren, gelang es dem damals Zweiundachtzigjährigen aufgrund seiner exzellenten Kontakte zu französischen und englischen Kunden, die Palm’schen Chemiewerke unbeschadet durch diese Krise zu führen.
Sein Sohn Adolf übernahm die Geschäfte im fortgeschrittenen Alter von fünfundfünfzig, nachdem der Patriarch 1925 gestorben war. Er hielt die Firma in den Folgejahren auf Kurs, wobei er zu den Nazis, anders als manche Industriellen im Ruhrgebiet, auf Distanz ging. Dies gelang ihm bis zum Kriegsbeginn 1939. Da der chemischen Industrie eine Schlüsselrolle zukam, musste er dulden, dass die nationalsozialistische Administration ihm einen Aufpasser vor die Nase setzte, der sowohl über Produktion als auch Vertrieb mitentschied. Alle Proteste halfen nicht.
Walter erinnerte sich zurück an diese Zeit, wenn sich sein Vater abends verbittert und erbost wegen dieser bornierten Affen und hirnverbrannten Brandstifter, wie er sie nannte, ereiferte.
Und dann kam die Katastrophe: eine der ersten Bombennächte 1940 im Ruhrgebiet. Er war noch spät in der Nacht im Stammwerk, als ein verirrter britischer Bomber seine Ladung fälschlicherweise über Bochum abwarf. Wesentliche Teile der Fabrik wurden beschädigt, ebenso wie die Verwaltung. Man fand Adolf Palm bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, jedenfalls sagte das die Polizei. Sie ließen es nicht zu, dass die Familie den Toten sehen durfte.
Es folgte eine harte Zeit, denn Walter, der einzige Sohn und Nachfolger, war kaum einundzwanzig Jahre alt. Wenigstens blieb ihm die Front erspart. Er musste schließlich die Fabrik wieder aufbauen und leiten. Er erinnerte sich ungern zurück. Vor allem der Einsatz osteuropäischer Zwangsarbeiter, die ab 1943 durch die Nazis in den Betrieb geschickt wurden, waren für ihn eine Unmenschlichkeit, die er versuchte, zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten abzumildern. Aber es waren allenfalls Tropfen auf den heißen Stein, und ihm war bewusst, dass etliche die Schufterei aufgrund des Nahrungsmangels nicht überlebten. Er dachte daran, und auch wenn er das Elend und seine Schuld weder wiedergutmachen noch sühnen konnte, schloss er heute persönlichen Frieden damit. Er erinnerte sich an die Zeit nach dem Krieg, als er Felicitas kennenlernte. Sie heirateten im Herbst 1945 und schmiedeten große Pläne, denn er erkannte das Potenzial seiner Gattin in geschäftlichen Dingen. Sie teilten sich die Arbeit auf, und die Palm’schen Werke wurden erfolgreicher als jemals zuvor. Sie setzten komplett auf Petrochemie. Die Nachkriegswelt hungerte nach neuen Produkten, vor allem Kunststoff. Walters Frau baute den Vertrieb auf, wobei ihr zugutekam, dass sie zweisprachig mit Englisch und Deutsch aufgewachsen war. Sie hatte vor dem Krieg all ihre Ferien bei ihrer britischen Verwandtschaft verbracht. Sie waren ein großartiges Team. Und wie gut sie mit der Belegschaft zurechtkam. Sie war die Mutter des Betriebs, kannte die Geburtstage und wusste, wer in Schwierigkeiten steckte. Für alle hatte sie ein offenes Ohr und kümmerte sich um die Angestellten. Walter bewunderte sie dafür. Er selbst war zwar ebenfalls beliebt bei den Mitarbeitern, aber ihm fehlte Felicitas’ Herzlichkeit und Natürlichkeit.
Ach, was waren das für Zeiten. Mitte der Fünfziger, als die Menschen zu bescheidenem Wohlstand gekommen waren, das Elend des Krieges langsam verblassend, gab es eine grandiose Aufbruchstimmung. Wirtschaftswunder nannten sie es. Und ja, es war ein Wunder, wie dieses zerstörte Land sich rasant entwickelt hatte. Und wie, um das Glück zu vervollkommnen, schenkte seine Frau ihm 1956 die Zwillinge Elisabeth und Alexander.
Er nahm ein dickes Fotoalbum aus einem Schrank und blätterte darin. Er erinnerte sich, dass die Jahre wie im Flug vergangen waren. Das Privileg, die Kinder gesund aufwachsen zu sehen, die immer aufs Neue angefachte Liebe zu seiner Frau, das Prosperieren des Unternehmens. Es war perfekt und so, wie eine Familiendynastie sein sollte. Das Zwillingspaar hatte schon früh deutlich gemacht, dass sie als nächste Generation die Werke weiterführen wollten. Das hatte ihm und Felicitas eine enorme Erleichterung verschafft.
Fast verlor er sich in den Erinnerungen, doch ein Gedanke, schneidend wie ein Messer, fuhr ihm durch den Körper. Seine Frau hatte den plötzlichen Niedergang des letzten Jahres nicht verschmerzt. Im Nachhinein war er sicher, dass der aussichtslose Kampf ums Überleben der Palm’schen Werke sie in den Schlaganfall getrieben hatte. Zum Glück musste sie nicht lange leiden. Ihre Beerdigung hatte ihn in seinem Entschluss gefestigt. Er hatte seitdem die finalen Verkäufe abgeschlossen und die zugehörige eidesstattliche Versicherung abgegeben.
Und morgen würde ihr Familiensitz neue Eigentümer finden. Eine Ära würde mit ihm zu Ende gehen. Hunderte von Angestellten würden arbeitslos sein, einige von ihnen waren seit bald fünfzig Jahren im Betrieb. Es war einer seiner schwersten Gänge gewesen, als er auf einer Betriebsversammlung vor sechs Wochen verkünden musste, dass es keine Zukunft mehr gäbe. Wut, Verzweiflung, Trauer, Mitleid – all das waren Emotionen, die ihm damals entgegenschlugen.
Das Einzige, was ihn beruhigte, war die Tatsache, dass Felicitas und er den Kindern rechtzeitig wertvolle Immobilien überschrieben hatten. Und dank der Herabsetzung der Volljährigkeit auf achtzehn Anfang des Jahres könnten sie selbst darüber verfügen. Da würden weder Testamentsvollstrecker noch Pleitegeier drankommen.
Ein Letztes blieb ihm zu tun. Er zündete sich eine Zigarette an, schritt zur dezent in einem Schrank untergebrachten Hausbar, schenkte sich einen Cognac aus einer Kristallkaraffe ein. Ein paar Mal schwenkte er den bauchigen Kelch, roch daran, wie sich das Aroma ausbreitete, und trank den Inhalt in einem Schluck aus. Er sah sich selbst gespiegelt im Glas einer Vitrine, sein hageres Gesicht, die schütteren, kurzen, ehemals roten Haare, die Ringe unter den Augen und den perfekt sitzenden Anzug, das Einstecktuch und die silberne Krawattennadel. Ein Gentleman durch und durch, dachte er bitter. Er inhalierte Züge, füllte zwischendurch den Cognacschwenker nach und sah auf das Tal hinaus. Als er aufgeraucht hatte, setzte er sich wieder an den Sekretär und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus. Er öffnete ein Geheimfach, leerte das Glas und schoss sich mit dem Revolver durch den Mund ins Hirn. Er war sofort tot.
Ingolstadt, 24. Oktober 2019
»Dieses ewige Gejammer geht mir wirklich auf den Sender«, sagte Fabian Böttcher, als er und seine Kollegen am Donnerstagabend in der dezent abgedunkelten Hotelbar bei Ingolstadt in ausladenden Ledersesseln im Chesterfield-Stil an einem passenden Tisch saßen. Der edle Eindruck verstärkte sich durch die Auslegeware, die an Teppiche in viktorianischen Pubs erinnerte, und eine Schrankwand mit Lederfolianten. Der Teppichflor dämpfte die Lautstärke.
»Genau«, ergänzte Michael und fuhr sich mit der Hand über den Kopf, wie um den Seitenscheitel zu erfühlen. »Erst die Karre in den Dreck fahren und dann nicht den Mut haben, die Kehrtwende einzuleiten.«
»Andererseits sind die Maßnahmen schon hart«, meinte Beatrice von Ödenburg.
»Ach komm, Bea, das Konzept basiert im Wesentlichen auf deinen Empfehlungen. MEK und ich sind hierbei ja nur die Umsetzer«, entgegnete Fabian, dessen schwarze Haare immer ein wenig zu lang und fettig waren, und fläzte sich tiefer in den Sessel.
»Da hast du natürlich recht, aber wenn ich die Schicksale der einzelnen Mitarbeiter so hautnah mitbekomme, wünschte ich, es würde anders funktionieren.«
»Liebe Projektleiterin, dann hättest du vorher was Besseres ausarbeiten müssen, und das hätte mehr Zeit gekostet und ergo mehr Honorar«, sagte Michael. »Ich meine, wir sind es doch nicht, die da den Deckel draufgehalten haben. Das war das Diktat des Insolvenzverwalters und mithin nicht unser Problem.«
»Es geht mir eben zunehmend gegen den Strich, wenn gesunde Unternehmen wegen Fehlentscheidungen Einzelner zerschlagen werden.«
»Das Geschäftsmodell ist nun mal genau für diese Fälle gestrickt«, meinte Fabian. »Deshalb kann ich zwar deine Skrupel nachvollziehen, aber leisten können wir sie uns nun wirklich nicht.« Er sah sie stechend an und nahm einen Schluck aus dem bauchigen Whiskyglas, das einen milden Glenmorangie enthielt. »Außerdem war der Laden nicht so gesund, wie du es darstellst. Also, ich finde, dass wir einen guten Abschluss hinbekommen haben, und der Bonus wird entsprechend sein.«
Sie stießen alle an, Beatrice mit Sekt und Michael mit einem Gin Tonic.
»Ich stimme ja zu, aber wisst ihr, die eine Frau, die da entlassen wird, geht mir nicht aus dem Kopf«, erinnerte sie sich und strich sich eine Strähne ihres dunkelbraunen Haares aus dem Gesicht.
Nachdem der Plan mit dem Insolvenzverwalter finalisiert worden war, drang das Ergebnis weitaus schneller, als es von allen Beteiligten gewollt war, nach draußen. Die Belegschaft der Druckgusswerke Seidelmaier & Sohn hatte sich spontan zu einer Demonstration eingefunden. Und so hatten die drei, als sie den Firmensitz in dem größeren Gewerbepark verließen, Aufmerksamkeit erregt. Bevor sie das Taxi besteigen konnten, waren sie umzingelt und mussten sich üble Beschimpfungen anhören. Presse war auch da, inklusive zwei Kamerateams. Das kannten sie aus ihrem Job. Sie waren die Profis, die Beschäftigungsverhältnisse beendeten. Liquidatoren bedienten sich gerne ihres außergewöhnlichen Portfolios. Sie analysierten die Unternehmen besser und effizienter als träge Juristen, ermittelten die Abteilungen, die zu retten waren, und diejenigen, die nicht dazugehörten. Dass dabei knallharte Renditeerwägungen die primäre Rolle spielten, wussten sie, und es war für sie kein grundlegend moralisches Problem. Aber vor allem Beatrice bekam in letzter Zeit zunehmend Gewissensbisse, wenn Firmen oder Teile davon abgewickelt wurden, weil sie die hohen Erwartungen an Umlaufrenditen nicht erfüllten. Doch diese Bedenken teilte sie nicht mit den beiden, ein paar Jahre jüngeren Kollegen, deren Ignoranz und Härte sie mittlerweile verabscheute. Gleich morgen würde sie sich ernsthaft mit dem Angebot aus dem Gesundheitssektor beschäftigen. Sie musste hier weg. Das war ihr nach dem heutigen Tag klar. Vor allem deshalb, weil sie mit vierzig nicht mehr jeden beliebigen Job bekommen konnte.
Unkonzentriert nahm sie wieder am Gespräch teil, als Michael sagte: »Komm Bea, die Alte mit diesem schrägen Namen, wie war der noch gleich …?«
»Buttweizen«, half Fabian, lachte und sah dabei ein wenig aus wie ein Fuchs.
»Die hat doch wirklich sehr dick aufgetragen«, setzte Michael fort. »Kann ja sein, dass sie zwei Kinder hat und alleinerziehend ist. Aber dann muss sie sich eben arbeitslos melden. Dazu gibt es Vater Staat.«
»Und überhaupt, sie hätte einfach ein bisschen mehr Leistung bringen können«, ergänzte Fabian und strich sich die Haare aus dem Gesicht. »Haben andere Unternehmen der Branche doch auch gebacken bekommen.«
»Das sagt sich so leicht von euch beiden. Ich glaube nicht, dass sie so schnell wieder einen genauso gut dotierten Job mit firmeneigener Kita bekommt. Aus meiner Sicht ist das ein Fall für den gesellschaftlichen Absturz«, hielt sie dagegen.
»Mag sein, Bea, aber ich sage es noch mal, wir haben das nicht zu verantworten«, gab Michael im Brustton der Überzeugung von sich. »Dein Konzept ist gut, die Firmenleitung hat die Fehler verbockt. Sie wird sich bei denen beschweren müssen und nicht bei uns, die den Trümmerhaufen später aufräumen.«
»Jungs, es war ein harter Tag und ich bin müde. Morgen für die Abschlussbesprechung will ich fit sein«, sagte sie nach einigen Augenblicken des Schweigens und verließ die beiden.
»Ich glaube nicht, dass Bea das noch lange macht«, vermutete Fabian.
»Hm, da hast du wahrscheinlich recht. Jammerschade, denn ihre Konzepte sind immer gut gewesen. Wie ist es mit dir? Einen Drink?«
»Danke, nein, ich stimme mit Bea zwar bei Weitem nicht in allen Punkten überein, aber was das Schlafen und Fitsein angeht, da auf jeden Fall«, verabschiedete sich Fabian. »Also gute Nacht, MEK.«
»Interessanter Name«, sagte eine für Michael sympathisch klingende Altstimme hinter ihm aus der Sitzgruppe. Er drehte sich um. Dort saß eine etwa fünfundvierzigjährige, gepflegte, gebräunte Blondine mit offenen, schulterlangen Haaren. Sie trug dezente goldene Ohrringe und eine dazu passende feingliedrige Halskette, die das üppige Dekolleté zur Geltung brachte und seinen Blick anzog. Das dunkelblaue Kleid betonte die frauliche Figur. Entweder hat sie einen dünnen BH an oder keinen, dachte er, denn ihre Brustwarzen zeichneten sich deutlich ab.
»Sie meinen MEK?«, fragte er.
»Ja, ich bin neugierig, wie man auf so etwas kommt. Klingt ja geradezu martialisch.«
»Das ist tatsächlich weniger geheimnisvoll, als Sie eventuell annehmen. Es ist das Kürzel meines eigenen Namens, Michael Eugen Kaplan.«
»Also abgesehen von Michael sind Eugen und Kaplan nun wirklich sehr selten«, sagte sie und wies dabei auf einen freien Sessel neben sich. »Ich bin interessiert, mehr zu erfahren, wenn Sie gestatten.«
»Natürlich«, bot er an. »Darf ich Sie dazu zu einem Getränk einladen? Campari mit Orangensaft?«
»Sie sind offensichtlich ein scharfer Beobachter.«
»Angesichts der Farbe des Drinks, des Angebots der Bar und, ich gebe es zu, Ihres Typs hatte ich darauf getippt«, erklärte Michael.
»Ich bin beeindruckt. Gerne noch einen davon, bitte«, sagte sie mit kokettem Augenaufschlag.
Er bestellte beim Barmann, blieb selbst bei Gin Tonic. Er blickte sich um und stellte fest, dass sie die Einzigen waren. Die Drinks kamen zügig. Er prostete der Dame zu.
»Sie kennen nun meinen Namen, darf ich Ihren ebenfalls erfahren?«, fragte er und beglückwünschte sich innerlich, dass er seinen Ehering nicht trug. Ein Abenteuer könnte diesem harten Tag das i-Tüpfelchen verleihen. Michael war ein Frauentyp, immer schon gewesen. Dafür hatte er viel getan. Auch seit er mit Franziska verheiratet war, leistete er sich weiterhin amouröse Auszeiten. Er verspürte keinen Konflikt dabei. Er war der alleinige Verdiener, und wie er stolz konstatierte, ein erfolgreicher. Knapp zweihunderttausend pro Jahr waren nicht zu verachten. Und seine Steuersparmodelle vergrößerten den finanziellen Spielraum zusätzlich. Sie hatten gemeinsam beschlossen, dass Franzi sich um Gordon und Clarissa kümmern und den Job bei einem anderen Beratungsunternehmen aufgegeben solle. Er fand, er habe sich ab und zu ein Goodie verdient. Und sie musste ja nichts davon erfahren. So hatte er Entspannung und würde harmonisch und ausgeglichen nach Hause kommen und sie hatten ein schönes spießiges Familienwochenende vor sich. Er mochte das. Fast hätte er sich in dem Gedanken verloren.
»Ich heiße Irene und wollte vorschlagen, dass wir uns vielleicht duzen.« Sie blickte ihm tief in die Augen. »Wir sind ja unter uns.«
»Aber sehr gerne«, sagte er und erwiderte den Blick. »Nenn mich bitte Michael, MEK ist mir im privaten Bereich nicht lieb.«
»Was hat dich hierhergeführt, wenn ich so indiskret sein darf?«
»Nachdem unser heutiger Arbeitstag sein Ende in den Abendnachrichten gefunden hat, würde ich sagen, dürfte vielen bekannt sein, was wir hier gerade tun«, sagte er. Er berichtete in kurzen Worten, was seine Aufgabe war, wobei er in der Erzählung die negativen Aspekte, die ihm bewusst waren, zumindest kaschierte und so ein Bild einer zwar harten, aber unvermeidlichen Tätigkeit zeichnete. Er hatte Übung und wurde, so empfand er das, immer besser darin.
»Du bist also eine Art Terminator«, sagte sie lächelnd.
Michael zögerte, denn diese Antwort hatte er nicht erwartet.
»Nein, das auf keinen Fall, schließlich ist es nicht das Ziel, irgendwelche Unternehmen plattzumachen«, widersprach er. Diesmal fühlte es sich nicht so überzeugend an wie sonst bei Schilderungen seines Berufslebens. »Der Job besteht in einer verträglichen Abwicklung für alle Beteiligten. Dass das in solchen existenziellen Krisen nicht immer gut klappt, kannst du dir bestimmt vorstellen, selbst wenn wir unser Bestes geben.«
»Ich wollte dir auch nicht zu nahetreten«, entschuldigte sie sich. »Tatsächlich wirkst du ein wenig verspannt. Sicher wegen der anstrengenden Arbeit.«
»Du hast recht«, sagte er, lehnte sich im Sessel zurück und nippte am Drink. »Solche Termine gehen nicht spurlos an einem vorbei. Ich gönne mir deshalb gerne am Wochenende Saunabesuche und Massagen. Work-Life-Balance eben.«
Sie tat es ihm gleich, und eine Zeit lang schwiegen sie.
»Was hältst du davon, wenn ich dich ein wenig massiere«, schlug sie unvermittelt vor. »Keine Angst, keine Avancen, sondern ein Angebot von einem Profi sozusagen.«
»Das kommt nun sehr unverhofft und gleichzeitig willkommen. Du sagtest Profi?«
»Ja, ich habe zunächst Physiotherapie gelernt, bin aber da schon lange nicht mehr tätig. Doch einmal erworbene Fähigkeiten in dem Bereich gehen ja nicht spurlos verloren. Daher besteht wenig Risiko, dass du danach noch verspannter bist.«
»Da sage ich gerne ja. Wo sollen wir uns treffen?«
»Wie wäre es auf deinem Zimmer? Ich hole nur schnell etwas Massageöl und komm dann zu dir, falls du mir die Nummer sagst«, sagte Irene, und wieder durchdrang ihn dieser Blick aus den grünen Augen.
»907«, antwortete er. »Wenn es erlaubt ist, bezahle ich die Drinks.«
»Nehme ich gerne an, bis gleich.« Sie verschwand in Richtung der westlichen Aufzüge, während er einen der östlichen wählte. Im Zimmer angekommen, prüfte er kurz sein Äußeres, kämmte sich, und sah nach, ob er Kondome in dem Geheimfach im Koffer hatte. Er hatte sich dies speziell anfertigen lassen, damit seine Frau nicht zufällig auf diese verdächtigen Dinger stieß, was zu lästigen Fragen führen würde. Für den Fall der Fälle, dachte er sich. In dem Moment klopfte es.
»Du bist ja wirklich fix«, sagte Michael, als er Irene hereinließ. Sie hatte ein Handtäschchen dabei.
»Zielorientiert, denn Verspannungen sollten möglichst schnell gelöst werden, bevor sie sich zu stark verhärten«, erklärte sie – und da war wieder dieser Blick.
»Ähm, ja, klar …« Er hasste es, wenn er die Selbstdisziplin einbüßte, doch es nützte nichts. Diese Frau sah durch seine aufgesetzte Beraterfassade hindurch. Sie lachte kurz auf. »Wie sollen wir, also ich meine, wie soll …?«
»Sei bitte nicht so schüchtern«, sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln. »Ich würde vorschlagen, du ziehst dich aus, natürlich nur bis auf die Unterhose, legst dich mit dem Bauch auf das Bett, und dann beginne ich, einverstanden?«
»Gut, ich lege mich hin.« Ihm war bewusst, dass er nur die Verlegenheit kaschierte, und die Wörter sprudelten ohne einen Sinnzusammenhang aus ihm heraus. Er fühlte das Blut aufsteigen und wusste, dass er errötete. Auch das noch, du cooler Berater, schalt er sich innerlich, das passiert doch sonst nicht. »Genau. Ich bin nur etwas unsicher, da ich bisher keine Privatmassage bekommen habe. Also, schon, aber eben nicht in einem Hotel. Sozusagen von einer Fremden. Womit ich natürlich nicht fremd im Sinne von …«
»Lieber Michael, kein Grund sich zu schämen«, sagte Irene, lachte, öffnete das Täschchen und entnahm ihm eine handliche Flasche mit Massageöl. »Leg dich einfach hin und genieße!«
Er zog sich bis auf die Unterhose aus und legte sich aufs Bett. Schon bei den ersten geübten Griffen stellte sich die Entspannung ein, wozu der Duft des Öls aus exotischen Aromen ein Übriges tat. Sie ist gut. Er genoss die Finger, die die Knoten am Halsansatz lösten und dann seinen Rücken durchkneteten. Er merkte, wie sie absetzte und sich nach einer kurzen Pause rittlings auf ihn setzte, um mit den Ellenbogen noch mal an den Schultern verstärkte Berührungen durchzuführen. Es tat ein wenig weh, war aber auszuhalten, fand Michael. Außerdem wollte er auf keinen Fall durch eine unbedachte Aktion diese intime Atmosphäre zerstören. Irene wechselte die Position und rutschte weiter herunter, sodass sie auf seinen Oberschenkeln zu sitzen kam. Sie bearbeitete den Lendenbereich der Wirbelsäule. Dann beugte sie sich vor, so schien es ihm, denn er spürte ihre Haare auf der Haut.
»Ich hätte übrigens jetzt auch Lust auf mehr«, flüsterte es in seinem Ohr.
»Da würde ich gerne behilflich sein«, sagte Michael, der den Kopf zur Seite gedreht hatte. »Wie wäre es, wenn ich dich zunächst ein wenig massiere? Sicher nicht so geübt, aber versuchen kann ich es ja.«
»Ich könnte mir auch vorstellen, dass du mich leckst, meine Möse ist schon ganz feucht«, wisperte sie und rollte von ihm herunter auf die rechte Seite des breiten Doppelbetts.
Michael richtete sich auf und sah, dass sie komplett nackt war. Sie musste sich unbemerkt während der Massage des Kleides entledigt haben. Er kniete sich zwischen ihre gespreizten Beine, der Schwanz war steil aufgerichtet, die Eichel ragte keck aus dem Gummi der Unterwäsche. Sie strich sich aufreizend über ihre Brüste und ihre steifen Nippel, die spitz und hart waren. Definitiv kein BH, schoss es ihm durch den Kopf. Er streifte die Boxershorts ab, und der befreite Penis schnellte hervor. Michael beugte sich zu Irene und roch den betäubenden Duft, der ihrer Vagina entströmte. Sie war komplett rasiert, die Bräune setzte sich nahtlos fort. Er liebte das, denn seine Frau mied FKK-Bereiche und öffentliche Saunen. So hatte sie im letzten Urlaub in Frankreich immer mindestens einen Bikini angehabt. Und wenn er gerne den Nacktbadestrand aufgesucht hätte, als die Kinder in der Klubanlage betreut wurden, und sie alleine waren, hatte sie sich geweigert. Deshalb hatte sie keine Ganzkörperbräune. Michael glaubte, dass Frauen, die Nacktheit schätzten, lustvoller waren, zumindest heutzutage. Franziska wäre nicht auf die Idee gekommen, sich so lasziv zu präsentieren.
Er nahm die Einladung an und tauchte ein in die ausströmende Nässe. Der Geschmack war, das wusste er aus diversen amourösen Abenteuern, individuell und unverwechselbar, manchmal stimulierend, und manchmal, ja auch das war ihm schon vorgekommen, abstoßend. Dieser hier erfüllte den Raum und heizte Michaels Lust weiter an. Ja, dachte er, du, Irene, gehörst zu den Geilsten, die ich bisher hatte. Routiniert leckte er sie. Er fand die richtigen Stellen, seine Finger assistierten zusätzlich, indem er den G-Punkt stimulierte und ihre Erregung damit befeuerte. Sie quittierte das mit einem unaufhörlichen Nässefluss. Immer wieder gut, dass ich so ausgiebig üben konnte, erinnerte er sich an zahlreiche One-Night-Stands und seine erste Lehrmeisterin im Sex, Ella, zurück.
Irene richtete sich auf, sodass sie zusehen konnte, wie er sie leckte. Er drückte ihre Klitorisspitze so weit nach oben, dass sie seine Zunge bei ihrem Spiel verfolgen konnte. Das machte sie noch geiler.
»O bitte, Michael, fick mich jetzt«, flehte sie.
Er war erstaunt wegen der derben Sprache, denn so etwas hatte er schon lange nicht mehr gehört. Aber es triggerte ihn, genau wie damals mit Ella. »Ich will den dicken Prügel tief in meiner Fotze haben.«
»Dein Wunsch ist mir Befehl. Bin gleich wieder da, und dann stopf ich dir die nasse Möse«, sagte er, stand auf, ging ins Bad, nahm eines der bereitgelegten Kondome und streifte es sich geübt über. Irene kniete inzwischen mittig auf dem Bett, die Beine gespreizt, den Rücken durchgebogen, eine Hand bewegte sie zwischen den Schamlippen. Sie weiß, wie es geht, dachte er, während der steife Penis synchron mit dem Herzschlag pulsierte. Michael platzierte sich hinter sie. Die Vagina war so geweitet, dass er mühelos eindrang. Kräftig fickte er sie, und sie fingerte sich dabei weiter. Im Spiegel einer Schranktür verfolgte er seine Bewegungen. Er sah, wie bei jedem Stoß Irenes Brüste hin- und herschwangen. Das verstärkte seine Geilheit extrem. Das war schon damals so gewesen, als er einen solchen Anblick das erste Mal bei Ellas mächtigen Titten genossen hatte. Seitdem nahm er mit Vorliebe Frauen von hinten, um das zu erleben. Und in Hotelzimmern war fast immer ein Spiegel an der richtigen Stelle. Er spürte, dass er bald spritzen würde. Das wollte er genießen. Sie schien bereit zu sein, aber das war ihm egal. Er musste jetzt Befriedigung haben und intensivierte die Bewegungen.
Ja, die Kontraktionen im Unterleib signalisierten ihm, dass es so weit war. Sie hatte es ebenfalls bemerkt und drängte sich gegen sein Becken, wie um den Schwanz tiefer in sich zu haben. Aus Michael schoss es heraus. Wäre nicht das Kondom, würde das Sperma aus ihrer Möse tropfen, dachte er stolz auf seine Manneskraft, während der Körper den Saft pumpte und er Irene stieß.
Sie erreichte, die Klitoris zusätzlich reizend, den Höhepunkt, kurz nachdem seine Ejakulation einsetzte, und genoss ihn wohlig stöhnend.
Als Michael merkte, dass der Schwanz erschlaffte, zog er ihn heraus, entfernte das Kondom und brachte es ins Bad, wo er es in den Mülleimer entsorgte.
»Unerwartet brachial, mein Lieber, so mag ich es«, sagte sie, denn sie war ihm gefolgt.
»Bei einer so verführerischen Einladung kein Wunder.« Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich würde jetzt duschen, und wenn du möchtest, nehmen wir noch einen Drink. Was meinst du?«
»An jedem anderen Abend liebend gerne, nur ich muss morgen ganz früh raus, weshalb ich es großartig finden würde, wenn ich vor dir duschen könnte.«
»Aber selbstverständlich«, sagte er und verließ das Bad. Aus der Minibar nahm er die Zutaten für einen Gin Tonic, mixte sich den Drink und legte sich aufs Bett.
Kurze Zeit später kam Irene aus dem Bad. Sie hatte das Kleid an und trug die Handtasche.
»Also, mein lieber Michael, es war mir ein Vergnügen, und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja irgendwann wieder.«
Ihm gefiel, dass sie nicht nach einer Telefonnummer oder anderen Kontaktdaten fragte. Das empfand er als professionell, wobei ihm der Begriff in dem Zusammenhang komisch vorkam.
»Liebe Irene, das Vergnügen war ganz auf meiner Seite«, sagte er und stand nackt vom Bett auf. »Ich kann mich dem nur anschließen, dass ich es, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gerne wiederholen würde.«
Wortlos gab sie ihm einen Kuss auf den Mund. Er öffnete ihr die Tür und dann war sie verschwunden.
Er nahm den Gin Tonic, schaltete den Fernseher ein und sah sich die Spätnachrichten an.
Bernburg 15. Januar 1999
Es war einer dieser beschissenen Freitage. Die ersten beiden Stunden Sport. Schon wieder Handball. Er hasste das genauso wie Fußball. Wenigstens gab es nicht mehr dieses Auswählen vor dem Spiel. Das war nach der Wende abgeschafft worden, gegen den Widerstand von Herrn Kracht, dem ältesten Sportlehrer. Für den war das neue System ein Hort der Verweichlichung, und innerhalb seines Unterrichts peitschte er die Schüler zu den Leistungen, die sie, so seine feste Überzeugung, zu erbringen hatten. Und heute eben mit Handball. Auch noch eine Doppelstunde.
Fabian schleppte sich lustlos in die Sporthalle, machte fahrig die Aufwärmübungen mit. Seit er in der Pubertät war, hatte er Schwierigkeiten, morgens um acht fit zu sein, geschweige denn, Sport zu machen. Es war schon mühsam genug, den Schulweg mit dem Rad aus dem Kaff, in dem er bei Tante und Onkel lebte, zurückzulegen. Die fünf Kilometer bis nach Bernburg kamen ihm wie eine Weltreise vor. Jetzt im Winter war es in der Frühe dunkel, und es nieselte zusätzlich. Die Haare waren komplett nass und er fror, weil er seine Mütze vergessen hatte – wieder einmal. In letzter Zeit war er immer unkonzentriert. Zum Glück hatte es heute nicht geschneit wie gestern. Er hätte am Abend nicht so lange an dem alten Fernseher basteln sollen. Andererseits hatte er seinem Onkel versprochen, das Gerät zu reparieren.
Er brauchte eine halbe Stunde für den Schulweg, kam deshalb ein paar Minuten zu spät und holte sich erst mal einen Anschiss von Kracht. Dieses verdammte Aufwärmtraining. Er bekam Seitenstiche, wie immer. Es wurde gespielt. Fabian war nicht geschickt, und schon wurde er bei einem Fehlwurf aufs Tor mitten im Gesicht von einem Ball getroffen. Es knirschte, und ein irrsinniger Schmerz durchzuckte seinen Kopf, dann wurde ihm schwarz vor Augen und er kippte um.
Als er wieder aufwachte, lag er auf einer Trage und wurde in einen Krankenwagen geschoben. Die Türen wurden geschlossen, das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Er stöhnte und wollte die Nase befühlen. Da war ein Verband.
»Sie ist gebrochen, Junge«, sagte der Rettungsassistent, der neben ihm saß und aufpasste. Fabian bemerkte ihn erst jetzt. »Wir fahren dich vorsichtshalber ins Krankenhaus, damit die nachsehen können, ob das alles ist. Am besten bleibst du ruhig liegen, wir sind bald da.«
»Meine Tante …«, fing er an.
»Die weiß schon Bescheid. Sie ist auf dem Weg. Mach dir keine Sorgen.«
Den Rest der Fahrt dämmerte Fabian vor sich hin und bekam kaum mit, als sie ihn in die Notaufnahme brachten. Nach etlichen Untersuchungen und einem MRT wurde er in ein Krankenzimmer gebracht und erhielt Beruhigungsmittel.
Es musste später Nachmittag oder Abend sein, als er aufwachte. Seine Tante stand am Bett und blickte ihn sorgenvoll an. Neben ihm saß ein Arzt auf der Bettkante und fühlte den Puls.
»Wie geht es dir?«, fragte er.
»Ich weiß nicht, irgendwie schummrig und schwindelig.« Er stellte fest, dass er lallte. Um den Kopf war ein Verband geschlungen. »Was ist denn los?«
»Du hast leider einen Schädelbruch erlitten, vermutlich, als du auf dem Boden aufgeschlagen bist, und deine Nase ist gebrochen. Wir werden das operieren müssen. Ich werde dir erklären, wie wir das anstellen, okay?«, sagte der Arzt.
Fabian nickte mühsam.
»Also, wir müssen dafür sorgen, dass keine Knochenfragmente ins Hirn gelangen. Nach der Auswertung des MRTs gibt es zwei kritische Stellen, die wir überprüfen werden. Außerdem werden wir deine Nase dann gleich richten. Morgen früh bist du als Erster dran. Ich werde dich selbst operieren. Aber keine Angst, das ist ein Routineeingriff und es besteht kaum Risiko. Hast du noch Fragen?«
»Wann komme ich wieder raus?«
»Falls es gut geht, wovon ich ausgehe, kannst du spätestens in einer Woche das Krankenhaus verlassen«, sagte der Chirurg und lächelte den Jungen an. »Den Verband wirst du noch länger brauchen. Und deine Haare wachsen natürlich auch nicht so schnell wieder nach. Gut, wenn alles klar ist, dann sehen wir uns morgen. Bis dahin versuch einfach, ein wenig zu schlafen.«
Fabian nickte und döste weg.
Später, als er erwachte, war es draußen dunkel, und seine Tante saß auf einem Stuhl neben dem Bett.
»Wie geht es dir?«, fragte sie besorgt.
»Immer noch ziemlich schlapp, aber ich habe keine Schmerzen oder so. Gibt es hier was zu trinken?«
»Ich schenk dir was ein.« Sie öffnete eine Flasche Mineralwasser, goss davon in ein Glas ein und reichte es Fabian.
»Danke«, nuschelte er leise und trank in kleinen Schlucken.
»Ich hole dir jetzt deine Sachen, damit du Zähne putzen kannst und was anzuziehen hast«, sagte sie. »Brauchst du noch was von zu Hause?«
»Den Gameboy und die Bauanleitung, die auf meinem Schreibtisch liegt, bitte. Und bloß keine Schulsachen.«
Sie gab ihm einen Kuss, den er widerwillig über sich ergehen ließ, und dann ging sie.
Fabian sah sich im Zimmer um. Unter einem Fernseher, der an der gegenüberliegenden Wand angeschraubt war, stand ein Tisch, daran zwei Stühle. Ein Fenster rechts von ihm ermöglichte den Blick in den Krankenhausgarten. Die Ausgangstür konnte er nicht sehen, denn der kurze Flur dorthin versperrte ihm die Sicht. Er nahm an, dass dort Dusche und WC waren. Einbauschränke befanden sich neben dem anderen Bett im Raum. Und darin lag ein Junge, etwa in seinem Alter.
»Na, bist du runter von den Drogen?«, fragte der. Er hatte lange, glatte, schwarze Haare, ein mädchenhaftes Gesicht, und die Tonlage war, obwohl er den Stimmbruch hinter sich hatte, fast die eines Mädchens. Trotzdem wusste Fabian instinktiv, dass es sich um einen Jungen handelte. Woran er das festgemacht hatte, darüber wunderte er sich später immer wieder, aber er kam nicht dahinter. Wahrscheinlich war es vollkommen banal. In Krankenhäusern waren Männer und Frauen getrennt untergebracht, nur war ihm nicht bewusst, dass er in dem Moment daran gedacht hatte.
»Ähm, wie meinst du das?«, wollte er verwirrt wissen.
»Ob die Beruhigungsmittel in der Wirkung nachlassen, meinte ich.«
»Ja, ich denke schon. Im Kopf bin ich so weit klar, nur ein bisschen Schmerzen habe ich noch.«
»Das ist doch super. Dann können wir uns ja ein wenig unterhalten. Ist nämlich echt langweilig hier. Ich bin übrigens Geraldine. Und bevor du fragst, ja, das ist ein Mädchenname. Und wie heißt du?«
»Fabian.«
»Das ist doch ein Anfang. Und warum du hier bist, habe ich ja mitbekommen. Wie ist denn das passiert?«
»Wenn ich das so genau wüsste. Mir hat im Sportunterricht jemand einen Ball an den Kopf geworfen, und dann war ich auch schon weg.«
»Lass mich raten, das ist nicht dein Lieblingsfach, oder?«, fragte Geraldine.
»Ich hasse es vollkommen. Der Sportlehrer ist so ein alter DDR-Typ. Kasernenhofton.«
»Ja, ja, diese Arschlöcher kenne ich zur Genüge. Die Schulen sind ja immer noch gut mit solchen Leuten versorgt. Bei uns gab es davon auch zwei Exemplare. Zum Glück haben die mich weitgehend in Ruhe gelassen«, stellte sie fest.
»Vermutlich, weil du sportlich bist. Dann ist es einfach, aber wenn du daran nun mal kein Interesse hast, bist du echt aufgeschmissen«, sagte Fabian resigniert.
»Stimmt, ich bin ziemlich sportlich. Der Hauptgrund war aber, dass ich mir, seit ich achtzehn bin, nicht mehr alles habe gefallen lassen. Außerdem hatten die konservativen Lehrer vor mir Respekt, Angst oder fühlten sich hilflos oder unsicher. Sehr praktisch.« Geraldine lächelte, und er dachte wieder, ein attraktives Mädchen vor sich zu haben.
»Auf mich wirkst du nicht furchteinflößend. Und hilflos fühle ich mich auch nicht dir gegenüber.«
»Du bist ja auch nicht erwachsen und im Weltbild festgefahren. Das hat Vorteile, weil du dir noch nicht so viele Vorurteile und Begrenzungen deiner eigenen Meinung andressiert hast.«
»Was meinst du denn mit andressiert?«
Geraldine setzte sich auf. Sie war schlank, soweit er sehen konnte, trug ein enges schwarzes Muskel-Shirt und …
Fabian sog die Luft scharf ein.
»Siehst du, das meine ich damit«, erklärte sie. »Du staunst, aber du greifst mich nicht sofort verbal oder körperlich an. Und ja, das ist ein Busen. Zugegeben, er ist klein, Größe A. Wenn ich Glück habe, wird es vielleicht B, nur wäre das schon fast ein Sechser im Lotto. Und bevor du vor Neugier platzt. Ich bin transsexuell, also ein Mädchen in einem männlichen Körper.«
Fabian wollte sich keine weitere Blöße geben, was ihm leichtfiel, weil die Kopfschmerzen sich zurückmeldeten, sodass er sich unwillkürlich an die Stelle mit dem Verband griff. Er stöhnte auf.
»Oh, du hast Schmerzen. Ich rufe die Schwester, okay?«
»Nein, nicht nötig«, sagte er dankbar. »Noch geht es. Danke dafür. Wie hast du denn festgestellt, dass du eigentlich ein Mädchen bist?«
»Interessant, so wie du die Frage stellst, passiert es selten.« Geraldine lächelte.
»Wieso? Was ist denn daran so besonders?«
»Ganz einfach, du willst nicht wissen, ob das eine Krankheit ist, ob man was dagegen machen kann oder ob so was heilbar ist. Das aber ist das, was die Leute in den meisten Fällen fragen, wenn es um mich geht. Du hast stattdessen völlig selbstverständlich hingenommen, dass ich ein Mädchen bin. Und das ist selten.«
»Ich habe mir gar nichts weiter dabei gedacht«, sagte Fabian. »Ich wollte es nur wissen.«
»Und das ist eben ungewöhnlich. Ich gebe dir die Kurzform, denn natürlich könnte ich endlos darüber reden. Die meisten transsexuellen Kinder kann man sehr früh erkennen. Mädchen und Jungs sind verschieden im Verhalten, und das schon lange, bevor sie in die Pubertät kommen. Ich habe mir zum Beispiel früh Kleider angezogen, musste unbedingt Mädchenschuhe haben und lange Haare mit geflochtenen Zöpfen. Überhaupt war ich ein richtiges Klischee. Sozusagen die mustergültige Tochter. Pech nur, dass ich im falschen Körper war.«
»Wie haben denn deine Eltern reagiert?«, wollte Fabian wissen.
»Erst haben sie gedacht, ihr Kind hat ’ne Macke. Aber nachdem ich nicht aufgehört habe, Mädchen zu sein, haben sie den Hausarzt gefragt. Zum Glück war der schon recht modern aufgestellt. Er hat ihnen erklärt, dass das keine Krankheit ist und das so was zwar selten auftritt, aber häufig genug, dass es Erfahrungen im Umgang damit gibt. Für meine Eltern war es anfangs eine schwere Zeit, wie sie mir später erzählt haben. Aber sie haben es schließlich hingenommen, und irgendwann war es für uns normal. Sie sind dann auch offensiv damit umgegangen. Ziemlich ungewöhnlich eigentlich, wenn man deren DDR-Vergangenheit berücksichtigt. Sie haben sich jede Menge Wissen darüber raufgeschafft, und seitdem haben wir ein richtig gutes Verhältnis miteinander. Ich bin dann in psychologischer Betreuung gewesen …«
»Und warum? Ich meine, wenn man nichts dagegen machen muss, was hat das dann für einen Sinn?«, unterbrach Fabian.
»Du stellst die richtigen Fragen. Es ging gar nicht darum, mich zu behandeln, sondern zu beweisen, dass ich transsexuell bin. Dazu braucht man ein Gutachten vom Seelendoktor. Und das benötigten wir, also meine Eltern als Erziehungsberechtigte, damit ich eine Hormonbehandlung machen durfte.«
»Und wozu ist die?«
»Jetzt bin ich überrascht. Aber du kannst ja nicht alles wissen. Ich sag mal Busen.«
Fabian errötete, was Geraldine zum Grinsen brachte. »Und du müsstest merken, dass meine Stimme nicht so tief ist wie bei einem Jungen. Gibt noch ein paar Merkmale mehr, um die es geht, und dabei helfen weibliche Hormone. Denn du erinnerst dich, ich bin ja ein Mädchen im falschen Körper. Aber den kann man medizinisch anpassen.«
»Und deshalb bist du im Krankenhaus?«, fragte er.
»Nein, noch nicht. Ich habe mir beim LARP letztes Wochenende einen Fuß gebrochen«, sagte sie und schob die Bettdecke beiseite. Fabian sah, dass ihr rechter Fuß bis über den Knöchel eingegipst war. »Das musste operiert werden. Ich bin aktuell noch zur Beobachtung hier, komme aber wahrscheinlich morgen oder übermorgen raus.«
»Was ist denn LARP?«, wollte er wissen.
»Ist nicht sehr bekannt und hier bei uns noch ziemlich neu. Ist eine Abkürzung für Live Action Role Play.«
»Damit kann ich aber auch wenig anfangen.«
Geraldine lachte, und das klang wie bei einem Mädchen. »Das habe ich mir gedacht. Vielleicht kennst du Spiele wie Dungeons and Dragons?«
Fabian antwortet: »Ja, das habe ich schon mal gespielt. Aber die Spielrunde ist nicht lange zusammengeblieben. Ich fand das schade. Mir hat es Spaß gemacht.«
»Das verstehe ich. Wir hatten eine Gruppe, die aber vor zwei Jahren auseinandergegangen ist. Oberstufenstress. Na ja, du kannst es dir bestimmt vorstellen. Du bist doch wahrscheinlich auch kurz vorm Abi, oder?«
»Ja, jetzt im Frühjahr ist es so weit«, sagte Fabian.
»Na, dann kannst du das ja verstehen. Jedenfalls hatte da kaum jemand Zeit und Lust, was in der Richtung zu unternehmen. Da ich gut war in der Schule, ist es mir leichtgefallen und ich musste nicht dauernd lernen. Und da passte es gut, dass ein ehemaliger Mitspieler, der schon etwas älter war, mich gefragt hat, ob ich Bock auf LARP hätte. Ich hatte davon schon gehört, aber nicht teilgenommen. Mit dem bin ich dann auf meine erste Con gegangen.«
»Con? Etwa so was wie Convention?«, fragte Fabian zögerlich, denn ihm war seine Unwissenheit in ihrer Gegenwart unangenehm. Er gestand sich ein, dass er sie attraktiv fand. Und es fiel ihm leicht, sie als Frau zu sehen. Sie war das erste Mädchen, zu dem er sich hingezogen fühlte. Natürlich hatte er, genau wie andere Jungs in seinem Alter, feuchte Träume. Wenn er zum Beispiel an Veronika mit ihrer Traumfigur und den langen schwarzen Haaren dachte, dann wurde der Schwanz sofort hart. Das Gleiche passierte bei Peggy, deren gigantischer Busen auf ihn denselben Effekt hatte. Manchmal verschwand er in einer der Pausen aufs Klo und onanierte dort. Als er einmal fast erwischt wurde, weil er die Klotür nicht richtig abgeschlossen hatte, verlegte er diese Aktionen nach zu Hause.
Geraldines hinreißendes Lachen riss ihn aus dem Tagtraum. »Gut, Fabian, du machst Fortschritte. Genau, das ist die gängige Abkürzung, die sich eingebürgert hat. Möchtest du noch ein bisschen was davon hören?«
»Sehr gerne«, sagte er. Sie hätte ihm genauso gut etwas über die Herstellung von Reißzwecken erzählen können – er wäre ebenso begeistert gewesen. Seine wasserblauen Augen strahlten dabei.
»Es geht darum, Abenteuer zu erleben, nur eben live. Mit allem, was dazu gehört, ob nun Kleidung, Umgebung, Waffen. Ich war bisher bei Cons, die sich an Spiele wie Dungeons and Dragons anlehnen, also Szenarien ein bisschen wie bei mittelalterlicher Fantasy. Das Letzte drehte sich um die Befreiung eines Prinzen. Ging über zwei Tage im Südharz-Gebiet. War echt anspruchsvoll mit einer Flussquerung per Seilbrücke, die wir bauen mussten, mit Kämpfen gegen Räuber, Übernachtung im Wald mit Feuerbohren und schließlich den Angriff auf die Burg, wo der Gefangene saß. Und das Wetter jetzt im Winter ist auch eine Herausforderung. Aber wir sind da eher hardcore. Leider bin ich bei einer Kletterpartie in der Nähe von Harkerode kurz vor dem Ende unvorsichtig gewesen, und da ist es dann passiert. War natürlich blöd für meine Gruppe und endpeinlich für mich als Waldläuferin. Ich meine, ausgerechnet die, die am besten klettern können sollte, versagt. Ich habe aber schon Nachricht bekommen, dass sie es auch zu fünft geschafft haben. Was echt Mist ist, dass ich bei der nächsten Con wahrscheinlich nicht dabei sein kann. Die ist in vier Wochen, und der Doktor meinte, dass das Bein bis dahin noch nicht wieder fit ist für solche Belastungen.«
»Krass. Das ist echt beeindruckend«, stellte Fabian bewundernd fest.
»Dass ich mir den Fuß gebrochen habe?«, fragte Geraldine, lachte aber und zwinkerte ihm zu.
»Nein, natürlich nicht«, erwiderte er ernsthaft und ein wenig gekränkt.
»Ach komm, so einen kleinen Spaß verstehst du doch, oder? Man sollte das Leben nicht zu ernst nehmen, ist meine Devise. Es ist eben passiert. Nächstes Mal pass ich garantiert besser auf.«
»Und du spielst eine Waldläuferin. Das kenne ich noch aus Dungeons and Dragons. Ist der Charakter bei LARP genauso?«
»Ja, ganz ähnlich. Wichtiger Unterschied allerdings ist, dass du bei den Cons nicht würfelst, sondern du musst das wirklich können, also jedenfalls in denen, in denen ich mitspiele.«
»Was heißt denn das genau?«, fragte Fabian. »Ich meine, einen Magier kann es ja nicht geben, oder? Und mit echten Waffen könnt ihr wohl auch nicht kämpfen.«
»Das stimmt«, erläuterte Geraldine, »deshalb benutzen wir Hilfsmittel. Wenn zum Beispiel ein Feuerball eingesetzt wird, dann ist das eben ein Schaumstoffball. Und die Wirkung, die der anrichtet, hängt davon, wie und wo der trifft. Aber das geht jetzt schon sehr ins Detail. Was die Waffen angeht, so sind die aus Glasfaser und Schaumstoff. Dazu kommen noch ein bisschen Latex und Farbe. Wenn du es genau wissen willst, da gibt es ein paar Seiten im Internet. Da kannst du dir das ansehen. Ist nur ziemlich langsam mit ISDN oder Modem.«
»Ja, das ist bei uns auch so. Aber danke für den Tipp. Wenn ich rauskomme, seh ich mir das gerne an. Ich wollte noch mal nachfragen wegen der Waldläuferin. Die ist doch nicht magisch, oder? Was musst du denn können?«
»Spuren lesen, Pflanzen erkennen, klettern, Seiltechnik, aber ohne moderne Hilfsmittel, Feuer machen, handwerkliche Tätigkeiten wie Knüpfen, Spleißen, Knoten binden … nur als Beispiele«, sagte sie und der Stolz darauf war unübersehbar. »Je mehr Fähigkeiten ich beherrsche, desto erfolgreicher sind die Gruppen, mit denen ich in den Cons unterwegs bin. Wir sind inzwischen schon ziemlich gut geworden.«
»Wahnsinn, wann lernst du das alles?«, fragte er.
»Praktisch immer. Nimm zum Beispiel Pflanzenkenntnis. Bevor ich jogge, sehe ich mir ein paar Pflanzen im Botanik-Buch an, die ich nicht kenne, und versuche, die dann beim Laufen zu finden. Neulich hatte ich mir Zahntrost und Frauenmantel als Aufgabe gestellt, da mir die Namen gut gefallen haben und sie Heilwirkung haben. Die können natürlich hilfreich sein bei Cons, wenn jemand verletzt ist. Dazu musste ich mir aber anlesen, wo die überhaupt vorkommen. Deshalb bin ich die Saale Richtung Gröna entlanggelaufen. Da gibt es feuchte Wälder und Wiesen und es hat geklappt.«
»Da musst du aber echt totaler Fan sein, wenn du so was machst«, meinte Fabian.
»Ja, das bin ich schon. Es macht mir Freude, und einiges davon kann mir vielleicht später im Beruf nützlich sein.«
»Was willst du denn machen?«
»Ab dem Wintersemester will ich Informatik studieren und später in die Spieleentwicklung gehen.«
»So genau weißt du schon, was du werden willst?«, meinte Fabian trübsinnig. »Ich habe selbst noch gar keine Ahnung, was ich will, außer wahrscheinlich irgendwas mit Computern oder Elektrotechnik. LARP würde ich aber gerne mal ausprobieren.«
»Hey, Kopf hoch. Das mit dem Job wird sich finden. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn wir beide hier raus sind, nehme ich dich mal mit zu einer Con. Und dann können wir ja sehen, ob dir das gefällt. Was meinst du? Und das mit der Elektrotechnik musst du mir dann mal genauer erzählen.«
Er war sprachlos und brachte kein Wort heraus. Die Gedanken und Bilder, von denen einige explizite Fantasien waren, wie er Sex mit Geraldine hatte, rotierten. Er merkte, dass er rot anlief.
»Das muss dir doch nicht peinlich sein«, sagte sie und lachte auf ihre zugleich spöttische und herzliche Art. »Also, wie würdest du das finden?«
»Ehrlich gesagt, total geil, jedenfalls das mit LARP«, brachte er heraus. »Elektrotechnik ist so ein Hobby von mir. Kaputte Sachen wieder zum Laufen bringen und so. Leider bin ich sportlich überhaupt nicht fit. Bestimmt kann ich mit euch anderen nicht mithalten.«
»Du bist wohl eher so ein Stubenhocker«, meinte sie und deutete auf seine linke Hand, an der am kleinen Finger ein Teil der Kuppe fehlte. »Ein richtiger Nerd. Und anscheinend nicht immer vorsichtig dabei.«
»Ach, das mit der Verletzung ist nicht beim Sport passiert, sondern im Kindergarten. Eingequetscht in der Tür. Tja, so was passiert eben.«
»Oh, das ist ja bitter«, sagte sie bedauernd.
»Ach, halb so wild, ich merke davon nichts. Und ja, ich denke schon, dass ich ein bisschen was von einem Nerd habe. Aber mir macht es Spaß.«
»Ach komm, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich meine, die LARP-Szene wimmelt von Nerds, da wärst du richtig gut aufgehoben. Weiß du, wir lassen es langsam angehen. Und wenn du Spaß dran hast, können wir ja später an deiner Fitness arbeiten.«
Plötzlich durchfuhr Fabian ein stechender Schmerz am Kopf, weshalb er zusammenzuckte und stöhnte.
»Ich rufe die Schwester, keine Widerrede«, wies Geraldine ihn an und drückte den Rufknopf.
Duisburg, Sommerhalbjahr 1999
Michael war ein Nachkomme der sogenannten Ruhrpolen. Diese Einwanderer, die in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wegen des Bedarfs an Bergarbeitern in den Zechen des Ruhrgebiets Arbeit fanden, brachten ihre eigenen Sitten, Gebräuche und Religion mit. Auch wenn sich im Laufe der Zeit aufgrund der Entwicklungen im Dritten Reich die polnische Sprache und typische volkstümliche Bräuche verloren hatten, blieb der Katholizismus erhalten. In der Familie war Frömmigkeit eine tragende Säule. Vor allem die weiblichen Mitglieder waren glühende Anhänger der Kirche. Das wurde 1978 verstärkt, als mit Karol Wojtyła, der sich Johannes Paul II nannte, ein Pole Papst wurde. Michaels Kindheit war geprägt von Kirchenbesuchen und der Teilnahme an religiösen Festen und Gruppen. Mit Kommunion inklusive Unterricht, kirchlichen Freizeiten, der Tätigkeit als Messdiener, der Firmung und Familienfeiern zu Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen war ein Großteil des Lebens ausgefüllt. Und dann der Sport in einem christlichen Verein. Er wäre unehrlich zu sich selbst, wenn er sich nicht eingestehen würde, dass ihm das gefallen hatte. Er liebte es, sich komplett auszupowern, und bekam Zugang zu vielen verschiedenen Sportarten. Ihm gefiel, dass er kräftig wurde. Sein Vater, ein ambitionierter und voll ausgestatteter Hobby-Fotograf, lieferte die Bilder dazu. Manchmal ging es Michael auf die Nerven, dass er ihm begeistert die Fotoalben zeigte oder es Diaabende mit den Nachbarn gab. Andererseits mochte er die Fotos, die belegten, dass er im Sport erfolgreich war.
Erst die Zeit auf dem katholischen Jungen-Gymnasium ließ in ihm Zweifel an den Heilsversprechen und der Unfehlbarkeit der Kirche aufkeimen. Es kamen Gerüchte auf, dass es zu einem Übergriff eines Lehrers, Vater Samuel Pauls, auf einen Mitschüler gekommen sei. Da er kein Klassenkamerad von ihm war, kannte Michael ihn nur flüchtig vom Sehen, mehr nicht. Eifrig wurde vonseiten der Schulleitung und des Trägervereins erklärt, dass nichts dran sei an den Vorwürfen. Das seien böswillige Unterstellungen. Kurz darauf verließ der Junge die Schule. Es wurde gemunkelt, dass das nicht freiwillig gewesen sei, aber keiner wagte, es laut zu sagen. Er erinnerte sich an ein Gespräch mit Pascal aus der Parallelklasse.
»Ich bin ziemlich sicher, dass es stimmt. Ich meine, sieh dir doch an, wie gierig Pauls manchen Schülern hinterherstarrt.«
»Ist mir gar nicht aufgefallen«, meinte Michael.
»Der wird sich hüten, das bei dir zu tun. Der hat bestimmt Schiss vor Kräftigeren.«
»Na ja, aber nur Hinterhersehen ist ja nicht gleich Anfassen, würde ich sagen.«
»Stimmt schon, stimmt schon«, sinnierte Pascal. Da in dem Moment die Klingel zur Stunde ertönte, endete das Gespräch abrupt. Der Gedanke daran ließ Michael nicht los. Er fragte sich, ob er mehr in Erfahrung bringen konnte.
Aber bereits nach kurzer Zeit hatte ihn der Alltag wieder so stark im Griff, dass er das vergaß. Es standen jede Menge Klausuren an und der Stoff schien schier unendlich viel zu sein. Er musste Stunden um Stunden in der Bibliothek verbringen wegen Geschichte, wo er weit hinter den Mitschülern zurückgeblieben war. Die Tische waren so verteilt, dass sie von Regalen umgeben waren und auf diese Weise Separees mit jeweils vier Sitzplätzen zwischen den Bücherwänden bildeten. Es war ein wenig wie ein Labyrinth. Das Deckenlicht konnte gedimmt werden, damit die Schreibtischlampen am hellsten waren. So sollten sich die Schüler besser auf den Stoff fokussieren können. Aber noch gab es Tageslicht genug in seiner Nische am Fenster zum Hof, sodass keine Lampe brannte. Er konnte sich heute nicht mehr konzentrieren. Es ging um das Drei-Kaiser-
Jahr und dessen Folgen, und das war so dermaßen langweilig, dass er sich zwingen musste, zu lernen. Dabei vertrödelte er die Zeit in Gedanken daran, was er stattdessen unternehmen könne. Inzwischen war er seit einer Stunde alleine, umgeben von einem Krater aus Büchern, alle anderen Schüler waren schon gegangen. Verdammte drei Kaiser. Hätte nicht einer gereicht? Wie er wohl als Herrscher gewesen wäre? Nicht schlecht, wenn er an die Lakaien dachte, die ihm die Wünsche von den Lippen ablesen würden. Und bestimmt würde er keine Schwierigkeiten gehabt haben, ein Mädchen zu bekommen. So wie die scharfe Azubine Sylvia, die in der Kantine aushalf. O ja, die war geil. Und ihre Titten. Die würde er gerne mal anfassen.
Plötzlich wachte er mit steifem Penis auf. Normalerweise, wenn er zu Hause wäre, würde er sich jetzt auf dem Klo einen runterholen. Aber hier war ihm dafür nicht vertraut genug. Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Kein Wunder, so spät war es geworden. Okay, das wird heute nichts mehr werden, egal wie lange ich hier noch sitze, dachte er und wollte aufräumen und die Tasche packen, da hörte er etwas. Das war merkwürdig. Er beschloss nachzusehen und stand auf. Durch die Bücherborde hindurch konnte er ein Licht in dem von der Eingangstür am weitesten entfernten Separee sehen. Seine Turnschuhe produzierten keine Geräusche, als er sich langsam näherte. Er spähte auf Zehenspitzen über ein paar Bücher in einem Regal hinweg. Da saß der fette Pauls in seiner Soutane allenfalls drei Meter entfernt, die Glatze schweißnass, und es war offensichtlich, was er machte. Der wichst! Ich glaube es nicht, der wichst hier in der Schule. Michael sah, wie der Priester, den Stuhl etwas von einem Tisch abgerückt und dessen Umhang hochgeschoben war, auf eine aufgeschlagene Zeitschrift auf dem Platz neben sich schaute. Den stattlichen Penis in der Hand schob er die Vorhaut hin und her. Die Eichel war nass. Die Bewegungen wurden intensiver, und der Pfarrer stöhnte leise. Es spritzte aus dem Schwanz in üppigen Strahlen auf den Parkettboden. In dem Moment fiel ein Buch zu Boden, auf das Michael sich gestützt hatte. Pauls sprang hektisch auf, die Soutane rutschte herunter, und er verschwand durch den nur für Befugte nutzbaren Nebeneingang. Die Tür schlug er mit einem Knall zu und schloss sie ab. Seine eiligen Schritte verklangen. Michael war überrascht von der Schnelligkeit und Wendigkeit des gedrungenen, untersetzten Priesters und näherte sich dem Schreibtisch, auf dem die einsame Lampe brannte. Auf dem Boden davor sah er mehrere nasse Flecken glänzen. Er nahm die Zeitschrift. Das war definitiv keine aus der Bibliothek. Es handelte sich um ein Heft in der Größe eines gängigen Magazins. Auf dem Cover war ein braun gebrannter, muskulöser, asiatischer Mann von höchstens achtzehn Jahren abgebildet. Der war komplett nackt, die Scham rasiert, und ein mächtiger Fleischpenis hing schlaff herunter. Darüber stand der Titel des Blattes Backdoor Stories. Neugierig blätterte Michael durch das Heft. Es gab ein wenig Text, ein paar Geschichten über neue Klubs, Reisemöglichkeiten für Schwule, eine Kontaktbörse und dann jede Menge Bilder in eindeutigen Posen. Da wurden Schwänze gelutscht, Sperma verspritzt, Analverkehr dargestellt. Es gab eine Serie zu Gruppensex und Glory Holes. Auffällig fand er, dass die Männer alle jung und vermutlich einige noch nicht volljährig waren. Er nahm das Magazin an sich, ging an seinen Platz zurück, packte die Schulsachen zusammen und verließ die Schule.
Als sich das Schuljahr im Juli dem Ende zuneigte und im kommenden Jahr der Eintritt in die Oberstufe mit den Klassen zwölf und dreizehn anstand, drohte Michael, in Geschichte und Latein eine Fünf zu bekommen. Die Konsequenz wäre, dass er das Vorsemester würde wiederholen müssen. Was für eine Katastrophe! Alleine schon, was er sich zu Hause anhören müsste. Noch mehr graute ihm vor der Multiplikation der Schande, da das mit Sicherheit die gesamte Verwandtschaft erfahren würde. Er konnte sich lebhaft ausmalen, was das für die kommenden Jahre bedeutete. Neben dem Katholizismus, zu dem er mittlerweile ein gespaltenes Verhältnis und den er weiterhin zu ertragen hatte, kämen dann diese ständigen Ermahnungen. Ihm klangen bereits die Worte seines Vaters im Ohr: »Nur mit Leistung bringt man es zu etwas« und »Du sollst es doch später besser haben als wir.« All das, was ihm ohnehin schon seit Jahren auf die Nerven ging, würde sein zukünftiges Leben prägen. Dazu durfte es nicht kommen.
Er fasste einen Plan, den er ab Anfang Juni in die Tat umsetzte. Nachdem er die Vorbereitungen abgeschlossen hatte, war es so weit. Eines Nachmittags nach der Schule ließ er sich Zeit, bis alle weg waren. Er schlenderte über das verwaiste Schulgelände und näherte sich seinem Ziel. An einer Tür der zum Schulkomplex gehörenden Reihenhäuser klingelte er. Kurz darauf wurde geöffnet.
»Michael, das ist ja eine Überraschung. Was kann ich für dich tun? Geht es um deine Lateinnote?«, fragte Vater Pauls.
»Ja, genau, darüber möchte ich mit Ihnen sprechen.«
»Na dann komm mal herein. Willst du deine Jacke ablegen?«
»Nein danke, ist ja nur eine leichte.« Er behielt die Trainingsjacke an.
Durch den engen dunklen Flur führte der Priester ihn in das Wohnzimmer. Michael registrierte eine biedere Sofagarnitur, die aus den Siebzigern stammte und deren Stoff an einigen Stellen fadenscheinig war. In der Mitte befand sich ein Couchtisch mit einer gefliesten Platte. Die Fliesen zeigten kirchliche Symbole. Darauf standen eine Thermoskanne, ein verdreckter Kaffeebecher und Dosenmilch. Ein Aschenbecher, der mit Resten von Zigarillos zur Hälfte gefüllt war, erklärte den Gilb an Tapete und Gardinen und den Geruch. Kunstdrucke von Kirchen und Klöstern zierten den Raum. Eine Schrankwand mit Büchern, Fernseher und Videorekorder beherrschte das Zimmer. Das Kruzifix über der Tür entdeckte Michael, nachdem er sich umgesehen hatte. Die ehemals hellgraue Auslegware hatte Brandlöcher und war insgesamt fleckig.
Was für ein versifftes Loch, dachte er.
»Setz dich doch«, sagte der Priester und wies auf einen Sessel, der, so ließ der Zustand des Stoffs vermuten, am seltensten benutzt wurde.
Wenigstens wird er da nicht draufgewichst haben, hoffte Michael, während er Platz nahm und die Schultasche abstellte.
»Also?«, fragte Pauls, der sich auf seinen Stammplatz aufs Sofa setzte.
»Ist es richtig, dass Sie mir eine Fünf geben wollen?«
»Nein, von wollen kann keine Rede sein. Ich bin dazu gezwungen, denn deine Leistungen sind schlecht, wie wir beide wissen. Ich habe es dir mehrfach während des Semesters gesagt, aber offenbar hast du keine Anstrengungen unternommen, dich zu verbessern. Du bist in einem Alter, in dem du Verantwortung übernehmen musst. Immerhin willst du in die gymnasiale Oberstufe und damit die Allgemeine Hochschulreife erlangen. Das erfordert entsprechenden Leistungswillen, den ich leider bei dir nicht erkennen kann.«
»Aber mit der anderen Fünf in Geschichte werde ich nicht weiterkommen«, jammerte Michael. »Können Sie nicht ein Auge zudrücken oder mich noch mal nachprüfen?«
»Was soll dabei herauskommen? Du hast den Anschluss verpasst, da hilft nur intensives Lernen, und das traue ich dir einfach nicht zu. Nein, ich denke, es wird wohl bei der Fünf bleiben.«
»Also gibt es keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern?«
»Hm, wohl kaum, es sei denn …«
»Es sei denn was?«, fragte Michael.
»Wie soll ich sagen? Ich könnte mir vorstellen, ein wenig Entgegenkommen deinerseits könnte meine Meinung ändern.«
»Was für ein Entgegenkommen?«
»Hast du eigentlich eine Freundin?«
»Ja, natürlich, sogar mehrere aus meiner Nachbarschaft.«
»Das kann ich mir gut vorstellen«, sagte der Priester, ohne den Satz zu beenden. »Aber ich meine eher etwas anderes …«
»Sie meinen ein Mädchen, mit dem ich gehe?«
»Genau, also hast du?«
»Nein, das verbietet ja unser Glaube.«
»Sehr richtig, der voreheliche Verkehr zwischen Mann und Frau ist verboten.«
»Aber warum fragen Sie dann?«
»Der voreheliche Verkehr zwischen Mann und Frau, der der Empfängnis dient, ist aus gutem Grund untersagt«, stimmte Pauls ihm zu und sah Michael direkt an. »Aber, sagen wir mal, ein harmloses Spiel, das nun nicht der Empfängnis dient, kann wohl kaum eine Sünde sein, was meinst du?«
»Sie meinen, nur so rumspielen aneinander?«
»Genau, nur zwischen Mann und Frau kann daraus natürlich schnell eine Situation entstehen, die zu einer Schwangerschaft führen kann, meinst du nicht auch?«
Michael schwieg und wartete ab.
»Ganz anders sähe das aus, wenn – rein hypothetisch gesprochen – zwei Männer miteinander spielen. Schließlich kann es da ja nicht zur Empfängnis kommen, nicht wahr? Wusstest du, dass diese Spiele, wo wir gerade bei Latein sind, bei den Römern ganz üblich waren?«
»Nein«, sagte Michael.
»Ja, das ist wirklich interessant. Man weiß gerade aus den Ausgrabungen von Pompeji, dass es etwas ganz Normales war.
Übrigens gibt es einige Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass auch frühe römische Christen solche Praktiken ausgeübt haben. Derartige Spiele dienten dem Zusammenhalt und der Harmonie. Aus diesen und anderen Gründen ist es für so manchen in unserer Kirche unverständlich, dass so etwas heute Sünde sein sollte. Was denkst du, Michael?« Die Augen des Priesters blickten lüstern, in seinen Mundwinkeln hatte sich ein wenig Speichel angesammelt.
»Ich weiß nicht. Meinen Sie, dass wir solche Spiele spielen sollten?«
»Ach mein Lieber, warum denn so förmlich?«, fragte Pauls und wies neben sich. »Komm, rück doch ein bisschen näher. Ich zeige dir etwas, das dir bestimmt gefällt.«
Verdammt, das darf nicht schiefgehen