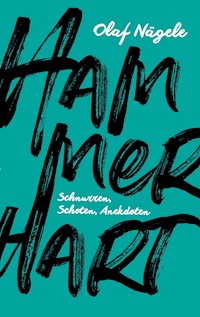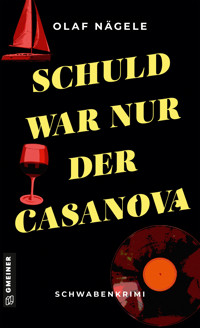Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Biberach: In einer Wohnung wird ein abgetrennter Kopf entdeckt – der des Wohnungsmieters. Von dessen Frau und Söhnchen fehlt jedoch jede Spur. Vor Pfarrer Goettles Tür wird bald darauf ein Baby abgelegt. Die Spuren führen zur Agentur "Bussenkindle", die für kinderlose Paare Wallfahrten zum Bussen, dem "heiligen Berg" Oberschwabens, anbietet. Schnell wird klar, dass nicht göttlicher Segen im Spiel ist, sondern ein wahrhaft teuflischer Handel ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olaf Nägele, 1963 in Esslingen geboren, hat nach langjährigen Aufenthalten in München, Stuttgart und Hamburg den Weg in seine Heimatstadt zurückgefunden. Dort feilt der freiberufliche Kommunikationswirt (KAH) an PR- und Werbetexten für seine Auftraggeber und verfasst als Journalist Artikel für diverse Zeitungen. Die Lust am Fabulieren und Geschichtenerzählen hat ihm zahlreiche Beiträge in Anthologien eingebracht, Hörspiele für den SWR folgten. Einige Bücher hat er bereits veröffentlicht. Auch durch seine satirisch angehauchten Lesungen hat Olaf Nägele sich einen Namen gemacht.
OLAF NÄGELE
Goettle und das Kindle vom Bussen
Oberschwaben-Krimi
Sollte dieses Werk Links auf WebseitenDritter enthalten, so machen wir unsdie Inhalte nicht zu eigen und übernehmenfür die Inhalte keine Haftung.
1. Auflage 2018
© 2018 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schweickhardtstraße 5a, D-72072 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung und Satz:
Christoph Wöhler, Tübingen.
Coverfoto: © yudhistirama– iStockphoto.
Lektorat: Michael Raffel, Tübingen.
Druck: CPI books, Leck.
Printed in Germany.
ISBN 978-3-8425-2110-0eISBN 978-3-8425-1820-9
Ihre Meinung ist wichtig für unsere
Verlagsarbeit. Senden Sie uns
Ihre Kritik und Anregungen an
Besuchen Sie uns im Internet
und entdecken Sie die Vielfalt
unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Nachwort
1
»Viviana! Süße! Ich bin da!«
Roxane zog den Schlüssel aus der Wohnungstür, hängte ihre Jacke an die Garderobe und lauschte ihren Worten nach. Die Wände schienen sie aufgesaugt, sie in absolute Lautlosigkeit verwandelt zu haben. Unsicher schob sie sich den Gang entlang, blickte ins Wohnzimmer. Die Abendsonne goss ihr mattes Orange über die Polstergarnitur. Eine Wolldecke lag zurückgeschlagen auf dem Dreisitzer, als wäre sie nur kurz verlassen worden, und wartete nur darauf, sich wieder um einen Körper schmiegen zu dürfen.
»Viviana, bist du zuhause?«
Roxanes Stimme hörte sich eine Spur zu schrill an, in der Frage schwang Unheilahnendes mit. Ihre Schwester musste zuhause sein. Sie hatte zwar nicht auf ihr Klingeln reagiert, so dass sie sich mit dem Zweitschlüssel, den ihr Viviane für »alle Fälle« überlassen hatte, Zutritt verschafft hatte, aber sie hatte ihr Auto auf der Straße stehen sehen. Außerdem hatte Viviana ihr eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. »Du musst kommen. Bitte«, lautete die knappe, aber unmissverständliche Botschaft. Nachrichten wie diese duldeten keinen Aufschub. Roxane hatte keine Minute gezögert, ihrer Chefin Bescheid gesagt, dass sie ihre Mittagspause vorziehe, und sich sofort auf den Weg gemacht.
Roxanes Hände begannen zu schwitzen, das Herz pochte ihr bis zum Hals. Einer inneren Stimme folgend stieg sie die Treppe zum Obergeschoss hinauf. Vielleicht hatte sich Viviana kurz ins Bett gelegt, sie war in der letzten Zeit oft sehr erschöpft gewesen. Die erfolglosen Versuche, schwanger zu werden, die Hormonbehandlungen, der Frust, wenn der Arzt wieder nur eine negative Mitteilung für sie hatte, dann die plötzliche Schwangerschaft, die Geburt und die ersten Monate mit dem Baby forderten ihren Tribut. So sehr sich Viviana und ihr Mann Alvin auch gefreut hatten, dass es nach vielen vergeblichen Versuchen doch noch geklappt hatte, ein Kind zu bekommen – mit den Aufgaben, die mit einem Säugling einhergingen, schienen sie oft überfordert.
Joshua weinte und schrie, oftmals die ganze Nacht, wenn man den Berichten der jungen Eltern Glauben schenken konnte. Und meist war es Viviana, die den Kleinen beruhigte, damit Alvin am nächsten Tag seiner Arbeit nachkommen konnte.
Umso unwirklicher war die Stille, die Roxane umgab.
War dem Kind etwas zugestoßen?
Die aufsteigende Panik mühsam unterdrückend, riss sie die Tür zu Joshuas Zimmer auf und spähte hinein. Es dauerte einen Moment, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Die Jalousien waren heruntergelassen worden, um die Hitze des Spätsommers abzuwehren. Sie näherte sich dem Bettchen, in dem der kleine Junge selig schlief. Regelmäßig gingen seine Atemzüge, ein leichtes Lächeln umspielte seine Gesichtszüge.
Roxane betrachtete ihn eine Weile, ließ sich von seinem Frieden anstecken, hauchte ihm einen Kuss auf die Stirn, schlich hinaus und schloss die Tür.
Aus dem Badezimmer drang ein kehliger Laut, geboren aus tiefstem Schmerz und Verzweiflung. Ein Laut, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Roxane hechtete zur Tür, prallte unsanft dagegen. Sie war verschlossen. Wie besessen betätigte sie die Klinke, schlug mit der Faust gegen das Holz.
»Viviana, um Gottes Willen, was ist mit dir? Mach auf!«
Ihre Schwester antwortete nicht, stattdessen hörte Roxane nochmals dieses markerschütternde Schluchzen. Ihre Nackenhaare stellten sich auf, sie schluckte trocken, um die Enge der Kehle zu weiten. Sie legte ihr Ohr an das Türblatt.
»Viviana, bitte. Ich bin doch da. Alles wird gut«, sagte sie sanft.
Erneut heulte ihre Schwester auf, ihr Weinen ging in ein knurrendes Maunzen über, und für einen Moment zweifelte Roxane daran, dass ein Mensch solche Töne hervorbringen konnte. Noch einmal klopfte sie, zaghaft dieses Mal, so als wollte sie der Verzweifelten signalisieren, dass sie keine Angst haben musste, weil sie doch da war und ihr Trost spenden konnte.
Minuten verstrichen, dann hörte sie, wie Viviana Papier von der Toilettenrolle zog, sich schnäuzte. Die Wasserspülung wurde betätigt, wenig später der Schlüssel im Schloss gedreht. Viviana trat ihr entgegen. Ihre Augen waren geschwollen und rot umrandet, der Lidstrich bildete einen verwaschenen Schatten.
Black Tears. Schwarze Tränen.
Sie zitterte. Kraftlos ließ sie sich in die Arme ihrer Schwester fallen, klammerte sich an sie.
»Es ist so furchtbar«, stammelte sie.
Roxane drückte sie an sich, strich ihr über das Haar. Sie kämpfte gegen ihre eigenen Tränen an. Es tat ihr weh, ihre Schwester so leiden zu sehen.
»Was ist denn passiert? Was macht dich so traurig?«
Viviana wurde von einem erneuten Weinkrampf erfasst, ihre Beine gaben nach. Roxane hatte Mühe, sie zu halten. Für einen Augenblick schien es, als würde ihre Schwester ohnmächtig werden, dann jedoch richtete sie sich auf, löste sich aus der Umarmung und sah sie an. Leid und Angst schwammen in ihren Augen, ihre Lippen bebten.
»Alvin …«, brachte sie mühsam hervor. Nur dieses eine Wort.
»Was ist mit ihm?«, fragte Roxane, obwohl sie die Antwort eigentlich nicht hören wollte. »Ist ihm etwas zugestoßen?«
Viviana wurde bleich.
»Er ist tot«, flüsterte sie.
Ihr Blick wanderte rastlos umher, richtete sich schließlich auf die Tür zum Kinderzimmer. Langsam hob sie den linken Arm und zeigte auf Joshuas Raum.
»Er wird mich auch töten. Und schuld daran ist dieser kleine Teufel. Er ist ein Abgesandter der Hölle.«
»Oh Gott, sie verliert den Verstand«, dachte Roxane. Sie versuchte, ihre Schwester wieder an sich zu drücken, doch die versteifte sich und entwand sich der Umarmung. Sie ging einige Schritte auf das Kinderzimmer zu, doch dann blieb sie abrupt stehen.
»Er wird auch uns ins Verderben stürzen. Wir müssen etwas unternehmen«, kreischte sie.
Roxane riss ihre Schwester an den Schultern herum. Vivianas Augenlider flatterten, die Mundwinkel zuckten, ein dünner Speichelfaden bahnte sich den Weg Richtung Kinn. Sie stand ganz offensichtlich unter Schock.
»Was ist mit Alvin passiert? Wieso ist er tot?«
Wortlos ging Viviana an ihrer Schwester vorbei. Roxane folgte ihr, die Treppe hinunter, ins Wohnzimmer.
Viviana sah sich um, als müsste sie sich in einer neuen Umgebung orientieren, als wäre sie in der eigenen Wohnung zu Gast. Dann nahm sie Kurs auf die Couch und ließ sich fallen.
Roxane nahm neben ihr Platz.
Stockend begann Viviana zu erzählen. Diffus, ohne chronologische Ordnung, es klang, als reihte sie unzusammenhängende Bilder aneinander, als schilderte sie die Eindrücke eines Traums. Manche Sätze gingen in wimmernden Lauten verloren, was es für Roxane nicht einfach machte, aus den Puzzleteilen die gesamte Geschichte zusammenzusetzen. Am Ende jedoch saß sie wie versteinert neben ihrer Schwester. Sämtliches Blut war aus ihrem Gesicht gewichen, sie kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an.
»Oh mein Gott. Das habt ihr nicht wirklich getan«, murmelte sie tonlos. »Ihr habt eure Seelen verkauft.«
»An den Leibhaftigen«, antwortete Viviana. »Joshua ist ein Kind des Teufels.«
»Sprich nicht so von dem Kleinen. Das ist Unsinn«, unterbrach Roxane streng. »Was kann er denn dafür?«
Sie stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Sie musste eine Lösung finden, wie eigentlich schon immer. Viviana war zwar die Ältere, ging jedoch schon seit Kindesbeinen mit einer an Naivität grenzenden Unbedarftheit durch das Leben. Probleme oder etwaige Schwierigkeiten blendete sie ohne weiteres aus, es zählte nur das »pro«, ein »contra« zog sie nicht in Erwägung.
Und so lief sie nicht nur einmal dem Unglück direkt in die offenen Arme, weinte bittere Krokodilstränen und wandte sich an ihre Schwester, die sich als Problemlöserin bewährt hatte.
»Du musst zur Polizei gehen und die Geschichte erzählen. Sie müssen dich und Joshua schützen«, sagte sie schließlich.
Viviana schüttelte vehement den Kopf.
»Das geht nicht«, antwortete sie schrill. »Die Polizei wird mir nicht glauben. Und er wird einen Fluch über uns sprechen und uns töten. So wie er Alvin getötet hat. Es gibt nur eine Lösung: Das Kind …«
Das Klingeln an der Haustür ließ die beiden Frauen zusammenzucken. Viviana rollte sich zusammen und hielt ein Kissen vor die Brust, als müsste sie sich schützen. Sie wimmerte.
»Wer kann das sein?«, flüsterte Roxane. »Erwartest du jemanden?«
»Das ist er«, keuchte Viviana. »Er kommt, um uns zu holen.«
Roxane zögerte kurz, dann ging sie zur Tür.
»Wer ist da?«, knurrte sie in die Gegensprechanlage, doch sie erhielt keine Antwort. Durch den Spion konnte sie niemanden entdecken. Vorsichtig öffnete sie, der Hausflur war leer.
Als sie sich umdrehte, bemerkte sie den Zettel, der an der Tür klebte. Es war eine Terminnotiz, wie man sie als Erinnerungsstütze beim Arzt bekam.
Sie riss das Blatt ab, kehrte zu ihrer Schwester zurück. Wortlos legte sie das Stück Papier auf den Tisch.
»Ihr nächster Termin: 15. August«, las Viviana und brach in Tränen aus.
In diesem Moment sprang das Babyfon an, das neben ihr lag. Joshua war offensichtlich aufgewacht.
Roxane fröstelte, als sie die Töne hörte, die aus dem Lautsprecher drangen. Joshua lachte. Laut und vernehmlich.
Und vor allem unheimlich.
2
»Oh Herr, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Der Herr Pfarrer hot sei Brill uff.«
Andreas Goettle blickte seine Haushälterin Renate Münzenmaier missmutig über den Rand seiner Morgenzeitung an. »Wenn i gwisst hätt, dass i Sie heut Morga scho angugga muss, no hätt i se in meim Zimmer glassa.«
Seine ehemalige Haushälterin zog ihm eine Grimasse. Sie kannte die Morgenmuffeligkeit ihres ehemaligen Dienstherrn zur Genüge, wusste jedoch auch, dass sie sich mit jedem Schluck Kaffee nach und nach verflüchtigte. Es war, als ob das Koffein die herbeigeschlafene Grimmigkeit des Geistlichen niedermetzelte, und um diesen Vorgang zu beschleunigen, goss Frau Münzenmaier nochmals von dem Gebräu nach.
Andreas Goettle sah ihr dabei zu, zog kurz die Augenbrauen nach oben und vertiefte sich wieder in seine Zeitung. Die Haushälterin betrachtete ihn eine Weile und schüttelte den Kopf. Sie hätte den alten Bruddler vermisst, wenn er wirklich hätte ausziehen müssen, so wie es Bischof Timmermann von der Diözese Rottenburg in seinem Amtsenthebungsverfahren gegen Goettle gefordert hatte. Die Tätigkeit des Gemeindepfarrers als »Amateur-Kriminalist«, seine Verschrobenheit in der Amtsführung sowie ein vermeintliches Vernachlässigen der Gemeinde hatten den Erzbischof zu dem Urteil kommen lassen, dass dies ein »völlig unangemessenes Verhalten« sei, »das für die kirchliche Gemeinschaft schweren Schaden und Verwirrung verursacht«.
An den genauen Wortlaut ihres Dienstherrn, mit dem er diesen Vorwurf erwiderte, erinnerte sich Haushälterin Münzenmaier nur ungern. Er hatte mit seiner Fluch-Litanei »einige Heilige vom Himmel runtergeholt«, hatte den Erzbischof mehrfach im Tierreich verortet und stellte, wie schon so oft, die Grundsätze der katholischen Kirche in Frage.
»Da schickat se neunjährige Kender in die Beichte, die no gar net genau wissat, was a Sünde isch und irgendeinen Lellabebb daherschwätzat, Hauptsache, sie werdet bestroft. Die Priester dürfat koine Beziehunga führa, geschweige denn sich geschlechtlich betätiga, und wenn sie es doch net lassa könnat, dann wird sofort das Jüngste Gericht angerufen. Es isch verbota zu verhüta, was vor allem in de arme Länder Probleme mit sich brengt, weil es net gnuag zum Fressa für alle gibt. Die Kender werdet uff d’ Stroß gschickt, um zu bettle oder um sich zu verkaufa. Do guckt mr dann großzügig drüber weg. Des isch in meine Auga unangemessenes Verhalta, das die kirchliche Gemeinschaft verwirren sodd. Aber wenn i dafür sorg, dass Recht und Ordnung aufrechterhalta werdat, dann kommt des einer Gotteslästerung gleich.«
Es lag eine gehörige Portion Stolz in seiner Weigerung, auf den rechten Pfad, der von ihm als Gemeindeseelsorger erwartet wurde, zurückzukehren. Schon zwei Mal hatte er der Kriminalpolizei in Biberach unter die Arme gegriffen. Beim ersten Mal, um die kriminellen Machenschaften rund um den Fußballverein FC Oberschwaben aufzudecken, und beim zweiten Fall, um die wahre Hexe vom Federsee in Bad Buchau überführen zu können.
An seinem kriminalistischen Tun wollte er nichts ändern. Im Gegenteil. Seine Detektivausrüstung, die er sich nach und nach über Spezialanbieter im Internet beschafft hatte, stand inzwischen dem Equipment des Geheimdienstes eines mittelgroßen Staates in nichts nach. Mittlerweile war er in der Kunst der Kostümierung so bewandert, dass ihn nicht einmal seine eigene Mutter erkannt hätte. Wenn er in seiner Obdachlosen-Tracht durch die Straßen Biberachs schlenderte, bewarfen ihn die Menschen mit Geldscheinen, so mitleiderregend kam er daher.
Goettle wusste, dass das Böse sich keine Pause gönnte, und sah sich berufen, es zu bekämpfen, wann immer er dazu in der Lage war. Kluge Sprüche von der Kanzel herab reichten in den meisten Fällen nicht aus. Nein, wenn es sein musste, dann gab es von dem Herrn Pfarrer persönlich »a gscheite Schella«, was selbstverständlich als Metapher zu sehen war, denn reale Ohrfeigen gab es von Andreas Goettle nur selten.
Gegen das Urteil der Erzdiözese hatte er natürlich Widerspruch eingelegt, aber es war ihm nicht erlaubt, während des schwebenden Verfahrens seine Tätigkeit als Gemeindepfarrer weiter auszuüben.
Stattdessen arbeitete er ehrenamtlich in der Seniorenresidenz Regenbogen und betreute dort die betagten Herrschaften. Vermittelt hatte ihm diese Tätigkeit Eva Stätter, die in dem Altenheim als Pflegerin tätig war und als Mitglied der »Grünen Minnen«, einer Frauenorganisation, die mit zuweilen ungewöhnlichen Methoden für die Interessen benachteiligter Menschen eintrat, des Öfteren für Furore gesorgt hatte.
Unvergessen war die Aktion der Minnen am Stadion des FC Oberschwaben, als sich die Damen barbusig an die Eingangstore gekettet hatten, um die Polizei abzulenken, während sich der Pfarrer Zutritt in die Sprecherkabine verschafft hatte, um die Fans über die kriminellen Machenschaften ihres Vorstandschefs aufzuklären.
Auch in seinem Kampf gegen die Amtsentlassung erhielt Goettle die Unterstützung der streitbaren Frauen. In nicht jugendfreien Nonnenkostümen, die im Grunde mehr von den Körpern preisgaben, als sie verhüllten, waren sie in Rottenburg aufgetaucht, um gegen die bigotte Herrschaft des Bischofs zu demonstrieren. Wieder musste ein großes Polizeiaufgebot für Ordnung sorgen. Die Beamten hatten ihre Mühe, die halbnackten Nonnen wegzutragen, die lauthals »Behaltet euren Gott. Wir wollen Goettle!« riefen. Einige der Angestellten, die sich der eigenen Aussage nach mit Sodom und Gomorrha 2.0 konfrontiert sahen, mussten psychologisch nachbetreut werden, und die Beichtstühle glichen in den Wochen danach Taubenschlägen.
Dass Andreas Goettle immer noch im Pfarrhaus wohnen durfte, war der Tatsache geschuldet, dass der neue Gemeindevorsteher Benedict Walcher seinen eigentlichen Amtssitz in Bad Waldsee nicht aufgeben wollte. Dort kam offenbar auch seine strenge Art, die Kirchenmitglieder auf dem rechten Pfad zu begleiten, sehr viel besser an. In Biberach wiederum schwänzten immer mehr Menschen die Gottesdienste, dem Kirchenchor liefen die Sängerinnen und Sänger davon, die keine Lust hatten, sich durch Psalme und den christlichen Kanon zu singen. Pfarrer Goettle hatte eine weit weltlichere Auffassung bei der Auswahl der Chorstücke vertreten, und dass er auch Stücke wie »Nothing else matters« von Metallica und »Highway to hell« von AC/DC im Repertoire führte, kam bei den jungen Gemeindemitgliedern sehr gut an.
Noch war der Kirchenvorstand von St. Joseph, der mit der jüngsten Entwicklung gar nicht zufrieden sein konnte, nicht bereit, in Sachen Andreas Goettle einzulenken. Schließlich hatte er selbst dafür gesorgt, dass die Amtsenthebung eingeleitet worden war, und ein Rückzug käme dem Eingeständnis des Irrtums gleich.
Andreas Goettle wiederum war mit seiner neuen Situation zufrieden. Die Damen und Herren, die in der Residenz Regenbogen wohnten, schätzten den Geistlichen, seinen Zuspruch und seine unkonventionelle Auslegung der Altenbetreuung sehr. Allein der morgendliche Kurs »Grüß Gott, lieber Gott«, bei dem Bewegungselemente aus Yoga, Tai Chi, Skigymnastik und Karate in Verbindung traten, barst fast aus allen Nähten, so beliebt war er. Und auch die Idee, einen sportlichen Dreikampf mit den Disziplinen Rollator-Hindernis-Lauf, Krückenbillard und Kirschkernweitspucken zu initiieren, kam bei den Heimbewohnern sehr gut an. Bei den Pflegekräften allerdings war die Euphorie gedämpft gewesen, was vor allem an der letztgenannten Kategorie lag, bei der die Haftcremes einiger Zahnersatzteile ihre Funktion aufgaben, so dass diese samt Kirschkern durch die Luft segelten. Die Zuordnung der Gebisse erwies sich schwieriger als angenommen, der Disziplin drohte kurzzeitig das Aus.
Wesentlich ungefährlicher wurde das Wissensquiz »Schlag die Demenz« eingestuft, bei dem die Anwohner einen kleinen Geldbetrag auf Teilnehmer setzen konnten, die sich tapfer den Wissensfragen aus allen Lebensbereichen stellten. Dem Gewinner konnte somit ein monetärer Gewinn sowie eine Klinikpackung Ginseng geboten werden.
»Die alte Leutla brauchet Aufgaba«, lautete Goettles Antrieb. »Wer ständig vor sich hindämmert, muss sich net wundre, wenn irgendwann alles zappeduster wird.«
Aber er wusste auch, dass durch reine Bespaßung nicht jedes Problem gelöst werden konnte. Hier kam ihm seine seelsorgerische Ausbildung zugute, von der auch die Angehörigen der Heimbewohner profitierten. Für viele war es schwer, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie sich auf lange Sicht von einem geliebten Menschen verabschieden mussten. Andreas Goettle hatte für jeden das richtige Wort: »Wenn einer von dieser Welt goht, bleibt in ons vieles do. Aber er nimmt au von ons was mit, so dass die Verbindung nie abreißt.«
»Ond? Gibt’s ebbes Neues im Städtle?«
Renate Münzenmaier schielte über die Schulter von Andreas Goettle, um eine Schlagzeile zu erspähen.
»Ja, hier stoht, dass Fraua, die besonders naseweis sen, künftig nur mit einem Holzfass bekleidet durch die Stadt laufe dürfa. I würd saga, sie solltet schon mal mit einem Küfer schwätza, damit er Holz bstella ka.«
Der Geistliche drehte sich von ihr ab, um seinen Unmut über die Störung deutlich zu machen.
»Overschämter Denger«, wisperte Frau Münzenmaier, stellte die Kaffeekanne mit betontem Knall auf die Anrichte und rauschte zur Türe hinaus.
»Des han i fei ghört«, grummelte es hinter der Zeitung hervor. Andreas Goettle war jedoch zu sehr an einem Artikel interessiert, um weiter auf die Laune seiner Haushälterin eingehen zu können. »Sieht so aus, als könnte die Polizei in Biberach mei Hilfe braucha«, murmelte er.
3
»Herrschaftszeita. Grad hot oiner aus Bad Waldsee angrufa, dass dieser Granadafetz scho wieder zugschlaga hot.«
Die Bartspitzen von Polizeiobermeister Fritz zitterten, wie immer, wenn ihn etwas sehr aufregte. Um seiner Empörung noch mehr Ausdruck zu verleihen, biss er krachend in einen Apfel.
»Meinen Sie unseren Enkeltrickbetrüger?«
Kommissarin Laura Behrmann sah von dem Protokoll hoch, das sie von der Befragung der zuletzt Geschädigten, Frau Stolte, anfertigte. Die alte Dame war völlig außer sich gewesen. Ein junger Mann hatte sich bei ihr telefonisch gemeldet und vorgegeben, der Sohn ihrer Schwester, die in Köln lebte, zu sein. Er hatte ihr erzählt, dass es seiner Mutter nicht gut gehe, dass sie dringend Medikamente benötige, die er aber nicht bezahlen könne. Er hatte sie gebeten, ihm 10 000 Euro zu leihen, nur vorübergehend, er erwarte eine größere Zahlung eines Auftraggebers, dann werde er seine Schulden sofort begleichen. Die Sache sei sehr eilig, der Schwester gehe es wirklich sehr schlecht, die Ärzte hätten die Hoffnung schon fast aufgegeben.
Die Nachricht von dem kritischen Gesundheitszustand ihrer Schwester hatte die allein lebende Dame so aufgewühlt, dass sie den Wahrheitsgehalt des Telefonats nicht in Frage stellte und zusagte, das Geld zu besorgen. Ihr vermeintlicher Neffe hatte einen sehr erleichterten Eindruck gemacht. Er hatte ihr mitgeteilt, dass ein Freund von ihm das Geld abholen würde, und tatsächlich stand am nächsten Tag ein junger Mann vor Frau Stoltes Tür, um die 10 000 Euro in Empfang zu nehmen. Die Rentnerin beschrieb ihn als angenehme Erscheinung: Mediterraner Typ, mittelgroß, schlank, sportlich bekleidet, modischer Kurzhaarschnitt und ein Bart, »wie ihn diese jungen Männer gerade alle tragen.«
Als sich ihre Schwester zwei Wochen später bei ihr telefonisch gemeldet hatte, war der Schwindel ans Tageslicht gekommen. Von einem Krankheitsfall konnte nicht die Rede sein, sie war putzmunter und kam gerade aus einem Kurzurlaub zurück. Frau Stolte schämte sich zutiefst für ihre Gutgläubigkeit und wollte die Angelegenheit zunächst nicht zur Anzeige bringen, doch ihre Schwester hatte darauf bestanden. Bei dem Versuch, ein Phantombild des jungen Mannes zu erstellen, wies die Erinnerungsfähigkeit der alten Dame plötzlich große Diskrepanzen zu ihrer bisherigen Aussage auf. Die modische Kurzhaarfrisur changierte in ihrer Beschreibung zwischen Wischmopp und Vollglatze, und auch beim Bärtchen war von der Oberlippenbeflockung bis Vollbart alles dabei.
»Dieses Mol hot er gsagt, er müsst an Kredit zrückzahla, der Gerichtsvollzieher sei schon do gwesa. 12 000 Euro hot der dem arme Mütterle abgnomma.«
Laura Behrmann ließ ihren Stift auf die Schreibtischplatte fallen.
»Es ist unfassbar. Das ist schon der vierte Fall in den letzten zwei Monaten. Ich möchte nicht wissen, wie viele alte Menschen er schon abgezockt hat. Ich fürchte, dass sich viele gar nicht melden, weil sie sich schämen zuzugeben, dass sie auf so eine Masche hereingefallen sind.«
Polizeiobermeister Fritz nickte.
»Was i net ganz begreif: Die Leutla müsstat doch ihre Verwandte kenna. Da muss mr doch misstrauisch werda, wenn sich oiner nach langer Zeit meldet ond an Haufa Geld will.«
Er schüttelte den Kopf und betrachtete den Apfelbutzen in seiner Hand, als könnte der ihm eine Antwort geben.
»Die Herrschaften, die betrogen werden, sind alt, leben meistens allein, haben wenig bis gar keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt«, antwortete Laura Behrmann. »Da kommt es zu Verschiebungen in der Wahrnehmung, auch was die eigene Familie angeht. Die sind über jeden Kontakt glücklich. Darauf bauen die Täter. Außerdem werden zur Geldübergabe immer Freunde oder Bekannte geschickt, das heißt, der vermeintliche Verwandte tritt nie selbst auf. Sonst würde der Schwindel womöglich früher auffliegen.«
»A Sauerei isch des. Da sparet die Leut a Leba lang, werdet erscht von de Banka bschissa, die koine Zinse meh zahlet, und dann kommat solche Hurgler daher und klauet des hart verdiente Geld.«
»Ja, und offenbar weiß der oder wissen die Täter immer, dass bei den Opfern etwas zu holen ist. Das ist schon seltsam.«
Die Kommissarin blätterte in den Akten, die vor ihr lagen, überprüfte die Eintragungen und nickte schließlich.
»Das habe ich mir fast gedacht. Bei den bisherigen Fällen hatten die Opfer jeweils ein Bankkonto bei der Oberschwäbischen Volkssparkasse. Womöglich haben wir da einen Tippgeber sitzen. Oder deren Kundendatei wurde gehackt. Wie sieht es denn bei dem neu angezeigten Fall aus? Bei welcher Bank hat das Opfer sein Konto?«
POM Fritz zuckte mit den Schultern. »Koi Ahnung. I hab net gfrogt. Aber vielleicht isch es au oifach bloß Zufall. I moin, i hab au a Konto bei der Volkssparkass, und für die Leut, die dort schaffat, leg i mei Hand ins Feuer. Awa, boide Händ und die Fiaß no dazu.«
»Mit solchen Aussagen wäre ich an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtiger. Bei diesem Institut arbeiten meines Wissens mehr als 3000 Menschen in ganz Oberschwaben. Da kann schon ein Schlawiner dabei sein, oder nicht? Ich fahr da jetzt mal hin und höre mich ein bisschen um. Nur für den Fall, dass die Chefin nach mir fragt.«
»Wo isch die überhaupt? Die hab i no gar net gseha.«
Laura Behrmann lächelte verschwörerisch. »Sie hat heute frei genommen, um auf Amors Pfaden zu wandeln. Offensichtlich ist es dieses Mal etwas Ernstes.«
POM Fritz sah seiner Kollegin hinterher. »Naja, es wär ja an der Zeit, dass die mol oin abkriagt. Wenn se no a bissle älter wird, dann interessierat sich am End bloß no Archäologa für sie. Und des wär jammerschad.«
Make-up: dezent. Frisur: lässig. Outfit: Enge Ripped Jeans, die ihre gebräunten Beine durchscheinen ließen, schwarzes Top, darüber eine transparente Bluse, Sneakers.
Nicht zu sexy, aber doch auf eine gewisse Art und Weise verführerisch.
Greta Gerber drehte sich ein letztes Mal vor ihrem Spiegel im Schlafzimmer, betrachtete sich von allen Seiten und beschloss, dass es gut war, was sie sah: So konnte sie zu ihrem ersten Treffen mit Darius gehen.
Darius. Allein der Name versprach Besonderes. Darius. So hießen Helden in Filmen – oder noch besser: Verführer in erotischen Romanen. Ein Darius versprach Abenteuer, vielleicht sogar ein bisschen Gefahr.
Sie hatte den aparten Mittdreißiger auf dem Internetportal »Easy Date« kennengelernt und wusste, dass er auf Frauen stand, die ihre Attraktivität nicht zu vordergründig präsentierten. Zumindest hatte er das geschrieben, und irgendwie passte es zu seiner zurückhaltenden, höflichen und durchaus charmanten Art der Gesprächsführung. Er machte Komplimente, die nicht aufdringlich oder sofort durchschaubar waren, er gab Greta genug Raum, etwas von sich preiszugeben, ohne zu neugierig zu sein. Und er ließ sie an seiner Gefühlswelt teilhaben, was ja bei Männern eher ein seltenes Attribut war.
Dazu sah er noch gut aus: Markante Gesichtszüge, ein lässiger Haarschnitt, groß, sportliche Figur, eher ein Jeans- als ein Anzugtyp. Er arbeitete in der IT-Branche, was für Greta im Normalfall ein Ausschlusskriterium gewesen wäre, aber er war weit davon entfernt, ein Bit- und Byte-abhängiger Nerd zu sein. Er war in der Lage, ein Gespräch zu führen, ohne in den branchentypischen Jargon zu verfallen – das hatte Greta bei ihren Telefonaten, die dem E-Mail-Verkehr gefolgt waren, erfahren dürfen.
Und nicht nur das: Wenn sie sich unterhielten, hatte sie den Eindruck, dass sie mit einem alten Bekannten plauderte. Da war eine Vertrautheit, die sie lange vermisst, deren Existenz sie sogar inzwischen für unmöglich gehalten hatte. Er war ein einfühlsamer Gesprächspartner, interessiert und interessant, einer, der sich ausdrücken konnte, was auf eine gewisse Belesenheit hindeutete, weitgereist und weltgewandt. Allein der Klang seiner Stimme machte Greta schwurbelig, und sie hatte schon daran gedacht, ihr Pseudonym, unter dem sie sich angemeldet hatte, für ihn zu lüften. Denn: Sie hatte sich gegen ihren Klarnamen entschieden. Über sie und ihre Tätigkeit als Hauptkommissarin existierten unzählige Einträge im Internet, die nur allzu leicht abrufbar waren, und wer wollte schon mit einer sehr beschäftigten Polizistin eine Liaison eingehen? In nahezu allen Fernsehkrimis scheiterten die Beziehungen der Polizisten an den Anforderungen, die der Job an sie stellte, und auch wenn dies nicht ganz auf die Realität übertragen werden konnte, ein Körnchen Wahrheit lag schon darin.
Für ihre »Easy Date«-Präsenz hatte sich Greta unter dem Namen Maya Krämer angemeldet. Maya nach ihrer Lieblings-Chocolaterie Maya, die schräg gegenüber von ihrer Wohnung lag und entsprechend oft von ihr besucht wurde. Und Krämer, weil dies ein herrlich unverbindlicher Nachname war.
Auch bei ihrem Foto hatte sie ein wenig nachgeholfen. Sie hatte ein paar Pfunde weggemogelt, ein paar Fältchen wegretuschiert und das Haar ein wenig nachgedunkelt. Eigentlich sah sie auf ihrem Foto aus wie vor fünfzehn Jahren, so dass es ihr gar nicht wie ein Betrug vorkam. Im Grunde hatte sie nur die Zeit per Photoshop ein wenig zurückgedreht.
Der Erfolg gab ihr Recht. Zunächst konnte sie sich vor Zuschriften kaum retten, auch wenn einige Verehrer ihre rein erotischen Absichten recht deutlich zum Ausdruck brachten. Einer wollte sich mit ihr sogar in einem Swinger Club treffen. Um die Anonymität zu wahren, sollte Greta als spärlich bekleidete Vampirin erscheinen, während ihr Galan in der Pornoversion von Frankensteins Monster auftauchen wollte. Beides, der Gedanke an den Swinger Club sowie an die Verkleidung, ließ die Hauptkommissarin gruseln.
Andere wiederum waren das genaue Gegenteil von forsch. Einer hatte nach dem ersten schriftlichen Kontakt seiner Mutter die weitere Kommunikation überlassen, da sie »genau wusste, was für ihren Sohn am besten war.«
Am seltsamsten war ein Typ namens Enrique gewesen, der behauptete, Maya Krämer zu kennen. Er gab sogar vor, mit ihr im Bett gewesen zu sein. Greta konnte sich nicht daran erinnern, jemals einen Liebhaber namens Enrique gehabt zu haben. Womöglich benutzte auch er ein Pseudonym.
Enrique jedoch blieb bei der Behauptung, mit Maya eine Liebelei gehabt zu haben. Er gab sogar explizite Details ihrer sexuellen Vorlieben preis, und Greta musste zugeben, dass er ziemlich exakt das beschrieb, was sie antörnte.
Dennoch legte sie den vermeintlichen Spanier unter der Rubrik »Wichtigtuer« ab. In dieser Schublade lagen all die Sportcoupé-Fahrer, Yachtbesitzer, Goldkettchen-Träger, verhinderten Rockstars, Amateurfotografen, Möchtegern-Gurus, Weltverbesserer und Muttersöhnchen.
Und gerade als sie sich mit dem Gedanken trug, sich von dem Portal abzumelden, flatterte Darius’ Kontaktmeldung ins virtuelle Postfach. Ein unverbindliches »Hallo«, ohne Gehabe, ohne Selbstbeweihräucherung, ohne übertriebene Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft. Allerdings mit dem dringlichen Wunsch, sie näher kennenzulernen.
Greta hatte sich mit ihrer Antwort Zeit gelassen, doch dann nahm alles seinen Lauf. Sie schrieben sich lange E-Mails, es folgten Telefonate, in denen sie kein Thema ausließen. Sie sprachen über ihre Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, über Wünsche, Träume, über das Leben im Allgemeinen und die Liebe im Besonderen. Greta hatte sich schon lange nicht mehr so verstanden, so seelenverwandt mit einem Menschen gefühlt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Wunsch nach einem persönlichen Treffen übermächtig wurde. Und ja, Greta hatte den ersten Schritt getan und Darius gefragt, ob er mit ihr etwas trinken gehen würde. Sie spürte es: Er war der Richtige. Zumindest konnte er es sein. Vielleicht. Sie musste es herausfinden.
Und nun war sie aufgeregt wie schon lange nicht mehr. Sie überprüfte abermals ihr Make-up, legte noch ein wenig Lippenstift auf, strich sich durch die Haare, warf ihrem Spiegelbild einen Handkuss zu und machte sich auf zum Alten Haus, wo sie Darius treffen wollte.
4
Am Tresen des Alten Hauses wechselte ein Briefkuvert den Besitzer. Ohne hineinzusehen, steckte Rafael den Umschlag in die Innentasche seines Sakkos und blickte sich nervös um.
»Wir müssen eine Pause machen«, flüsterte er seinem Nachbarn, der in Szenekreisen »der schöne Elias« genannt wurde, zu.
»Heute war bei uns die Polizei im Haus, und die Geschäftsleitung hat eine Rundmail verfasst, dass es auffällig sei, dass ausgerechnet Kunden unseres Instituts Opfer von Betrügern geworden sind. Alle sind angehalten, die Augen offen zu halten. Jeder Verdacht soll gemeldet werden. Seitdem bespitzelt jeder jeden.«
»Und?«, knurrte sein Gesprächspartner. »Gibt es schon einen Verdacht?«
Rafael zögerte. »Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist unwahrscheinlich. Ich habe sämtliche Spuren beseitigt. Ich weiß ja schließlich, wie man so etwas macht.«
Er deutete ein Lächeln an, das selbstbewusst wirken sollte, das jedoch sofort in sich zusammenfiel. Sein Partner, mit dem er, der Not gehorchend, zusammenarbeitete, klopfte ihm anerkennend auf den Rücken.
»Na also. Dann kann doch nichts passieren.«
Elias nippte an seinem Wodka Lemon, fischte einen Eiswürfel aus dem Glas und steckte ihn in den Mund.
»Noch drei, vier Adressen. Dann können wir über eine Pause nachdenken. Es ist ja auch zu deinem Besten, mein Freund. Unser kleiner Deal entspannt unsere Beziehung. Außerdem habe ich mir erlaubt, deiner Provision einen kleinen Bonus beizulegen. Als Motivationsspritze sozusagen. Astreiner Stoff übrigens.«
Er legte die Hand auf Rafaels Sakko, auf die Stelle, wo er den Briefumschlag vermutete. Dass er den jungen Möchtegern-Dandy beteiligte, war reine Nächstenliebe. Normalerweise ging er mit seinen Kunden, die ihre Kredite nicht rechtzeitig zurückbezahlen konnten, nicht so zimperlich um. Für Elias gab es ein unumstößliches Geschäftsprinzip: Eine pünktliche Lieferung von einwandfreier Ware musste pünktlich bezahlt werden. Und wer ihn zu lange auf sein Geld warten ließ, dem musste geholfen werden, sich zu erinnern, mit welchem Geschäftspartner er es zu tun hatte. Ein mit einem Flaschenöffner gebrochener Finger oder der nächtliche Überraschungsbesuch in der Wohnung des Schuldners bewirkte oft wahre Wunder und beschleunigte den Zahlungsprozess kolossal.
Diese kleine Koksnase neben ihm jedoch, Sohn eines ehemaligen Schulfreundes und langjährigen Weggefährten, erinnerte ihn an die Zeit, als er in vollem Saft stand. An die Zeit, als die Frauen Nummern zogen, um mit ihm ins Bett zu kommen. Weil er eine große Nummer war. Im Bett, im Geschäft, im Leben und überhaupt.
Rafael war natürlich weit entfernt davon, eine große Nummer zu sein, aber er liebte das Leben mit allen Freuden, die es zu bieten hatte, und er war bereit, einiges dafür zu tun, um der Erbärmlichkeit seines täglichen Tuns als Banker zu entfliehen. Der Junge hatte Potenzial, das gefiel Elias. Da war er ganz wie sein Vater, der leider viel zu früh einer schweren Krankheit erlegen war. Und der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass sein Sohn den Schwanz einziehen wollte, obwohl es nicht den geringsten Grund dafür gab.
Rafael sah sich um und wischte Elias Hand beiseite.
»Es ist zu gefährlich. Die Kollegen sind jetzt auf der Hut. Lass uns eine Auszeit nehmen. Bis sich die Wogen geglättet haben.«
Seine letzten Worte fielen zu betont aus, doch offensichtlich hatte kein anderer Gast Notiz davon genommen. Lediglich eine attraktive Frau, die mit einem Mann an einem Tisch in der Nähe saß, hatte kurz in seine Richtung gesehen. Er machte eine beschwichtigende Geste, sie quittierte es mit einem Lächeln, dann wandte sie sich wieder ihrem Begleiter zu. Der Typ war um diese Frau zu beneiden, fand Rafael. Sie sah umwerfend aus.
Im nächsten Moment spürte er Elias’ Griff im Nacken, der ihn wieder in die Realität zurückholte. »Jetzt pass mal auf, mein Freund. Wann wir eine Auszeit nehmen, bestimme immer noch ich. Oder fällt dir eine andere Möglichkeit ein, wie du deinen Kredit bei mir abzahlen willst?«
Der Schmerz im Nacken nahm zu, und Rafael unterdrückte mit Mühe den Impuls zu schreien. Seine Gedanken wirbelten wild durcheinander, und er wurde sich immer mehr der Aussichtslosigkeit seiner Lage bewusst. Der Typ neben ihm hatte ihn in der Hand. Wenn Rafael sich weigerte, ihn weiter mit Adressen von wohlhabenden alten Menschen zu versorgen, die er mit einem simplen, aber wirkungsvollen Telefontrick um ihr Geld erleichtern konnte, dann bedeutete das Abschiednehmen vom sorgenfreien Leben, von all den Annehmlichkeiten, die er mit dem geliehenen Geld beschafft hatte: Von dem Glücksrausch, der ihm von dem weißen Stimmungspulver verschafft wurde. Von seinem Triumph Spitfire, dessen aufwändige Restaurierung ein Vermögen verschlungen hatte. Von der eleganten Sitzgarnitur von Rolf Benz, von dem exklusiven Wasserbett, dem Chronographen von Tag Heuer, den maßgefertigten Hemden und Schuhen, von der modernen Computeranlage. Von den Geschenken für seine Verlobte ganz zu schweigen.
Roxane war eine Markenfetischistin, und zwar in allen Belangen. Sie liebte es zu shoppen, auch wenn das bei ihrem mageren Gehalt als Hotelfachfrau kaum möglich war. Ihr Traum war es, alle Länder dieser Erde zu bereisen, natürlich nicht mit Wanderstiefeln, Rucksack und Zweimann-Zelt. Nein, es musste schon etwas luxuriöser sein: Ein Hotel, das weniger als vier Sterne aufwies, galt in ihren Augen als Absteige.
Rafael liebte es, seine Freundin glücklich zu sehen. Also erfüllte er ihr fast jeden Wunsch. Mit Geld, das er nicht besaß und das er von seiner Bank auch nicht mehr bekam. Das er sich leihen musste, zu den ungünstigsten Konditionen, die man sich nur vorstellen konnte. Von einem Typen, der in der Ober- wie in der Unterwelt zu Hause war und der neben astronomischen Zinsen auch noch verlangte, dass Rafael ihn mit Daten von Bankkunden versorgte. Bei Geschäften hörte bei Elias die Freundschaft auf. Da bestimmte er die Regeln und sonst keiner.
Zunächst hatte alles problemlos funktioniert. Das Kreditinstitut hatte seiner Marketingabteilung aufgetragen, alle Kunden mit einem hohen Guthaben anzuschreiben, dass auf Beträge über 10 000 Euro ab Oktober ein Strafzins fällig werde. Damit gab die Bank die Kosten weiter, die ihr von der Europäischen Zentralbank aufgebürdet worden waren. Ein Guthaben zu haben, einst mit dem Gefühl der Sicherheit verbunden, war längst zum Makel geworden. Die Menschen sollten nicht sparen, sondern konsumieren. Es galt, das große Mühlrad der Konjunktur am Laufen zu halten, auf dass für jeden genug Krumen abfielen.
Allen ökonomischen Erwägungen zum Trotz empfand es Rafael als Ungerechtigkeit, dass Sparer für ihre Umsicht bestraft wurden. Die ihn maßlos aufregte, auch wenn er noch nie einen höheren Betrag besessen hatte. Und so hatte er sich nur einmal in Elias’ Gegenwart hinreißen lassen, sich laut darüber zu echauffieren, und seinen Partner auf eine Geschäftsidee gebracht.
»Dann helfen wir diesen Menschen, ihr Geld loszuwerden. Dann haben alle etwas davon«, hatte er gesagt und Rafael in seinen Plan eingeweiht.
Vor allem auf ältere Menschen, die auf das Schreiben reagierten und höhere Geldbeträge abhoben, hatte es Elias abgesehen. Rafaels Aufgabe bestand darin, Bescheid zu geben, wenn ein potenzielles Opfer dem Anliegen der Bank nachgekommen war.
Ein Kinderspiel. Als Mitarbeiter der Marketingabteilung hatte Rafael Einsicht in die Kundendatenbank des gesamten Unternehmens, und da er mit der Erfolgsüberwachung der Aktion betraut war, konnte er alle Kontobewegungen überprüfen, ohne Verdacht zu erwecken.
Der schöne Elias übernahm den Rest. Er nahm telefonisch Kontakt zu den Opfern auf, ersann eine Lügengeschichte und organisierte die Geldübergabe.
Rafael wurde mit fünfzehn Prozent an der ergaunerten Summe beteiligt. Ein Drittel davon erhielt er in bar, der Rest wurde mit seinem Kredit verrechnet. Ab und zu fiel ein Päckchen mit dem pulverförmigen Stimmungsaufheller für ihn ab.
Elias wusste genau, wie er seine Mitarbeiter gefügig machen konnte, und einmal mehr wurde sich Rafael bewusst, dass er keine andere Wahl hatte, als das zu tun, was Elias von ihm wollte.
»Okay, gut«, murmelte er, »du bekommst die Adressen. Aber wir müssen das Einsatzgebiet erweitern. Damit der Verdacht auf mehrere Filialen gestreut wird. Schlecht wäre es auch nicht, wenn man einen Hackerangriff simulieren könnte. Ich meine, du kennst doch bestimmt Leute …«
Der schöne Elias lockerte seinen Griff, tätschelte Rafaels Wange und lächelte. »Du machst das schon. Am besten gehst du kurz zur Toilette, puderst dir die Nase und denkst noch einmal über alles nach. Dann fällt dir sicher etwas ein.«
Elias stand auf, trank sein Glas aus und stellte es auf den Tresen.
»Er zahlt«, bellte er in Richtung des Barkeepers und raunte Rafael zu: »Und das gilt nicht nur für den Drink, mein Freund.«
5
»Es war wirklich ein schöner Abend. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mich zuletzt so gut unterhalten habe.«
Greta Gerber sah Darius liebevoll an, hob die Hand, um ihm über die Wange zu streichen, besann sich jedoch darauf, dass sie diesen Mann erst seit ein paar Stunden persönlich kannte und dass er eine solche Geste als zu intim empfinden konnte. Sie erstarrte in der Bewegung und zupfte sich verlegen am Ohrläppchen.
»Ging mir genauso. Es war, als würden wir uns schon ewig kennen.«
Darius lächelte und senkte den Blick.
Von der Stadthalle her war das Johlen von Jugendlichen zu hören, die den lauen Temperaturen huldigten, indem sie sich im Freien betranken und den Sternen ihre Lust am Leben zugrölten.
Greta fühlte sich von dem Geschrei um den romantischen Abschluss ihres Treffens betrogen und zog eine genervte Grimasse. Wie gerne hätte sie Darius zu sich nach Hause auf die obligatorische Tasse Kaffee eingeladen, ihre Wohnung lag nur wenige Gehminuten vom Marktplatz entfernt. Doch dann hätte er ihren Schwindel mit dem falschen Namen bemerkt, und sie hätte das Prickeln, das sie schon den ganzen Abend verspürt hatte, durch erklärende Worte zerstören müssen. Womöglich würde ihr Darius den Betrug nicht verzeihen und sich nie wieder melden, und das wiederum würde sie sich niemals verzeihen. Der richtige Moment würde schon noch kommen, um ihm die Wahrheit zu sagen. Aber wenn er sie jetzt fragen würde, ob sie mit zu ihm käme …
»Gut. Es ist wohl besser, wenn ich mich jetzt verabschiede. Ich habe morgen einen langen Arbeitstag vor mir und muss sehr früh raus«, sagte er.
Greta nickte und kämpfte gegen die aufwallende Enttäuschung an. Vernunft belegte im Eigenschaftsranking, nach dem sie ihren Traummann bewertete, einen der hinteren Plätze. Sie streckte Darius die Hand zum Abschied entgegen. Er ergriff sie, zog Greta an sich und presste seine Lippen auf die ihren. Greta war zu überrascht, um den Kuss erwidern zu können. Darius löste sich von ihr, machte einen Schritt zurück und blickte betreten drein.
»Entschuldigung«, murmelte er nach eine Weile. »Es war … ich dachte …«
»Es ist okay«, erwiderte Greta leise.
»Sehen wir uns wieder?«
Die Frage trug etwas Flehendes in sich, als wollte er Abbitte leisten für den etwas zu ungestümen Versuch, sie zu küssen. Dabei hätte Greta sich sehr gern von ihm küssen lassen, genau in diesem Moment. Doch er kam ihr nicht näher, hielt Abstand und sah sie schweigend an.
»Ja, ich möchte dich sehr gern wiedersehen.«
Seine Miene erhellte sich, und das Funkeln in seinen Augen, das den ganzen Abend nur ihr gegolten hatte, glomm wieder auf.
»Schön, ich ruf dich an. Oder schreib dir eine Mail. Oder eine SMS, eine WhatsApp. Ach was, ich schicke eine Brieftaube. Was auch immer. Also, ich gehe jetzt. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.«
Er drehte sich rasch um und überquerte den Marktplatz mit raschen Schritten in Richtung Theaterstraße. Greta sah ihm lange nach und seufzte.
Sie schlenderte noch ein wenig durch die Gassen Biberachs. Zu viele Gedanken wirbelten in ihrem Kopf durcheinander. Darius war ein fantastischer Unterhalter, sah großartig aus, war charmant, besaß einen bestechenden Humor. Wie konnte es sein, dass so ein Prachtexemplar von einem Mann noch Single war? Natürlich hatte es in seinem Leben auch Beziehungen gegeben, einmal stand er sogar kurz vor einer Hochzeit. Doch am Ende hatten sich die Frauen immer für einen anderen entschieden. Warum? Waren seine Ex-Freundinnen zu dämlich gewesen, um zu erkennen, was er für ein Juwel war? Oder gab es etwas, was Greta übersehen hatte? Hatte er womöglich ein dunkles Geheimnis?
Greta grinste. Still und heimlich hatte sich der berufsbedingte Argwohn der Hauptkommissarin eingeschlichen, stets bereit, romantische Empfindungen zu meucheln. Im Grunde konnte sich Darius die gleichen Fragen zu Gretas Liebesleben stellen. Auch wenn sie das nie von sich behauptete hätte, war sie eine attraktive Erscheinung. Ihre Eltern hatten sie offenbar mit guten Genen ausgestattet, denn obwohl sie selten Sport machte, war sie schlank. Zudem mit genau dem richtigen Maß an weiblichen Rundungen ausgestattet. Sie war in der Lage, ein intelligentes Gespräch zu führen, war einfühlsam, verständnisvoll, tolerant …
Warum gelang es ihr nicht, eine dauerhafte Beziehung zu führen? Was stimmte mit ihr nicht, dass sie von den meisten Kerlen nach kurzer Zeit sitzengelassen wurde? Konnte nur der stressige und zeitraubende Beruf als Ausrede dienen? Verliebte sich Greta immer nur in die Falschen, so dass der Blick für den Richtigen blockiert war?
Vielleicht war das bislang so gewesen, aber bei Darius war es anders. Sie fühlte eine angenehme Wärme in sich aufsteigen, wenn sie sein Bild abrief, ein Kribbeln in der Magengegend, wenn sie an ihn dachte.
Wie an einem unsichtbaren Faden war sie zu ihrer Wohnung gezogen worden. Sie bog in die Zwingergasse ein, und wieder einmal fiel ihr auf, welche Ruhe dieser Ort, den sie vor Jahren zur ihrer Heimat erkoren hatte, ausstrahlte. Und diese Stille, die Unaufgeregtheit der Stadt übertrug sich auch auf die Menschen, die hier lebten. Die Oberschwaben waren weit entspannter als die Zeitgenossen, die sie in ihrer Zeit in Freiburg gekannt hatte, und diese Stressresistenz übertrug sich langsam auch auf sie selbst.
Sie kramte in ihrer Handtasche nach dem Haustürschlüssel, grub mit ihrer Hand in den unendlichen Tiefen herum, bis sie das metallische Klimpern vernahm.