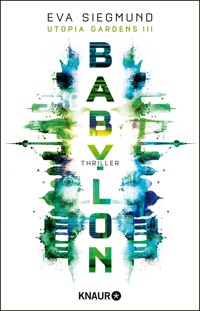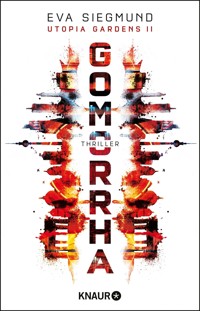
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Utopia Gardens
- Sprache: Deutsch
Berlin in einer nahen Zukunft: Wer sich nicht scheut, gegen rigorose Gesetze zu verstoßen, kann seinen Körper mithilfe illegaler Prothesen in eine tödliche Waffe verwandeln – oder ein Objekt der Lust. Diese Kriminellen werden »Cheater« genannt. Viele der Veränderten finden ihr Auskommen im größten Club der Welt, dem Utopia Gardens. In »Gomorrha« muss der junge Cop Birol feststellen, wie eng Rache und Schuld beieinanderliegen. Währenddessen verstrickt sich die zum Strafdienst verurteilte Modderin Raven immer tiefer in die Geheimnisse rund um einen verschwundenen Millionärssohn – und in dessen virtuelle Präsenz. Birol, seine Kollegin Laura und Raven müssen erneut in die Tiefen des Utopia Gardens eintauchen – wo alles käuflich und nichts real zu sein scheint. »Bedrohlich, abgründig und packend – sowohl der Plot, als auch die Charaktere. Mit Utopia Gardens hat Eva Siegmund ein atmosphärisches Thriller-Highlight geschaffen.« Anne Freytag »Gomorrha« ist der zweite Band der Thriller-Reihe »Utopia Gardens«. Die Techno-Thriller erscheinen in folgender Reihenfolge: · Sodom · Gomorrha · Babylon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eva Siegmund
Gomorrha
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In »Gomorrha« muss der junge Cop Birol feststellen, wie eng Rache und Schuld beieinanderliegen. Währenddessen verstrickt sich die zum Strafdienst verurteilte Raven immer tiefer in die Geheimnisse rund um einen verschwundenen Millionärssohn – und in dessen virtuelle Präsenz. Birol, seine Kollegin Laura und Raven müssen erneut in die Tiefen des Utopia Gardens eintauchen – wo alles käuflich und nichts real zu sein scheint.
Inhaltsübersicht
Silbermann
Ophelia
Lin
Raven
Ronny
Birol
Ophelia
Elster
Lin
Laura
Raven
Othello
Lin
Birol
Mikael
Laura
Raven
Birol
Raven
Laura
Raven
Birol
Othello
Ronny
Spencer
Laura
Raven
Birol
Laura
Cristobal
Raven
Birol
Spencer
Laura
Raven
Ronny
Hinnerk
Birol
Othello
Laura
Raven
Othello
Raven
Sky
Birol
Ronny
Raven
Ronny
Raven
Laura
Eugene
Othello
Laura
Sky
Silbermann
Birol
Raven
Laura
Der zwölfte Mann saß ihm gegenüber und blickte ihn abwartend an. Ganz ruhig und selbstbewusst. Er hatte diesen leicht misstrauischen Blick, den alle Menschen, die auf der Straße lebten, wie eine Rüstung trugen. Doch er lächelte, seine Körperhaltung war entspannt. Dieser Typ erwartete nichts Böses. Silbermann war neugierig, wie lange das wohl so blieb.
Dem Mann war noch nicht klar, was mit ihm passiert war – was sie ihm angetan hatten. Und dass er das Angebot eines Fremden, egal wie gut es gewirkt hatte, besser niemals angenommen hätte. Doch genau deswegen suchte er sich seine »Teilnehmer« ja immer an den kalten, feuchten Straßenrändern Hamburgs, einer Stadt, die ansonsten im Wohlstand erstickte. Weil die Wahl, vor die er sie stellte, für diese Menschen in Wahrheit gar keine war. Er konnte sie pflücken wie reifes Obst; nicht ein einziges Mal hatte jemand abgelehnt. Und darüber hinaus waren sie perfekt, weil sie niemand vermisste. Diese Leute starben sowieso täglich, vollkommen unbemerkt. Sie erfroren am Straßenrand, fielen betrunken in Elbe oder Alster, wurden ohne Ausweispapiere in irgendwelche Krankenhäuser eingeliefert. Wieder einer weniger. Wen kümmerte das schon?
»Herzlichen Glückwunsch!« Silbermann strahlte übers ganze Gesicht. So angestrengt, dass es wehtat. Sein Kopfschmerz begleitete ihn genauso treu und stetig wie der Wodka. Allmählich fiel es ihm schwer zu fokussieren.
»Sie haben es geschafft, das Ark-Projekt erfolgreich zu absolvieren.« Er senkte komplizenhaft die Stimme. »Darauf können Sie sich ruhig was einbilden. Das hat vor Ihnen noch so gut wie niemand geschafft.« Nicht einmal eine Lüge. Silbermann konnte sehen, dass sich der Mann geschmeichelt fühlte, es aber zu verbergen suchte. Auch das gehörte zur Vorsicht dieser Menschen ohne Meldeadresse. Sie wollten so unabhängig von anderen leben wie nur möglich. Sich weder von Schmeicheleien noch von Grausamkeiten beeindrucken lassen. Rätselhaft und unnahbar. Lob war ein Nebenprodukt von Hierarchie, und jegliche Form von Hierarchie lehnten sie ab. Das Exemplar, das er hier vor sich hatte, bildete da absolut keine Ausnahme.
Er lehnte sich, noch immer krampfhaft lächelnd, in seinem Stuhl zurück und wartete auf eine Reaktion seines Gegenübers. Das sich allerdings eine ganze Weile Zeit ließ. Man spürte, dass dieser Mann gerne die Oberhand hatte. Jemand war mit großer mentaler Stärke. Wahrscheinlich sein einziger Trumpf, aber den wollte er ausspielen.
Der Professor fragte sich, ob diese Stärke, der Überlebenswille, für die positive Übertragung ebenfalls eine Rolle spielte. Medizinisch gesehen war das zwar nicht plausibel, aber er hatte in seinen vielen Jahren der Praxis und Forschung mehr als einmal erlebt, wie eng Körper und Geist miteinander in Verbindung standen. Viele der Probanden, die er von der Straße geholt hatte, hatten ihr Leben vielleicht nicht ohne Grund verloren. Möglicherweise waren sie längst viel zu müde gewesen, um sich noch mit aller Macht daran zu klammern. Er beschloss, diesem Aspekt in Zukunft mehr Beachtung zu schenken.
Silbermann machte der Blick des Mannes allmählich nervös. Auf eine merkwürdige Art war es leichter, wenn die Probanden nicht überlebten, dachte er kurz. Das ersparte einem zumindest dieses Gespräch. Natürlich schämte er sich im nächsten Moment für seine Gedanken. Er hatte nicht gewollt, dass sie starben. Nie. Schließlich war er immer noch Arzt, Himmelherrgottnochmal.
Und nun hatte es – endlich! – wieder einer überlebt. Ein Mann, der nun den Raum mit seiner Stille komplett ausfüllte.
Der Mediziner hatte den Mann vor ein paar Minuten geweckt, nachdem er sich vergewissert hatte, dass seine Mitarbeiter die Lage richtig eingeschätzt hatten. Dass der Proband den Prozess tatsächlich gut überstanden und keinen größeren Schaden genommen hatte. Und wirklich: Es sah alles gut aus. Die Vitalwerte schienen normal, die Hirnströme waren auch in Ordnung, die Responsivwerte wirkten ebenfalls vielversprechend. Obwohl Silbermann es schon einmal geschafft hatte, hatte er nicht mehr daran geglaubt, es wiederholen zu können. Als wäre die erste gelungene Übertragung kein Ergebnis akribischer und jahrelanger Forschung und Entwicklung gewesen, sondern eine schicksalhafte Fügung. Wie ein biblisches Wunder. Doch nun hatte er den Beweis vor sich, dass er es tatsächlich in der Hand hatte. Dass er schon immer richtiggelegen und nun recht behalten hatte. Es war möglich. Und er, Gotthold Silbermann – ja, er war sich der Ironie seines Vornamens durchaus bewusst –, hatte es vollbracht. Als erster Mensch überhaupt hatte er die Konnektom-Theorie bewiesen. An einem Menschen. Er hatte sich etwas getraut, das bisher noch kein Wissenschaftler gewagt hatte.
Besonders bitter war allerdings, dass die wissenschaftliche Welt, seine Kollegen und Widersacher, die Zweifler und Neider, niemals davon erfahren durften. Weil er mit seinem Treiben die Grenzen der Gesetze und des ethisch Vertretbaren nicht nur gedehnt, sondern vollständig gesprengt hatte. Sie hatten ihn für seine Visionen schon immer angefeindet, und er war dem Ausschluss aus der Ärztekammer bereits zwei Mal nur knapp entronnen. Dabei würde das, was er tat, einmal der gesamten Menschheit zugutekommen. Er rettete mit seiner Arbeit Tausende, wenn nicht gar Millionen zukünftiger Leben. Doch das sahen sie natürlich nicht, kleingeistig und engstirnig, wie sie waren. Wenn bei so einer Arbeit überhaupt Versuche am lebenden Objekt durchgeführt wurden, dann stellte ein Wissenschaftler sich selbst zur Verfügung. So dachten sie. Dass, wenn es schiefging, mit dem Wissenschaftler auch dessen Brillanz und Arbeit vernichtet wurde, das sahen sie nicht. Sie lebten nach dem Grundsatz, dass jedes menschliche Leben gleich viel wert war, obwohl doch alle wussten, dass das nur Heuchelei war. Niemand sah es wirklich so, aber alle handelten danach. Und so musste er sich damit begnügen, sich Professor Schnees Reaktion vorzustellen und einstweilen abzuwarten.
Gerne hätte Silbermann behauptet, die Anerkennung seiner Kollegen sei ihm nicht wichtig – doch das entsprach nicht den Tatsachen; das Gegenteil war der Fall. Am liebsten wollte er seinen Triumph in die Welt hinausschreien. Sie sollten Straßen nach ihm benennen und Titelseiten mit seinem Gesicht drucken, verdammt. Er hatte es verdient. Weil er allein den Mut aufbrachte, es zu versuchen. Okay, bitte. Kannenberg hatte das Verfahren entwickelt, und auch er hatte vor nichts zurückgeschreckt, aber Kannenberg war tot. Wen kümmerte es noch, dass er den Großteil der Arbeit geleistet hatte? Er hatte bewiesen, dass er mindestens genauso herausragend war wie sein Mentor. Er hatte es sich selbst und ihr bewiesen.
Die Wirkung des Alkohols, den Silbermann kurz zuvor noch wie ein Häuflein Elend in einer Toilettenkabine stehend in sich hineingekippt hatte, war wie weggeblasen und hatte dem Gefühl absoluter Euphorie Platz gemacht. Endlich würde er wenigstens ihre Anerkennung bekommen; dann würde sich auch das enge Gefühl in seiner Brust verflüchtigen. Seine Existenz war nicht verflucht. Vielleicht konnte er heute Nacht ja sogar wieder schlafen.
Sie hatten den Pausenraum der Assistenten als Ort für das Gespräch ausgewählt, weil er am wenigsten über ihren Aufenthaltsort verriet. In dem fensterlosen Zimmer standen lediglich ein Tisch mit sechs schlichten Stühlen und an einer Wand ein schmales Sideboard mit Wasserkocher, Kaffeemaschine und ein paar Tassen. Dieser Raum konnte sich wirklich überall auf der Welt befinden. Silbermann wollte verhindern, dass der Mann voreilige Schlüsse zog oder übermäßig nervös wurde.
Sein Assistent Sönke Rehlein stand hinter ihm und trat vor Ungeduld von einem Bein auf das andere. Dabei quietschten die Schuhsohlen auf dem alten Linoleumboden, der überall auf der Marianne, dem geheimen Forschungsschiff von SanderSolutions, verlegt war. Rehlein steckte beinahe genauso tief drin wie Silbermann, nur hatte er nie etwas von echter Relevanz beigetragen, was Silbermann zu gleichen Teilen nervte wie gelegen kam. Sönke war ein Speichellecker, ein Kaffeefleck auf einem blütenweißen Hemd, aber solche Typen gehörten dazu. Schließlich konnte Silbermann nicht die ganze Arbeit alleine machen, wollte aber, dass die Lorbeeren ihm alleine zufielen. Da kam man um Handlanger wie Sönke einfach nicht herum. Auch wenn es ihn rasend machte, dass sein Assistent eine dicke, runde Hornbrille auf der Nase trug – wahrscheinlich, um intellektueller zu wirken, als er war – in Zeiten, in denen man sich jede Sehschwäche in wenigen Minuten weglasern lassen konnte. Es würde ihn nicht einmal wundern, wenn in der Brille nur Fensterglas verklebt wäre.
»Was ist denn mit dem los?«, fragte der zwölfte Mann plötzlich amüsiert und zeigte auf Sönke, als hätte er Silbermanns Gedanken gelesen. »Muss der mal pinkeln?«
Silbermann lächelte. Nicht, weil er den Mann witzig oder sympathisch fand, sondern weil diese Aussage reichte, ihm zu beweisen, dass das Bewusstsein des Probanden keinen Schaden genommen hatte. Ironie und Humor gehörten zum Kern eines jeden menschlichen Wesens. Wenn diese Fähigkeiten mit übergegangen waren, dann war der Prozess perfekt.
Er drehte sich zu seinem Assistenten um. »Sönke, würdest du uns bitte einen Augenblick alleine lassen?«
Rehleins Gesichtszüge fielen in sich zusammen, seine Enttäuschung war offenkundig groß. Natürlich. Auch er hatte diesem Projekt schon jetzt viele Jahre geopfert und wollte dabei sein, wenn die Früchte ihrer Arbeit geerntet wurden. Doch weil er schon während seines Studiums kaum Ambitionen gezeigt hatte, war er nun derjenige, der Weisungen entgegennahm. Trotzdem sah er dabei aus, als hätte er auf eine Zitrone gebissen. Und das war auch der Grund, warum es Silbermann besonderen Spaß machte, ihn wegzuschicken.
»Sag der Chefin Bescheid. Sie soll hier runterkommen, sobald sie kann.«
Sönke nickte knapp und verschwand wortlos durch die niedrige Stahltür. Manchmal vergaß Silbermann, dass sie sich auf einem Schiff befanden. Die kleinen Türen mit ihren abgerundeten Ecken erinnerten ihn dann wieder daran. Und seinem Gegenüber fielen sie ebenfalls auf.
Der zwölfte Mann runzelte die Stirn. »Sagen Sie mal, Doc. Wo sind wir hier eigentlich?«
»Das kann ich Ihnen leider nicht verraten«, antwortete Silbermann freundlich.
»Streng geheim also?«
Der Professor nickte und fuhr fort, den Mann eingehend zu mustern. Vor der Übertragung hatten sie ihn gewaschen und frisiert, hatten ihm die langen Haare und den Bart abgenommen. Darunter war ein Gesicht mit durchaus angenehmen Zügen zum Vorschein gekommen. Der Mann war jünger, als Silbermann auf den ersten Blick gedacht hatte. Er war noch ziemlich fit, vom Leben auf der Straße nicht so gezeichnet. Und, wie alle echten Hanseaten, nicht sonderlich gesprächig.
Silbermann wandte sich den Unterlagen zu, die vor ihm auf dem Tisch lagen. Es war der Vertrag, den seine Mitarbeiter vor der Übertragung mit dem Mann geschlossen hatten. Daraus ging hervor, dass er tatsächlich noch ziemlich jung war.
»Thomas Hegel«, las er laut vor. »Geboren im Universitätsklinikum Kiel – vor neunundzwanzig Jahren.«
Hegel nickte. »Kann ich nicht abstreiten.«
Silbermann kniff die Augen zusammen. »Sie wirken wie ein gescheiter Kerl. Und Sie sind noch jung. Wie sind Sie auf Hamburgs Straßen gelandet?«
Der Mann zuckte die Schulter. »Was kümmert Sie das denn? Wenn Sie mich auszahlen, werde ich ganz sicher nicht mehr dahin zurückkehren. Warum also darüber reden? Sie sind weder mein Therapeut noch meine Mutter.«
Oh, dachte Silbermann. Der längste Satz bisher. Wahrscheinlich hatte er einen wunden Punkt bei dem Mann erwischt.
»Natürlich.« Der Professor griff nach einem Blatt Papier und einem Kugelschreiber. Jetzt kam der kniffelige Teil des Gesprächs. »Doch bevor wir Sie auszahlen und in Ihr neues Leben entlassen können, müssen wir Sie eine Weile beobachten. Wir können es noch nicht verantworten, Sie vor die Tür zu setzen. Ich muss sichergehen, dass alles glattgelaufen ist.«
»Also mir geht es gut«, sagte Hegel. »Außerdem stand in dem Vertrag nichts davon, dass ich hinterher noch hierbleiben muss.«
Silbermann zog die Brauen hoch. »Sie haben den Vertrag gelesen?«
»Natürlich. Würden Sie etwas unterschreiben, das Sie nicht gelesen haben?«
Silbermann lachte nervös. Seines Wissens nach war das eine weitere Premiere. »Vermutlich nicht. Aber ich bin auch kein Anwalt, sondern Arzt, und es ist meine ärztliche Pflicht, sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht und alles in Ordnung ist. Also. Verraten Sie mir ganz genau, wie Sie sich fühlen.«
»Ich sagte doch schon, ich fühle mich gut!«
»Keine Kopfschmerzen?«, hakte Silbermann nach. Doch der Mann verneinte.
»Wie steht es um Ihre Arme und Beine? Tut da irgendwas weh?«
Hegel schnaubte ungeduldig. »Ich sagte Ihnen doch schon, dass es mir gut geht.«
Silbermann überlegte kurz. Sollte er es wirklich wagen? Das letzte Mal hatte Frau Sander es ihm verboten, doch das waren andere Umstände gewesen. Hegel war alleine sein Werk, und die Chefin war noch nicht hier. Der Professor beschloss, es zu riskieren. Er musste es einfach wissen.
»Tun Sie mir einen Gefallen und kneifen sich mal in den rechten Oberschenkel.«
»Aber warum …?«
»Seien Sie einfach so nett«, forderte Silbermann freundlich.
»Wenn es Sie glücklich macht«, brummelte Hegel.
Der Professor hielt den Atem an und beobachtete das Gesicht des jungen Mannes ganz genau.
Zuerst wirkte es noch aufgeräumt, unbekümmert und vollkommen arglos. Dann breitete sich allmählich leichte Verwirrung in Hegels Zügen aus.
»Was zum …?«
»Versuchen Sie es nur!«, forderte Silbermann freundlich. »Oder gibt es ein Problem?«
Er blickte den jungen Mann abwartend an, dem allmählich nackte Angst in die Augen kroch. Nun war Silbermann doch froh über den Wodka, der noch immer wärmend seine Adern durchströmte und die Emotionen unterdrückte. Sonst wäre er wahrscheinlich vor Aufregung und Unbehagen aus der Haut gefahren.
»Was ist das für eine Scheiße?«, murmelte Hegel, seine Augäpfel zuckten panisch hin und her.
Silbermann wusste, was in dem Mann vorging. Er versuchte, seine Gliedmaßen zu lokalisieren. Doch er würde sie nicht finden.
»Wieso fühle ich meine Beine nicht??!« Hegels Stimme wurde lauter. Silbermann wusste, dass Hegel aufspringen würde, wenn er könnte. Konnte er aber nicht.
»Fühlen Sie Ihre Beine nicht, oder können Sie sie nur nicht ertasten?«, hakte Silbermann nach.
Hegel hielt inne und runzelte die Stirn. »Ich kann sie nicht ertasten«, sagte er nach einer Weile langsam. »Aber ich … ich weiß, dass sie da sind.«
Silbermann lächelte und lehnte sich zufrieden zurück. Wunderbar. Genau so sollte es sein.
»Was grinsen Sie so dämlich?«
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken«, überging Silbermann die Frage Hegels gelassen. »Sie werden sich mit der Zeit daran gewöhnen.«
»Wie zur Hölle soll ich mich daran gewöhnen?!« Hegel wurde laut. Er warf den Kopf hektisch hin und her, sein Blick schoss suchend durch den Raum und blieb schließlich an der Tür hängen.
»Scheiße, ich hab genug von Ihnen. Stecken Sie sich Ihr Geld sonstwo hin. Ich bin raus hier.«
»Sie werden nirgendwo hingehen«, erwiderte Silbermann ruhig. Er schätzte, dass seine mangelnde Impulskontrolle Hegel in heftige Probleme gestürzt hatte, die ihn letztendlich auf der Straße hatten landen lassen. Das würde die Zusammenarbeit mit ihm erschweren.
Es klopfte an der Tür, und Sönke schlüpfte zurück in den Raum.
»Und?«, fragte der Professor, ohne sich nach seinem Assistenten umzudrehen. »Kommt sie?«
»Ich fürchte, nein.«
»Was meinst du damit?« Nun drehte er sich doch zu Sönke um.
»Die Chefin und Könighaus sind nicht hier. Keiner weiß, wo sie hin sind. Ich habe ihre Assistentin und am Empfang gefragt, niemand konnte mir Näheres sagen. Nur, dass die beiden vor drei Stunden die Zentrale verlassen haben.«
Silbermann schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, und sowohl Hegel als auch Sönke zuckten zusammen.
»Wunderbar! Einfach großartig.« Er schnaubte verärgert. Da war ihnen in ihrem Projekt der ultimative Durchbruch gelungen, und jetzt war die Frau, die für all das die Verantwortung trug, ihn getriezt und zu Unaussprechlichem verleitet hatte, nicht einmal im Haus, um es mitzubekommen. Er atmete einmal tief durch und mahnte sich zur Ruhe.
Eigentlich war es ja auch nicht so wichtig. Sie würde schon noch davon erfahren. Und Hegel würde ihnen nicht weglaufen. Wie sollte er auch?
»Habt ihr euch um den Körper gekümmert?«, fragte er seinen Assistenten leise, und dieser nickte. »Selbstverständlich.«
»Gut. Dann schlage ich vor, wir nutzen die Gunst der Stunde. Die Katze ist aus dem Haus, also können die Mäuse heute auch mal ein bisschen früher nach Hause gehen. Zur Feier des Tages.«
Sönke lächelte. »Eine hervorragende Idee.«
»Wie jetzt?«, fragte Hegel aufgebracht. »Ihr wollt nach Hause gehen? Einfach so? Und was ist mit mir?«
Silbermann lächelte verschlagen. »Sie können in der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen abschalten. Das haben Sie sich wirklich verdient.« Manchmal fand er sich selbst unerträglich geistreich.
»Abschalten?!«, schrie Hegel. »Wie zur Hölle soll ich denn abschalten? Ich fühle meine scheiß Beine nicht!!«
»Es wird leichter fallen, als Sie jetzt denken«, antwortete Silbermann freundlich.
Dann streckte er die Hand aus und brachte Hegel zum Schweigen.
Alles in diesem Haus roch nach Anstrengung und Versagen, und sie hasste es. Da hatte das viele Putzen auch nicht geholfen, das Scheitern drückte sich durch jede einzelne Steckdose des gesamten Anwesens. Die Villa war neu und dennoch nur kurze Zeit bewohnt gewesen. Von Leuten, die sich finanziell verhoben hatten; das verrieten ihr die Details. Sie hatte ein Auge für Fehler, auch wenn sie noch so klein waren. Ophelia erkannte Schwachstellen, bei Menschen ebenso wie bei Gebäuden wie diesem. Sauteures Parkett, aber billige Lichtschalter von der Stange. Der Versuch, am Ende der Bauphase die Kosten zu drücken in der Hoffnung, es würde niemandem auffallen. Doch Ophelia entging nichts. Sie sah die Familie förmlich vor sich, sah ein junges Ehepaar mit hochgezogenen Schultern und verkniffenen Gesichtern.
Bauherren, die sich verrechnet hatten. Die unbedingt ganz oben hatten mitspielen wollen. Und jetzt versuchten, sich mit der Verkaufssumme wenigstens ihr altes Leben wieder zurückzuholen, während sie hofften, dass anderen nicht auffiel, dass sie ihre Schuhe nun länger trugen, als für diese Wohnlage angemessen war. Es bestand offenbar Zeitdruck, sonst hätte der Makler ihnen wohl kaum einen Besichtigungstermin am Tag des Anrufs angeboten, was zu einer ziemlich gehetzten Fahrt von Hamburg nach Berlin geführt hatte. Sie konnte Eile nicht ausstehen, aber in diesem Fall war sie notwendig. Die Gelegenheit war zu günstig.
Mit verschränkten Armen ging sie durch den großen Wohnraum, der sich hinter dem Küchenblock zum Garten hin öffnete. Vielleicht würde das Geld, das sie für diese Immobilie zu zahlen gedachte, bald bei einer Scheidung durch zwei geteilt. Lief das nicht immer so? Und obwohl es jeder wusste, heirateten und verschuldeten die Menschen sich immer noch, weil sie die Arroganz besaßen zu glauben, dass so was immer nur anderen passierte.
Ophelia sah den massiven Holztisch regelrecht vor sich, an dem sich die Verkäufer gestritten und zerrieben hatten. Handgefertigt mit Holz aus Brandenburg. Sicher Platz für zwölf Gäste und niemals voll besetzt. Sie konnte wetten, dass er über die Terrasse herein- und wenig später wieder hinausgetragen worden war. Vielleicht von neuen Eigentümern, weil er aus Platzgründen nicht mit hatte umziehen können. Ihr sollte das nur recht sein. Karma war eine Maßeinheit, die in ihrem Leben nicht vorkam.
Im Leben des Maklers offenbar auch nicht, denn der raubte ihr noch den letzten Nerv. Und sie hatte ohnehin kaum noch Nerven übrig nach den vergangenen Tagen. Oder Geduld. Oder ein Lächeln. Gut, Geduld hatte sie eigentlich nie.
Ihre Finger strichen gedankenverloren über die Bandagen an ihren Händen. Sie wusste, wie das alles für einen Außenstehenden wirken musste. In den Augen des Maklers war sie eine unglückliche, reiche Frau, die versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, und vor der gesellschaftlichen Schmach jetzt nach Berlin floh. Dass nicht etwa Rasierklingen, sondern die Scherben eines von ihr selbst zertrümmerten Fitnessstudiospiegels die Ursache für ihre Verletzungen waren, konnte er schließlich nicht wissen. Und der Makler bekämpfte sein Unbehagen durch aufgesetzte Fröhlichkeit. Zu viel aufgesetzte Fröhlichkeit.
Alles, was sie wollte, war, dass er die Klappe hielt. Doch zu ihrem großen Unglück konnte sie ihm das nicht sagen, weil sie in gewisser Weise auf ihn angewiesen war.
»Wirklich, Sie haben unwahrscheinliches Glück. Villen wie diese gibt es in Berlin kaum noch auf dem freien Markt. Die Stadt wächst und wächst, das internationale Publikum …« »Wir wissen Ihre Bemühungen wirklich sehr zu schätzen«, fiel ihm Ronny Könighaus ins Wort. Gott sei Dank. Ihr Mann fürs Grobe hatte ein erstaunliches Gespür für die Feinheiten ihrer Launen entwickelt.
Vielleicht aber auch nicht, dachte Ophelia, als er plötzlich ihre Hand ergriff. Sie versteifte sich und strich das Lob gleich wieder aus ihrem geistigen Protokoll. Warum hatte sie dieser dämlichen Idee bloß zugestimmt?
»Meine Frau und ich suchen dringend nach einem ruhigen Haus in Stadtnähe und sind sehr interessiert. Der Zustand ist ausgezeichnet und die Lage sehr reizvoll. Hier ist auch genügend Platz für unsere beiden Kinder.«
Ophelias Nackenhaare stellten sich auf, und ihr rechtes Auge zuckte. Kinder? Hatte der Lack gesoffen?
Könighaus schien ihren Unmut zu spüren, denn er drückte ihre Hand eine Spur zu fest, und sie zischte leise, konnte sich einen giftigen Kommentar aber gerade noch verkneifen. Stattdessen lächelte sie, so gut sie konnte, und wusste insgeheim, dass es für den Makler erkennbar aufgesetzt wirken würde. Doch es blieb ihr nichts anderes übrig. Wenn sie Glück hatte, führte er ihr gekünsteltes Lächeln auf ihren bedauernswerten Allgemeinzustand zurück.
Die Wahrheit war: Sie brauchte dieses Haus, und in einem Punkt hatte dieser unausstehliche Typ leider recht – der Markt in Berlin war wie leer gefegt. Also musste sie freundlich sein zu dieser Schießbudenfigur. Ihr einziger Trost war, dass der Typ wenigstens nicht für sie arbeitete.
Sondern für eine der unzähligen Immobilienfirmen der Stadt. Dass er überhaupt für jemanden arbeitete, fasste sie als Beleidigung auf. Ophelia Sander war eigentlich Chefsache. Doch eine Firma wie diese hatte es nur mit Menschen zu tun, die Chefsache waren, und außerdem war sie inkognito hier. Trotzdem war sie nicht gerne in der Gesellschaft von Handlangern.
Zum Glück hatte sie beinahe unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Für jemanden mit so viel Geld wurden Dinge möglich gemacht. Anders war sie es nicht gewohnt. Doch auch sie konnte keine passende Immobilie aus dem Boden stampfen lassen. Ihr lief die Zeit davon, und diese hier war zumindest akzeptabel. Auch wenn sie für ihre Zwecke eigentlich zu viele Fensterfronten aufwies und sie mit dem Architekten gerne ein Wörtchen über seine Wahl der Bodenbeläge gewechselt hätte. Hatten die Leute nicht irgendwann mal genug von Fischgrätparkett?? Aber die Hanglage war perfekt; etwas, das in Berlin den Seltenheitswert eines siamesischen Zwillingspaares aufwies. Außerdem gab es so gut wie keine Nachbarn, da waren die großen Fenster auch schon egal.
Sie trat an die enorme Glasfront, von der aus man einen erhöhten Blick auf den weitläufigen Garten hatte, der gottlob zu allen Seiten von hohen Bäumen und geschmackvollen Hecken eingefasst war. Trotz der offensichtlich intensiven Pflege wirkte der Garten kalt und abweisend, was aber auch an der Stadt selbst liegen konnte. Der Himmel war auf eine Art grau, die sie nur aus Berlin kannte. In ihrer Erinnerung hatte sich genau dieses Grau über ihre Kindheit gespannt. Es war weniger eine Farbe als vielmehr ein Gefühl, dem sie nicht entkommen konnte. Sie war die letzten Jahre immer nur davor geflohen. Und jetzt war sie wieder hier und starrte auf etwas, das wohl bald ihr gehören würde. Als wäre sie die ganze Zeit einfach nur im Kreis gelaufen.
Ophelia bewegte sich schon ihr ganzes Leben lang in der oberen Gesellschaft, und ihr Gehirn konnte anerkennen, dass der Garten kenntnisreich angelegt und sehr gepflegt und alles am gesamten Anwesen hochwertig war, wenn man von der schlampigen Detailarbeit einmal absah.
Ihr Bruder könnte wohl die Designer runterbeten, die hier am Werk gewesen waren. Kannte vermutlich die Leute, die hier verkauften, oder hatte zumindest ihre tragische Geschichte gehört. Er hatte schon immer einen Sinn für Klatsch und Tratsch gehabt. Überhaupt war er geselliger, als sie es jemals gewesen war, weshalb er sie in puncto Beliebtheit auch stets übertrumpft hatte. Othello Sander war ein Mann, der einen gesamten Raum unterhalten konnte. Die Menschen um ihn herum neigten dazu, ihm mit zur Seite gekippten Köpfen verzückt zu lauschen, nur um dann im passenden Moment in anerkennendes Gelächter auszubrechen.
Ihr wurde heiß, wenn sie an Othello dachte. Es war seine Schuld, dass sie diese Scharade abziehen mussten, seine Schuld, dass sie überhaupt zurück war in dieser Drecksstadt. Seine Schuld, dass jetzt nur der Norden Berlins für einen Wohnsitz infrage kam, weil er im Süden wohnte. So wie alle Leute bei Verstand im Süden von Neuberlin wohnten. Sie hasste den Norden. Hier roch es immer noch, nach all den Jahren, nach Kleinbürgertum und Studenten. Insofern passten die billigen Baumarktsteckdosen ziemlich gut hierhin. Es war die älteste Gegend Neuberlins, und an einigen Stellen war der Lack schon ziemlich ab.
Der Garten verschwamm vor ihren Augen, und in ihren Ohren begann es zu rauschen. Seit zehn Jahren hatte sie ihren Bruder nicht gesehen. Und sie hätte es vorgezogen, ihn niemals wiederzusehen, nicht einmal dieselbe Stadtluft zu atmen. Doch er ließ ihr keine Wahl. Was er getan hatte, war nicht zu entschuldigen. Er hatte ihr das Liebste genommen, was sie auf der Welt besessen hatte.
Othello hatte ihr ihn weggenommen. Sky.
Nur deshalb war sie wieder hier.
Könighaus war zwar der Auffassung, es könnte auch noch ganz anders sein, mahnte sie zur Besonnenheit, doch auf dem Ohr war sie taub. Ophelia kannte ihren Bruder – sie wusste genau, dass er dahintersteckte. Irgendwie musste er herausgefunden haben, dass sie doch noch ihrer wahren Liebe begegnet war. Und Othello hatte es noch nie ertragen, sie glücklich zu sehen.
Doch Ophelia würde sich diesmal nicht einfach verkriechen, würde sich nicht verjagen lassen. Das war vorbei. Sie würde Sky nach Hause holen, wo er hingehörte. An ihre Seite. Koste es, was es wolle.
Und dann würde sie sich endlich an ihrem Bruder rächen. Etwas, das sie schon vor Jahren hätte tun sollen. Sie wollte, dass er litt.
»Ich habe für dieses Objekt natürlich eine Reihe von Interessenten, mein Postfach quillt quasi über«, hörte sie den Makler sagen. »Auch wenn Sie die ersten sind, die einen Blick darauf werfen dürfen, heißt das leider noch lange nicht …«
Ophelia drehte sich abrupt um, und der Makler zuckte unter ihrem Blick zusammen.
»Wie viel?«, fragte sie und bemerkte aus dem Augenwinkel, wie Ronny Könighaus in sich zusammensackte. Sie hatte sich von ihm überreden lassen, als Ehepaar aufzutreten, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Er hatte sie überzeugt, den Ball flach zu halten – es sollten so wenig Leute wie möglich mitbekommen, dass sie wieder in Berlin war, und der einzige Weg hierzu war, ihn reden zu lassen. Doch Ophelias Geduld war aufgebraucht. Es war für ihren Geschmack schon viel zu viel Atemluft verschwendet worden.
Auf das Gesicht des Maklers trat ein unsicheres Lächeln, doch Ophelia entging der gierige Glanz in den Augen nicht. Na bitte. Offenbar hätten sie das Ganze von Anfang an auch einfacher haben können.
»Ich verstehe nicht ganz«, entgegnete der Makler höflich. »Beziehen Sie sich auf die Quadratmeterzahl des Anwesens oder des Gartens?«
Könighaus hob belustigt eine Augenbraue, und Ophelia schnaubte ungeduldig.
»Ich beziehe mich auf die Höhe der Summe, die ich Ihnen zahlen muss, damit Sie die anderen Leute aus Ihrem Mailpostfach vergessen und aufhören, mit Plattitüden um sich zu werfen wie ein drittklassiges Immobilienportal.«
Der Mann räusperte sich verlegen, gab sich aber ansonsten unbeeindruckt. »Sie sind offenbar sehr interessiert.«
»Wir wollen das Haus gerne kaufen«, bestätigte Könighaus, offenbar bemüht, die Fassade des Ehemannes aufrechtzuerhalten. »Und wir sind bereit, hierfür noch etwas draufzulegen, falls es nötig sein sollte.«
Ophelia Sander war erstaunt, wie geschliffen der Mann reden konnte, den sie vor einem Bordell in Sankt Pauli aus der Gosse geklaubt hatte. Normalerweise hörte man Könighaus’ Herkunft aus jedem seiner Worte.
»Nun, das müssen Sie mit meinem Chef besprechen«, erwiderte der Makler zurückhaltend. Er war vorsichtig, aber interessiert. Ophelia sah es in seinen Augen. Und sie hatte keine Lust auf dieses Spielchen.
»Ich gebe Ihnen zehn Prozent des Kaufpreises unter der Hand«, sagte sie. »Dann brauchen Sie sich über Ihren Chef keine Gedanken mehr zu machen.«
Sie zog ihr Tablet aus der Handtasche und hielt es in Richtung des Maklers. Binnen Sekunden wurden seine Gesichtszüge erfasst und die Daten auf dem Bildschirm angezeigt.
»Corbinian Röschel?«, fragte sie zur Sicherheit, und der Mann nickte. Was für ein selten dämlicher Name, dachte Ophelia. Was hatten sich seine Eltern denn dabei gedacht? Das klang wie eine ausgestorbene Vogelart.
Ronny Könighaus trat einen Schritt vor, und sie hob den Kopf. Ihre Blicke trafen sich, und Könighaus seufzte. Ophelia wusste, dass er sie nur allzu gerne zurückhalten würde, aber das stand ihm nicht zu. Sie war immer noch seine Chefin und konnte alleine entscheiden, was sie tat und was sie bleiben ließ. Könighaus kannte seinen Platz.
Ohne mit der Wimper zu zucken, überwies Ophelia eine gigantische Summe auf das Konto des jungen Maklers. In seiner Aktentasche pingte es.
Mit kaum verhohlener Neugier zog er sein eigenes Gerät hervor und blickte auf den Bildschirm.
»Nehmen Sie das Geld und machen Sie Ihr eigenes Büro auf«, sagte sie ruhig, während der Makler nach Atem rang. »Dann müssen Sie sich in Zukunft in solchen Situationen überhaupt keine Gedanken mehr machen.«
Corbinian Röschel nickte langsam, den Blick immer noch starr auf das Display geheftet. Ihm war anzusehen, dass sein gesamtes zukünftiges Leben vor seinem inneren Auge an ihm vorbeizog. Dann riss er den Kopf nach oben und starrte Ophelia überrascht an.
Natürlich. Er hatte nicht nur die Summe gesehen, sondern auch die Zeile mit dem Absender gelesen. Jeder kannte ihren Namen, vor allem Leute, die es mit Deutschlands Reichen zu tun hatten. Keine Chance, dass dieser Typ über die Begegnung mit ihr Stillschweigen bewahren konnte. Er würde jedem davon erzählen, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Und vielleicht würde er sich bald ebenfalls ein Haus kaufen, das viel zu teuer für ihn war, und einen Eichentisch reinstellen, den er nie benutzte. Es war ihr egal. So wie ihr vieles dieser Tage egal war.
Scheiß drauf, dachte Ophelia grimmig. Dann fahre ich eben mit offenem Visier.
Das Zimmer sah genauso aus wie die der anderen. Das gleiche Bett, der gleiche Tisch, die gleichen Sessel. Nur die Grundfarben und Namen der einzelnen Zimmer variierten. Blaue Lagune. Sonnentau. Lila Lounge. Schwarzes Loch. Das sollte wahlweise sinnlich, elegant, stilvoll oder ruchlos wirken, hatte Ruby ihnen einmal erklärt. Lin fand es nur dämlich. In all der Zeit hatte noch keiner ihrer Freier großes Interesse an der Zimmereinrichtung gezeigt, aber sie war gezwungen, zu sagen: »Gehen wir doch nach hinten in den Roten Rausch.«
Sie hatte sich das Zimmer selbst aussuchen dürfen. Das war eines der wenigen Privilegien, die sie als eines der wenigen besonders beliebten Mädchen hatte. Rot war die Farbe ihres Herkunftslandes und passte somit perfekt. So hatte sie das Gefühl, es würde wenigstens auf eine Art zu ihr gehören. Denn mehr Individualität war leider nicht drin.
Es war ihnen verboten, persönliche Gegenstände anzuhäufen; angeblich hatte das logistische Gründe, weil die Mädchen immer mal wieder die Zimmer wechselten, aber Lin wusste es besser. Es ging, wie meistens bei Ruby, um Gier und Macht. Was sie gehabt hatte, war ihr genommen worden, als sie den Vertrag mit den Metzger-Brüdern unterschrieben hatte. Und das in jedweder Hinsicht.
Ihre gesamte Kleidung, das bisschen Schmuck und die Bilder, die ihre Eltern zum Abschied auf altmodische Art hatten anfertigen lassen, was sie sicher ein Vermögen gekostet hatte. Ihr Verlust hatte Lin am meisten geschmerzt, mittlerweile begann sie sogar, die Gesichter ihrer Familienmitglieder zu vergessen. Die Fotos waren in Mikael Metzgers Kamin gelandet, den Rest hatte Ruby weggeschafft.
An jenem Tag hatte sie ihr Leben aufgegeben und war zu etwas anderem geworden. Was das war, versuchte sie bis heute zu begreifen. Etwas Düsteres und Falsches jedenfalls.
Sie zwang sich, immer mehr von ihrem alten Leben zu vergessen, das Vorher aus Kopf und Herz zu streichen. Wer sie gewesen war, was sie als Kind geliebt hatte und wen sie vermisste. Wer sie aufgegeben und wen sie verletzt hatte. Und sie hatte es fast geschafft. Wenn die Bilder von früher kamen, dann fühlten sie sich an wie ein Film, den sie vielleicht mal gesehen hatte und an dessen Inhalt sie sich kaum erinnern konnte. Das war gut so. Und bald würde alles endgültig verblassen.
Am wichtigsten aber war es, die Träume zu vergessen, die sie nach Berlin geführt hatten. Und am schwersten. Denn ihre Träume hatten sie immer angetrieben, sie aufrecht gehalten. Und stolz gemacht.
Lin war ihr Leben lang Artistin gewesen. In einem asiatischen Zirkus, der durch Europa getingelt war. Ärmlich und abgehalftert, nur noch ein Abklatsch des Glanzes aus alten Zeiten, die ihre Urgroßeltern kaum noch erlebt und dennoch in Geschichten überlebensgroß hochgehalten hatten. Heute ging fast keiner mehr in den Zirkus, es gab andere Vergnügungen. Die Kinder waren durch Akrobatik nur noch selten zu begeistern – es gab kaum etwas, an dem sie sich online nicht schon sattgesehen hatten. Leute wie sie und ihre Familie gehörten in eine andere Zeit, eine andere Welt. Eine Welt, in der es nach Sägespänen und Zeltleinen roch.
Lin war ein Schlangenmensch. Und sie war gut, hatte im Alter von drei Jahren angefangen, sich zu verbiegen, die Grenzen ihres Körpers immer und immer wieder zu überschreiten. Sie hatte es geliebt, dabei angesehen zu werden; der Applaus, so spärlich er auch ausgefallen war, war für sie seit frühester Kindheit wie warmer Sommerregen gewesen. Etwas, das auf eine aufregende und ganz eigene Art glücklich machte. Sie hatte nie etwas anderes als Manegenbretter unter den Füßen spüren wollen. Jetzt gruben sich ihre Zehen in Perserteppiche, die man schon viel zu oft mit Bleiche von Körperflüssigkeiten befreit hatte.
Und sie war selbst schuld daran. Natürlich hatte jemand wie Lin vom Circus im Utopia Gardens geträumt – so wie alle anderen Kinder, mit denen sie aufgewachsen war. Nur war sie als Einzige von ihnen gegangen und auch noch furchtbar stolz auf ihren Wagemut und darauf gewesen, dass sie aufgenommen worden war. Vom einzigen Zirkus, dessen Besucherränge noch gefüllt waren. Jeden Tag zwei Mal. Und dessen Betreibern beinahe grenzenlose Mittel zur Verfügung standen. Wie alle anderen hatte auch sie die Augen nur allzu gerne davor verschlossen, wo das Geld herkam, obwohl es jeder wusste. Es war kein Wunder, dass die meisten hier im Teenageralter in die Fänge der Metzger-Brüder gerieten. In dem Alter war das Urteilsvermögen besonders stark gestört und die Selbstüberschätzung grenzenlos.
Sie hatte ein paar Fehler gemacht, die sie ewig bereuen würde. Wegen dieser Fehler war sie schlussendlich nicht in der Manege des Gardens, sondern ganz woanders gelandet. Zwei Stockwerke tiefer im Salon Rouge. Unter der Erde, dort, wo Kinderaugen nicht hinkamen und die Kindheit eines jeden Mädchens endete. Eine kreisrunde, plüschige Hölle, in der viel und unecht gelacht wurde und die Polster nach Champagner und schwerem Parfum rochen. In dieser Manege standen Metallstangen, an denen die Mädchen tanzen mussten.
Und Lins Heimweh folgte dem Takt der Musik. Ihr Zirkus war arm gewesen, doch das hatte für sie kaum eine Rolle gespielt. Sie war von der gesamten Zirkusfamilie mit viel Liebe aufgezogen worden.
Wahrscheinlich fiel es ihr deshalb jetzt so schwer anzunehmen, was war. Und anderen Menschen das zu geben, was bei den meisten an die Stelle von Liebe getreten war.
Denn sich verbiegen zu können wie eine Brezel war auch unter Freiern sehr gefragt – sie gehörte nicht umsonst zu den am besten bezahlten Mädchen im Club. Nachts hatte sie niemals Pause. Nicht dass es ihr etwas helfen würde. Die Schulden, die sie hatte, würde sie nicht ausgleichen können, dafür hatten die Metzgers gesorgt. Vollkommen egal, wie viele Freier sie mit in den »Roten Rausch« nahm und wie sehr sie sich verbog. Das war das System Utopia Gardens.
Die meisten ihrer Kolleginnen überlebten, indem sie Drogen nahmen, doch Lin vermied das, so gut es ging.
Ruby, die Chefin des Bordellbereichs, verteilte Rauschgift wie Schokolinsen unter ihren Mädchen. Oft kamen Dealer und Drogenbosse gezielt zu ihr, um die Wirkung neuer Substanzen am lebenden Objekt zu testen. Ihre Körper konnten nicht nur für Sex gekauft werden, sondern auch für andere Dinge, da war die Chefin des Salons ganz und gar nicht wählerisch. Und Drogentests stimmte Ruby besonders gerne zu. Denn wo kein Wille mehr war, musste auch keiner gebrochen werden.
Gedankenverloren drehte Lin den flauschigen Katzenschwanz in ihren Fingern, der hinten an ihrem prächtigen Korsett festgenäht war. Am Anfang war sie immer draufgetreten oder hatte ihn aus Versehen in der Toilette versenkt, aber mittlerweile war er ihr so vertraut, als wäre er tatsächlich ein Teil ihres Körpers. Sie war zwar der Schlangenmensch, aber Nina war die Schlange. Lin war zu niedlich, um eine Schlange zu sein. Trotz ihrer mittlerweile zwanzig Jahre sah sie immer noch aus wie zwölf. Mit ihren Katzenöhrchen und dem flauschigen Schwanz, dem Korsett und den Netzstrumpfhosen bediente sie eine der schlimmsten Männerfantasien. Und mit über hundert Kamasutrastellungen im Repertoire bediente Lin den Rest.
Das war ihr Leben. Im Gegensatz zu den anderen Mädchen ging sie tagsüber nicht raus. Die meisten schliefen ein bisschen und verließen dann das Gardens, um sich in Alt- oder Neuberlin herumzutreiben und wenigstens ein paar Stunden lang so zu tun, als wären sie normal. Sie wurden im Club nicht festgehalten. Nicht physisch. Doch wenn sie nicht rechtzeitig zur Arbeit erschienen, konnten sie über ihre Tracker leicht geortet und »nach Hause geholt« werden. Der Aufwand für die ganze Aktion wurde ihnen natürlich in Rechnung gestellt und auf das Minuskonto aufgeschlagen. So wie alles andere hier. Die Kleidung. Das Essen. Make-up. Wäscheservice. Seife. Sogar Kondome. Niemand konnte sich nur durch Arbeit wieder freikaufen. Der Club führte penibel Buch. Es gab sogar eine Kilometerpauschale für die Anfahrt zum Aufenthaltsort im Falle einer »Rückholaktion«.
Deutschland. Ein Land, in dem selbst die Gangster eine tadellose Buchhaltung hatten und Trinkgeld immer knapp ausfiel, ganz egal, wie sehr sie sich auch abmühte.
Doch der Tracker war nicht der Grund, warum Lin nicht nach draußen ging. Sie traute sich durchaus zu, pünktlich zum Schichtbeginn wieder im Club zu sein, schließlich war sie nicht blöde.
Es war Selbstschutz. Sie wollte einfach nicht wissen, wie es jenseits dieser Mauern aussah. Ob die Sonne schien oder Regen die Straßen benetzte. Ob es kalt war oder angenehm warm. Wie die Nachbarschaft aussah, ob sich etwas im Laufe der Zeit verändert hatte. Zu wissen, dass dort draußen eine Welt war, die nicht auf sie wartete und sich stattdessen einfach weiter drehte, machte es ihr viel schwerer, ihr Leben im Gardens zu ertragen. Sie tat lieber so, als gäbe es draußen gar nichts, als sei das Gardens selbst die ganze Welt. Wer keine Alternativen hatte, suchte auch nicht mehr nach dem Glück.
Sie zuckte zusammen, als es an der Tür klopfte. Ganz leise und zaghaft. Lin runzelte die Stirn. Um diese Uhrzeit klopfte nie jemand, alle waren ausgeflogen oder schliefen – sie hatte frei, verflucht. Jeder wusste, dass sie lieber für sich blieb. Sie reagierte einfach nicht, und es klopfte erneut, diesmal ein klein wenig lauter.
Seufzend erhob sie sich und ging in Richtung Tür, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne. War es klug, was sie hier tat?
Nach dem, was in den letzten Tagen im Gardens passiert war, sollte sie wachsamer sein. Eine von ihnen war getötet worden; die meisten Security-Mitarbeiter waren bei der großen Razzia verhaftet worden und noch immer nicht zurückgekehrt. Sie waren hier im Moment ziemlich schutzlos. Zum ersten Mal schoss ihr durch den Kopf, dass sie in Gefahr sein könnte.
Sollte sie weiterhin so tun, als sei sie nicht da? Nein. Wenn ein Mörder nach ihr suchte, dann würde ihr Schweigen ihn sicher nicht davon abhalten, das Zimmer zu betreten.
Klopften Mörder eigentlich an?
Wenn sie einem Sicherheit vorgaukeln wollten, bestimmt.
Lin sah sich angespannt im Zimmer um, doch alles war nur plüschig und weich und stank nach Lufterfrischer.
Früher hatte unter jedem Kopfkissen ein Messer zur Selbstverteidigung gelegen, falls ein Freier mal zu grob wurde. Doch nachdem zu viele Männer im Salon Rouge zu Tode gekommen waren, hatte man ihnen die Waffen abgenommen. Das Leben zahlender Kunden war mehr wert als das eines Mädchens. Im Zweifel. Schließlich musste man die ganzen Scherereien und die Rufschädigung gegenrechnen.
»Lin, bist du da?«, drang eine zarte weibliche Stimme durch das Türblatt, und Lin entspannte sich ein wenig.
»Ja«, antwortete sie schroff. »Was ist denn?«
»Es tut mir leid, dass ich dich störe, aber Ruby will dich sehen!«
Lin presste die Kiefer aufeinander. Ausgerechnet. Ruby war der schlimmste Mensch im ganzen Gardens, wenn man sie fragte.
Die Metzger-Brüder waren Geschäftsmänner, sie waren grausam, wenn es in ihren Augen notwendig war, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder einen Standpunkt zu verdeutlichen. Es war Teil ihres Jobs, wenn man so wollte. Ruby war grausam, weil es ihr Spaß machte. Weil sie fett und alt war und niemand sie mehr vögeln wollte.
Lin erhob sich und öffnete die Tür. Davor stand ein zartes, junges Mädchen und sah sie aus großen Augen an. Lin kannte sie nicht, doch das war nichts Ungewöhnliches. Viele Mädchen verschwanden für immer aus dem Salon Rouge, andere rückten nach. Berlin hatte offenbar einen unerschöpflichen Vorrat an verzweifelten jungen Dingern.
»Wieso? Was ist denn los?« Lin war bewusst, wie unfreundlich sie klang, und zwang sich zu einem Lächeln. Sie wollte nicht wie Ruby sein, wollte ihren Ärger nicht an Schwächeren auslassen, die überhaupt keine Schuld traf.
»Ich … ich weiß es nicht«, stammelte das Mädchen.
»Ist schon gut.« Lin seufzte. »Natürlich hat sie dir nichts gesagt, es war dumm von mir, dich überhaupt zu fragen.«
Das Mädchen lächelte schüchtern. »Kein Problem!« Und nach kurzem Zögern setzte sie hinzu: »Ich freue mich, dich kennenzulernen, weißt du? Ich bin ein großer Fan deiner Arbeit!«
Lins Muskeln wurden bei diesen Worten steif. Das war das Letzte, was sie hören wollte. Ganz sicher wollte sie mit ihrer »Arbeit« kein Vorbild für Teenager sein. Natürlich wusste sie, dass der Livestream aus dem Barbereich des Salons nicht nur von notgeilen volljährigen Männern konsumiert wurde, sondern auch von Teenagern, die eigentlich noch halbe Kinder waren. Genauso wie von unzähligen Hausfrauen.
Und leider war sie selbst einer der Stars dieses anrüchigen Programms. Sie bekam sogar Fanpost und haufenweise Geschenke. Die Ruby natürlich alle einkassierte. Der ganze Schmuck, mit dem die Matrone im Bordell herumspazierte, musste ja schließlich irgendwo herkommen.
»Ähm. Ja, danke«, gab sie irritiert zurück und setzte sich in Richtung Bar in Bewegung.
Bloß nicht nachdenken, sagte sie zu sich selbst. Nur nicht zu lange drüber nachdenken.
»Jetzt sag schon endlich: Was machst du da?«
Raven ließ den Lötkolben sinken und blickte Sky streng an. »Das habe ich dir doch schon tausend Mal gesagt: Ich arbeite!«
»Der Informationsgehalt dieser Aussage ist ziemlich dürftig, das weißt du genau.«
»Wirst du jemals aufhören zu reden? Ich muss mich konzentrieren.«
Sky grinste schief und zeigte sein linkes Wangengrübchen.
»Jeder sollte das tun, was er am besten kann. Streng genommen ist es momentan sogar das Einzige, was ich kann. Zum Glück ist es überdies mein größtes Talent. Und gib es zu: Du liebst den Klang meiner Stimme. Du kannst gar nicht genug davon bekommen.«
Raven verdrehte die Augen. Warum noch mal hatte sie ihn mit nach unten in ihre Werkstatt genommen? Sie beugte sich vor und untersuchte das Tablet, das vor ihr stand.
»Hast du keine Mute-Taste oder so?«
»Hey, lass deine Finger gefälligst von meinen intimsten Teilen!«
Raven lachte auf. Dafür, dass Sky von Bülow erst vor Kurzem erfahren hatte, dass er von seinem Körper getrennt worden war, hatte er nervtötend gute Laune. Oder er benutzte sie, um seine Verzweiflung dahinter zu verstecken. Raven kannte genug Leute, die das taten, auch wenn sie noch nie begriffen hatte, wieso. Es gab doch so viele andere Wege. Wut zum Beispiel. Oder Unnahbarkeit. Oder einfach Drogen. Aber sie hatte auch noch nie verstanden, warum es das Ziel mancher Leute war, von allen gemocht zu werden. Das bedeutete schlicht, keinen eigenen Charakter zu haben. Sie stellte sich das sehr anstrengend vor. Oder man war so wie Spencer. Der wurde von allen gemocht, weil er schlicht und ergreifend an einen Labrador erinnerte. Freundlich, loyal und ein bisschen dumm. Da war der virtuelle Sky von Bülow ein ganz anderes Kaliber.
Der ließ sich nicht so leicht lesen wie Spencer. Was sie an seinem Verhalten zum Beispiel nicht begriff, war, warum Sky nicht wollte, dass seine Familie über seinen Zustand und den Aufenthaltsort informiert wurde. Oder die Hamburger Polizei. Es wäre Raven ein Leichtes gewesen, das Tablet anonym an die zuständige Wache zu schicken, und dann wäre alles seinen Gang gegangen. Vielleicht hätte der Milliardärssohn so wenigstens eine Chance, seinen Körper und somit sein altes Leben zurückzuerhalten. Oder falls nicht, wenigstens diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die dafür verantwortlich waren. Doch Sky bestand darauf, bei ihr zu bleiben. Raven hinterfragte die Motive anderer Leute für gewöhnlich nicht, aber diese Entscheidung gab ihr Rätsel auf. Wovor hatte der Sunnyboy Angst? Was konnte ihm passieren, das noch schlimmer war, als von seinem Körper getrennt und auf einer Festplatte gespeichert zu werden? Ganz Deutschland suchte nach dem jungen Mann – und wieso sollte ausgerechnet sie die Richtige sein, ihm zu helfen? Raven hatte ihre eigenen Probleme und eigentlich keine Zeit für eine Million anderer. Doch aus irgendeinem verrückten Grund hatte sie Sky versprochen, ihm bei der Suche nach seinem Körper zu helfen. Insgeheim machte sie Schlafmangel für diese vollkommen wahnsinnige Entscheidung verantwortlich. Doch Raven war kein Mensch, der ein Versprechen zurücknahm. Ihr Wort galt. Weshalb der Modder Dark überall in der Unterwelt einen tadellosen Ruf genoss.
Sie beugte sich zum dutzendsten Mal in dieser Nacht wieder über ihr Werkstück, doch es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Ihre Gedanken wanderten immer wieder zurück zu Sky, selbst wenn der ausnahmsweise mal die Klappe hielt. Raven wusste noch nicht genau, was sie von alldem halten sollte. Angefangen natürlich bei der philosophischen Frage, ob Sky überhaupt ein Mensch war oder nicht. Zuerst hatte sie noch gedacht, dieses Tablet sei vielleicht die Kreation eines Hyperfans des jungen Mannes. Jemand, der Sky so gut studiert hatte, dass es ihm gelungen war, diesen täuschend echten Avatar zu programmieren. Aber der Typ, der ihr da herausfordernd aus dem Display entgegengrinste, war zu ausgereift. Zu schlagfertig und witzig. Bis heute war es ihres Wissens nach noch keinem gelungen, einen Avatar mit Schlagfertigkeit und Sinn für Humor sowie einem ungesunden Maß an Selbstüberschätzung zu kreieren. Das war einfach zu komplex, schließlich mussten die Antworten und Paroli ja auch zum Thema des jeweiligen Gesprächs passen. Irgendetwas mussten Menschen ja Maschinen noch voraushaben.
Außerdem kannte dieser Sky hier sehr private Details aus Sky von Bülows Leben. Und selbst wenn der Typ, der sie hier vom Bildschirm aus anstarrte, nicht der Milliardärssohn war, blieb noch die Frage, wohin Sky von Bülow denn sonst bitte verschwunden war. Es wäre doch ein allzu großer Zufall, wenn der Milliardärssohn und beliebtester Junggeselle Deutschlands verschwunden wäre und Raven wenig später ein Tablet mit seiner Persönlichkeit in den Asservaten der Polizei finden würde, das rein gar nichts mit seinem Verschwinden zu tun hatte. Fragte sich nur noch, wie das alles mit Birols Vater zusammenhing. Gedankenverloren griff sie versehentlich an das heiße Ende des Lötkolbens.
»Au, verdammt!«, stieß sie aus und wedelte ungeduldig mit ihrer verbrannten Hand in der Luft herum.
»Du kannst wohl keinen heißen Kolben halten, was?«
Empört riss sie die Augen auf, konnte sich ein Lachen aber nicht verkneifen. »Sky!«, rief sie tadelnd. »Du bist …«
»Geistreich!«, beendete Sky ihren Satz triumphierend. »Natürlich findest du mich geistreich. Alle Frauen finden mich geistreich.«
»Ich bin aber nicht alle Frauen«, schimpfte Raven, noch immer amüsiert über Skys Obszönität. »Und ich hätte nicht gedacht, dass einer wie du überhaupt weiß, was ein Lötkolben ist.«
»Einer wie ich«, echote Sky mit einem leichten Lächeln, doch sein Blick wurde irgendwie glasig. Vielleicht war das aber auch nur das Display.
Raven überlegte eine Weile. Irgendwie hatte sie immer gedacht, reiche Menschen rissen keine zotigen Witze. Obwohl sie von Nina wusste, dass genau das Gegenteil der Fall war. Raven seufzte und betrachtete ihr Werkstück. Ihre Arbeit repräsentierte so viel von dem, was sie ausmachte, und füllte sie praktisch bis zum Rand aus. Andere Dinge wie ihre Wohnung, Kleidung oder gar Essen waren ihr nie sonderlich wichtig gewesen. Es ging immer nur um ihr aktuelles Projekt. Nun war die Polizeiarbeit irgendwie dazugekommen, und sie versuchte immer noch, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Denn so gerne sie sagen würde, dass es anders war, so sehr entsprach es den Tatsachen, dass ihr die Arbeit mit den Kollegen etwas gab, das sie zuvor in ihrem Leben vergebens gesucht hatte: das Gefühl, etwas richtig zu machen. Etwas, das ausnahmsweise mal niemandem schadete. Und das war eine ziemlich gute Sache.
Es war reines Glück gewesen, dass sie nicht wie all ihre Freunde schon vor Jahren in den Fängen der Metzger-Brüder gelandet war. Sie hatte all die Voraussetzungen, um im Salon Rouge zu landen. Sie war Waise, damals noch mittellos gewesen, und ihr Aussehen bediente einen ganz speziellen Geschmack. Mit ihrer jetzigen Arbeit lebte sie zwar auch gefährlich und war ebenfalls zu großen Teilen von den Metzger-Brüdern abhängig, aber es war eine Abhängigkeit auf Augenhöhe. Sie brauchten Dark genauso, wie Dark ihr Geld brauchte. Trotzdem war es zur Abwechslung sehr erfrischend, mal für jemand anderen zu arbeiten. Jemand, der nicht mit den Metzgers, dem Gardens oder der Polizei zu tun hatte.
Ein Kunde aus München hatte starke Magnete für seine Fingerspitzen bestellt. Nicht gerade die Herausforderung ihres Lebens, aber es musste gemacht werden.
Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Sky den Blick durch den Raum schweifen ließ.
»Dass du nicht wie andere Frauen bist, ist nur allzu offensichtlich«, murmelte er.
Raven setzte sich ihre Lupenbrille auf, um die winzigen Kontakte zu sehen, die sie gleich festlöten wollte. Sie runzelte die Stirn. »Was willst du damit sagen?«
Sie hörte Sky verächtlich schnauben. »Nun, du legst zum Beispiel schon mal keinen großen Wert auf dein Äußeres.«
Raven kniff den Mund zusammen. Musste er so was sagen?
»Vielleicht lege ich einfach nur andere Maßstäbe an als jemand, der den Großteil seines Lebens damit verbracht hat, sich durch die Betten irgendwelcher hirnloser Models oder Schauspielerinnen zu vögeln. Kein Wunder, dass dein Blick auf Frauen völlig verzerrt ist.«
»Autsch!« Sky lachte. »Da hat aber jemand ganz tief in die Klischeekiste gegriffen heute Morgen. Und bitte entschuldige, dass ich dein Nasenfahrrad nicht als letzten Schrei in der Brillenmode identifiziert habe. Ich war schon seit geraumer Zeit nicht mehr in Paris.«
»Tu mir einen Gefallen und sag jetzt bitte ausnahmsweise mal nichts.«
Raven klemmte die Zungenspitze zwischen die Zähne und beugte sich tief über ihre kleinen Werkstücke. An sich waren magnetische Fingerspitzen nicht sonderlich komplex, es sei denn, der Kunde wollte sie nicht manuell, sondern über einen gedanklichen »Befehl« über das Gehirn an- und abschalten. Vor ihr lagen die herkömmlichen Modelle, die ihr Kunde durch kurzes, doppeltes Fingertippen aktivieren konnte. Trotzdem musste sie sich konzentrieren, da alles an diesen ohnehin schon kleinen, leicht gebogenen Metallplatten verflixt winzig war. Zur Sicherheit checkte sie noch einmal die Scans der Fingerkuppen, die ihr der Kunde online über eine verschlüsselte Verbindung im Darknet geschickt hatte. Sky schaute auf ihren Bildschirm und pfiff leise durch die Zähne.
»Bist du eine Hackerin oder so was?«
»Sky, bitte! Wie oft soll ich es denn noch sagen: Ich muss mich hier konzentrieren!«
»Das ist eine einfache Frage, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst!«
Stöhnend griff Raven nach dem Tablet und gab ihm einen leichten Schubs, sodass es mit dem Bildschirm voran auf die Tischplatte kippte.
»Hey!«, erklang Skys gedämpfter Protest. »Da macht es sich aber jemand ganz schön einfach!« Sie musste schmunzeln.
Tatsache war, dass es ihr schwerer fiel, als sie gedacht hätte, in Skys Gegenwart zu arbeiten. Und wenn sie ganz ehrlich war, musste sie zugeben, dass das weniger an seinem unaufhörlichen Gequatsche lag – dazu neigte Spencer genauso, und sie hatte gelernt, sich unter Dauerbeschallung zu konzentrieren –, sondern dass es vielmehr das Gesicht des jungen Mannes war, das sie vollkommen aus dem Konzept brachte. Ihr Blick wurde davon magisch angezogen.
Sie arbeitete eine Weile schweigend vor sich hin, und Sky blieb zu ihrem großen Erstaunen ebenfalls still. Tatsächlich juckte es sie nach einer Weile in den Fingern, nachzusehen, was er so trieb.
Raven fragte sich, ob es in seiner Welt jetzt einfach dunkel war, ob er sich in einer Art Raum befand oder was sein Bewusstsein überhaupt wahrnahm. Es war selbst für sie, die den fließenden Übergang zwischen Mensch und Maschine nur allzu gut kannte, kein Leichtes, sich eine Existenz, wie Sky sie gerade führte, vorzustellen.
Als sie fertig war, verstaute sie die Fingerspitzen in einer sterilen Box, zog die Brille ab und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare.
Dann tat sie etwas, das sie sonst immer vermied. Raven ging ins Badezimmer und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. Natürlich hatte Sky mit seiner Bemerkung vorhin einen wunden Punkt getroffen. Sie war ja nicht aus Eis, verflucht, auch wenn sie so aussah.
Raven wusste, dass alles an ihr speziell war. Mit ihren weißen Haaren und der hellen Haut, den hohen Wangenknochen und den vollen Lippen.
Da man mit ihrer Krankheit auch schlecht sah und sehr sonnenempfindlich war, hatte sie sich früh Kontaktlinsen mit Stärke und Tönung anfertigen lassen, sodass ihre Augen fast schwarz aussahen, wenn sie die Linsen trug. Wie zwei Tropfen Motoröl in einer Tasse Milch.
War sie schön? Sie wusste es nicht. Aber sie bemerkte, dass sie sich verändert hatte, seitdem sie das letzte Mal länger als drei Sekunden in den Spiegel geschaut hatte. Ihre Gesichtszüge waren härter, definierter. Die Wangenknochen schienen noch höher gerutscht zu sein, was natürlich Blödsinn war. Raven vermutete, dass es daran lag, dass sie kaum zum Essen kam.
Obwohl sie eindeutig abgenommen hatte, sah sie jetzt nicht mehr aus wie jemand, den ein Lufthauch aus den Schuhen reißen konnte, sondern wie eine Frau, mit der man sich besser nicht anlegen sollte. Umso besser, da sie ziemlich sicher war, dass ihr jemand nach dem Leben trachtete. Oder vielmehr ihrer zweiten Identität, dem berühmten Modder Dark. Zwei Menschen hatten für ihn schon mit dem Leben bezahlt, und Raven musste sich eingestehen, dass es für jeden gefährlich werden konnte, der sich von ihr modifizieren ließ. Doch sie konnte es nicht ändern. Wenn sie jetzt aufhörte zu arbeiten, würde sich schnell herumsprechen, dass Dark ein Feigling war. Und dass er Lunte gerochen hatte, was es für sie umso gefährlicher machen könnte. Im Gardens roch man Schwäche zwanzig Meter gegen den Wind. Und es fand sich immer jemand, der nur allzu bereit war, diese Schwäche auszunutzen.
Im Stillen dankte sie sich selbst dafür, ein männliches Alias gewählt zu haben. Das bot ihr momentan noch einen gewissen Schutz. Das und die Arroganz der meisten Männer, die sich nicht vorstellen konnten, dass eine Frau zu »so etwas« in der Lage war.
Sie wusch sich das Gesicht und wuschelte sich noch einmal durch die Haare. Eine Dusche wäre der Himmel auf Erden, allerdings hatte sie nicht mehr genügend Zeit. Der Morgen graute, und sie musste zurück in ihr mittlerweile drittes Leben als Mitarbeiterin der Mordkommission Berlin.
Zurück im Wohnzimmer, griff sie nach dem weißen Tablet und drehte es wieder um.
Sky blickte ihr beleidigt entgegen. »Das war nicht nett.«
Raven seufzte. »Entschuldige, aber es ging nicht anders. Du bringst mich einfach zu sehr aus dem Konzept mit deinem Gequatsche.«
»Streng genommen hätte ich weitersprechen können. Du hast mich nur nicht mehr gesehen.«
»Nun, es hat geholfen, oder?«
»Du hast es jedenfalls drauf, einem zu zeigen, dass man nicht erwünscht ist.«
»Sky, es tut mir wirklich leid, was dir passiert ist und so. Aber nicht jeder hat so viel Geld, dass er es mit beiden Händen ausgeben kann. Andere Leute müssen sich ihr Auskommen hart verdienen, und zu denen zähle ich. Außerdem muss ich gleich zur Arbeit.«
»Ich dachte, das hier wäre deine Arbeit!«, rief Sky aus, und Raven registrierte, dass er sich bei dem Gedanken daran, alleine zu sein, offensichtlich nicht sonderlich wohlfühlte.
»Ich habe zwei Jobs«, gab Raven zurück.
»Du hast zwei Jobs, zwei Wohnungen, zwei Gesichter … verrate mir, was du noch so doppelt hast!«
Raven war verblüfft. Bemerkte sie da etwa so was wie Tiefgang? »Zwei Gesichter?«, fragte sie stirnrunzelnd. »Was meinst du damit?«
Sky schmunzelte. »Ich werde mein ganzes Pulver doch nicht auf einmal verschießen.« Und nach kurzem Zögern fragte er: »Kann ich nicht mitkommen? Zu deiner Arbeit, meine ich?«
Raven schüttelte den Kopf. »Das geht nicht. Es ist viel zu gefährlich.«
»Gefährlich?«, echote Sky.
Raven packte ein paar Sachen in ihren Rucksack und wandte sich dann wieder Sky zu.
»Ja, gefährlich. Für dich und für mich.«
»Jetzt machst du mich aber neugierig.«
Nun huschte ein Lächeln über Ravens Gesicht. »Habe ich dir das noch gar nicht gesagt? Ich bin bei der Polizei.«
Schon den fünften Tag in Folge saß er hier und schlug die Zeit tot. Genau vor der Adresse, die der kleine Hackerarsch ihm gegeben hatte, bevor sie in Richtung Berlin aufgebrochen waren. Und er in Richtung Kolumbien. Weiß der Henker, warum sich der junge Mann ausgerechnet Kartagena als neuen Wohnsitz auserkoren hatte. Wahrscheinlich, um vor Ort irgendeinen Drogenboss zu erpressen. Ronny würde es überhaupt nicht wundern, wenn Sven, der sich online nur SeaSalt nannte, bereits von der Marianne aus alles in die Wege geleitet hatte.
Sie hatten ihm ein Vermögen für seine Dienste gezahlt und ein neues Leben organisiert. Und das alles nur für eine Adresse. Genauer gesagt: Koordinaten.
Gespeichert in einer extra angelegten Cloud in einer verschlüsselten Datei. Mittlerweile konnte Ronny sie auswendig aufsagen. Die Koordinaten sollten ihn zu dem gestohlenen Prototypen des Ark-Projektes und damit zu Sky von Bülow führen. Der großen Liebe seiner durchgeknallten Chefin. Das Problem war nur: Hier war nichts. Verlassene Hochhäuser am Rand der Stadt, Bruchbuden, die aussahen, als könnten sie jeden Augenblick zusammenbrechen. Er wurde das Gefühl nicht los, dass Sven sie verarscht hatte. Oder dass er einen Fehler gemacht hatte. Allerdings war das ziemlich unwahrscheinlich, der kleine Hackerarsch war nämlich eigentlich ein ziemlich großer Hackerarsch, jedenfalls gemessen an seiner Berühmtheit. Er hatte im Gefängnis gesessen, weil er das Sicherheitssystem des Nachrichtendienstes außer Kraft gesetzt hatte. Und Ronny hatte ihn rausgehauen mithilfe vieler alter Kontakte und einer Unmenge Geld. Und wofür? Dafür, dass er jetzt am Arsch von Berlin sitzen und auf eine Reihe Hauseingänge starren durfte. Das musste man sich auch erst mal reinziehen.
Allerdings genoss er es, mal alleine in Ruhe irgendwo sitzen zu können. Ronny hatte keine Ahnung, wie lange es her war, dass er mal seine Ruhe vor allem gehabt hatte. Hier war niemand, der was von ihm wollte, niemand, der seinen Wahnsinn, seine Bedürfnisse oder Vorwürfe über ihm ausschütten konnte. Niemand, der wollte, dass er jemanden umbrachte, eine Leiche verschwinden ließ, sauteuren Wein besorgte, zur Dinnerparty erschien, sich mit den Nachbarn unterhielt oder ein Rassemeerschweinchen kaufte. Er konnte einfach hier sitzen, Kaffee trinken, seinen Lieblingspodcast hören und ein bisschen in die Luft starren. Es war fast wie Urlaub.
Das Problem war nur, dass die Sanderin ungeduldig wurde. Wobei. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sie normalerweise geduldig war. Was weit von der Realität entfernt war. Jedenfalls saß sie ihm im Nacken, und allmählich wurde sie ihm gegenüber ausfallender als sonst.
Aber Ronny hatte keine Ahnung, wo er anfangen sollte. Rund um die Adresse – ein großer Platz, um den herum sich früher mal Geschäfte befunden haben mussten und auf dem der Sendemast stand, von dem angeblich das letzte Signal des Geräts gekommen war, standen vierzehn Hochhäuser mit jeweils zwölf bis sechzehn Stockwerken. Er hatte ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es in solchen Häusern rund 120 Wohneinheiten gab. 120 mal 14. Ergab 1680 Möglichkeiten für den Ursprung des Signals. Das Gerät, das er suchte, war nicht einmal so groß wie das Tablet, das er gerade in den Händen hielt. Es war die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen. Da er nicht in jedes Haus reinstiefeln und jede einzelne Tür auftreten konnte oder wollte, hatte er beschlossen, erst einmal die Lage zu sondieren. Herauszufinden, wer sich hier so herumtrieb. Viele Menschen waren es nicht, die hier lebten oder ihren Geschäften nachgingen.