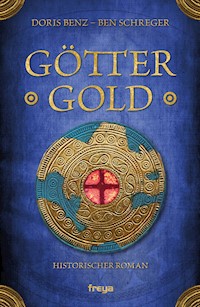
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freya
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
DAS HEUTIGE SÜDWESTDEUTSCHLAND ZUM ENDE DER SPÄTBRONZEZEIT IM 9. JAHRHUNDERT V. CHR. Eine Zeit bedeutender Umwälzungen: Raubüberfälle, Brandschatzung und Frauendiebstahl nehmen zu. Das Streben nach Macht ist verbunden mit dem Besitz von Metallen und ihrem Handel. Es ist der junge Nalumbin, der die Auswirkungen des Wandels zu spüren bekommt. Als zukünftiger Sippenführer trägt er schwer am Erbe seiner Väter, das an ein Versprechen gebunden ist. Doch stellt sich ihm ein mächtiges Gebirge entgegen, um es einzulösen, die heutigen Schweizer Alpen. Die Reise mit ungewissem Ziel wird zum Abenteuer voller Dramatik, bereichert von tiefer Freundschaft und erster Liebe. – Eine Geschichte, in der das vorkeltische Brauchtum mit seinen Naturgöttern und magischen Riten einen wesentlichen Platz einnimmt. Schamanen, Heiler, Himmelsbeobachter und Priesterfürsten betreten die Bühne vor dem Hintergrund eines gewaltigen Naturgeschehens. "Den Autoren ist es gelungen, Licht in das Dunkel einer Epoche zu bringen, die uns keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hat, dafür aber mit ihrem handwerklichen Können und künstlerischem Schaffen bis heute erstaunen lässt. – Ein fesselndes und exzellent recherchiertes Buch." Dr. Jürg Rageth, Archäologe, Chur, Graubünden, Schweiz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Doris Benz und Ben Schreger
GÖTTERGOLD
Historischer Roman über die späte Bronzezeit
ISBN 978-3-99025-427-1
© 2020 Freya Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Layout: freya_art, Regina Raml-Moldovan
Lektorat: Dorothea Forster
Coverdesign: Ben Schreger
Bildverweise: Cover: Das Amulett auf dem Buchcover zeigt zum einen das Modell einer vereinfachten Darstellung der Sonnenscheibe des Sonnenwagens von Trundholm/Dänemark, fotografiert von Udo Lunddahl, und zum anderen die Darstellung einer bronzezeitlichen Bernsteinscheibe aus Dänemark aus dem Ölbild „Bronzezeit IV-II“ von Jens N H Erdmann. Beiden Künstlern gilt unser besonderer Dank für die Freigabe ihrer Werke.
Zum Sonnenwagen von Trundholm: Nordische Bronzezeit (15. bis 14. Jh. v. Chr. – Periode II); Fundort: Im Moor von Trundholm, Dänisches Nationalmuseum Kopenhagen
Zur Bernsteinscheibe: Nordische Bronzezeit (17. bis 13. Jh. v. Chr.– Periode II); Dänemark – Fundort unbekannt, Dänisches Nationalmuseum Kopenhagen
© Adobe Stock: Goldtextur スタジオサラ,
printed in EU
Inhalt
VORWORT
ERSTES Buch
Im Zeichen des Orakels
Das Sonnenfest
Des Schlachters Ruf
Fieberträume
Aufbruch
Ardevi
Zweites
Schwarzmoos
Tara
Die Tore von Thaine
Das Band
Der Stachel
Drittes
Sernagrund
Vom feurigen Fischer
Stimmen
Auf dem heiligen Berg
Die heilige Hochzeit
Die steinerne Stele
Sernagrunds Maskenträger
Im Schatten des Todes
Traumbilder
Abschied
Viertes
Hedars Haus
Schreie im Schwarzmoos
Das rote Tuch
Mitten in der Nacht
Augenblicke
Der Schwur
Fünftes
Reisewege
Jago
Die Felsen von Kar
Der Schlucht entgegen
Die Brücke
Ambera
Lichtblicke
Die Rückbesinnung
Aufwärts
Sturmkrieger
Rovera
Die Stimme des Wassers
SechstesBuch
Morgendämmerung
Sternenstaub
Der Ruf
Ausklang
Nachwort
Anmerkungen
Danksagung
Schauplätze
Literaturliste
VORWORT
„Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier, wacht auf im Menschen!“, heißt es im Altindischen. Die stein-, kupfer- und bronzezeitlichen Kulturen Mitteleuropas mit ihren vorkeltischen Riten beziehen sich stark auf dieses Weltbild.
Längst schon sind sie aufgewacht, die Menschen, und haben sich der kostbaren Erze in den Steinen bedient. Und so war der Zeitsprung zwischen der Steinzeit und dem Metallzeitalter ein epochaler Schritt. Mit der Verhüttung und Weiterverarbeitung von Kupfer und Zinn zu Bronze ab 2200 v. Chr. entwickelte sich in Mitteleuropa wirtschaftlicher Reichtum und gesellschaftliche Macht. Waffen, Geräte und Schmuck aus Bronze waren die Errungenschaften einer neuen Zeit. Kriegerische Auseinandersetzungen um diese Metalle nahmen zu. Von nun an sollte das Gold den Göttern nicht mehr allein gehören.
Kupfer, Bronze, Zinn, Bernstein und Glas als Zahlungsmittel bedeuteten Umwälzungen in der Gesellschaftsstruktur. Der Handel florierte schon damals über riesige Distanzen von der Ostseeküste bis ins heutige Ägypten. Selbst ein so mächtiges Gebirge wie die Alpen stellte keine unüberwindbare Barriere für die Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd dar. Ein neues Wirtschaftssystem war geboren. Es bildete sich eine Oberschicht heraus. Großsiedlungen und aufwendige Befestigungsanlagen nahmen ihren Anfang. Besonders deutlich wird dies mit der Epoche der Spätbronzezeit von 1300 bis 800 v. Chr. Sie steht für das Bindeglied zur darauf folgenden Eisenzeit, in der das Streben nach Macht durch das neue, noch härtere Metall endgültig den Sieg davontragen sollte.
Die späte Bronzezeit zeugt von hoher Handwerkskunst, von beachtlichem mathematischem Wissen und von einer Ideenfülle, die uns auch heute noch staunen lässt. Mit vielfältigen Kultgegenständen wurde damals versucht über die begreifbare Welt hinauszuschauen. Die Ausläufer ihrer facettenreichen Ausdruckskraft finden sich noch heute in religiösen Fruchtbarkeits- und Jahreszeitenritualen. Und immer wieder ist es der Sonnenmythos, der sich, wie auch in anderen Kulturen, nicht nur in der Kunst offenbart hat, sondern auch in Religion, Philosophie, Heilwissen und Himmelsbeobachtung; dies alles vor dem Hintergrund des gewaltigen Naturgeschehens. Der Mensch hatte sich dem Götterwillen bedingungslos zu beugen. Ernteausfälle und Hungersnöte vertrieben ganze Sippen auf der Suche nach einer besseren Zukunft aus ihrer Heimat. Dann aber entschieden nicht mehr nur die Götter über Freud und Leid. Die Metalle machten ihnen ihre Erhabenheit streitig. Der Mensch strebte immer mehr nach Reichtum und der damit verbundenen Macht und begann seine Zäune zu übersteigen ...
Begeben wir uns nun auf die Reise in die ausgehende Epoche der Spätbronzezeit im 9. Jh. v. Chr., in eine Zeit, in der das Gold den Göttern nicht mehr allein gehören sollte ...
Bei der Entstehung des vorliegenden Romans konnten wir zurückgreifen auf unsere eigenen Vorstudien. Richtungsweisend aber war der konstruktive Kontakt zu Dr. Jürg Rageth vom Archäologischen Dienst Graubünden in der Schweiz. Ihm, als dem weltweit bekannten Experten für bronzezeitliche Forschung, sind wir für die Begleitung unserer Texte zu ganz besonderem Dank verpflichtet!
Die Autoren
Niedereschach und Schorndorf im Jahr 2020
„Nicht die Form der Welle ist es, die sie zur Welle macht, die Kraft ist es, die sie bewegt ...“
– Keltische Weisheit –
ErstesBuch
Im Zeichen des Orakels
Auch in diesem Jahr erhob sich das Wetter: Der Regen wurde zum größten Feind für die Bewohner des Beleintales in den südlichen Waldbergen. Das Tal, das sich von der Großen Ebene des Stromes Rhenair im Westen bis zum Sonnenberg im Osten hinzog, barg an seinem Ende das Stammesdorf der Lomer. Der Winter hatte noch bis ins Frühjahr hinein ihre Siedlung in eisigem Griff gehalten. Danach tat ein regenreicher Frühsommer sein Schlimmstes, und so kam es, dass fast die gesamte Saat von Emmer und Dinkel und Gerste verfaulte. Es gab eine Hungersnot. Viele Kinder überlebten nicht. Die Sorge um die Zukunft des Stammes griff um sich, und lähmende Angst erfasste die Herzen der Lomersippe.
Die nur aus wenigen Häusern bestehende Siedlung befand sich auf einer Anhöhe über dem Talgrund, umgeben von Feldern und Kleeweiden, die an dichten Wald grenzten, der überwiegend aus Buchenbäumen bestand. In den Häusern mussten die Vorräte aus dem letzten Jahr streng eingeteilt werden, und die Gesichter der Bewohner kündeten davon – wie die regenschweren und dunklen Wolken über den Dächern. Unter einem dieser Dächer lebte Jor, der Sippenführer.
Er öffnete einen Holzkasten und entnahm ihm einen Tonkrug mit Honigwein. Während er in Erwartung seines Gastes den Verschluss aus Birkenpech öffnete und zwei Becher zur Hand nahm, fiel sein Blick durch eine offene Luke auf den Dorfplatz. Dort ragte die Stammeslinde in den grauen Himmel. Sie rief Erinnerungen wach an die vielen heiteren Feste lange zurückliegender Jahre. In diesen Tagen jedoch war alles mager und verhalten ausgefallen. Am Essen musste gespart werden, auch im Hinblick auf die bevorstehende Sonnenfeier. Stattdessen hatten die Lomer unter dieser mächtig ausladenden Lindenkrone nur wenige und stille Bittfeste zelebriert.
In diese schweren Gedanken hinein klopfte es an die Tür. Es war Pjat, das Oberhaupt der Talischen. Die Lomer nannten sie so, da die Siedlung der Talischen zwar nur wenige Steinwürfe entfernt, jedoch um ein paar Baumlängen tiefer lag als das Dorf der Lomer. Trat man vor die Einfriedung der Lomersiedlung, so konnte man auf die Hausdächer der Talischen hinabblicken und die Windrichtung am Rauch aus ihren Firstluken ablesen. Regen troff Pjat von Kappe und Umhang und hinterließ beim Eintreten kleine Pfützen. Jor begrüßte den Gast und forderte ihn auf, am Herdfeuer Platz zu nehmen. Nun ergriff Pjat das Wort: „Nicht das erste Mal ist es, dass wir uns ratlos gegenübersitzen und einer auf des anderen Entscheidung wartet.“
„Die Verantwortung ist zu groß, um solche Entscheidungen allein zu treffen“, bemerkte Jor.
„Wartet Jedaure auf uns?“
Jor bejahte. Sein nachdenklicher Blick glitt erneut aus dem Fenster.
„Jedaures Rat ist meine ganze Hoffnung, denn unter meinen Leuten sind nicht alle einer Meinung. Es gibt da Zweifler.“
„Nicht nur unter euch, Pjat, auch bei uns sind Stimmen laut geworden, die in Frage stellen, ob das Leben an den Seen jenseits des Weißen Gebirges wirklich einfacher ist? Nicht alle trauen den Berichten der Händler, die erzählen, dass es dort sehr mild sei und das Wetter meist gut. Wie ein schmales Band soll sich der lange See von den Bergen bis in die fruchtbaren Ebenen des Südens ziehen, in denen Früchte und Getreide doppelt so groß wachsen und in der halben Zeit reifen sollen wie bei uns. Kann man dem Glauben schenken? Ich wünschte es mir, aber ein Abschied von hier, der ist mehr als schwer. Dieses Tal ist seit Langem unsere Heimat. Aus jeder Pflanze, jedem Baum, jedem Tier, aus jeder Quelle und jedem Stein weht hier der Geist unserer Ahnen.“
„Nun gut, Jor! Es gibt gewiss immer wieder Aufschneider unter den Händlern. Aber etwas Wahres muss ja wohl daran sein.“
„Wer weiß?“, spann Jor die Gedanken von Pjat fort. „Ich denke da an die Begegnung mit Laraun aus der großen Höhensiedlung über dem Rhenair. Er sprach davon, dass ein paar seiner Leute ebenfalls ihre Auswanderung erwägen, obwohl es sich dort – wie wir wissen – deutlich leichter lebt als bei uns. Wir sind einfache Bauern, die Bergsiedlung aber beherbergt viele Handwerker. Ihre Waren haben einen guten Ruf und sind begehrt. Wir mit unseren einfachen Geräten können da nicht mithalten. Außerdem ziehen bei ihnen die Händler durch, und der Warentausch hat immer schon Wohlstand mit sich gebracht. Wen wundert’s, dass Laraun also der Meinung ist, die heimische Erde mache eher satt als alle Versprechungen der Welt.“
„Womit er nicht ganz unrecht hat!“, bekräftigte Pjat.
„Ihre Speicher sind besser gefüllt als unsere. Noch ist das so. Aber was ist, wenn das nasse Wetter auch ihnen die Ernte verdirbt? Dann wird sich der Tauschhandel von wertvoller Ware gegen Nahrungsmittel zuspitzen. Einfache Leute wie wir stehen dann am Ende mit leeren Händen da.“
„Sei es wie es will, doch bevor es so weit ist, müssen wir handeln, nicht nur reden“, sagte Jor mit auffordernder Geste.
„Wir müssen endlich Klarheit haben. Die Götter allein kennen unseren Schicksalsweg, und Jedaure ist die Brücke zu ihnen. Komm!“
Sie erhoben sich und traten aus der Tür. Der Regen hatte aufgehört. Feiner Nebel zog in Schwaden durch die Gassen. An einem Haus, in dessen Türbalken ineinander verschlungene Kreise und ein fünfzackiger Stern eingeritzt waren, machten sie Halt. Holunderbüsche umrahmten den Eingang. In ihren Blütendolden sprühten winzige Tröpfchen wie aus einem Sternenhimmel im Zwielicht des Nebels hervor. Bald würde die Sonne die feuchten Schwaden verzehren.
Auf Jors Klopfen hin erschien eine hohe Gestalt mit schlohweißem Haar und Bart. Es war Jedaure, der alte weise Mann, der im Lauf der Zeit über die Siedlung der Lomer hinaus bekannt geworden war. Woher er wirklich stammte, wusste niemand genau zu sagen. Ebenso wenig, warum er sich als gebildeter Mann bei den Bauern, die ihn verehrten, im Beleintal niedergelassen hatte. Er half ihnen, die Zeiten für Aussaat und Ernte zu bestimmen. Er weissagte ihnen, er leitete ihre Opferrituale, und er gab ihnen aus den Himmelszeichen nützliche Ratschläge. Beim Herannahen erkannte man ihn am Klingeln seines Kettengehänges am Gürtel.
Die Stammesführer traten ein und trugen dem Weisen ihr Anliegen vor. Da ergriff Jedaure einen Lederbeutel und forderte sie auf, ihm zu folgen. Zu dritt verließen sie Haus und Dorf. Ihr Ziel war ein mächtiger Hügel, der den Blick auf die beiden Siedlungen freigab. Biegsame Weiden wuchsen dort. Jedaure schnitt Zweige von ihnen und band sie zu zwei großen Ringen. Er legte sie so zu Boden, dass sie sich überschnitten. Nun entnahm er dem Beutel eine Handvoll Zierscheiben aus Bronzeblech. Die Scheiben trugen in der Mitte eine Ringöse, an der jeweils ein Anhänger von menschenähnlicher Gestalt befestigt war. Mit den Scheiben in der linken Hand – es waren sieben an der Zahl – kniete sich Jedaure vor den beiden Ringen nieder. Dann begann er mit geschlossenen Augen zu sprechen, das Gesicht nach Osten gerichtet:
„Regen, Regen, wenig Brot,
alles Werden ungewiss,
bar von Hoffnung in der Not,
alles wankend, alles trauernd
um der Kinder frühen Tod.
Raub und Grauen, Krieg und Schande,
alles aus dem rechten Lot.
Im Dunkel liegt der Weg,
erloschen ist das Morgenrot.“
Er hob den Arm zum Himmel und bat:
„Entsiegelt euch, ihr großen Götterzu Einem, das uns helfen kann, euch gilt mein Ruf, führt ihr uns an!“
Der Arm sank nieder. Die rechte Hand ergriff eine der Scheiben. Voller Ehrfurcht vernahmen Pjat und Jor die Stimme, die fortfuhr:
„Zeigt mir den Weg, zeigt mir die Brücke, die alles überwinden hilft,vereint in diesem Augenblicke!“
Jetzt warf Jedaure die erste Scheibe. Sie landete vor einem der beiden Schnittpunkte.
„Die Mitte ist der Weg, die Mitte ist die Brücke, und nur der Brückenschlag von beiden Seiten kann sicher uns zu neuen Ufern leiten.“
Es folgte die zweite Scheibe. Sie traf in den rechten Ring.
„Ein Lichtgedanke – nur ein Wort, ihr Götter, sendet in die Kreise,dass Segen ruhe auf der weiten Reise.Lasst fallen euren dichten Schleier,und zeigt euch im Orakelspielals Antwort auf das ferne Ziel.“
Die dritte und vierte Scheibe folgten dicht aufeinander. Sie fanden ihren Platz in der Schnittmenge der beiden Ringe. Jedaure verfiel in einen Sprechgesang, dessen Sinn Pjat und Jor nicht verstehen konnten, so angestrengt sie auch lauschten. Die fünfte und sechste Scheibe waren an der Reihe. Eine traf mitten in den linken Ring, die andere landete außerhalb. Die Blicke der Dorfhöchsten begegneten sich kurz, aber vielsagend, danach starrten sie wieder gebannt auf Jedaures Hand, die sich anschickte, die letzte und siebte Scheibe zu werfen.
„Sei verbunden diesem Bunde, himmelan und zeitenlos, ruhend in der Götter Schoß, siebte, letzte, heilige Zahl, du bestimm‘ in dieser Runde, ob zu lassen dieses Tal, ob zu rüsten und zu reisen? Ach, ihr Götter gebt uns Kunde, ist die Ferne uns verheißen?“
Pjat und Jor stockte der Atem. Wo würde sie landen? Sie fiel genau in die Überschneidung der beiden Ringe. Drei Scheiben befanden sich nun darin. Pjat und Jor wagten sich nicht zu rühren. Jedaure öffnete die Augen. Lange Zeit herrschte Schweigen. Dann machte sich Jedaure leise murmelnd daran, die Lage der Figuren an den Ringösen zu deuten. Die beiden Dorfführer erschauerten angesichts der Bedeutung dieses Augenblicks. Gebannt starrten sie auf Jedaure, und so bemerkten sie die Jungengestalt nicht, die sich hinter einem der Büsche verborgen hielt und deren Augen das Geschehen erspäht hatten.
Es war kurz vor dem Sonnenfest, als Nalumbin, der Sohn von Jor, seinen Blick von einem Felszacken aus in die Ferne schweifen ließ. Am südlichen Horizont erhob sich die mächtige Kette des Weißen Gebirges. Zwei Sonnenläufe waren vergangen, seitdem er Jedaures Orakelspiel heimlich belauscht hatte. Die Vorstellung, über das Weiße Gebirge zu ziehen, begeisterte ihn; endlich zu sehen, welche Landschaften dahinter lagen. Über die Gefahren einer Überschreitung des gewaltigen Gebirges war er sich mit seinen vierzehn Sommern nicht im Klaren.
Jetzt aber galt sein Interesse den Vorbereitungen zum kommenden Sonnenfest. Endlich war er alt genug, um mit den Erwachsenen auf den Sonnenberg zu ziehen. Es sollte sein erstes und zugleich letztes Fest auf dem Berg sein; ein Berg, dessen Gipfel in seiner Form an den kraftstrotzenden Nacken eines Stieres erinnerte. Die Götter hatten entschieden, dass die Bewohner von Nalumbins Dorf gemeinsam mit den Talischen fortziehen würden.
Eine seltsame Spannung lag über der Siedlung, und nicht einmal die wärmende Sonne, auf die man so lange gewartet hatte, konnte sie durchbrechen.
Nalumbin vertauschte seinen Standort mit dem Wipfel eines Baumes über der Siedlung. Er sah, wie seine Mutter und Schwester vor dem Haus saßen und aus Zweigen und Blumen Kränze und Girlanden flochten und wie sein Vater das Feuerbecken vorbereitete, in das er anderntags das noch glühende Holz aus dem Herd legen würde.
Es sollte auf den Berg getragen werden, der aufgehenden Sonne entgegen. Mit ihren Strahlen würde sie die Glut neu beleben. Körbe mit Feldfrüchten und Saatgut und Deckelgefäße mit frisch geschöpftem Wasser aus der Quelle wurden auf Karren verladen. Neue Kleidungsstücke, Fibeln und Broschen kamen hinzu. Auch Bündel von sorgsam ausgewähltem Holz für das Festfeuer, das kein Blitz getroffen haben durfte.
Als dann die Talischen aus der Nachbarsiedlung eintrafen, lag nicht nur der Duft von frisch gebackenem Brot über dem Ort, sondern auch eine Stimmung, die die Vorfreude auf das Fest dämpfte. Sie alle wussten, dass es ihr letztes Sonnenfest auf dem heiligen Berg sein würde. Und da spürte auch Nalumbin den Abschiedsschmerz, der wie eine unsichtbare Hand nach der soeben noch hoch fliegenden Freude griff. Als er sah, dass die Talischen sogar ihren Pflug auf eine von Ochsen gezogenen Schleife geladen hatten, da erkannte er, wie groß ihre Sorge um die künftige Fruchtbarkeit ihrer Äcker und damit um ihrer aller Überleben sein musste.
Hatten sie die Absicht, den Pflug morgen auf den Berg zu schaffen, dass auch er am Segen der Sonne teilhaben konnte?
Es war Abend, als Nalumbin mit zwei anderen Jungen das Vieh von der Waldweide in den Pferch der Siedlung trieb. Die Sonne entsandte ihre letzten Strahlen in die Wipfel der Stammeslinde inmitten des Dorfplatzes, während die Gassen zwischen den Häusern bereits im Schatten der kommenden Nacht lagen.
Die bis zur Erde herabreichenden Dächer mit ihren spitzen Giebeln stachen schwarz in den rot glühenden Himmel. Aus einem der Häuser drang leiser Gesang. Auf dem Rückweg sah Nalumbin durch die offene Tür, wie Jendur, der Töpfer, im Schein seines Herdfeuers den Trichterrand eines wohlgeformten Tonkruges verzierte.
In Gedanken versunken war Nalumbin vor dem Haus stehen geblieben, als ihm eine vertraute Stimme ins Ohr flüsterte:
„Ist es nur der Schein von Jendurs Feuer, der deine Augen zum Glänzen bringt, oder spiegeln sich Sorge und Schmerz in ihnen?“
Es war Jedaure. In den Zeiten seines Heranwachsens hatte Nalumbin ihn häufig aufgesucht, um seinen Wissensdurst zu stillen. Auch wenn der weise Mann über die pausenlose Fragerei des Jungen oft ungehalten war, so mochte er ihn dennoch und war stets bereit zu antworten.
„Jedaure, wird der Weg übers Gebirge schwierig sein?“, fragte der Junge.
„Wenn die Götter gnädig sind, ist kein Ziel zu fern. Aber wehe dem, der ihren Zorn zu spüren bekommt. Dann schleudern sie Steine, Schnee und Eis von den Bergen. Die Windgeister fegen über Höhen, zerbrechen Brücken und Stege, entwurzeln Bäume und jagen durch Schluchten, die so tief sind, dass das Auge vergeblich nach ihrem Grund sucht. Und die Kälte streckt ihre eisigen Finger nach allem aus, was lebt. Und dennoch ziehen die Menschen seit ewigen Zeiten über die Berge und versuchen durch Opfergaben die Götter milde zu stimmen und deren Wohlwollen zu erlangen.“
„Ziehen sie auch zum Langen See?“
„Auch zum Langen See.“
„Jedaure! Erzähl mir vom Südland!“, bat Nalumbin.
„Das will ich gerne tun. Bei einem Schluck Gärigem jedoch wird der Geist wacher und die Zunge lockerer. Also, lauf rasch in mein Haus und bring mir einen Becher davon!“
Nalumbin ließ sich dies nicht zwei Mal sagen. Voller Spannung auf Jedaures Bericht eilte er davon. Seine Neugier galt nicht nur dem Südland, sondern auch Jedaures Behausung mit all den seltsamen Dingen. Er kannte den Platz, an dem sich das Gewünschte befand, denn bei so manchem Gespräch hatte sich Jedaure des Kruges bedient und den Becher geleert. Beides, Krug und Becher, standen auf einem ausladenden Wandbrett neben dem Herd. Die Nähe des Feuers hielt das Getränk angenehm warm und damit verträglich. Nalumbin schenkte ein. Es zischte und roch säuerlich und gleichzeitig nach süßreifen Waldbeeren.
Mit dem vollen Becher in der Hand verharrte er. Er konnte nicht anders, denn der Anblick der Sammlung an fremdartigen Gebilden auf dem Brett fesselte ihn auch diesmal. Da waren ein winziger Kessel auf vier Rädern, ein verzierter Schwertgriff, Kamm und Rasiermesser, Spiralringe – alles aus Bronze, und versehen mit geheimnisvollen Zeichen. Neben Kettengehängen aus Tierzähnen, geschnitzten Masken und Kugeln aus farbigem Glas behaupteten sich kleine Figuren aus Horn und Wurzeln, als wollten sie jeden Augenblick lebendig werden.
Dazwischen versteckte sich ein Kästchen, dessen Außenseiten und Deckel weiches, faseriges Leder überzog. Ein Schmetterling und ein vierblättriges Kleeblatt waren auf dem Deckel eingeprägt; Kunstwerke aus mattgrauem, mit Hammer und Punzen bearbeitetem Metall, die Nalumbin schon immer bewundert hatte. Diesmal stand der Deckel offen, und die seit Langem unbeantwortete Frage nach seinem Inhalt erübrigte sich jetzt.
Voller Ehrfurcht berührte Nalumbin das hellbraune Leder, während sein Auge einen flachen Stein von ungewöhnlicher Farbe erfasste. Es war nicht der Schein des Feuers, der den Stein im Kästchen rosa schimmern ließ, es war der Stein selbst. Bis auf die Farbe unterschied er sich nicht von dem harten körnigen Gestein, wie es mit seinem grünlichen Grau in den Waldbergen vorkam, und in dem sich der Wald widerspiegelte.
Das Besondere aber an dem Stein waren seine Ritzzeichen: Die Köpfe von zwei vogelartigen Wesen, die mit großen kreisrunden Augen in entgegengesetzte Richtungen schauten; sie saßen auf lang gezogenen, geschwungenen Hälsen, die am Rand des Steins endeten. Zwischen beiden Köpfen ließ sich ein Kreissymbol aus vier Ringen erkennen. Die fremdartigen Bilder muteten seltsam an. Warum hatten die Vogelwesen keine Körper? Jetzt erst bemerkte Nalumbin, dass die Kante unter ihren Hälsen abgebrochen zu sein schien.
„Nalumbin! Wo bleibst du? Ich warte nicht länger!“ Es klang ungeduldig. Es war Jedaures Ruf.
Ein letzter Blick noch beim Verlassen von Jedaures Haus! An der Wand blinkten im Feuerschein Schallbleche und eine Lure auf! Mit dem überschäumenden Becher in der Hand rannte Nalumbin hinüber zu Jendurs Werkstatt, bemüht, nichts von dem edlen Tropfen zu verschütten. Als dann Jedaure einen tiefen Zug nahm, wiederholte Nalumbin die Frage, die ihm nach wie vor auf den Lippen brannte: „Warst du schon einmal im Südland?“
„Nein, aber ein alter Freund mit Namen Arfund ist mehrmals übers Weiße Gebirge in den Süden gezogen. Nicht nur in seinen jungen Jahren. Er kennt die Wege wie kein anderer. Über seine Reisen hat er mir viel und so ausführlich berichtet, dass ich am Ende meinte, selbst unterwegs gewesen zu sein. Noch immer sehe ich das Bild vom Langen See vor mir, das er mir geschildert hat: Tiefblaues Wasser zwischen steil aufragenden Bergen, die sich nach Süden bis zu den fruchtbaren, sonnigen Ebenen hinziehen. Zu jeder Jahreszeit ein Hauch von Frühling. Frisches Grün, saftige Uferwiesen! – Ich habe dir doch schon öfters von den Nachbarbergen unserer Waldberge im Nordosten erzählt ...“
„Du meinst die Tafelberge, deren Gipfel so aussehen als hätten die Götter sie auf halber Höhe abgeschnitten?“, fiel Nalumbin Jedaure ins Wort.
„Ja, so ist es! Östlich von diesem Gebirge, am Divonefluss, gibt es Siedlungen, die an den alten, in alle Himmelsrichtungen führenden Handelswegen liegen. Hier befördern die Händler ihre Geräte, Waffen und Schmuck, aber auch Feuerstein, Gold, Glaspaste, Rohkupfer und lebensnotwendiges Salz. Dort, in der Thainesiedlung, diesem wichtigen Ziel- und Ausgangsort, ist mein Freund Arfund sesshaft geworden. Vor drei Sommern hat er mich besucht. Unser ganzes Dorf hat ihn angestaunt – er ist eine wilde Erscheinung. Erinnerst du dich noch?“
Oh, ja! Nalumbin erinnerte sich genau an den Besucher von damals. Nie zuvor hatte er einen solch abenteuerlich aussehenden Mann gesehen. Derbe Gestalt. Ein breiter, gedrungener Rücken, stämmige Beine und Arme. Gekleidet in Fell und zerfranstes Leder. Um den Hals ein Bündel von Raubtierzähnen, das ihm dieses wilde Aussehen verlieh.
„Auch die Völker des Südens scheuen den Weg nicht über das Weiße Gebirge, ebenso wenig wie mein Freund Arfund“, fuhr Jedaure fort.
„Zu den großen Handelsstätten bringen sie kostbare Keramik, Öl und feine Gewürze, die man nur mit Gold aufwiegen kann. Auch neues Handwerk in der Herstellung von Gerätschaften gelangen über diese alten Wege zu uns.“
Mit einer Handbewegung deutete Jedaure auf die offene Töpferwerkstatt. Dabei begann das Kettengehänge aus den vielen kleinen Bronzeringen an seinem Gürtel zu klingeln und er fuhr fort:
„Sieh her! Meine Ringe! Auch das Zinn, das zur Herstellung von Bronze benötigt wird, kommt von weit her aus den Landschaften im Westen an den Küsten des Großen Meeres. Du siehst, wie die Dinge sich vereinen. Das Ferne wird nah und das Nahe wird fern.“
Aus der Werkstatt drang Sprechgesang. Jedaure und Nalumbin sahen, wie sich Jendur nach getaner Arbeit auf den Boden setzte. In sich versunken, beschwor er nun mit seltsamen Lauten den schönen Krug, der vor ihm stand.
„Wird Jendur diesen Krug morgen opfern?“
„Ja, das wird er tun. Auf dem Sonnenberg wird er ihn im Schein der Mondin in eine Felsspalte werfen. Der Krug wird zerbersten, und jede Scherbe wird der Göttin geweiht sein. Doch hör! Jendur besingt den Krug. Er dankt der Göttin für die Erde, aus der er ihn schaffen konnte. Sein Loblied wird in jeder Scherbe klingen bis hin zum kleinsten Splitter. Keines Menschen Hand wird den Krug, wenn er erst zerbrochen ist, je wieder für sich nutzen können. Was für diesen Krug gilt, gilt auch für das Gold. Gold, das gehörte früher nur den Göttern. In diesen Tagen aber mehren sich die Schurken, die es den Göttern streitig machen. Der Glanz des Goldes widerspiegelt sich auf schlimme Weise in ihren Augen. Sie sind geblendet von Reichtum und Macht. Wehe uns, wenn diese Macht missbraucht wird. Dann ist das Unheil nahe, denn die Götter werden zürnen. – Doch jetzt lass' uns mit Freude auf den morgigen Tag blicken! Zum ersten Mal wirst du auf dem Sonnenberg durchs Feuer springen. Es ist das Feuer, in dem der Sonnenfunke wohnt!“
Diese aufmunternden Worte ließen das Bild des Herdfeuers in Jedaures Haus aufflackern. Nalumbin sah das Wandbrett mit dem Lederkästchen, das sich ihm unerwartet offen gezeigt hatte, und ohne nachzudenken, ob er ein Recht hatte, nach dem Sinn seines Inhalts zu fragen, brach es auch schon aus ihm heraus: „Jedaure! Das schöne Kästchen mit dem Schmetterling und dem Kleeblatt! Ich hab' hineingeblickt! Der Deckel war offen! Ich wollte nicht neugierig sein, aber der Stein mit den Vogelköpfen, er hat mich angeschaut! Was hat er zu bedeuten? Woher kommt seine rötliche Farbe?“
Es kam keine Antwort. Als Nalumbin den Blick hob, sah er in ein Gesicht, dessen Miene sich verfinsterte, so wie auch das Tageslicht schwand. Jedaures Hand umklammerte den treuen Begleiter, seinen Stab, als suche sie Halt. Nalumbin fühlte sich unwohl in seiner Haut. Warum hatte er sich nicht beherrscht und geschwiegen? Hatte er Jedaure mit seiner Neugier verärgert? Nalumbin fühlte sich schuldig. Er fror. Dann, nach geraumem Schweigen, sagte Jedaure:
„Du musst jetzt gehen!“
Als hätte Jedaure es geahnt, hörte der Junge auch schon die Stimme seines Vaters:
„Nalumbin! Komm endlich her!“, rief es durch die dunkle Gasse. „Der Karren belädt sich nicht von allein!“
„Ich komme, Vater!“
Eine Geste des Abschieds, dann ein letzter Blick in Jedaures Gesicht, und Nalumbin konnte nicht anders, als unschlüssig stehenzubleiben. Er sah, wie Jedaures Züge sich nach einem Schluck aus dem Becher plötzlich entspannten, und wie der Kummer einem nachsichtigen Lächeln wich. Da fielen Kälte und Unwohlsein von Nalumbin ab.
„Im Kästchen liegt die Erinnerung an meine Heimat, an längst Vergangenes. Im Stein hat es sich verkörpert!“
„Nalumbin! Wie lange sollen wir noch auf dich warten?“ In Jors Stimme schwang ein drohender Unterton.
„Geh', Junge!“, befahl Jedaure.
Im Begriff zu folgen, wandte sich Nalumbin noch einmal um. Sein Gesicht war von Schatten umspielt, und die Stimme zögerlich, beinahe ängstlich:
„Jedaure, werde ich den Sonnenberg jemals wiedersehen?“
„Deine jungen Füße werden dich noch weit tragen!“
„Kann das Glück mit uns sein, auch wenn wir in die Fremde ziehen?“
„Mit einem großen Gedanken im Herzen wirst du jede Grenze überschreiten. Orientieren kannst du dich an den Sternen. Erreichen wirst du sie nicht, und das ist gut so. Das Glück ist immer umsonst. Erkennen musst du selbst, wo es liegt.“
Die Schritte des Jungen wurden rascher und verklangen. Die Mondin überschüttete nun die Siedlung mit ihrem Licht. Im Gebüsch sang der Nachtvogel. Jors Fackel erhellte den Platz vor dem Haus, auf dem der gepackte Handwagen stand. Letzte Handgriffe. Im Haus selbst flackerte das Herdfeuer. Knisternd rollte sich die Birkenrinde unter den sorgsam geschichteten Scheiten zusammen. Im Kessel kochten eine Handvoll Linsen und ein Stück Speck – die Mahlzeit, mit der sich die Familie am kommenden Morgen vor dem Aufbruch stärken würde.
Als dann das Feuer nur noch glimmte und Nalumbin sein Lager aufgesucht hatte, ließen ihn Jedaures Worte lange nicht zur Ruhe kommen. Aber auch die Vorfreude auf das Sonnenfest verwehrte ihm den Tiefschlaf. Bläulicher Morgenschimmer lag über der noch stillen Lomersiedlung, als er sich heimlich aus dem Haus stahl. Unter Jors Schnarchlauten war es seinen geschickten Händen gelungen, den Riegel fast geräuschlos wegzuschieben und die Tür zu öffnen. Auf bloßen Füßen huschte er zum Dorfplatz.
Sanft zupften die Windschwestern an den Blättern der alten Stammeslinde und verbreiteten ihren Duft. Nalumbins Augen suchten nach dem kleinen Holzschrein, der sich in der Krone des mächtigen Baumes verbarg. Von seinem Vater wusste er, dass dieser Schrein ein Kleinod hütete – einen Bernstein von unvergleichlicher Farbe –, den die Lomer ‚Träne des Meeres‘ nannten.
Die ersten Vogelrufe mischten sich in das Windgeflüster. Das Laubwerk der Linde, in dem sich das Geheimnis barg, zitterte und raschelte. Der Sand unter Nalumbins Füßen knirschte, als er den Stamm umrundete. Er hörte Tritte, die sich näherten. Bildete er sich dies ein? Waren es seine eigenen Schritte? Er blieb stehen und lauschte. Eine Stimme, die er kannte, rief: „Junge! Was tust du hier?“ Es war die Stimme von Jor. Nalumbin fühlte sich ertappt.
„Ich konnte nicht schlafen, Vater!“
„Du hast doch etwas im Sinn, sonst würdest du um diese Zeit nicht nach draußen schleichen! Was ist es, das dich beschäftigt?“
„Ich war in Jedaures Hütte. Hast du schon einmal das Kästchen mit dem Schmetterling und dem Kleeblatt gesehen? Der Deckel stand offen, und ich schaute hinein. Ein Stein liegt darin, der so ganz anders aussieht, als unsere Steine – mit seltsamen Zeichen darauf – zwei vogelartigen Wesen. Weißt du, was sie bedeuten?“
„Jedaure hütet so manche Besonderheit, deren Geschichte und mythische Bedeutung nur er kennt! Wenn dir das Kästchen mit dem Schmetterling aufgefallen ist, dann hast du sicher auch die anderen rätselhaften Dinge in seiner Sammlung bemerkt?“
„Ich habe Jedaure nach dem Kästchen gefragt. ‚In ihm liegt die Erinnerung an meine Heimat‘, hat er geantwortet. Hast du eine Ahnung, woher Jedaure stammt und wie alt er ist?“
„Das weiß niemand so genau!“
Jor zog den Sohn auf die tiefschattige Bank unter dem Baum. Zurückversetzt in die Tage seiner Kindheit erzählte er:
„Solange ich denken kann, hat die Erscheinung Jedaures einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Als ich alt genug war, fragte ich meinen Vater, so wie du mich jetzt fragst, nach dem Geheimnis um Jedaure, der damals schon alterslos zu sein schien. Wir saßen genau hier, am selben Ort, als ich seinen Geschichten aus längst vergangener Zeit zuhörte.“
Jor legte seinem Sohn den wärmenden Mantel um.
Dann fuhr er fort: „Von meinen Vater weiß ich, dass Jedaure in jungen Jahren in einem Land weit im Westen gelebt hat, mit Ufern, an denen sich steiler Fels mit der weißen Gischt des Meeres vereint. Und doch bleibt die genaue Herkunft Jedaures ein Rätsel. Es war dein Urgroßvater – sein Name war ‚Bardo‘ –, dem Jedaure vor vielen Sonnenumläufen einst ein dunkles Geheimnis anvertraut haben soll ...
Es hieß, dass eines Abends ein besonders vertrauter Schüler seinem Lehrmeister aufgelauert habe. Es soll an der Küste des Meeres an jenem Ort gewesen sein, an dem der weise Mann oftmals den nächtlichen Sternenhimmel und den Lauf der Mondin betrachtete, umringt von hohen Steinen. Der Schüler war der Schönheit eines kostbaren Bernsteins verfallen, der die Spitze eines Eichenstabes zierte – das Eigentum des Meisters! Der Schüler versuchte, diesem den Stab zu rauben. Ein heftiger Kampf entbrannte, wobei es dem Schüler gelang, dem Meister den Stab zu entreißen.“
Nalumbin lauschte in atemloser Spannung. Jor spürte seine Erregung und nahm seine Hand.
„Stell dir vor! Kaum aber war der Stab in der Hand des flüchtendes Diebes, sprach der Meister einen Fluch über ihn aus. Augenblicklich sandten die Meeresgötter ihre Fluten nach ihm. Die tosenden Wellen rissen den Frevler mit sich, und die tiefen, nachtschwarzen Wasser sollen ihn für immer verschlungen haben! Die Meeresgötter aber gaben den Stab mit der Bernsteinspitze wieder frei. Am Morgen darauf fand der weise Mann den Stab unversehrt inmitten des Steinkreises liegend! Warum es ihn dann von den Küsten des Meeres fortzog, darauf gibt es bis heute keine Antwort. Von meinem Vater weiß ich nur, dass die Füße des weisen Mannes ihn weit nach Osten trugen. So weit, bis sie schließlich die südlichen Waldberge erreichten.“
„Was ist aus ihm geworden?“, platzte es aus Nalumbin heraus.
„Das wirst du gleich erfahren, mein Sohn! Im Beleintal dann, in unserem Tal, in unserer Siedlung, suchte der fremde Wanderer Schutz vor Unwetter unter einer Linde, dem Baum, unter dem wir jetzt sitzen.
Und nun höre und staune: Als er seinen Stab gegen den Stamm dieses Baumes lehnte – so hat es dein Urgroßvater Bardo meinem Vater berichtet – soll sich etwas Unfassbares zugetragen haben: Unser alter Lindenbaum verneigte sich zum Erstaunen und auch zum Entsetzen der Lomer unter lautem Krachen und Ächzen vor dem Fremden mit dem prachtvollen Stab.
Die Äste des Baumes neigten sich so tief, als wollten sie nach etwas Bestimmtem greifen. Mit einem Donnerschlag, der die Luft zerriss, fuhr ein Blitz herab! Stimmen sollen im Blätterdach gewispert und geraunt haben! Als der Baum sich wieder aufrichtete, fand sich die abgebrochene Spitze des Stabes mit dem Bernstein unter einem herabgestürzten Ast am Fuß des Stammes. Aus dem Ast wurde später die Bank gezimmert, auf der wir jetzt sitzen! Der Baum hatte den Stein an sich genommen. In einem kunstvoll geschaffenen Eichenschrein wurde er hoch oben in der Linde verborgen und blieb bis heute das Allerheiligste für uns Lomer.“
„Und was geschah dann mit dem fremden Wanderer?“, rief Nalumbin aus, während sein Kopf Schutz suchend an die Schulter des Vaters sank. Die Linde schien ihm plötzlich unheimlich.
„Der fremde Wanderer hat sich bei uns Lomern niedergelassen. Da niemand wusste, wie er wirklich hieß, gab man ihm den Namen ‚Jedaure‘, was so viel bedeutet wie: ‚Der, zu dem die Bäume flüstern‘!“
Dieser Name ließ Nalumbin nicht nur verblüfft aufhorchen. Er sprang auf, wandte sich um, und seine Hände tasteten nach der Rinde des Baumes, als könnten sie dem Geschehen von damals nachspüren. Das soeben Gehörte schien ihm unglaublich.
„Dann sind der fremde Wanderer und Jedaure ein und derselbe?“
Jor spürte Nalumbins Erregung. Besänftigend zog er ihn wieder an seine Seite unter den Mantel.
„Ja! So wird es erzählt! Doch das alles war vor meiner Zeit. Ich weiß nur, dass Jedaure viel älter ist als die ältesten Bewohner des Beleintals! Und dein Urgroßvater Bardo starb schon vor langer Zeit!“
„War dein Großvater auch Sippenführer der Lomer, wie jetzt du und zuvor dein Vater?“,fragte Nalumbin.
„Ja, das war er. Der Stand des Vorstehers wurde schon vor Generationen auf den Sohn übertragen, sofern dieser seine Sache im Sinne seiner Sippe gut machte. Wenn nicht, wurde er davongejagt und geächtet. Wehe ihm, wenn er sich an Hab und Gut anderer vergriff, um seinen eigenen Besitz zu mehren!“
Bei dem Gedanken, dass er, Nalumbin, auch einmal dieses Erbe von Jor anzutreten hatte, wurde ihm fast schwindlig.
Mit stockender Stimme fragte er: „Muss auch ich eines Tages dein Nachfolger werden?“
„Es wird noch lange dauern, mein Junge. Ich habe vor, alt zu werden! Schließlich muss ich für die Sicherheit unserer Leute auf dem Zug über das Weiße Gebirge sorgen! Was danach geschieht, das wissen allein die Götter! Du hast also viel Zeit, dich auf deine künftige Aufgabe vorzubereiten!“
Der Warnschrei eines Eichelhähers rief Nalumbin und seinen Vater in die Wirklichkeit zurück. Diese Wirklichkeit war aufregend! Aufregend ob der Ungewissheit der Zukunft jenseits der Weißen Berge. Aufregend auch angesichts des hohen Festes auf dem Berg, an dem er, Nalumbin, zum ersten Mal den heiligen Stein sehen durfte.
Vater und Sohn traten aus dem Nachtschatten des Baumes und blickten hinauf in sein mächtiges Astwerk, in dem sich die ‚Träne des Meeres‘ verbarg. Die ersten Sonnenstrahlen vergoldeten die sommergrünen Blätter ...
Das Sonnenfest
Im Licht des jungen Tages bewegte sich der festlich geschmückte Zug der Lomer und der Talischen den Sonnenberg hinauf, langsam, schweigend. Nur die Stimmen der Vögel, das Rattern der Räder und das Gemecker der mitgeführten Ziegen waren zu hören. An manchen Stellen war der Pfad so schmal, dass die Karren und Schleifen in den Kurven mehrmals vor- und zurückgesetzt werden mussten, um weiter zu kommen. Häufig galt es auch den Weg von Steinen und Geröll freizuräumen. Über allem wogte der Buchenwald. Wie eine Schlange wand sich der Pfad dem Gipfel entgegen.
Höher und höher kletterte er, wurde steiler und steiler, bis nach einer Wegbiegung eine mächtige Felsplatte erreicht war. Dort hielt der Zug. Frei konnte der Blick über das Tal zum nebelverschleierten Horizont schweifen. Die steigende Sonne tauchte einen aufgerichteten Stein in gleißendes Licht. Es schien, als würde dieser Stein zwischen Himmel und Erde schweben, seiner gewaltigen Größe trotzend.
Jetzt wurden Mehl, Salz und Brotstücke zur Besänftigung der Windschwestern und Wolkengeister verstreut. Die sichere Ankunft auf dem Gipfel hing von ihrer Gunst ab. Mit tönernen Schellen rief man die Luftfeen an und bat um ihren Schutz. Für den Donnergott wurden die Ziegen gemolken und die Milch in steinerne Schalen gegossen; runde Vertiefungen, die in den felsigen Boden gehauen waren. Dem Berggeist gehörten Kuchen und Feldfrüchte. Eine Spalte im Fels verschlang sie. Die Bitte, den Berg betreten zu dürfen, war damit erfüllt.
Zum Zeichen der Verbindung mit den fruchttragenden Kräften der Erde berührten die Frauen den taunassen Grund mit Händen und Stirn. Unter den schräg einfallenden Sonnenstrahlen blinkten Tropfen an Halm und Blatt und vertrieben das Nachtdunkel aus den Bäumen.
Die letzte Wegstrecke stand bevor. Es bildeten sich Abstände zwischen den Gruppen. Als eine der ersten erreichten Nalumbin und sein Vater mit dem voll beladenen Karren den Gipfel. Als das Auge des Jungen zum ersten Mal die ungeheure Weite ringsum erfasste, durchlief ihn ein Schauer.
Noch stand die Sonne östlich vom Zenit. Kalt und scharf blies der Wind. Fester zog er den ledernen Umhang um die Schultern, den ihm seine Mutter eigens für den großen Tag des Erwachsenseins genäht hatte. Jetzt endlich stand er selbst auf dem heiligen Berg, dem Altar der Götter, dem Ort des Lichts und der Sonne näher als jemals zuvor.
Im Nordosten begrenzte das Massiv des Donnerberges den Blick. So nannten die Siedler des Beleintals den mächtigsten unter ihren Waldbergen, denn oftmals umtobten erzürnte Wettergeister seinen Gipfel, launisch, unberechenbar und von zerstörerischer Kraft. Im Sommer, wenn Regen fiel, verdichtete er sich zu Wänden aus Wasser; und im Winter, wenn es schneite, schlugen dem Wanderer Böe um Böe wie eisige Peitschenhiebe entgegen, erbarmungslos.
Das Gebrüll des Donners aber war die Sprache des Berges und wurde landauf und landab gehört, krachend und grollend bis hinab ins Beleintal. Darauf folgende Blitze fuhren wie glühend geschmiedete Schwerter herab und setzten den Himmel über dem Berg in Brand. Der Nachhall des Donners aber blieb noch lange in den Bäumen hängen, tief unten in den Tälern.
Am südlichen Horizont erhob sich die Kette des Weißen Gebirges, ohne Anfang, ohne Ende. Sie schien wie in ewiger Ferne und doch zum Greifen nah. Scharf zeichneten sich ihre Umrisse im wolkenlos blauen Himmel ab. Nun wanderte der Blick nach Westen und erfasste die Ebene, die sich tief und weit ausbreitete. Wie ein silbernes Band zog der Hauptstrom des Rhenair dahin. Seine Nebenarme verbanden sich zu einem funkelnden Netzwerk. Auch jenseits des Großen Stromes erhoben sich im Westen Berge.
Die Einheimischen erzählten sich, dass Westberge und Waldberge einst ein einziges Gebirge gewesen seien. Missgestaltete Dunkelwesen hätten darin gehaust. Als sie Zauberwaffen schmiedeten, mit denen sie den Waldgöttern ihre Macht zu entreißen versuchten, gerieten diese in großen Zorn. Sie schlugen das Gebirge entzwei und schoben die Hälften weit auseinander, bis ein breites Tal entstand.
Regen- und Flussgötter, Verbündete der Waldgötter, entsandten daraufhin ihre Fluten zu Tal und verschlangen die Abtrünnigen. In den Tiefen des Rhenairs sollten ihre Seelen für immer gefangen sein. In mondlosen Nächten höre man ihr Wehklagen, so hieß es.
Die Vorbereitungen für das nächtliche Fest dauerten bis zum frühen Abend. Der heftige Wind hatte sich gelegt. Die Wettergeister und Wolkenfeen waren den Feiernden wohlgesonnen. Noch einmal wurden die Ziegen gemolken. Auf einem mächtigen Steinblock, in dem viele kleine und große, zum Teil durch Rinnen verbundene Schalen eingehauen waren, ordneten die Frauen Blumengirlanden zu einem Rad. In die Schalen füllten sie Milch und Honig, Samen, Kräuter, Nüsse, Beeren, Blätter und Baumrinde. Auch Wasser, das sich mit dem Nacht- und Morgentau vermischen sollte – das Kostbarste, das es zu gewinnen galt. In ihm wirkten die Kräfte des Himmels und der Erde.
Nalumbin sah, wie Aithe, seine Mutter, und andere Frauen kleine, nackte Frauenfiguren aus Ton und Holz niederlegten. Auch sie sollten die zeugende Kraft der Sonne in sich aufnehmen und den Frauen Glück und gesunde Kinder bringen. Zwischen Flachs und Schafwolle warteten tönerne Spinnwirtel und Webgewichte auf das Erscheinen der Sonne; ihre Wärme würde die Schutzwirkung der anzufertigenden Kleidung verstärken und gegen Krankheiten schützen.
Allmählich breitete sich die Nacht auf dem Berg aus. Ein funkelnder Sternenhimmel zog auf, und das Licht der fast runden Mondin überschüttete den Berg mit seinem Glanz. Die Menschen ruhten. Nur Jedaure legte sich nicht nieder. Er wachte am Zeitenstein, seit die Mondin im Osten über dem Horizont aufgestiegen war. Als dann das Gestirn der Nacht vor die Rinne trat, die vor langer Zeit in den Steinblock gekerbt worden war, gab er das Zeichen zum Beginn des Festes. Mit drei Hornstößen weckte er die Ruhenden, und augenblicklich war alles auf den Beinen.
Bald erfüllten das Prasseln des Feuers und Sprechgesänge die Luft. Im rhythmischen Takt bewegten sich Hände und Füße der Feiernden, die das hell lodernde Feuer umkreisten. Trommeln, Flöten, Schwirrhölzer und Hörner erklangen. Schallbleche und Klapperringe mischten sich darunter. Die Ersten begannen mit dem Sprung durch das Feuer, dessen Lohe als heilkräftig galt. Nalumbin zögerte, als er an der Reihe war. Sein Herz schlug heftig. Noch im Sprung wunderte er sich, dass ihm das Feuer nichts anhaben konnte, und als er wieder sicher auf den Füßen landete, leuchteten seine Augen vor Stolz.
Jetzt verließen Jendur und Jedaure den Festplatz. Jendur trug den Opferkrug. Ein Scheppern und Klirren nun im Fels, und Jendurs Werk von Tagen war auch schon in Stücke zersprungen und konnte von keiner Menschenhand mehr gebraucht werden. Es gehörte allein den Göttern.
Als es an der Zeit war die Botschaft des gesungenen Wortes zu hören, ließ man sich am Feuer nieder. Zwei Sänger, Großvater und Enkelsohn, setzten sich einander gegenüber. Ihre Handflächen legten sie aneinander, verschränkten ihre Finger und wiegten ihre Oberkörper hin und her, vor und zurück. Die Gesänge der Ahnen erklangen. Der alte Sänger sang vor, der junge Sänger wiederholte die Worte. Es klang wie ein Echo. Sie sangen von einem Land, das sich der Sonne entgegenhob, getragen von vier goldenen Pfeilern. Ein Land, in dem es weder Krieg noch Klage gab.
Die Gesänge verklangen. Das Festmahl begann. Wie schon in den letzten Jahren fiel es nicht üppig aus. Die Jagd aber war erfolgreich verlaufen und so gab es Fleisch. Linsen- und Hirsegerichte dagegen waren knapp. Wildgemüse, Quark und kleine Kuchen, gesüßt mit dem Sirup von Veilchen und Holunder, rundeten die Mahlzeit ab. Gärgetränke aus Äpfeln, Hagebutten, Löwenzahn und Brombeeren, vermischt mit Honig und Quellwasser, sorgten trotz der Zukunftssorgen für Heiterkeit.
Bald schon stieg der neue Morgen rötlich dämmernd aus dem Osten herauf und weckte den Berg. Hoch aufgerichtet stand Jedaure am Opfertisch. Im noch nächtlichen Schatten hob er die Arme, bereit den Segen der Sonne zu empfangen. Tiefe Stille herrschte unter den Versammelten, als sich dann die ersten Strahlen im Opferwasser spiegelten. Die Sonnenkräfte, die nun diesem Wasser zuflossen, gab Jedaure weiter an die in langer Reihe vorbeiziehenden Menschen. Jedem Einzelnen benetzte er die Stirn.
„Die Kraft des Lichtes soll uns begleiten auf unserem Zug über Berg und Tal, durch Eis und Schnee, bei Sturm und Regen!“, sprach Jedaure mit fester Stimme und wandte sich an die beiden Stammesführer.
Da überreichte ihm Pjat auch schon eine kleine Schale aus blankem Gold, kaum größer als eine Faust. Jedaure stellte sie auf den Tisch. Reihen von kunstvoll getriebenen, kleinen und großen Perlbuckeln und ein Ringmuster umliefen sie. Woher die Schale stammte, dies war bis zum heutigen Tag ein Geheimnis geblieben. Für die Talischen, die fast allesamt Bauern waren, bedeutete sie eine Kostbarkeit von unschätzbarem Wert.
Der Überlieferung nach wusste man, dass die Vorfahren der Talischen das kleine Prunkstück beim Fischen in der Reuse gefunden hatten, zu Zeiten, in denen größte Not herrschte. Wissend, dass alles Gold den Göttern gehörte, gaben sie die Schale dem Fluss wieder zurück. Als sich dann anderntags die Schale erneut in der Reuse zwischen dem spärlichen Fischfang befand, begannen sie sich zu wundern, wie dies angesichts des rasch fließenden Wassers möglich war.
Sie fragten sich, ob es ein Zeichen der Götter sei, ihre Not zu lindern? Ein zweites Mal warfen sie das kostbare Gold zurück ins Wasser. Und siehe da! Das Kleinod befand sich ein drittes Mal in der Reuse. Hiermit war es gewiss: Es war die Dreiheit, auf der alles fußte. Damit sahen sie die Schale als ein Geschenk der Götter an. Die Götter selbst hatten sich ihrer angenommen! Und so verehrten die Talischen fortan dieses Geschenk und hüteten es streng.
Lomer und Talische umstellten nun den Steinernen Tisch. Nalumbin, der mit seinem Vater in Jedaures Nähe stand, sah zum ersten Mal die Schale. Noch nie zuvor hatte er Gold gesehen. Es war für ihn, als wäre die Sonne selbst mit ihrem Glanz herabgestiegen. Jetzt aber wartete auch der Schatz der Lomer darauf, ans Licht zu kommen.
Jedaures Hand hob den Deckel des Schreins, griff hinein, und da war sie – die ‚Träne des Meeres‘, eine in Bronze gefasste Scheibe aus Bernstein, durchsichtig wie Glas und von strahlender Schönheit!
Jedaure hielt den Stein gegen das Sonnenlicht. Für alle sichtbar erglühte er in feurigem Rot. Purpurfarbene, fast schwarze Linien durchkreuzten sein Inneres: Es war das versteckte und machtvolle Bild des Radkreuzes. Die bronzene Fassung, die den Stein umschloss, endete in einem Schaft, der sich zu einem Spiralmuster verjüngte. Dies ließ erahnen, dass der Bernstein Jedaures Stab einst als Spitze gedient haben musste.
Jedaures Kettengehänge am Gürtel klirrte und durchbrach die Stille. Sein Blick schweifte weit in die Ferne. Am Himmel segelte ein Falke. Nalumbin und alle anderen sahen, wie Jedaure den Stein der Lomer in die Schale der Talischen legte. Zum Zeichen der Zusammengehörigkeit beider Stämme goss er Wasser über die Stammesheiligtümer. Es war Wasser vom Morgentau, belebtes Wasser, in dem die Sonnenfunken wirkten.
In manchen Gesichtern schimmerte es tränenfeucht. Dann aber wich die Anspannung. Lomer und Talische schüttelten sich die Hände und beglückwünschten sich zum Sonnenfest. Noch einmal erklangen die Hörner, die Flöten, die Trommeln und die heiteren Gesänge. Jor verwahrte die beiden Kleinodien im Schrein. Jedaures Hand malte unsichtbare Schutzzeichen darüber. Damit war das Bündnis besiegelt. Bis zum Aufbruch der beiden Sippen sollte der Schrein hoch oben in der Lomerlinde verwahrt werden.
Mit einem letzten, ausgelassenen Tanz um den Altar verabschiedeten sich die beiden Sippen vom Berggipfel, der bald schon seine Umrisse in herabdrängenden Wolken verhüllte. Müde, aber glücklich über die Gnade, die ihnen die Sonne durch ihr Scheinen auf die Opfergaben erwiesen hatte, kehrten sie in die Siedlung am Fuß des Berges zurück, wo die Daheimgebliebenen sie erwarteten, Alte, die nicht mehr gut zu Fuß waren, und Kinder, darunter Nalumbins kleine Schwester Suri, die ihm mit strahlend blauen Augen entgegenrannte. Es war ein vertrautes Gefühl, die kleine Hand zu spüren, die nach der Hand des großen Bruders griff.
Nalumbin blickte in ein rosiges Gesicht. Grübchen in den Wangen verrieten eine Frohnatur. In Suris blonden Löckchen steckten Blumen und erinnerten an Schmetterlinge. Unter dem ausgefransten Rocksaum lugten zwei Füßchen so dunkel hervor, als hätten sie bald eine Wäsche nötig.
Vor aller Augen kletterte Jor nun mit dem Schrein in die Linde. Hoch oben befand sich eine Plattform, auf der er den kleinen Kasten wieder befestigte. Andächtig blickten Lomer und Talische in den Baum empor. Unzählige Sonnen und Monde schon hatte der mächtige Baum gesehen. Lange aber dauerte es nicht, und die Andacht wich erneut dem Frohsinn.
Die Lomerfrauen verteilten Mohnkuchen und Brot. Die talischen Männer füllten Becher um Becher mit ihrem letzten Honigwein. Gemeinsam lagerten sie alle unter dem Baum und verweilten dort bei Gesang und Gesprächen bis weit in den Abend.
Längst schon schwebte die Mondin am Himmel, als endlich Ruhe in den Häusern einkehrte. Noch immer berauscht von den Erlebnissen auf dem Sonnenberg, blieb Nalumbin auf seinem Lager noch lange ohne Schlaf. Wie im Traum zogen die Bilder der Nacht und des entschwundenen Tages vorüber.
Lebhaft stand der Augenblick vor ihm, als die ersten Sonnenstrahlen das Wasser auf dem Altar aufleuchten ließen. Wie ein Himmelsauge hatte ihn darin die Sonne angeblickt. Heiß und kalt war es ihm über den Rücken gekrochen. Am Tag, unter der Kraft des Lichtes, hatte er großen Mut, hatte sich als Mann gefühlt, ja unbändige Reiselust empfunden auf das große Abenteuer der Weißen Berge.
Neugier, Drang nach Wissen und Zukunft hatten die Oberhand gewonnen, jetzt aber, im Dunkeln, drohte das ängstliche Kind in ihn zurückzukehren, das Furcht hatte vor den bösen Geistern der Nacht. Nalumbin rollte sich zusammen, kroch tiefer unter sein Fell. Die bösen Geister – gab es sie, und was hatten sie vor ...
Des Schlachters Ruf
Jor war der Erste im Haus, den das Gebell der Hunde aus dem Schlaf riss. Sein vom Jagen geschärftes Gehör nahm das Surren von Pfeilen wahr, die klackend auf das Dach prallten. Feuerschein drang durch die Luke. Bei ihrem Öffnen sah Jor einen brandhellen Himmel. Sein Herz zog sich zusammen. Entsetzen! Das Dorf der Talischen! Es brannte! Über Jor erfasste ein mächtiger Windstoß die noch spärlichen Flammen und ließ den Dachfirst wie von Geisterhand auflodern.
„Räuber!“, schrie er: „Männer, schlagt die Pfeile ab, löscht das Feuer!“
Jetzt waren auch die anderen Männer der Lomersiedlung auf den Beinen, griffen zu allem, was sich zur Verteidigung fand, stießen die Türen auf und stürzten hinaus.
„Hierher, Jendur, zu mir ans Haupttor! Du, Tiann, übernimm die Ketten! Leuk und Norin, öffnet das Fluchttor!“, drang die Stimme seines Vaters an Nalumbins Ohr, während er sich aus dem Schlaf quälte. Danach hörte er die Schläge von aufeinandertreffendem Metall und das Krachen von Beilen, wie sie ins Holz des Palisadenrings schlugen. Schmerzensschreie, wilde Flüche und das Geklirr von Ketten zerrissen die Nacht.
„Was ist das?“, stammelte Nalumbin. Da spürte er auch schon Aithes Hand, die ihn hochriss.
„Raus, Kinder! Schnell, es brennt!“, befahl sie.
Sie drückte Nalumbin seinen Beutel in die Hand, warf ihm den Umhang zu und drängte ihn und die kleine Suri auch schon ins Freie. Am Fluchttor der Siedlung warteten bereits Leuk und Norin und entließen die Flüchtenden in den angrenzenden Wald. Auch die anderen Frauen waren bereits mit ihren Kindern und Bündeln auf den Beinen. Sie hasteten den Pfad entlang, der zu einem Felssporn führte. Darunter verbarg sich die Fluchthöhle.
Die Angreifer aber hatten die Absicht der Flüchtenden erkannt. Sie schnitten ihnen den Weg ab. Leuk und Norin kämpften mit Todesverachtung, um ihn zu verteidigen. Der Feind aber war in der Überzahl. Mit einem gellenden Schmerzensschrei sank Leuk zu Boden. Ein Schwert hatte ihn durchbohrt.
Da wurde Nalumbin im Gemenge von Aithe und seiner Schwester getrennt. Panische Angst erfasste ihn. Ziellos hastete er umher, stolpernd, schwankend. Sein Herzschlag dröhnte in den Ohren. Es knisterte und knackte im Unterholz. Schreie und Waffengeklirr hinter ihm trieben ihn wieder auf die Siedlung zu. Beim Anblick des brodelnden Feuers, das sich pfeifend in die Häuser hineinfraß, kamen ihm die Tränen.
Jetzt hatten sich die einzelnen Brandherde vereinigt. Rauchschwaden verdunkelten die Mondin. Ein Teil des Schutzzaunes aus aufgerichteten Stämmen war niedergerissen. Im Feuerschein der Flammen sah der Junge, wie Jendur gegen mehrere Angreifer mit einer bronzenen Sichel kämpfte, ihm zur Seite Tolte, der Weber, die schwere Steinaxt schwingend. Tiann ließ die Ketten durch die Luft rasen, und wehe jedem, der in ihren Sog geriet. Mit Kampfgeschrei rannten Pjat und seine Männer aus der Nachbarsiedlung herbei. Das Grauen packte Nalumbin, als er über einen abgeschlagenen Kopf stolperte. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, irrte er am Rand des Schlachtfeldes umher.
Eine Hand, die Nalumbin plötzlich auf seiner Schulter spürte, ließ sein Herz für Augenblicke stillstehen. Es war eine Hand, die sich blutig anfühlte. Es war die Hand seines Vaters, die den Sohn noch einmal berühren wollte. Sterbend brach Jor zusammen.
„Nalumbin! Rette die Schale, rette den Stein! Bring sie in Sicherheit! Hier, mein Dolch, nimm ...“!
Es waren Jors letzte Worte. Verzweifelt und in brennendem Schmerz umklammerte Nalumbins Hand noch einmal die blutige Hand des Vaters. Dann stürzte er blind vor Tränen davon, mitten durch den Schauplatz des Grauens, vorbei an Wimmern, Stöhnen und Klageschreien. Der Geruch von Blut folgte ihm bis zur Linde.
Eine nie gekannte Schwäche überfiel ihn und lähmte seinen Willen. Es war, als würde eine Nebelwand vor ihm aufziehen. Und doch drangen Stimmen und Hufschläge hindurch. Den Stamm der Linde umfassend, spürte er nach Augenblicken, die ihm wie Ewigkeiten schienen, seine Kräfte zurückkehren. Die Stimmen kamen näher.
„Rasch, den Dolch verstauen!“, befahl er sich.
Dann, ein Griff in den gespaltenen Stamm des Baumes, und schon zog er sich hinauf. Hinauf, nur hinauf in den Schutz des Baumes! Das Feuer, das die Nacht erhellte, entsandte flackerndes Licht bis in das Blätterdach und enthüllte den Schrein.
Mit zitternder Hand öffnete Nalumbin den Kasten. Sie griff nach dem Bernstein und steckte ihn in seinen Beutel. Ein zweiter Griff! Die goldene Schale der Talischen, die im Feuerschein aufblinkte.
„Was machst du da?“, schrie es von unten.
Die Stimme fuhr Nalumbin durch Mark und Bein. Die Schale entglitt seiner zitternden Hand, noch bevor diese sie in den Beutel stecken konnte. Mit leisem Klirren fiel die Schale in die Tiefe. Entsetzen packte Nalumbin. Zu Stein erstarrt verharrte er im Baum. Unter sich hörte er Schritte. Sie umrundeten den Baum. Er wagte kaum zu atmen. Die Schritte entfernten sich. Es war der Augenblick, in dem der Junge all seinen Mut zusammennahm und sich in fliegender Hast den Stamm hinabhangelte. Ein letzter Sprung, und er hatte wieder festen Boden unter den Füßen.
Doch noch bevor er nach der verlorenen Schale suchen konnte, bauten sich auch schon zwei dunkle Gestalten drohend vor ihm auf und wollten nach ihm greifen. Mit einem scharfen Haken entfloh er und hetzte auf den Wald zu, den Beutel fest umklammert. Die Furcht vor den nächtlichen Geistern verblasste vor der Angst, von den Gestalten ergriffen zu werden, die ihm auf den Fersen waren.
Er rannte und rannte, ohne jeden Plan. Äste und Zweige peitschten ihm ins Gesicht. Scharfe Dornen griffen nach seinen Kleidern. Gebüsche und Baumwurzeln versperrten ihm den Weg und ließen ihn immer wieder straucheln. Dichter und schwärzer wurde die Wand aus Unterholz. Wie ein Rasender kämpfte er sich hindurch. Todesangst im Nacken erstickte jeden Schmerz. Dort, wo sich unerwartet Abhänge vor ihm auftaten, verließ er sich nicht auf seine Füße, sondern rutschte hinab. Nur fort, weit fort von den wilden Flüchen, die hinter ihm durch die Nacht hallten. Sein Atem dampfte, und er verlor jedes Gefühl für Zeit und Raum, und er wusste nicht, ob seine Flucht durch den Wald jemals ein Ende nehmen würde.
Als ihm dann ein Bach den Fluchtweg abschnitt, hielt er erschrocken an. Die Angst vor den Verfolgern aber trieb ihn weiter. Eilends watete er ins Wasser, das im Licht der Mondin hell aufschimmerte. Unter seinen Füßen fühlte er große, runde Steine. Da geschah es! Er glitt aus und stürzte. Ein rasender Schmerz am Knöchel!
„Weiter!“, befahl er sich. Triefend nass humpelte er durch den Bach zum anderen Ufer, den Beutel immer noch umklammernd. Die Stimmen seiner Verfolger verloren sich. Irgendwann und irgendwo wich die Angst der Erschöpfung. Er sank auf den Waldboden.
Der Morgen dämmerte herauf. Prasselnder Regen weckte Nalumbin. Zitternd vor Kälte versuchte er aufzustehen. Es wollte kaum gelingen. Durch den Regenschleier nahm er in unmittelbarer Nähe übereinandergetürmte Felsblöcke wahr. Das Verlangen nach einem trockenen Unterschlupf war genauso stark wie der Schmerz im Fuß, und so schleppte er sich zu den Felsen, auf der Suche nach einem schützenden Dach, das es doch hier irgendwo geben musste.
Sein Gefühl hatte ihn nicht getäuscht. Unter Ranken und Gesträuch verbarg sich eine höhlenartige Nische, in die er hineinkroch. Unter großer Anstrengung zog er seine nassen Kleider aus. Nur sein lederner Umhang schützte ihn. Seine Mutter hatte das Leder gut eingefettet. Ihr, dem toten Jor und seiner Schwester Suri galten seine Gedanken, bevor er auf dem moosigen Grund in schweren Schlaf fiel ...
Fieberträume
Der Tag war längst gegangen. Sturm war aufgekommen. Er fegte an der Felsspalte vorbei und entsandte sein Heulen in das Dunkel der Nacht. Nalumbin lag in schwerem Schlaf. Auch der Ruf des Eichelhähers, der den Morgen ankündigte, vermochte ihn nicht zu wecken. Fieber lähmte seinen Körper.
Unzählige Tropfen des nächtlichen Regens, die sich von den Baumwipfeln hinabstürzten, glänzten im Sonnenlicht und ließen die Welt vor der dunklen Höhle wie einen Kristall erstrahlen. Nalumbin aber hatte keinen Blick für die Schönheit des Morgens. Frierend und doch voll innerer Glut kroch er aus der Felsnische. Die Zunge klebte am Gaumen. Als er aufzustehen versuchte, durchfuhr ein brennender Schmerz den Fuß. Seine Hand tastete nach dem aufgeschürften Knöchel und fühlte unter der heißen, gespannten Haut eine starke Schwellung. Dann aber siegte der Durst über den Schmerz.
So sehr er nach seinem Sturz den Bach verflucht hatte, umso dankbarer war er nun, ihn in der Nähe zu wissen. Durch regennasses Gras kroch er fort, den kranken Fuß als eine Last mit sich ziehend, die sein Körper kaum tragen konnte.
Endlich, das Kinn auf einen flachen, glatten Stein am sumpfigen Ufer gestützt, gelang es ihm zu trinken. Beinahe unersättlich. Frische Kräfte kehrten in ihn zurück. Nicht für lange, jedoch lange genug, um einen Blick auf die Umgebung zu werfen.
Vor sich sah er die schaufelartigen Blätter des Wasserklees. Sie erinnerten ihn an die Frauen seiner Sippe, an Aithe, wie sie ihren fieberkranken Kindern mit dem Kraut Erleichterung verschafft hatten. Entschlossen riss seine Hand Blätter von der Pflanze. Den Kopf immer noch auf dem Stein, halb im Wasser liegend, umspült vom leise dahinplätschernden Bach, kaute er Blatt um Blatt. Es schmeckte unangenehm bitter und es kostete ihn Überwindung, den Brei zu schlucken. Und während er sich dazu zwang, war ihm, als flüstere es aus dem Bach:
„Es gibt noch andere Pflanzen an meinem Ufer, die dir helfen können!“
„Welche?“, wollte er fragen. Da trat auch schon Jedaure in seine Fieberfantasien und deutete auf Körbe mit Weidenrinde und wildem Flieder, und er konnte sich selbst sehen, wie er beim Schneiden und Pflücken der Heilmittel geholfen hatte. Jetzt verschwammen die Bilder.
Der Bach schwieg. Um Nalumbin wurde es Nacht. Eine innere Stimme aber rief ihn wach, die ihm befahl, den Kopf aus dem Wasser zu heben. Vom Fieber geschüttelt kroch der Kranke zurück zur Höhle.
Später, als sich der Tag neigte und der Durst wieder unerträglich wurde, verließ der Junge seine Behausung auf ein neues und suchte den Bach auf, nicht nur um zu trinken, sondern in der Hoffnung, einen Weidenbaum zu finden. Die Wegstrecke zu einer Gruppe Weiden, die auf einer verlandeten Bachschleife stand, schien ihm endlos. Getrieben vom Wunsch, den stechenden Schmerz im Fuß zu lindern, brachte er es mit vielen Unterbrechungen dann zuwege, mit dem Messer seines Vaters Bast und Rindenstücke von den Weidenstämmen zu lösen.
Unter ihnen wucherte wilder Knoblauch, der schon verblüht war. Die zerkauten Blätter drückte er auf den verletzten Knöchel. Von Jedaure wusste er um die reinigende Wirkung der Pflanze. Es brannte.
Zurückgekehrt in sein Lager, löste er die Lederschnur von seinem Beutel und band damit die Weidenrinde um den Knöchel. Erschöpft, willenlos und mit hämmerndem Kopf überließ er sich dem Schlaf. Immer wieder trat Jor in seine Fieberträume, fragte ihn nach dem Bernstein und der Schale. Nalumbin wollte antworten, wollte ihm sagen, dass er den Stein hatte retten können, doch die Zunge lag ihm wie ein Klumpen im Mund. Auch sah und hörte er seine Sippe, wie sie nach ihm rief. Er wollte aufspringen, wollte ihr entgegenlaufen.
Eine Macht aber drückte ihn nieder, schwarz und drohend – Fieber, das ihn umzubringen drohte.
Wie viele Sonnen und Monde auf- und untergegangen waren, wusste Nalumbin später nicht zu sagen. Er wusste nur, dass er sich von Zeit zu Zeit zum Bachufer geschleppt hatte. Der Bach – er war sein Lebensretter. Dem frischen Wasser verdankte er es, dass er lebte. Auch den Pflanzen dankte er. Sie hatten mitgeholfen, das Fieber und die Entzündung im Fuß zu bekämpfen.
Zum ersten Mal, auf schwachen, jedoch beiden Beinen verließ er humpelnd die Höhle. Er hatte Hunger, unsäglichen Hunger. Jetzt war der Jagdtrieb in ihm erwacht, denn die Beeren allein, die ihm die Vögel an einem Strauch übrig gelassen hatten, konnten den entkräfteten Körper nicht stärken. Und so, wie es ihn die älteren Jungen seiner Sippe gelehrt hatten, suchte er sich nun am Bach eine Stelle, an der sich kleine Krebse vermuten ließen.
Vorsichtig und langsam tastete er in das grün schimmernde Bachgeröll am Uferrand, wendete Stein um Stein. Seine Geduld wurde mit einem Krebstier belohnt. Er brach die Schale auseinander und schlang das weiße Fleisch hinunter. Flussmuscheln, die er ausschlürfte, rundeten diese erste Mahlzeit ab. Die Entzündung im Fuß war am Abklingen und die Schwellung am Zurückgehen, doch steigerte sich der Schmerz am Knöchel mit der Anzahl seiner taumelnden Schritte.





























