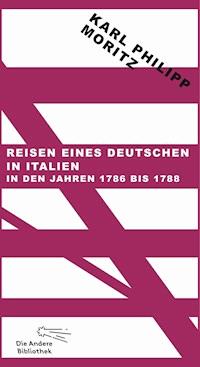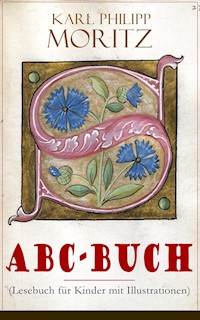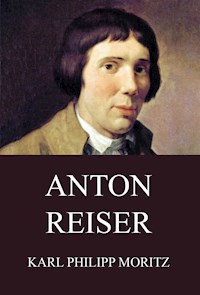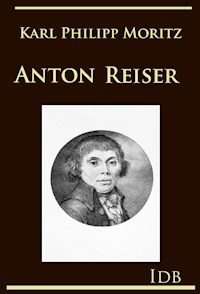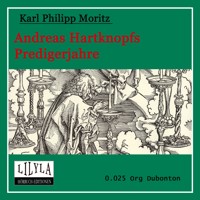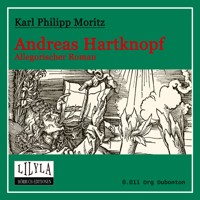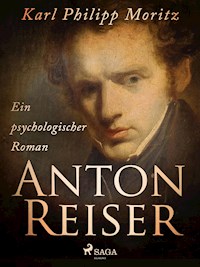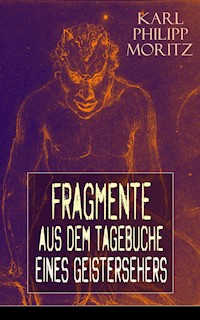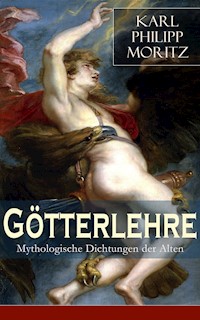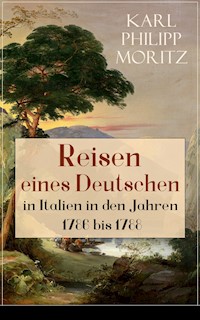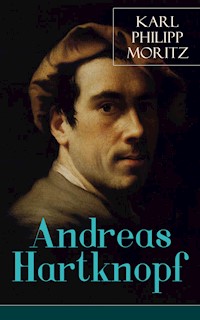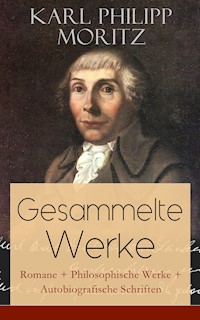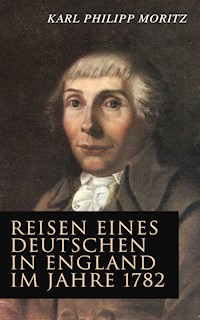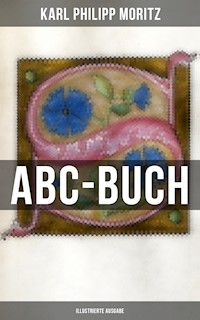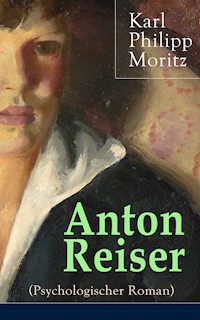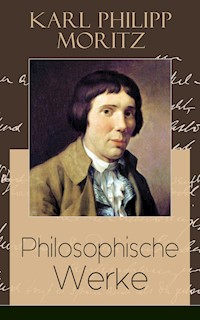Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die "Götterlehre" wird zum Hauptwerk des Schriftstellers gezählt. Moritz befasst sich hier eingehend mit den Götterfiguren, deren Wohnsitze und mythologischen Hintergründen sowie den Dichtungen, in denen diese eine große Rolle spielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Götterlehre
oder Mythologische Dichtungen der Alten
Karl Philipp Moritz
Inhalt:
Karl Philipp Moritz – Biografie und Bibliografie
Götterlehre
Gesichtspunkt für die mythologischen Dichtungen
Die Erzeugung der Götter
Der Götterkrieg
Die Bildung der Menschen
Die Nacht und das Fatum, das über Götter und Menschen herrscht
Die alten Götter
Amor
Die himmlische Venus
Aurora
Helios
Selene
Hekate
Oceanus
Die Oceaniden
Metis
Eurynome
Styx
Mnemosyne
Themis
Pontus
Nereus
Die Nereiden
Thaumas
Eurybia
Phorkys und die schöne Ceto oder die Erzeugung der Ungeheuer
Die Flüsse
Proteus
Chiron
Atlas
Nemesis
Prometheus
Jupiter, der Vater der Götter
Die Eifersucht der Juno
Vesta
Ceres
Jupiter
Die neue Bildung des Menschengeschlechts
Ogyges
Inachus
Cekrops
Deukalion
Die alten Einwohner von Arkadien
Der Dodonische Wald
Die menschenähnliche Bildung der Götter
Jupiter
Juno
Apollo
Neptun
Minerva
Mars
Venus
Diana
Ceres
Vulkan
Vesta
Merkur
Die Erde
Cybele
Bacchus
Die heiligen Wohnplätze der Götter unter den Menschen
Kreta
Dodona
Delos
Delphi
Argos
Olympia
Athen
Cypern
Gnidus
Cythere
Lemnos
Ephesus
Thracien
Arkadien
Phrygien
Das götterähnliche Menschengeschlecht
Perseus
Bellerophon
Herkules
Die zwölf Arbeiten des Herkules
Die Taten des Herkules, welche er nicht auf fremden Befehl vollführt hat
Die Vermählungen des Herkules und seine Vergehungen und Schwächen
Des Herkules letzte Duldung und seine Vergötterung
Kastor und Pollux
Iason
Die Fahrt der Argonauten
Meleager
Die Kalydonische Jagd
Atalante
Minos
Dädalus
Theseus
Die Wesen, welche das Band zwischen Göttern und Menschen knüpfen
Genien
Musen
Liebesgötter
Grazien
Horen
Nymphen
Satyrn
Faunen
Pan
Sylvan
Penaten
Priapus
Komus
Hymen
Orpheus
Chiron
Äskulap
Hygiäa
Die Lieblinge der Götter
Ganymed
Atys
Tithonus
Anchises
Adonis
Hyacinthus
Cyparissus
Leukothoe
Endymion
Acis
Peleus
Die tragischen Dichtungen
Theben
Kadmus
Ödipus
Eteokles und Polynikes
Der Thebanische Krieg
Die Pelopiden
Troja
Niobe
Cephalus und Prokris
Phaeton
Die Schattenwelt
Pluto
Furien
Die Strafen der Verurteilten im Tartarus
Tantalus
Ixion
Phlegyas
Die Danaiden
Sisyphus
Amor und Psyche
Götterlehre, K. P. Moritz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849632069
www.jazzybee-verlag.de
Karl Philipp Moritz – Biografie und Bibliografie
Eine der eigentümlichsten Gestalten der Sturm- und Drangperiode, geb. 15. Sept. 1756 in Hameln, gest. 26. Juli 1793 in Berlin, verlebte seine früheste Jugend unter traurigen Familienverhältnissen, sollte dann in Braunschweig die Hutmacherei erlernen, kehrte aber bald wieder zu seinen Eltern, die inzwischen nach Hannover gezogen waren, zurück. Hier erregte er durch seine großen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit eines fürstlichen Gönners, erhielt dadurch Gelegenheit, das Gymnasium zu besuchen, verließ es aber als Primaner, um unter Ekhof in Gotha Engagement als Schauspieler zu suchen, begann, als dieser Plan nach manchen abenteuerlichen Erlebnissen scheiterte, in Erfurt zu studieren (1776), machte einen nochmaligen vergeblichen Versuch, sich der Bühne zu widmen, und fand, als auch dieser gescheitert war, zunächst eine Zuflucht bei den Herrnhutern in Barby. Von der Brüdergemeinde unterstützt, studierte er in Wittenberg Theologie (1777) und trat dann in Dessau als Lehrer ins Philanthropin ein. Basedows Geistestyrannei trieb ihn aber bald aufs neue zum Wandern; er ging nach Potsdam und wurde dort 1778 Lehrer am Militärwaisenhaus, einige Zeit später am Grauen Kloster in Berlin. Hier machte er sich bald als Schriftsteller, Prediger und Dichter bekannt. Er unternahm 1782 eine Reiie nach England, die er in einem sehr lesenswerten Buch (s. unten) beschrieb, wurde darauf Professor am Köllnischen Gymnasium in Berlin, versuchte als Redakteur der »Vossischen Zeitung« ohne Erfolg diese zu einem Blatt »für das Volk« umzugestalten, geriet durch die Leidenschaft für eine verheiratete Frau in verhängnisvolle Herzenswirren und suchte 1786 geistige Genesung durch eine Reise nach Italien. Hier traf er mit Goethe zusammen, der ihn schätzen und lieben lernte und ihm manche Anregung verdankte. 1788 nach seiner Rückkehr fand M. bei Goethe in Weimar gastliche Ausnahme. Durch Empfehlung des Herzogs Karl August erlangte er die Mitgliedschaft der Berliner Akademie der Wissenschaften und wurde 1789 Professor der Altertumskunde an der Kunstakademie in Berlin. 1792 vermählte er sich mit einem jungen Mädchen, Friederike Matzdorf. Unter M. ' Schriften ist die wichtigste der autobiographische Roman »Anton Reiser«, der die Lebensschicksale des Verfassers bis zur Zeit nach dem Erfurter Aufenthalt schildert (Berl. 1785–90, 4 Bde.; fortgesetzt von Klischnig, 1794; neue Ausg. von Geiger, Heilbr. 1886, und von H. Henning in Reclams Universal-Bibliothek, Leipz. 1906), eine psychologisch und kulturgeschichtlich bemerkenswerte Darstellung der Seelenzustände eines Jünglings, der von den großen Anregungen der Sturm- und Drangperiode ergriffen wird. Auch in »Andreas Hartkopf« (Berl. 1786) schildert M. eigne Erlebnisse. Geistreich und durch originelle Ideen wertvoll sind auch noch andre von M.' zahlreichen Schriften, z. B.: »Versuch einer deutschen Prosodie« (Berl. 1786, neu aufgelegt 1815), das bedeutendste Werk über Metrik aus der Zeit unsrer Klassiker; »Über die bildende Nachahmung des Schönen« (Braunschw. 1788; neue Ausg. von Dessoir, Heilbr. 1888); die »Götterlehre« (Berl. 1791; 10. Aufl. von Frederichs, 1851; neue Ausg. von M. Oberbreyer in Reclams Universal-Bibliothek); »Reisen eines Deutschen in England« (Berl. 1783; neue Ausg. von Otto zur Linde, das. 1903); »Reisen eines Deutschen in Italien« (das. 1792–93, 3 Bde.) u.a. 1783–93 gab M. im Myliusschen Verlag ein »Magazin für Erfahrungsseelenkunde« (10 Bde.) heraus. Vgl. Alexis in Prutz' »Literarhistorischem Taschenbuch« (Hannov. 1847); Varnhagen v. Ense, Vermischte Schriften, Bd. 1; Dessoir, Karl Philipp M. als Ästhetiker (Berl. 1889); Altenberger, K. Ph. M.' pädagogische Ansichten (Leipz. 1905). Über M.' Verhältnis zu Schiller, den er durch eine Besprechung von »Kabale und Liebe« schwer beleidigte, vgl. Auerbach in der »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte«, Bd. 5 (Weim. 1892).
Ich habe es versucht, die mythologischen Dichtungen der Alten in dem Sinne darzustellen, worin sie von den vorzüglichsten Dichtern und bildenden Künstlern des Altertums selbst als eine Sprache der Phantasie benutzt und in ihren Werken eingewebt sind, deren aufmerksame Betrachtung mir durch das Labyrinth dieser Dichtungen zum Leitfaden gedient hat. Die Abdrücke von den Gemmen aus der Lippertschen Daktyliothek und aus der Stoschischen Sammlung habe ich mit dem Herrn Professor Karstens, der die Zeichnungen zu den Kupfern verfertigt hat, gemeinschaftlich ausgewählt, um, soviel es sich tun ließ, diejenigen vorzuziehen, deren Wert zugleich mit in ihrer Schönheit und der Kunst, womit die Darstellung ausgeführt ist, besteht.
Götterlehre
Gesichtspunkt für die mythologischen Dichtungen
Die mythologischen Dichtungen müssen als eine Sprache der Phantasie betrachtet werden: Als eine solche genommen, machen sie gleichsam eine Welt für sich aus und sind aus dem Zusammenhange der wirklichen Dinge herausgehoben.
Die Phantasie herrscht in ihrem eigenen Gebiete nach Wohlgefallen und stößt nirgends an. Ihr Wesen ist zu formen und zu bilden; wozu sie sich einen weiten Spielraum schafft, indem sie sorgfältig alle abstrakten und metaphysischen Begriffe meidet, welche ihre Bildungen stören könnten.
Sie scheuet den Begriff einer metaphysischen Unendlichkeit und Unumschränktheit am allermeisten, weil ihre zarten Schöpfungen, wie in einer öden Wüste, sich plötzlich darin verlieren würden.
Sie flieht den Begriff eines anfangslosen Daseins; alles ist bei ihr Entstehung, Zeugen und Gebären, bis in die älteste Göttergeschichte.
Keines der höheren Wesen, welche die Phantasie sich darstellt, ist von Ewigkeit, keines von ganz unumschränkter Macht. Auch meidet die Phantasie den Begriff der Allgegenwart, der das Leben und die Bewegung in ihrer Götterwelt hemmen würde.
Sie sucht vielmehr, soviel wie möglich, ihre Bildungen an Zeit und Ort zu knüpfen; sie ruht und schwebt gern über der Wirklichkeit. Weil aber die zu große Nähe und Deutlichkeit des Wirklichen ihrem dämmernden Lichte schaden würde, so schmiegt sie sich am liebsten an die dunkle Geschichte der Vorwelt an, wo Zeit und Ort oft selber noch schwankend und unbestimmt sind und sie desto freiern Spielraum hat: Jupiter, der Vater der Götter und Menschen, wird auf der Insel Kreta mit der Milch einer Ziege gesäugt und von den Nymphen des Waldes erzogen.
Dadurch nun, daß in den mythologischen Dichtungen zugleich eine geheime Spur zu der ältesten verlorengegangenen Geschichte verborgen liegt, werden sie ehrwürdiger, weil sie kein leeres Traumbild oder bloßes Spiel des Witzes sind, das in die Luft zerflattert, sondern durch ihre innige Verwehung mit den ältesten Begebenheiten ein Gewicht erhalten, wodurch ihre Auflösung in bloße Allegorie verhindert wird.
Die Göttergeschichte der Alten durch allerlei Ausdeutungen zu bloßen Allegorien umbilden zu wollen ist ein ebenso törichtes Unternehmen, als wenn man diese Dichtungen durch allerlei gezwungene Erklärungen in lauter wahre Geschichte zu verwandeln sucht.
Die Hand, welche den Schleier, der diese Dichtungen bedeckt, ganz hinwegziehen will, verletzt zugleich das zarte Gewebe der Phantasie und stößt alsdann statt der gehofften Entdeckungen auf lauter Widersprüche und Ungereimtheiten.
Um an diesen schönen Dichtungen nichts zu verderben, ist es nötig, sie zuerst, ohne Rücksicht auf etwas, das sie bedeuten sollen, gerade so zu nehmen, wie sie sind, um soviel wie möglich mit einem Überblick das Ganze zu betrachten, um auch den entfernteren Beziehungen und Verhältnissen zwischen den einzelnen Bruchstücken, die uns noch übrig sind, allmählich auf die Spur zu kommen.
Denn wenn man zum Beispiel auch sagt: Jupiter bedeutet die obere Luft, so drückt man doch dadurch nichts weniger als den Begriff Jupiter aus, wozu alles das mitgerechnet werden muß, was die Phantasie einmal hineingelegt und wodurch dieser Begriff an und für sich selbst eine Art von Vollständigkeit erhalten hat, ohne erst außer sich selbst noch etwas andeuten zu dürfen.
Der Begriff Jupiter bedeutet in dem Gebiete der Phantasie zuerst sich selbst, so wie der Begriff Cäsar in der Reihe der wirklichen Dinge den Cäsar selbst bedeutet. Denn wer würde wohl zum Beispiel bei dem Anblicke der Bildsäule des Jupiter von Phidias' Meisterhand zuerst an die obere Luft gedacht haben, die durch den Jupiter bezeichnet werden soll, als wer alles Gefühl für Erhabenheit und Schönheit verleugnet hätte und imstande gewesen wäre, das höchste Werk der Kunst wie eine Hieroglyphe oder einen toten Buchstaben zu betrachten, der seinen ganzen Wert nur dadurch hat, weil er etwas außer sich bedeutet.
Ein wahres Kunstwerk, eine schöne Dichtung ist etwas in sich Fertiges und Vollendetes, das um sein selbst willen da ist und dessen Wert in ihm selber und in dem wohlgeordneten Verhältnis seiner Teile liegt, dahingegen die bloßen Hieroglyphen oder Buchstaben an sich so ungestaltet sein können, wie sie wollen, wenn sie nur das bezeichnen, was man sich dabei denken soll.
Der müßte wenig von den hohen Dichterschönheiten des Homer gerührt sein, der nach Durchlesung desselben noch fragen könnte: was bedeutet die Iliade? was bedeutet die Odyssee?
Alles, was eine schöne Dichtung bedeutet, liegt ja in ihr selber; sie spiegelt in ihrem großen oder kleinen Umfange die Verhältnisse der Dinge, das Leben und die Schicksale der Menschen ab; sie lehrt auch Lebensweisheit, nach Horazens Ausspruch, besser als Krantor und Chrysipp.
Aber alles dieses ist den dichterischen Schönheiten untergeordnet und nicht der Hauptendzweck der Poesie; denn eben darum lehrt sie besser, weil Lehren nicht ihr Zweck ist, weil die Lehre selbst sich dem Schönen unterordnet und dadurch Anmut und Reiz gewinnt.
In den mythologischen Dichtungen ist nun die Lehre freilich so sehr untergeordnet, daß sie ja nicht darin gesucht werden muß, wenn das ganze Gewebe dieser Dichtungen uns nicht als frevelhaft erscheinen soll.
Denn der Mensch ist in diesen poetischen Darstellungen der höhern Wesen so etwas Untergeordnetes, daß auf ihn überhaupt und also auch auf seine moralischen Bedürfnisse wenig Rücksicht genommen wird.
Er ist oft ein Spiel der höhern Mächte, die, über alle Rechenschaft erhaben, ihn nach Gefallen erhöhen und stürzen und nicht sowohl die Beleidigungen strafen, welche die Menschen sich untereinander zufügen, als vielmehr jeden Anschein von Eingriff in die Vorrechte der Götter auf das schrecklichste ahnden.
Diese höhern Mächte sind nichts weniger als moralische Wesen. Die Macht ist immer bei ihnen der Hauptbegriff, dem alles übrige untergeordnet ist. Die immerwährende Jugendkraft, welche sie besitzen, äußert sich bei ihnen in ihrer ganzen üppigen Fülle.
Denn da ein jedes dieser von der Phantasie gebornen Wesen in gewisser Rücksicht die ganze Natur mit allen ihren üppigen Auswüchsen und ihrem ganzen schwellenden Überfluß in sich darstellt, so ist es als eine solche Darstellung über alle Begriffe der Moralität erhaben. Weil man weder von der ganzen Natur sagen kann, daß sie ausschweife, noch dem Löwen seinen Grimm, dem Adler seine Raubsucht oder der giftigen Schlange ihre Schädlichkeit zum Frevel anrechnen darf.
Weil aber die Phantasie die allgemeinen Begriffe fliehet und ihre Bildungen soviel wie möglich individuell zu machen sucht, so überträgt sie den Begriff der höhern obwaltenden Macht auf Wesen, die sie als wirklich darstellt, denen sie Geschlechtsregister, Geburt und Namen und menschliche Gestalt beilegt.
Sie läßt soviel wie möglich die Wesen, die sie schafft, in das Reich der Wirklichkeit spielen. Die Götter vermählen sich mit den Töchtern der Menschen und erzeugen mit ihnen die Helden, welche durch kühne Taten zur Unsterblichkeit reifen.
Hier ist es nun, wo das Gebiet der Phantasie und der Wirklichkeit am nächsten aneinandergrenzt und wo es darauf ankommt, das, was Sprache der Phantasie oder mythologische Dichtung ist, auch bloß als solche zu betrachten und vor allen voreiligen historischen Ausdeutungen sich hüten.
Denn diese Mischung des Wahren mit der Dichtung in der ältesten Geschichte macht an unserm Gesichtskreise, so weit wir in die Ferne zurückblicken, gleichsam den dämmernden Horizont aus. Soll uns hier eine neue Morgenröte aufgehen, so ist es nötig, die mythologischen Dichtungen als alte Völkersagen soviel wie möglich voneinander zu scheiden, um den Faden ihrer allmählichen Verwebungen und Übertragungen wieder aufzufinden. In dieser Rücksicht die ältesten Völkersagen, welche auf uns gekommen sind, nebeneinanderzustellen ist das Geschäft einer allgemeinen Mythologie, wozu die gegenwärtige, welche auf die Götterlehre der Griechen und Römer beschränkt ist, nur von fern die Hand bieten kann.
In das Gebiet der Phantasie, welches wir nun betreten wollen, soll uns ein Dichter führen, der ihr Lob am wahrsten gesungen hat.
Meine Göttin
Welcher Unsterblichen Soll der höchste Preis sein? Mit niemand streit' ich, Aber ich geb' ihn Der ewig beweglichen, Immer neuen, Seltsamsten Tochter Jovis, Seinem Schoßkinde, Der Phantasie.
Denn ihr hat er Alle Launen, Die er sonst nur allein Sich vorbehält, Zugestanden Und hat seine Freude An der Törin.
Sie mag rosenbekränzt Mit dem Lilienstengel Blumentäler betreten, Sommervögeln gebieten, Und leichtnährenden Tau Mit Bienenlippen Von Blüten saugen;
Oder sie mag Mit fliegendem Haar Und düsterm Blicke Im Winde sausen Um Felsenwände, Und tausendfarbig, Wie Morgen und Abend, Immer wechselnd, Wie Mondesblicke, Den Sterblichen scheinen.
Laßt uns alle Den Vater preisen, Den alten, hohen, Der solch eine schöne, Unverwelkliche Gattin Den sterblichen Menschen Gesellen mögen!
Denn uns allein Hat er sie verbunden Mit Himmelsband, Und ihr geboten, In Freud' und Elend, Als treue Gattin, Nicht zu entweichen.
Alle die andern Armen Geschlechter Der kinderreichen, Lebendigen Erde Wandeln und weiden In dunkelm Genuß Und trüben Schmerzen Des augenblicklichen, Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Notdurft.
Uns aber hat er Seine gewandteste, Verzärtelte Tochter, Freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich, Wie einer Geliebten! Laßt ihr die Würde Der Frauen im Haus!
Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleidige!
Doch kenn' ich ihre Schwester, Die ältere, die gesetztere, Meine stille Freundin: O daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Treiberin, Trösterin Hoffnung!
Goethe
Die Erzeugung der Götter
Da, wo das Auge der Phantasie nicht weiter trägt, ist Chaos, Nacht und Finsternis; und doch trug die schöne Einbildungshaft der Griechen auch in diese Nacht einen sanften Schimmer, der selbst ihre Furchtbarkeit reizend macht. – Zuerst ist das Chaos, dann die weite Erde, der finstere Tartarus – und Amor, der schönste unter den unsterblichen Göttern.
Gleich im Anfange dieser Dichtungen vereinigen sich die entgegengesetzten Enden der Dinge; an das Furchtbarste und Schrecklichste grenzt das Liebenswürdigste. – Das Gebildete und Schöne entwickelt sich aus dem Unförmlichen und Ungebildeten. – Das Licht steigt aus der Finsternis empor. – Die Nacht vermählt sich mit dem Erebus, dem alten Sitze der Finsternis, und gebiert den Äther und den Tag. Die Nacht ist reich an mannigfaltigen Geburten, denn sie hüllt alle die Gestalten in sich ein, welche das Licht des Tages vor unserm Blick entfaltet.
Das Finstere, Irdische und Tiefe ist die Mutter des Himmlischen, Hohen und Leuchtenden. Die Erde erzeugt aus sich selbst den Uranos oder den Himmel, der sie umwölbet. Es ist die dunkele und feste Körpermasse, welche, von Licht und Klarheit umgeben, den Samen der Dinge in sich einschließt und aus deren Schoße alle Erzeugungen sich entwickeln.
Nachdem die Erde auch aus sich selber die Berge und den Pontus oder das Meer erzeugt hat, vermählt sie sich mit dem umwölbenden Uranus und gebiert ihm starke Söhne und Töchter, die selbst ihrem Erzeuger furchtbar werden.
Hundertärmige Riesen, den Kottus, Gyges und Briareus; ungeheure Cyklopen, den Brontes, Steropes und Arges; herrschsüchtige und mit weit um sich greifender Macht gerüstete Titanen, den Cöus, Krius, Hyperion und Japet; den Oceanus; die mächtigen Titaniden, die Thia, die Rhea, die Themis, die Mnemosyne, die Phöbe, die Tethys und den Saturnus oder Kronos, den jüngsten unter den Titanen.
Diese Kinder der Erde und des Himmels aber erblicken das Licht des Tages nicht, sondern werden von ihrem Erzeuger, der ihre angeborne Macht scheuet, sobald sie geboren sind, wieder in den Tartarus eingekerkert. Das Chaos behauptet noch seine Rechte. Die Bildungen schwanken noch zwischen Unterdrückung und Empörung. – Die Erde seufzt in ihren innersten Tiefen über das Schicksal ihrer Kinder und denkt an Rache; sie schmiedet die erste Sichel und gibt sie als ein rächendes Werkzeug dem Saturnus, ihrem jüngsten Sohne.
Die wilden Erzeugungen müssen aufhören; Uranos, der seine eigenen Kinder im nächtlichen Dunkel gefangenhält, muß seiner Herrschaft entsetzt werden. – Sein jüngster Sohn Saturnus überlistet ihn, da er sich mit der Erde begattet, und entmannet seinen Erzeuger mit der Sichel, die ihm seine Mutter gab. Aus den Blutstropfen, welche die Erde auffängt, entstehen in der Folge der Zeit die rächerischen Furien, die furchtbaren, den Göttern drohenden Giganten und die Nymphen Meliä, welche die Berge bewohnen. – Die dem Uranos entnommene Zeugungskraft befruchtet das Meer, aus dessen Schaum Aphrodite, die Göttin der Liebe, emporsteigt. – Aus Streit und Empörung der ursprünglichen Wesen gegeneinander entwickelt und bildet sich das Schöne.
Nun vermählen sich die Kinder des Himmels und der Erde und pflanzen das Geschlecht der Titanen fort. – Cöus mit der Phöbe, einer Tochter des Himmels, zeugt die Latona, welche nachher die Vermählte des Jupiter, und die Asteria, welche die Mutter der Hekate ward. – Hyperion mit der Thia, einer Tochter des Himmels, zeugt die Aurora, den Helios oder Sonnengott und die Luna. Oceanus mit der Tethys, einer Tochter des Himmels, erzeugt die Flüsse und Quellen. – Japet vermählt sich mit der Klymene, einer Tochter des Oceanus, und erzeugt mit ihr die Titanen Atlas, Menötios, den Prometheus, der die Menschen bildete, und den Epimetheus. – Krius mit der Eurybia, einer Tochter des Pontus, erzeugt die Titanen Asträus, Pallas und Perses.
Saturnus vermählt sich mit seiner Schwester, der Rhea, und mit ihm hebt eine Reihe von neuen Götterzeugungen an, wodurch die alten in der Zukunft verdrängt werden sollen. Die bleibenden Gestalten gewinnen endlich die Oberhand; aber sie müssen vorher noch lange mit der alles zerstörenden Zeit und dem alles verschlingenden Chaos kämpfen. Saturnus ist zugleich ein Bild dieser zerstörenden Zeit. Er, der seinen Erzeuger entmannt hat, verschlingt seine eigenen Kinder, sowie sie geboren werden: denn ihm ist von seiner Mutter, der Erde, geweissagt worden, daß einer seiner Söhne ihn seiner Herrschaft berauben werde. So rächte sich der an seinem Erzeuger verübte Frevel; Saturnus fürchtet gleich diesem die sich empörende Macht, und während er über seine Brüder, die Titanen, herrschte, hielt er dennoch gleich dem Uranos die hundertärmigen Riesen und Cyklopen in dem Tartarus eingekerkert.
Von seinen Kindern fürchtet er Verderben; denn noch lehnet das Neuentstandene sich gegen seinen Ursprung auf, der es wieder zu vernichten droht. So wie die Erde seufzte, daß der umwölbende Himmel ihre Kinder in ihrem Schoße gefangenhielt, so seufzt nun Rhea über die Grausamkeit der alles zerstörenden, ihre eigenen Bildungen verschlingenden Macht, mit welcher sie vermählt ist. Und da sie den Jupiter, den künftigen Beherrscher der Götter und Menschen, gebären soll, so fleht sie die Erde und den gestirnten Himmel um die Erhaltung ihres noch ungebornen Kindes an.
Die uralten Gottheiten sind ihrer Herrschaft entsetzt, und haben nur noch Einfluß durch Weissagung und Rat; sie raten ihrer Tochter, wie sie den Jupiter, sobald sie ihn geboren, in eine fruchtbare Gegend, in Kreta, verbergen soll. – Die wilde, umherschweifende Phantasie heftet sich nun auf einen Fleck der Erde und findet auf dem Eilande, wo dies Götterkind erzogen werden soll, den ersten Ruheplatz.
Auf den Rat ihrer Mutter Erde wickelt die Rhea einen Stein in Windeln und gibt ihn dem Saturnus, statt des neugeborenen Götterkindes, zu verschlingen. Durch diesen bedeutungsvollen Stein, dessen bei den Alten so oft Erwähnung geschieht, sind der Zerstörung ihre Grenzen gesetzt; die zerstörende Macht hat zum ersten Male das Leblose statt des Lebenden mit ihrer vernichtenden Gewalt ergriffen, und das Lebende und Gebildete hat Zeit gewonnen, gleichsam verstohlnerweise sich an das Licht emporzudrängen.
Allein es ist noch vor den Verfolgungen seines allverschlingenden Ursprungs nicht gesichert. Darum müssen die Erzieher des Götterkindes auf der Insel Kreta, die Kureten oder Korybanten, deren Wesen und Ursprung in geheimnisvolles Dunkel gehüllt ist, mit ihren Spießen und Schilden ein immerwährendes Getöse machen, damit Saturnus die Stimme des weinenden Kindes nicht vernehme. – Denn die zerstörenden Kräfte lauern, das zarte Gebildete in seinem ersten Aufkeimen womöglich wieder zu zernichten.
Die Erziehung des Jupiter auf der Insel Kreta macht eines der reizendsten Bilder der Phantasie; ihn säugt die Ziege Amalthea, welche in der Folge unter die Sterne versetzt und ihr Horn zum Horn des Überflusses erhöhet wird. Die Tauben bringen ihm Nahrung, goldgefärbte Bienen führen ihm Honig zu, und Nymphen des Waldes sind seine Pflegerinnen.
Schnell entwickeln sich nun die Kräfte dieses künftigen Beherrschers der Götter und Menschen. Das Ende von dem alten Reiche des Saturnus nähert sich. Denn fünf seiner Kinder sind noch, außer dem Jupiter, von seiner zerstörenden Macht gerettet. Die den Erdkreis mit heiliger Glut belebende Vesta, die befruchtende Ceres, Juno, Neptun und Pluto.
Mit diesen kündigt Jupiter dem Saturnus und den Titanen, welche dem Saturnus beistehen, den Krieg an, nachdem er vorher die Cyklopen aus ihrem Kerker befreiet und diese ihn dafür mit dem Donner und dem leuchtenden Blitze begabt hatten. Und nun scheiden sich die neuern Götter, die vom Saturnus und der Rhea abstammen, von den alten Gottheiten oder den Titanen, welche Kinder des Himmels und der Erde sind.
Der Götterkrieg
Die Titanen sind das Empörende, welches sich gegen jede Oberherrschaft auflehnt; es sind die unmittelbaren Kinder des Himmels und der Erde, deren weit um sich greifende Macht keine Grenzen kennet und keine Einschränkung duldet.
Jupiter aber hatte sich den Weg zu der Alleinherrschaft schon gebahnt, indem er die hundertärmigen Riesen Kottus, Gyges und Briareus und die Cyklopen, die unter dem Uranos und Saturnus gefangengehalten wurden, aus ihrem Kerker befreiet und dadurch den Donner und Blitz in seine Gewalt bekommen hatte.
Die neuern Götter, mit dem Jupiter an der Spitze, versammelten sich auf dem Olymp, die Titanen ihnen gegenüber auf dem Othrys, und der Götterkrieg hub an. – Zehn Jahre dauerte schon der Kampf der neuern Götter mit den Titanen, als der Sieg noch unentschieden war, bis Jupiter sich den Beistand der hundertärmigen Riesen erbat, die ihm die Befreiung aus ihrem Kerker dankten.
Als diese nun an dem Treffen teilnahmen, so faßten sie ungeheure Felsen in ihre hundert Hände, um sie auf die Titanen zu schleudern, welche in geschlossenen Phalangen in Schlachtordnung standen. Als nun die Götter aufeinander den ersten Angriff taten, so wallte das Meer hoch auf, die Erde seufzte, der Himmel ächzte, und der hohe Olymp wurde vom Gipfel bis zur Wurzel erschüttert.
Die Blitze flogen scharenweise aus Jupiters starker Hand, der Donner rollte, der Wald entzündete sich, das Meer siedete, und heißer Dampf und Nebel hüllte die Titanen ein.
Kottus, Gyges und Briareus standen voran im Göttertreffen, und mit jedem Wurfe schleuderten sie dreihundert Felsenstücke auf die Häupter der Titanen herab. Da lenkte sich der Sieg auf die Seite des Donnerers. Die Titanen stürzten nieder und wurden so weit in den Tartarus hinabgeschleudert, als hoch der Himmel über die Erde ist.
Nun teilten die drei siegreichen Söhne des Saturnus das alte Reich der Titanen unter sich; Jupiter beherrschte den Himmel, Neptun das Meer und Pluto die Unterwelt. Die hundertärmigen Riesen aber bewachten den Eingang zu dem furchtbaren Kerker, der die Titanen gefangenhielt.
Jupiters Blitz beherrschte nun zwar die Götter, allein sein Reich stand noch nicht fest. Die Erde seufzte aufs neue über die Schmach ihrer Kinder, die im dunkeln Kerker saßen. Mit den Blutstropfen befruchtet, die sie bei der Entmannung des Uranos in ihren Schoß aufnahm, gebar sie in den Phlegräischen Gefilden die himmelanstürmenden Giganten mit drohender Stirn und Drachenfüßen, bereit, die Schmach der Titanen zu rächen.
Zu Boden geworfen, waren sie nicht besiegt, denn mit jeder Berührung ihrer Mutter Erde gewannen sie neue Kräfte. – Porphyrion und Alcyoneus, Oromedon und Enceladus, Rhötus und der tapfere Mimas huben am stolzesten ihre Häupter empor: sie schleuderten Eichen und Felsenstücke mit jugendlicher Kraft gen Himmel und achteten Jupiters Blitze nicht.
In dem hier beigefügten, nach einem der schönsten Werke des Altertums verfertigten Umriß heben die mächtigen Söhne der Erde, unter Jupiters Donnerwagen zu Boden gestreckt, dennoch gegen ihn ihr drohendes Haupt empor. Macht ist gegen Macht empört – einer der erhabensten Gegenstände, den je die bildende Kunst benutzte.
Daraus, daß in den mythologischen Dichtungen die Giganten den Göttern entgegengesetzt werden, sieht man auch, daß die Alten den Göttern keine ungeheure Größe beilegten. Das Gebildete hatte bei ihnen immer den Vorzug, vor der Masse; und die ungeheuren Wesen, welche die Phantasie sich schuf, entstanden nur, um von der in die hohe Menschenbildung eingehüllten Götterkraft besiegt zu werden und unter ihrer eignen Unförmlichkeit zu erliegen.
Gerade die Vermeidung des Ungeheuren, das edle Maß, wodurch allen Bildungen ihre Grenzen vorgeschrieben wurden, ist ein Hauptzug in der schönen Kunst der Alten; und nicht umsonst drehet sich ihre Phantasie in den ältesten Dichtungen immer um die Vorstellung, daß das Unförmliche, Ungebildete, Unbegrenzte erst vertilgt und besiegt werden muß, ehe der Lauf der Dinge in sein Gleis kömmt.
Die ganze Dichtung des Götterkrieges scheint sich mit auf diese Vorstellung zu gründen. Uranos oder die weit ausgebreitete Himmelswölbung ließ sich noch unter keinem Bilde fassen; was die Phantasie sich dachte, war noch zu weit ausgebreitet, unförmlich und gestaltlos; dem Uranos wurden seine eigenen Erzeugungen furchtbar; seine Kinder, die Titanen, empörten sich gegen ihn, und sein Reich entschwand in Nacht und Dunkel.
Der Name der Titanen zeigt schon das weit um sich Greifende, Grenzenlose in ihrem Wesen an, wodurch die Bildungen, welche sich die Phantasie von ihnen macht, schwankend und unbestimmt werden. Die Phantasie flieht vor dem Grenzenlosen und Unbeschränkten; die neuen Götter siegen, das Reich der Titanen hört auf, und ihre Gestalten treten gleichsam im Nebel zurück, wodurch sie nur noch schwach hervorschimmern.
An der Stelle des Titanen Helios oder des Sonnengottes steht der ewig junge Apoll mit Pfeil und Bogen. Unbestimmt und schwankend schimmert das Bild vom Helios durch, und die Phantasie verwechselt in den Werken der Dichtkunst oft beide miteinander. So steht an der Stelle des alten Oceanus Neptun mit seinem Dreizack und beherrscht die Fluten des Meers.
Demohngeachtet aber bleiben die alten Gottheiten noch immer ehrwürdig, denn sie waren den neuern Göttern nicht etwa wie das Verderbliche und Hassenswürdige dem Wohltätigen und Guten entgegengesetzt, sondern Macht empörte sich gegen Macht, Macht siegte über Macht, und das Besiegte selbst blieb in seinem Sturze noch groß.
So wie man sich nämlich unter dem Reiche der Titanen und unter der Herrschaft des Saturnus, der seine eigenen Kinder verschlang, noch das Grenzenlose, Chaotische, Ungebildete dachte, worauf die Einbildungskraft nicht haften kann, so verknüpfte man doch wieder mit dieser Vorstellung von dem Ungebildeten, Umherschweifenden und Grenzenlosen, das keinem Zwange unterworfen ist, den Begriff von Freiheit und Gleichheit, der unter der Alleinherrschaft des einzigen, der mit dem Donner bewaffnet war, nicht mehr stattfinden konnte.
Man versetzte daher das Goldene Zeitalter unter die Regierung des Saturnus, welcher, nachdem er in dem Götterkriege seiner zerstörenden Macht beraubt war, nach einer alten Sage dem Schicksale der übrigen Titanen, die in den Tartarus geschleudert wurden, entfloh und sich in den mit Bergen umschlossenen Ebenen von Latium verbarg, wohin er das Goldene Zeitalter brachte, indem er in einem Schiffe auf dem Tiberstrome beim Janus anlangte und mit ihm vereint die Menschen mit Weisheit und Güte beherrschte.
Diese Dichtung ist vorzüglich schön wegen des Überganges vom Kriegerischen und Zerstörenden zum Friedlichen und Sanften. Während daß Jupiter noch immer in Gefahr, der Herrschaft entsetzt zu werden, seine Blitze gegen die Giganten schleudert, ist Saturnus fern von dem verderblichen Götterkriege in Latium angelangt, wo unter ihm sich die glücklichen Zeiten bilden, die nachher in den Liedern der Menschen als entflohenes Gut besungen und vergeblich zurückgewünscht wurden.
So ist er auf einer alten Gemme, wovon hier der Umriß beigefügt ist, mit der Sense in der Hand, auf einem Schiffe, wovon nur der Schnabel oder das Vorderteil sichtbar ist, abgebildet; neben dem Schiffe sieht man einen Teil einer Mauer und eines Gebäudes hervorragen, wahrscheinlich weil an den Ufern der Tiber vom Saturnus die alte Stadt Saturnia auf den nachmaligen Hügeln Roms erbauet wurde.
Auf diese Weise ist nun Saturnus bald ein Bild der alleszerstörenden Zeit, bald ein König, der zu einer gewissen Zeit in Latium herrschte. Die Erzählungen von ihm sind weder bloße Allegorien noch bloße Geschichte, sondern beides zusammengenommen und nach den Gesetzen der Einbildungskraft verwebt. Dies ist auch der Fall bei den Erzählungen von den übrigen Gottheiten, die wir durchgängig als schöne Dichtungen nehmen und durch zu bestimmte Ausdeutungen nicht verderben müssen. Denn da die ganze Religion der Alten eine Religion der Phantasie und nicht des Verstandes war, so ist auch ihre Götterlehre ein schöner Traum, der zwar viel an Bedeutung und Zusammenhang in sich hat, auch zuweilen erhabene Aussichten gibt, von dem man aber die Genauigkeit und Bestimmtheit der Ideen im wachenden Zustande nicht fordern muß.
Ob nun Jupiter gleich die Titanen in den Tartarus verbannt und über die Giganten zuletzt die Inseln des Meeres mit rauchenden Vulkanen gewälzt hatte, so war dennoch sein Reich noch nicht befestigt; denn die Erde zürnte aufs neue über die Gefangenschaft ihrer Kinder und gebar, nachdem sie sich mit dem Tartarus begattet hatte, den Tiphöus, ihren jüngsten Sohn.
Das furchtbarste Ungeheuer, das je aus der dunkeln Nacht emporstieg, dessen hundert Drachenhäupter mit schwarzen Zungen leckten und mit feurigen Augen blitzten, das bald verständliche Laute von sich gab und bald mit hundert verschiedenen Stimmen der Tiere des Waldes heulte und brüllte, daß die Berge davon widerhallten.
Nun wäre es um die Herrschaft der neuen Götter getan gewesen, wenn Jupiter nicht schleunig seinen Blitz ergriffen und ihn unaufhörlich auf das Ungeheuer geschleudert hätte, so lange, bis Erd' und Himmel in Flammen stand und der Weltbau erschüttert ward, so daß Pluto, der König der Schatten, und die Titanen im Tartarus über das unaufhörliche Getöse erbebten, das über ihren Häuptern rollte.
Der Sieg über dies Ungeheuer wurde dem Jupiter am schwersten unter allen und drohte ihm selber den Untergang. Er freute sich daher dieses Sieges nicht, sondern schleuderte den Tiphöus, als er zu Boden gesunken war, trauervoll in den Tartarus hinab.
Denn dem Herrscher der Götter drohte stets Gefahr, nicht nur von fremder Macht, sondern auch von seinen eigenen Entschließungen. So weissagte ihm, als er sich mit der weisheitbegabten Metis, einer Tochter des Oceanus, vermählt hatte, ein Orakelspruch, daß sie ihm einen Sohn gebären und daß dieser, zugleich mit der Weisheit seiner Mutter und der Macht seines Vaters ausgerüstet, die Götter alle beherrschen würde.
Um dem vorzubeugen, zog Jupiter die weisheitbegabte Metis mit schmeichelnden Lockungen in sich hinüber und gebar nun selbst die Minerva, welche bewaffnet aus seinem Haupte hervorsprang. – Eine ähnliche Gefahr drohte ihm noch einmal, da er sich mit der Thetis begatten wollte, von der ein Orakelspruch geweissagt hatte, sie würde einen Sohn gebären, der würde mächtiger als sein Vater sein.
So fürchtet sich in diesen Dichtungen das Mächtigste immer vor noch etwas Mächtigerm. Bei dem Begriff der ganz unumschränkten Macht hingegen hört alle Dichtung auf, und die Phantasie hat keinen Spielraum mehr. Man muß daher die Verstandesbegriffe auf keine Weise hiemit vermengen, da man überdem eins dem andern unbeschadet, jedes für sich abgesondert sehr wohl betrachten kann.
In der folgenden Zeit wurden sogar zwei Söhne des Neptun, die derselbe mit der Iphimedia, einer Tochter des Aloeus, erzeugte und welche daher die Aloiden hießen, dem Jupiter furchtbar. Ihre Namen waren Otus und Ephialtes; sie ragten im Schmuck der Jugend und Schönheit mit Riesengröße zum Himmel empor und drohten den unsterblichen Göttern, indem sie Berge aufeinandertürmten, auf den Olymp den Ossa und auf den Ossa den Pelion wälzten, um so den Himmel zu ersteigen, welches ihnen gelungen wäre, wenn sie die Jahre der Mannbarkeit erreicht hätten. Aber Apollo erlegte sie mit seinen Pfeilen, ehe noch das weiche Milchhaar ihr Kinn bedeckte.
Selbst die Sterblichen wagten es also, sich gegen die Götter aufzulehnen, welche daher auch eifersüchtig auf jede höhere Entwickelung menschlicher Kräfte waren, jede Überhebung auf das schärfste ahndeten und den armen Sterblichen anfänglich sogar das Feuer mißgönnten. Denn die Menschen mußten noch den Haß der Götter gegen die Titanen tragen, weil sie von einem Abkömmling derselben, dem Prometheus, gebildet und ins Leben gerufen waren.
Die Bildung der Menschen
So untergeordnet ist in diesen Dichtungen der Ursprung der Menschen, daß sie nicht einmal den herrschenden Göttern, sondern einem Abkömmlinge der Titanen ihr Dasein danken.
Denn Prometheus, welcher die Menschen aus Ton bildete, war ein Sohn des Japet, der außer ihm noch drei Söhne erzeugt hatte, den Atlas, Menötius und Epimetheus, die alle den Göttern verhaßt waren.
Japet, der Stammvater der Menschen, lag schon vom Jupiter mit den übrigen Titanen in den Tartarus hinabgeschleudert; sein starker Sohn Menötius wurde wegen seiner den Göttern furchtbaren Macht und übermütigem Stolz, von Jupiters Blitz erschlagen, in den Erebus hinabgestürzt. Dem Atlas legte Jupiter die ganze Last des Himmels auf die Schultern; den Prometheus selber ließ er zuletzt an einen Felsen schmieden, wo ein Geier unaufhörlich an seinem Eingeweide nagte; und den Epimetheus ließ er das Unglück über die Menschen bringen.
So verhaßt war den Göttern das Geschlecht des Japet, woraus der Mensch entsprang, auf den in der Folge die unzähligen Leiden sich zusammenhäuften, wodurch er die Schuld des ihm mißgönnten Daseins vielfach büßen mußte.
Prometheus befeuchtete die noch von den himmlischen Teilchen geschwängerte Erde mit Wasser und machte den Menschen nach dem Bilde der Götter, so daß er allein seinen Blick gen Himmel emporhebt, indes alle andern Tiere ihr Haupt zur Erde neigen.
Den Göttern selber also konnte die Phantasie keine höhere Bildung als die Menschenbildung beilegen, weil nichts mehr über die erhabene aufrechte Stellung geht, in welcher sich gleichsam die ganze Natur verjüngt und erst zum Anschauen von sich selber kömmt.
Denn die Strahlen der Sonne leuchten, aber das Auge des Menschen siehet. – Der Donner rollt, und die Stürme des Meeres brausen, aber die Zunge des Menschen redet vernehmliche Töne. – Die Morgenröte schimmert in ihrer Pracht, aber die Gesichtszüge des Menschen sind sprechend und bedeutend.
Es scheint, als müsse die unermeßliche Natur sich erst in diese zarten Umrisse schmiegen, um sich selbst zu fassen und wieder umfaßt zu werden. Um die göttliche Gestalt abzubilden, gab es nichts Höheres als Aug' und Nase, und Stirn und Augenbraunen, als Wang' und Mund und Kinn; weil wir nur von dem, was lebt und diese Gestalt hat, wissen können, daß es Vorstellungen habe wie wir und daß wir Gedanken und Worte mit ihm wechseln können.
Prometheus ist daher auf den alten Kunstwerken ganz wie der bildende Künstler dargestellt, so wie auch auf dem hier beigefügten Umriß, nach einem antiken geschnittenen Steine, wo zu seinen Füßen eine Vase und vor ihm ein menschlicher Torso steht, den er, so wie jene, aus Ton gebildet und dessen Vollendung er zum einzigen Augenmerke seiner ganzen Denkkraft gemacht zu haben scheint.
Als es dem Prometheus gelungen war, die göttliche Gestalt wieder außer sich darzustellen, brannte er vor Begierde, sein Werk zu vollenden; und er stieg hinauf zum Sonnenwagen und zündete da die Fackel an, von deren Glut er seinen Bildungen die ätherische Flamme in den Busen hauchte und ihnen Wärme und Leben gab.
So ist er hier zum zweitenmal abgebildet, sitzend mit der Fackel in der Hand, über der ein Schmetterling schwebt, welcher den beseelenden Hauch andeutet, wodurch die tote Masse belebt wird. Der bildende Künstler ist zum Schöpfer geworden; seine Bildungen werden ihm gleich.
Daß Prometheus selbst ein Schöpfer göttlicher Bildungen wurde, darüber zürnte Jupiter und dachte darauf, wie er die Menschen verderben wollte. Als daher Prometheus einst einen Stier schlachtete und, um den Jupiter zu versuchen, das Fleisch und die Knochen jedes in eine Haut gewickelt besonders legte, damit Jupiter wählen möchte, so wählte dieser mit Fleiß den schlechten Teil, um wegen des Betruges auf den Prometheus zürnen zu können und seinen Zorn an den Sterblichen auszulassen, die er nun plötzlich des Feuers beraubte.
Denn an dem Prometheus selber seinen Haß auszuüben, wagte Jupiter damals noch nicht; er suchte ihm nur sein Werk zu verderben; aber auch dieses gelang ihm nicht; denn Prometheus, der den Jammer der Menschen nicht dulden konnte, stieg wiederum zum Sonnenwagen und entwendete aufs neue den ätherischen Funken, den er in dem Marke der röhrichten Pflanze verbarg und ihn den Sterblichen vom Himmel wiederbrachte.
Als nun Jupiter von fern den Glanz des Feuers unter den Menschen erblickte, so dachte er aufs neue, wie er sie durch ihre eigene Torheit strafen wollte, während daß Prometheus fortfuhr, die Menschen alle nützlichen Künste zu lehren, welche der Gebrauch des Feuers möglich macht, und, was die größte Wohltat war, ihnen den Blick in die Zukunft benahm, damit sie unvermeidliche Übel nicht voraussehen möchten.
Dem Jupiter also gleichsam zum Trotz suchte Prometheus seine Menschenschöpfung und Menschenbildung zu vollenden, ob er gleich selber wußte, daß er dereinst schrecklich würde dafür büßen müssen. – Dies ungleiche Verhältnis der Menschen zu den herrschenden Göttern gab nachher den Stoff zu den tragischen Dichtungen, deren Geist in den folgenden Zeilen atmet, worin ein Dichter unserer Zeiten den Prometheus, im Namen der Menschen, deren Jammer er in seinem Busen trägt, redend einführt.
Prometheus
Bedecke deinen Himmel, Zeus, Mit Wolkendunst, Und übe, dem Knaben gleich, Der Disteln köpft, An Eichen dich und Bergeshöhn; Mußt mir meine Erde Doch lassen stehn, Und meine Hütte, die du nicht gebaut, Und meinen Herd, Um dessen Glut Du mich beneidest.
Ich kenne nichts ärmers Unter der Sonn' als euch, Götter! Ihr nähret kümmerlich Von Opfersteuern Und Gebetshauch Eure Majestät, Und darbtet, wären Nicht Kinder und Bettler Hoffnungsvolle Toren.
Da ich ein Kind war, Nicht wußte wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Zur Sonne, als wenn drüber wär' Ein Ohr zu hören meine Klage, Ein Herz wie mein's, Sich des Bedrängten zu erbarmen
Wer half mir Wider der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich Von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, Heilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, Betrogen, Rettungsdank Dem Schlafenden da droben?
Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Hast du die Tränen gestillet je des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Meine Herrn und deine?
Wähntest du etwa, Ich sollte das Leben hassen, In Wüsten fliehen, Weil nicht alle Blütenträume reiften?
Hier sitz' ich, forme Menschen Nach meinem Bilde, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiden, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und dein nicht zu achten, Wie ich!
Goethe
Nun ließ aber Jupiter, der über den Raub des Feuers noch immer zürnte, eine weibliche Gestalt von Götterhänden bilden, die er, mit allen Gaben ausgeschmückt, Pandora nannte, und sandte sie mit allen verführerischen Reizen und mit einer Büchse, worin das ganze Heer von Übeln, das den Menschen drohte, verschlossen war, zum Prometheus, der bald den Betrug erkannte und dies gefährliche Geschenk der Götter ausschlug.
Da konnte Jupiter seinem Zorne nicht länger Einhalt tun, sondern ließ den Prometheus, für seine Klugheit zu büßen, an einen Felsen schmieden; und das Unglück kam demohngeachtet über die Menschen; denn der unvorsichtige Epimetheus, des Prometheus Bruder, ließ sich, obgleich gewarnt, durch die Reize der Pandora betören, welche, sobald er sich mit ihr vermählt hatte, die Büchse eröffnete, woraus sich plötzlich alles Unheil über die ganze Erde und über das Menschengeschlecht verbreitete.
Sie machte schnell den Deckel wieder zu, ehe noch die Hoffnung entschlüpfte, welche nach Jupiters Ratschluß allein zurückblieb, um einst noch zur rechten Zeit den Sterblichen Trost zu gewähren. Die verführerischen Reize der sinnlichen Lust brachten also auch nach dieser Dichtung zuerst das Unglück über die Menschen. Der törichte Epimetheus vereitelte bald die vorsehende Weisheit des Prometheus. Vernunft und Torheit waren sogleich bei der Bildung und Entstehung des Menschen miteinander im Kampfe.