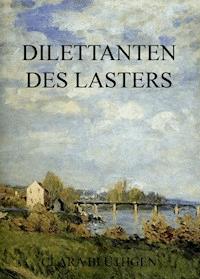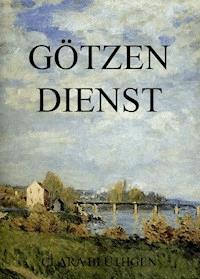
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Leidenschaft, erzählt von einer der beliebtesten Autorinnen des frühen 20. Jahrhunderts.
Das E-Book Götzendienst wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Götzendienst
Clara Blüthgen
Inhalt:
Götzendienst
Götzendienst, C. Blüthgen
Götzendienst
I.
Der alte Löwe war gestorben.
So lange hatte seine gewaltige Natur mit dem Tode gerungen, daß nun das Ende des Kampfes wie etwas Unwahrscheinliches erschien, mit dem man sich nicht abfinden wollte. Seine reckenhafte Gestalt, der auch das hohe Alter nichts von ihrer eisernen Gedrungenheit genommen hatte, sein Löwenhaupt mit der dichten eisgrauen Mähne, mit den durchdringenden Augen war so sehr zu einem Besitz seiner Nation geworden, daß man sich daran gewöhnt hatte, ihr auch die physische Unsterblichkeit zuzutrauen. Seine Bücher, in ihren Auflagen von Hunderttausenden, überschwemmten sein kleines Land; eines seiner Bilder, der alte Wiking, umgeben von vier mächtigen dänischen Doggen, war historisch geworden und hing, im billigen Farbendruck, eingerahmt in den Bauernhäusern. Wer ihm je einmal begegnet war, wenn er seine weiten Wanderungen ausführte, wer dabei ein Wort, einen Handschlag von ihm empfangen hatte, erzählte es daheim wieder und wieder, das Wort gewann Leben und vererbte sich als ein Besitz auf Kinder und Enkel.
Markig und gedrungen wie seine Erscheinung war auch das Wesen seiner Kunst. Die Geschichte seines Landes mit ihren Kriegen und Bürgerkämpfen lieferte ihm die Stoffe. Dort, wo es am blutigsten herging, wo die wildesten Instinkte sich am ungezügeltsten zeigten, war er am meisten zu Hause. Seine Gestalten wuchsen über das Historische hinaus. Seine Männer wurden zu Giganten, die zerschmetterten und vernichteten, die Jünglinge zitterten in Kampfbegier, Krieg und Mord war ihnen ein alltägliches Geschäft, um das man nicht viel Aufhebens machte. Von den Frauen mit ihren blauen Augen und dem bernsteingelben Haar trugen nur wenige einen weichen Zug um die Lippen und den Nacken in Demut gebeugt. Weitaus die meisten warfen den Kopf trotzig zurück und waren sich ihrer Leidenschaft als ihres Rechtes bewußt. Schlachtengewühl, brennende Dörfer und Städte, ein blutroter Himmel und eine vom Blut getränkte Erde, Heldentaten persönlichen Muts und eine Hingabe, die über Not und Tod triumphierte – das war des Alten Welt!
Wer ihn recht zu lesen verstand, dem wurde das Auge naß und die Kehle trocken vor Erregung, und etwas Großes blieb in ihm zurück, das ihn das Kleine um sich her nur noch kleiner sehen ließ.
Ein Glück war's für seine Umgebung, daß des Alten Gewaltnatur in seinen Schriften dieses mächtige Sicherheitsventil gefunden hatte.
Seine Art war nicht bequem, seine Größe riß wohl für den Augenblick empor, aber sie zerschlug auch, was in seine Nähe kam und sich ihm vielleicht widersetzte. Er duldete keinen Widerspruch, keinen Willen neben dem seinen.
Wohl konnte er sehr liebenswürdig sein. Man erzählte von ihm kleine reizende Züge von Herzensgüte, allerliebste Aussprüche waren zu geflügelten Worten geworden. Aber dieser Liebenswürdigkeit war nicht zu trauen, sie war die des Löwen, der in freundlicher Laune mit einem Hündchen spielt – irgendein Zufall konnte genügen, um sie in das Gegenteil umschlagen zu lassen. Dann zitterte vor ihm, was in seine Nähe kam, und am meisten das, was ihm am nächsten stand: sein alter Diener und seine junge Frau.
Er hatte sie genommen, wie die Helden seiner Geschichten sich das Weib nahmen, auf das ihre Sinne sie hinwiesen. Wie ein Reiteroberst eine Dirne lachend auf sein Pferd zwang, die Linke um ihren Leib gepreßt, die Rechte im Degenkorb. Die junge, behütete Tochter einer vornehmen Familie hatte sich ihm so wenig widersetzt wie diese Familie selbst. Des Alten Wille war wie ein Ungewitter über sie gekommen, wie eine Macht von oben, gegen die es keine Auflehnung gibt.
Über den Zaun des elterlichen Gartens hinüber hatte die junge Astrid Brandis hinübergespäht zu dem alten Malthe Börgesen, wenn er in dem weiten Park, gefolgt von seinen grauen Doggen, spazierenging, eingeknöpft in seinen langen grauen Mantel, den weichen Filzhut auf dem grauen Haar. Ihre Wangen glühten und ihre Augen weiteten sich, wenn er aus dem Dunkel der Bäume heraustrat und langsam mit wuchtigen Schritten das Hünengrab erstieg, das den Mittelpunkt seiner Besitzung bildete, das einzige noch uneröffnete im ganzen Lande.
Gegen den kaltblauen nordischen Himmel stand düster und massig seine Silhouette inmitten der gewaltigen Tiere – ein Urweltmensch zwischen Geschöpfen der Urwelt – ein Bild, das der jungen Astrid keinen Schrecken einjagte, sondern ihr Herz im freudigen Stolz zittern ließ. Zart, jung, blond und behütet wie sie war, riß es sie hin zu ihrem Gegenspiel, dem Starken, Knorrigen, vom Leben Gehärteten, Rücksichtslosen.
Er sah ihr loses blondes Haar über dem grünen Zaun wehen. Er trat heran. Ein paar Worte herüber und hinüber – wie ein gutgelaunter Großonkel sich mit dem Nichtchen unterhält. Er behielt ihre Hand, die sie ihm zum Gruß gereicht hatte, in seiner, und der starke Schlag seines Blutes pulste in sie über und füllte sie mit fremden Schauern, die sie nicht verstand.
Dann schickte er ihr seine Bücher. Freilich waren sie alle längst im Besitz ihrer Familie, wie es sich bei dem berühmten Nachbar ziemte, und die meisten kannte sie davon. Aber sie las sie alle noch einmal die Nächte hindurch bei der Lampe in ihrem Mädchenzimmer, atemlos, zitternd vor so viel Größe, aufgepeitscht von der fremden Art, die von ihr Besitz ergreifen wollte.
Am Morgen verrieten dunkle Ringe um die Augen und ein seltsam reifer Zug um den Mund, wie ihre Nächte gewesen waren. Der Alte sah es und lächelte über seinen Sieg.
Ein paar Wochen später, und er trat vor die Eltern und erbat sich Astrid – nicht als sein eheliches Gemahl, denn er war seit langem gebunden, sondern als sein Pflegetöchterchen, den Sonnenschein seines Abends, als einen feinen stillen Duft, der neben ihm weben sollte.
Er versprach, sie aus der Enge des vornehmen, aber armen Hausstandes herauszunehmen, ihr die Welt zu zeigen, die er so gut kannte. Und er hielt sein Wort.
Über ein Jahr lang waren sie auf Reisen. Als gelte es, alle Brücken hinter ihnen abzubrechen, führte er sie aus ihrer nordischen Heimat fort nach dem Orient, nach Kleinasien, Griechenland, Italien. Auf Korsika richteten sie sich häuslich ein. Sie waltete um ihn wie eine kleine Hausfrau, kochte für ihn, kaufte für ihn alle die seltsamen köstlichen Früchte, die besonderen Gemüse ein, die für sie lauter kleine Wunder waren. Von ihrer Dienerin, einem halbwüchsigen Mädchen, erlernte sie die Sprache des Landes und war stolz, wenn sie ihn mit immer neuen Fortschritten und immer neuen Landesgerichten überraschen konnte.
Mit den Mönchen eines hochgelegenen Klosters hielten sie gute Freundschaft. Oftmals stiegen die geistlichen Herren zu ihnen hinunter, oder sie zu jenen hinauf; dann ward die junge blonde Signorina nicht übel verwöhnt.
Astrid nahm es lächelnd hin, erfreut, weil es sie in den Augen ihres Beschützers heben mußte, aber gefeit, wie durch eine besondere Luftschicht gegen jedes Begehren geschützt.
Mit anderen Augen sah der alte Recke diese Huldigungen an. Mann war für ihn Mann, der äußere Schutz von Kutte und Tonsur erschien ihm höchst ungenügend; der alte Lebenskenner traute jenen Symbolen der Enthaltsamkeit nicht. Freilich fürchtete er für den Augenblick nichts. Aber das Gebaren der frommen Herren war ihm doch eine Warnung. Bisher hatte er Astrid von der Berührung mit allen Männern geschickt abzuschneiden gewußt, hatte die Luxushotels mit ihrer eleganten reisenden Lebewelt gemieden und war auf Bergfahrten und in der Eisenbahn jeder andrängenden Bekanntschaft ausgewichen.
Nun sagte er sich, daß er ein »Pflegetöchterchen« nicht immer so werde schützen können, und er beschloß, sie fester an sich zu binden.
Hals über Kopf kehrte er mit ihr in die Heimat zurück, um reinen Tisch zu machen.
Er besaß eine gealterte Frau und verblühte Töchter, die mißmutig des Freiers warteten. Kein geistiges oder seelisches Band fesselte ihn an diese Familie – so schob er sie von sich ab, wie man eine Schachpartie, derer man müde geworden, mit der Hand zusammenwischt. –
Er versorgte sie überreich, und sie versuchten kaum, sich zur Wehr zu setzen. Auch für sie hatte es nie einen anderen Willen als den des Alten gegeben. Sie wußten, daß, wenn sie sich ihm widersetzt hätten, er ihnen das Leben zur Hölle gemacht und sie nach und nach zum Weggehen gezwungen hätte. So gingen sie lieber freiwillig.
Es war der letzte Don-Juan-Streich eines an erotischen Abenteuern überreichen Lebens, und er lief in das schlichte Bürgerliche aus.
Astrid Brandis war Astrid Börgesen geworden; sie hätte diesem Namen verschiedene klangvolle Titel voransetzen können, wenn sie nur gewollt hätte. Aber sie legte ebensowenig Gewicht darauf wie ihr Gatte.
Der Schritt in ihr neues Leben war kaum größer gewesen als der über den Zaun ihres väterlichen Gartens in den Park ihres Nachbars.
Wieder begannen sie ihr unruhiges Reiseleben.
Über die Geschichte dieser raschen Scheidung und Wiederverheiratung mußte erst Gras wachsen, ehe man in der Heimat seßhaft werden konnte. Das kleine Land zwar hätte seinem Dichter auch diesen Gewaltstreich ebenso verziehen wie die früheren, zum Teil sehr bösen Liebesabenteuer; ja, er war dazu angetan, als Beweis seiner nie versiegenden Jugendlichkeit seine Volkstümlichkeit nur noch zu steigern.
Aber da war etwas anderes. Seine Beziehungen stiegen sehr weit hinauf, zu einer Höhe, die nicht mehr zu überbieten war. Die Prinzen seines fürstlichen Hauses gingen bei ihm ein und aus und luden sich zwanglos zum Tee ein. Die Prinzessinnen bedachten ihn zum Geburtstag mit selbstgemalten Porzellandöschen und gestickten Unnützlichkeiten, der Kronprinz eines verwandten königlichen Hauses hatte ihn besucht, um seine Doggenzucht in Augenschein zu nehmen. Als man ihm den bevorstehenden Besuch gemeldet und seine damalige Frau ihn bestürmt hatte, wenigstens einen schwarzen Rock anzuziehen, war er unangenehm geworden: er sei er, wer zu ihm komme, müsse ihn auch nehmen, wie er einmal sei, er sei es nicht gewesen, der den Besuch gerufen habe.
Er war dann auch wirklich in seiner grauen Hausjacke geblieben, was der Kronprinz mit Humor hingenommen hatte. Als dieser dann aber ein besonders reizendes junges Doggenexemplar zu kaufen gewünscht, war die mühsam beherrschte Mißstimmung des alten Nationaldichters durchgebrochen: »Königliche Hoheit – ich verkaufe wohl Bücher, aber nicht junge Hunde«, war er aufgebraust. Schließlich aber hatte man Frieden geschlossen, und das Tier war als Geschenk in den Besitz des Kronprinzen übergegangen.
Bei diesen Beziehungen war es nicht gut möglich, die Prinzen und Prinzessinnen eine junge Frau Staatsrätin Börgesen nach ein paar Monaten anstatt der alten antreffen zu lassen. Nach ein paar Jahren dagegen würde es sich als etwas ganz Selbstverständliches ergeben.
Diese Rechnung stimmte. Die hohen Gäste stellten sich ein, als sei nichts verändert, und die junge Frau Astrid Börgesen empfing sie mit vieler Anmut und Sicherheit – zugleich mir einer Bescheidenheit, die als sehr reizend empfunden wurde.
Auch alles, was in der Hauptstadt einen künstlerischen oder literarischen Namen trug, durfte Astrid bei sich empfangen. Jeden Dienstag war offenes Haus und offene Tafel den ganzen Tag über, die Besucher schwirrten ein und aus bis in die Nacht hinein, und der alte Barde war der fröhlichste unter ihnen.
Die sechs anderen Tage der Woche gehörten der Arbeit. Sie war für Börgesen eine Notwendigkeit wie das Atmen, oder wie Essen und Trinken. Sein Glück und die Quelle immer neuer Kraft. Seine Arbeitswut band sich nicht an Stunden. Sobald ein neuer Stoff seine Fänge um ihn schlug, war er für die Außenwelt verloren. Niemand durfte ihn stören, ganz still mußte es um ihn sein, damit die Gestalten in ihrem Kommen und Gehen, in ihrem Reden und Handeln nicht gestört wurden. Dann war er wie ein Verzückter, wie das Medium einer fremden Kraft, die durch ihn arbeitete. Bogen um Bogen bedeckten sich mit seiner knorrigen Schrift.
Wenn dann sein Tagewerk fertig war, wenn man endlich daran denken durfte, die Mahlzeiten nachzuholen, dann war er wie aus einem Jungbade gestiegen, fröhlich, zärtlich, gütig, von einem überquellenden Humor, der immer neue Wendungen fand.
Dann endlich fand er auch Zeit für seine junge Frau. Dann stieg er mir ihr auf das Hünengrab und übersah mit ihr seinen Besitz, den er durch immer neue Landankäufe wie ein kleines Fürstentum ausgestaltet hatte. Dann wandelte er mit ihr in den gelben Sandwegen, die immer frisch geharkt sein mußten, ließ sie vor sich hergehen, um den Abdruck ihrer zierlichen Füße zu verfolgen.
Als sie noch auf Reisen lebten, war es beim Ankommen in jeder größeren Stadt sein Erstes, irgendein feines, zartgefärbtes Leder zu kaufen und daraus eigenhändig Stiefelchen für seine Frau zuzuschneiden, die dann der beste Schuhmacher der Stadt nähen mußte. Es war eine Sache von höchster Wichtigkeit, daß die »Rehfüßchen« in einer Hülle steckten, die bequem war und doch die ganze Schmalheit dieser kleinen Füße zeigte. Er sammelte diese Schuhchen, wie junge Damen die Wappenlöffel der verschiedenen Städte, die sie bereist, als Andenken zu sammeln pflegen. Die Hieroglyphen der schmalen Sohlen in dem goldenen Sand der Wege waren immer wieder sein Entzücken: »Die Rehfüßchen, die mir gehören!«
Davon wollte Astrid nichts wissen.
»Ich will dir mehr sein, als ein weiches Haustierchen. Warum läßt du mich nicht dabei sein, wenn du arbeitest?«
»Weil mein kleines Schmaltier mir die Geister verscheuchen könnte, wenn sie mich besuchen kommen. Du weißt doch, daß ich aus mir selbst nichts kann. Alles ist eine Verbindung von drüben her. Irgend solch blutrünstiger Kerl, der schon an die dreihundert Jahre tot ist, erzählt es mir – da heißt's aufpassen und zupacken.«
An der Idee einer Verbindung mit irgendeinem Jenseits hielt er eigensinnig fest. Dennoch erlaubte er schließlich, daß seine junge Frau ihm half. Zuerst durfte sie ihm die Korrektur lesen, dann las er ihr vor, was er jeden Tag geschrieben hatte. Zuletzt gewöhnte er sich daran zu diktieren, und sie hatte ihre liebe Not, seinem hastig vordrängenden Gedankenflusse zu folgen. Die Geister einer jenseitigen Welt wurden nicht durch ihre lebendige Gegenwart verscheucht, sondern zeigten sich hilfsbereiter als je.
Kaum wurde Astrid es gewahr, daß sie kein eigenes Leben mehr lebte, daß ihr ganzes Sein allmählich in das des alten Gatten mündete, von seinem verschlungen wurde. Der Einfluß, den seine starke Natur auf sie ausübte, war so mächtig, daß alles so, wie es war, ihr natürlich und gut erschien, daß sie kaum daran dachte, daß ihre Jugend andere Anforderungen hätte stellen dürfen, als die Sekretärin und Gesellschafterin eines alten Herrn zu sein.
Hin und wieder, wenn sie eilfertig die Gedanken ihres Gatten zu Papier brachte, in äußerster Anspannung, um ja kein Wort zu überhören, war es ihr, als ob daneben eigene Gedanken in ihr wach würden, die sich mühten, jene zu verdrängen.
Zuerst wies sie alles, was sich regte, voll Empörung zurück, wie Vermessenheit erschien es ihr, daß sie, die nur Dienerin eines Großen zu sein hatte, für sich selbst etwas schaffen könnte. Dann aber, als die Gedanken sich für den Zwang rächten und sie nur um so gewaltsamer überfluteten, schrieb sie sie nieder. Nichts Geordnetes, nichts, das man in irgendeine Rubrik, als Novelle, Artikel oder nur Skizze hätte einschachteln können, nur hingeworfene Gedanken, Einfälle, kleine Blitze und Fünkchen, aber absonderlich, überquellend von jugendlicher Kraft und Phantasie.
Astrid selbst fand keine ernste Stellung dazu, aber sie liebte ihre Aufzeichnungen als etwas Geheimes, Verbotenes. Sie freute sich auf die einsame Stunde, in der ihr Gatte Mittagsschlaf hielt und in der sie an dem krausen Gedankengespinst weiter wirken konnte. Sorgfältig schloß sie die Blätter ein, damit der Alte sie nicht entdecken sollte. Nach einer Weile aber kam ihr der Wunsch, sein Urteil darüber zu hören, und eines Tages, als sie ihn bei recht guter Laune glaubte, brachte sie ihm die Blätter, zaghaft und rot über das ganze Gesicht wie ein junges Mädchen.
Er war etwas erstaunt. »Sieh, sieh, ich dachte, du hättest mit dem, was du für mich schreiben müßtest, reichlich genug. Was für Kraft doch in euch Frauen steckt, und in den zartesten am meisten.«
Dann nahm er die Schriften, rückte damit nahe zum Fenster und setzte ein zweites Augenglas über die Brille, denn seine Augen hatten in der letzten Zeit sehr nachgelassen.
Klopfenden Herzens sah Astrid von ihrer Handarbeit zu ihm hinüber.
Nach einem Weilchen stand er auf, bog ihren Kopf hinten über und klopfte ihr die Wangen: »Na, da hat mein Schatz sich ja eine hübsche Federübung geleistet.«
»Eine Federübung? So, ist es nicht zu gebrauchen?« Das Herz sank ihr.
»Gewiß ist's zu gebrauchen, für einen ganz guten Zweck sogar. Sieh mal so . . .«
Er faltete die Blätter zusammen, zog sein mächtiges Taschenmesser, das groß wie ein Dolch war, schnitt den Kniffen entlang und zündete mit einem der Fidibusse seine Pfeife an. »Nun ist's Rauch geworden und schadet keinem mehr. Das Schmaltierchen wollen wir aber entschädigen. Wir fahren zusammen zur Stadt, da habe ich in dem bewußten Juwelierladen eine Schnur Barockperlen gesehen, die einem weißen Hälschen recht gut stehen müßten.«
Astrid aber wollte keine Perlen und keinen Schmuck. Ihr war zu Sinn, als habe das Dolchmesser des Gatten etwas Lebendiges gemordet.
Wie aber stets das, was der Alte anderen nahm, ihm selbst zugute kam, so auch hier. Nun Astrid glauben mußte, für sich selbst nichts mehr erreichen zu dürfen, stellte sie sich um so demütiger ganz in den Dienst des Gatten.
Sein achtzigster Geburtstag war vorüber, eine Feier für das ganze Land, die seinem Namen die letzte Verherrlichung brachte. Jede Zeitung nahm in Wort und Bild davon Notiz, seine Marmorbüste stand nun auf einem Ehrenplatz im Museum der Hauptstadt. Ein paar Tage lang war sein Landhaus der Wallfahrtsort für Hunderte gewesen, die ihm huldigen wollten, Fest reihte sich an Fest ihm zu Ehren.
Weiter gingen die Jahre, die Tage so durch Arbeit gefüllt, daß kaum Zeit blieb, über ihr Vergehen nachzudenken.
Dem alten eisgrauen Recken taten sie nur wenig an, höchstens, daß die Altersrunen seine Haut schärfer zerrissen und daß das mächtige Löwenhaupt tiefer zwischen die Schultern einsank. Von Astrid aber hatten sie den Schmelz abgestreift. Langsam war ihre Mädchenhaftigkeit in blühende Frauenreife übergegangen – langsam auch diese fast überschritten, ohne daß sie eigentlich gelebt hatte.
Was an jungen, gesunden Instinkten in ihr gelegen, war durch das geistige Übergewicht des alten Gatten erstickt worden. War doch noch einmal ein Wunsch in ihr lebendig aufgesprungen beim Anblick eines Liebespaares oder spielender Kinder, so hatte sie sich darüber geschämt und war rot geworden.
Es waren viele Männer in ihrem Heim ein und aus gegangen, auch solche, die nach gemeinem Brauch die junge Frau eines alten Mannes als Freiwild ansehen zu können glaubten – trotzdem hatte sich kaum ein Wunsch an sie gewagt und hatte kein Werben ihren Frieden erschüttert. Sie alle kannten den alten Recken, kannten die elementaren Kräfte seiner Natur, zu deren gewaltigsten die Eifersucht gehörte. Lebendig war noch der Ruf früherer Geschehnisse, bei denen ein paarmal die Eifersucht zu grausamen Zusammenstößen geführt hatte. Daß diese Leidenschaft auch im Alter nicht erloschen sei, nahmen sie alle an.
Ein einziges Mal war sie zu guter Letzt noch emporgelodert.
Allmählich hatte der riesenhafte Körper sich doch den Beschwerden des Alters beugen müssen, heftige Gichtanfälle hatten Börgesen zuweilen für lange Wochen hilflos ans Bett gefesselt und Diener wie Frau eine schwere Pflege aufgebürdet.
Mit wachsamen Augen verfolgte der Alte jede Bewegung Astrids und des Doktors, wenn sie gemeinschaftlich seine kranken Beine in Watte und Flanell packten. Die Sorge des Arztes, daß die gnädige Frau sich nicht überanstrengen und sich täglich ein paar Stunden Spazierengehen und öfter eine Fahrt von ihrer grünen Gartenstadt zur Hauptstadt gönnen sollte, erschien ihm übertrieben und wie ein Raub an sich selbst.
Einmal, als Astrid den Arzt beim Abschied auf seinen Wink ins Nebenzimmer begleitete, um von ihm noch eine Anweisung zu empfangen, die nicht für das Ohr des Kranken berechnet war, packte Börgesen die Eifersucht, urkräftig wie in seinen jungen Jahren. Sie hatten ihre Stellung im anderen Zimmer so gewählt, daß er sie nicht sehen konnte. Er hörte sie sprechen, aber sein Ohr hatte an Schärfe verloren, so sehr er es auch anspannte, konnte er kein Wort verstehen. Er versuchte, sich im Bett hochzusetzen, den Oberkörper vorzubeugen, um schärfer zu hören. Ein Stöhnen entfuhr ihm bei der unbeholfenen Bewegung – wie tief mußten jene beiden in ihre Unterhaltung vertieft sein, daß sie nicht hörten, wie er litt – der Arzt, dem es Beruf war, zu sorgen, die Frau, der es Herzenssache hätte sein müssen!
Er stand Qualen aus, wie niemals in den Tagen der Jugend und Leidenschaft. Ein Jahr opfern von der nur noch kärglich bemessenen, kostbaren Lebenszeit, um zu sehen, was zwischen den beiden vorging.
Er spannte die kranken Muskeln an, seinen Willen: Ich will! Was waren die Wunderheilungen des Mittelalters, bei denen die Lahmen ihre Krücken fortwarfen und wandelten, anderes, als eine aufs äußerste angespannte Willenfestigung im gläubigen Wahn an das Gelingen.
Plötzlich stand er auf den kranken Beinen, taumelte ein paar Schritte vor, riß den Türflügel zurück – und sah Astrid weinend, das Taschentuch in der einen Hand, in der anderen ein Rezept, das der Arzt wohl eben geschrieben, den Arzt selbst in tröstend verbindlicher Haltung neben ihr.
Dann verließ ihn die Kraft. Er stürzte hin wie ein Felsblock, der sich vom Grat losgelöst hat und auf den Boden aufklatscht.
Sie brachten ihn wieder zu Bett unter schweren Mühen. Ihrer drei genügten kaum, um den gewaltigen Körper zu regieren. Sein Gesicht war bläulich, die Augen starr, ein leichter Schaum stand auf der breiten, blaurot geäderten Unterlippe. Seine Zunge war schwer und brachte nur ein paar lallende Laute hervor.
Anfangs glaubte der Arzt, daß ein Schlag ihn getroffen habe, aber es zeigte sich keine andere Lähmung als die seiner gichtischen Erkrankung. Er hob den Arm gegen die Tür: »Allein bleiben!«
Doch als die drei, Astrid, der Doktor und der alte Diener, wie Verbrecher hinausschleichen wollten, hob er den Arm abermals, nun gegen seine junge Frau: »Du – bleiben! Hierherkommen!«
Scheu und zitternd wie eine Schuldige trat sie an sein Lager.
Die Körperkräfte kamen dem Alten früher zurück als die Sprache. In ohnmächtiger Empörung packte er die Hand seiner Frau, drückte und schüttelte sie, und schleuderte sie dann fort wie etwas Ekelhaftes. Vier rote Fingermale auf der blassen, verwöhnten Haut zeugten von seinem Zorn.
Das weiße Haar schien sich über seiner Stirn zu sträuben, er blickte aus bösen, blutunterlaufenen Augen wie ein Tobsüchtiger – ein abscheulicher Anblick.
Ein unbewußtes Grauen trieb Astrid von ihm fort, aber der eingebläute Gehorsam gegen seinen Willen hielt sie regungslos neben ihm.
»Du gehörst mir. Höre zu, was ich dir sage. Mir gehörst du jetzt und für alle Ewigkeit. Ich will nicht, daß ein anderer auch nur das Geringste von dir nimmt, nicht von deiner Seele, nicht von deinem Leibe. Kein Blick und kein Händedruck soll einem anderen zugute kommen als mir. Ich bin alt, aber meine Lebenskraft geht über das Menschliche hinaus. Ich werde noch lange leben, weil ich es will. Und weil ich nicht will, daß jemals einer dich nimmt.«
»Malthe«, bat sie, »du weißt doch, daß ich nur an dich denke.« –
Da richtete er sich in den Kissen auf, stützte sich auf die bebenden Arme.
»Küsse mich, Astrid. An deinem Kuß will ich erkennen, ob du die Wahrheit sprichst!«
Und Astrid überwand ihr Grauen und legte ihre weichen, zitternden Lippen auf den aufgeschwemmten Greisenmund. Und in der Angst, er könne nicht zufrieden sein, das Mißtrauen könne ihn wieder überwältigen, küßte sie ihn wieder und wieder und heftig, wie in junger Leidenschaft.
Nachher schlug sie in einer Ohnmacht auf den Teppich – der ersten ihres Lebens.
Allmählich ging die körperliche Krankheit Börgesens zurück, dagegen trat eine Trübung seines Verstandes ein, die rasche Fortschritte machte.
Dunkel ahnte er, was ihm bevorstand, aber mit allen Kräften versuchte er sich dagegen zu wehren.
Seine Arbeit wollte er nicht aufgeben, gerade dieses Werk, an dem er jetzt arbeitete, bedeutete für ihn die Krönung seines Lebenswerkes. Mit der Hast eines, der fühlt, daß ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, diktierte er; anhaltender als je war Astrid mit der Feder neben seinen Stuhl gefesselt, und mit Entsetzen bemerkte sie, wie seine Gedanken sich immer mehr verwirrten. Aber gehorsam, wie er es sie gelehrt, schrieb sie nun die krausen Sinnlosigkeiten nieder.
Endlich erklärte er das Werk für fertig und legte es Astrid ans Herz, bei dem Verleger möglichst günstige Bedingungen zu erzielen.
»Für dich, armes Kind! Damit du wenigstens äußerlich glänzend dastehst, wenn ich nicht mehr sein sollte. Freilich, was nützt dir dann das Leben überhaupt? Armes Kind, wie wirst du dann allein sein.«
Kein leiser Gedanke, daß sie sich trösten, daß dann erst das Leben ihr bieten könne, was es ihr bis jetzt schuldig geblieben. Felsenfest war er davon überzeugt, daß sie am liebsten nach der Art indischer Witwen sich mit ihm verbrennen lassen würde.
Nachdem mit der Fertigstelle seines Dramas der stärkste Lebensantrieb ihm genommen war, ging es schnell mit ihm bergab.
Er saß nun untätig in seinem tiefen Lehnstuhl und sah mit trüben Greisenaugen in den Park hinaus, auf das Hünengrab und den Hundefriedhof darunter, wo alle seine verstorbenen Doggen ein ehrenvolles Begräbnis gefunden hatten. In dem silbern schimmernden Kiesgrund bezeichnete ein Mal von rotem, zerkleinertem Porphyr jedes Einzelgrab.
»Hier bei meinen Tieren will ich auch einmal liegen. Sorge dafür, Astrid, daß es geschieht. Nicht auf dem Menschenkirchhof unter der neidischen Bande. Menschen sind alle untreu und gemein, treu sind einzig noch die Hunde.«
Er, der sein Leben lang die Menschen seinem Willen untertan gemacht hatte, war am Ende seines Lebens von einer teuflischen Menschenverachtung erfüllt.
Allmählich aber vergaß er die Menschen und die Welt, und eine andere Welt tat nun schon vor ihm ihre Pforten auf.
Er sah sie zu sich hereinkommen, die Geister lange abgeschiedener Freunde, er hielt mit ihnen seltsame Zwiesprachen:
»Setze dich, Erik, dort steht dein alter Sessel. Es freut mich, wenn du darin sitzst, und keiner von dem gemeinen Menschenpack. Alter Kerl, hast du nicht genug von dieser Welt, wo die Weiber falsch und die Freunde treulos sind, daß du dich nochmals zu uns zurückwagst?«
Auch die Gestalten seiner Dichtungen kamen zu ihm zu Gaste, Erik Hansen, der Rebell, Jürgen, der Schmugglersohn, und Palle, der sonnige Knabe, der so rührend im Kampfe fiel.
Zuletzt kamen auch seine toten Hunde, sie legten die mächtigen Schnauzen auf seine Knie und peitschten mit den starken Ruten den Boden, und er rief sie alle mit Namen und ließ sich von ihnen die Hände lecken.
Und merkwürdig, seine zwei lebendigen Lieblingsdoggen Palle und Marko, nach den Helden seiner Geschichten genannt, Palle hellgelb mit schwarzumrandeten Menschenaugen, Marko blaugrau von besonders gedrungener Gestalt, hielten gute Freundschaft mit den Geistern ihrer Gefährten, begrüßten sie wedelnd, oder fletschten knurrend auch die Zähne, wenn jene sich unziemlich benahmen.
Astrid aber stand außerhalb dieser Schemenwelt. Oftmals kam sie das Grausen an, wenn ihr Gatte von ihr verlangte, daß sie seine Geisterfreunde bewirten solle, ihnen Honig und Wein hinsetzen, die Speise der Zurückgekehrten von alters her, aus der sie die Kraft für ein kurzes Schattendasein nehmen, oder wenn er sich bei jenen entschuldigte, daß er ihnen kein Blut vorsetzen könne, das ihr Dasein am kräftigsten verlängern würde.
Nun er in der Gesellschaft seiner Abgeschiedenen sich so wohl fühlte, hatte Astrid mehr Zeit für sich als früher. Und plötzlich war auch der alte Schaffensdrang wieder in ihr lebendig, den der Alte so grausam gemordet hatte. Ja, es schien, als ob als Ausgleich die fliehende Schöpferkraft Börgesens in seine Frau übergeströmt sei.
Sie schrieb, schrieb, schrieb mit größter Leichtigkeit, unter einem zwingenden Muß – oft kam es ihr, daß sie aufhorchen mußte, wie früher auf das Diktat ihres Gatten. Was sie niederschrieb, erschien ihr wie sein Geschenk, wie eine besondere unverdiente Gnade.
Dann aber warf sie die Blätter zusammen und stürmte hinaus ins Freie, hinauf auf das Hünengrab, und bot aufatmend ihre Brust dem Winde; ihr blondes Haar peitschte ihr die Stirn. Sie fühlte Kräfte in sich erwachen, fordernde Stimmen wurden in ihr laut. Etwas Wundervolles, Ungekanntes regte sich hinter dem Vorhang – nur noch kurze Zeit und sie würde das Recht haben, ihn beiseite zu ziehen.
Dann warf sie in Scham über die fremden Stimmen den Kopf zurück, und zur Buße verdoppelte sie ihre Sorge für den sterbenden Gatten. Aber sie konnte es nicht verhindern, daß nun die Luft des Krankenzimmers, das halbe Licht, das Gemisch von Gerüchen, von Salben und Äther ihr Widerwillen einflößte, daß ihre Nerven sich gegen die hundert kleinen Krankendienste empörten, die sie gerade auf sich genommen hatte.
Was sie aufrecht hielt, war ihr Buch. »Königsgeschlechter« nannte sie es, als es fertig war. Sie nahm lichte Augenblicke des Gatten wahr, um es ihm vorzulesen. Etwas erfaßte er davon, dann verwirrte sich ihm das Denken. Doch mochte er in dem Wenigen, was er davon aufgenommen, ein Teilchen seines eigenen Geistes gewittert haben, und großmütig, als wenn er ihr ein Geschenk mache, sagte er: »Es soll unter meinem Namen erscheinen, Astrid. Bedenke, was das besagen will: unter meinem Namen!«
Als sie sich dankbar über seine knorrige Hand mit den dick aufliegenden Adersträngen beugte, vergaß sie, daß er unter dem Anschein der Güte ihr dieses Mal befahl, wie ihre ganze Ehe hindurch.
Endlich war der alte Löwe gestorben. Nach einem furchtbaren Kampfe, der alle Schrecken des Aufhörens von etwas Erdgeborenem vereinte.
»Vergiß nicht, Astrid! bei den Hunden!« waren seine letzten Worte gewesen.
Astrid schickte den Diener hinaus, um ganz allein bei ihrem Gatten die Totenwacht zu halten. Sie saß am Kopfende des Bettes und sah auf das gelbe Gesicht, das sich langsam nach dem letzten Kampf glättete, das nun seltsam fremd wurde, nur ein Vertrautes behielt, den Zug unsäglicher Menschenverachtung, den es in den letzten Jahren angenommen hatte. Sie hielt Abrechnung mit dem Toten, maß ab, was sie ihm von ihrem Leben gegeben und was sie dafür von ihm empfangen hatte. Ein Zug bitteren Hasses lag auf ihrem Gesicht, als sie sich erhob.
Rot und prächtig wie eine Feuersbrunst ging die Sonne auf.
Astrid sah noch einmal auf den Toten.
»Aber ich lebe!« sagte sie. Es klang wie eine Drohung, klang nach Vergeltung und Rache.
Dann breitete sie abgewandten Hauptes ein Tuch über das Totenantlitz. – –
Drei Tage lang soll eine Leiche über der Erde stehen, so bestimmt es das Gesetz.
Dem toten Dichter war eine längere Zeit vergönnt, in der er noch in seinem Schlafzimmer ruhen, die Kieferndüfte seines Parkes über sich hinstreichen fühlen und das Gezwitscher der Vögel in dem Buschwerk vor seinem Fenster hören konnte. Ihm, dem Diktator seines eigenen Willens, sollte sein letzter Wille nicht beachtet werden. In geweihter Erde, das heißt auf irgendeinem Kirchhof sollte er sein Grab finden, das später ein auf Staatskosten ausgeführtes Prachtmal krönen würde.
Seine Witwe berief sich auf seinen so deutlich ausgesprochenen letzten Willen. Sie wandte sich an die Behörden, machte Eingaben – man beschied sie abschlägig, vertröstete sie dann – die Angelegenheit ging den Instanzenweg – bis schließlich der alte Recke selbst nach seinem Begräbnis verlangte. Seit Wochen schon hatte er sein luftiges Schlafgemach mit einem engen, fest verlöteten vertauschen müssen.
In einer regenschweren Frühlingsnacht, wo die Erde aufgelockert war und aus tausend und aber tausend braunen herzigen Blattknospen der junge Werdeduft quoll, grub Astrid mit dem alten Diener ihrem Eheherrn das Grab. Ihre verwöhnten Hände zitterten nicht, als sie Scholle um Scholle aus der Tiefe emporwarfen. Sie versagten den Dienst nicht, als sie mit ein paar aus dem Schlaf geweckten, und von der Ungeheuerlichkeit des Vorgangs betäubten Nachbarsknechten halfen, den Sarg aus dem Hause zu tragen und in der Gruft zu versenken.
Als die Sonne heraufstieg, wölbte sich schon der Hügel über dem Alten. Zu Häupten hielt der gepanzerte Hüne in seinem ungeöffneten Grabe Wacht, zu Füßen breitete sich ein weißschimmernder Teppich mit roten Denkzeichen aus. So lag der Dichter, der Stolz seines Landes, der Freund von Königen, wie er es gewünscht, »bei den Hunden«!
Mit der vollendeten Tatsache fand sich sogar die Behörde ab; man ließ ihn ruhen und vertuschte die Sache, so gut es ging.
Astrid war nun frei. Sie, die kaum eine Stunde ihres Lebens als ihr Eigen gehabt hatte, stand dieser Wendung mit einem hilflosen Erstaunen gegenüber. Das Leben lag nun in ungeheurer Weite vor ihr, in ungeheurer Leere. Und ebenso jeder neue Tag.
Schon in den letzten Lebensjahren ihres Eheherrn hatte sie frei geschaltet, den Haushalt nach ihrem Ermessen geleitet, die Verlagsangelegenheiten geführt, das große Vermögen Börgesens verwaltet. Der Ertrag seiner Schriften, der ihr jetzt zufiel, gestattete ihr, das Leben in der gewohnten Weise weiter zu führen.
Sie hätte nun schreiben können, ungehindert etwas Großes schaffen. Aber der Quell schien verschüttet. – War es vielleicht nur ein Ausfluß aus der Seele des Alten gewesen, hatte er ihn mit seinem Tode abgegraben in Mißgunst? – –
So machte sich die Witwe daran, den literarischen Nachlaß Börgesens zu ordnen – eine Fronarbeit für den Toten, wie früher für den Lebendigen.
Er brachte ihr eine große Überraschung.
Stets hatte sie geglaubt, mit allem, was ihr Gatte je geschrieben, ganz vertraut zu sein – jetzt zeigte sich, daß in seinem Pult ungehobene Schätze ruhten. Entwürfe für Romane und Dramen. Oft nur flüchtig skizziert das Skelett der Handlung, hier nur eine Szene ausgeführt – oft nur ein knappes Wort hingesetzt zur Charakteristik der Personen. Dann wieder andere Stellen breit angelegt und inmitten der Handlung jäh abbrechend. – Eine flüchtig skizzierte Stellung – Anmerkungen, Durchgestrichenes, – Überarbeitetes –
Und so Stöße von Manuskripten, in denen diese elementare Schaffenskraft sich Luft gemacht hatte. Ausbrüche wie aus einem Krater, glühend, überwältigend – dann wieder lange trostlose Stellen, wie erstarrte Lava.
Aus der Jünglingszeit stammten die ersten Bruchstücke. Sie begleiteten dann sein ganzes Leben, selbst aus seinem hohen Alter waren noch Entwürfe zu wuchtigen Arbeiten da, von denen sie nichts wußte.
Astrid war betäubt, überwältigt von dieser Fülle. Wieder kam die hilflose Bangigkeit über sie: wie das alles anpacken, wie das Gold ausmünzen? Würden ihre Kräfte dieser Aufgabe gewachsen sein?
Der Gedanke an einen Helfer und Berater kam ihr. Zuerst wies ihre selbstherrische Natur ihn zurück, dann ließ das Gefühl der Verantwortlichkeit für ihres Gatten Werk ihn wieder aufnehmen.
Sie überdachte die Menge ihrer literarischen Freunde: mancher war dabei, der ihr hätte helfen können, den ihr Gatte als literarischen Anfänger auf die Beine gestellt hatte und den nun die Dankespflicht hätte gefügig machen müssen. Aber sie kannte diesen ganzen literarischen Klüngel und mißtraute allen. Mißtraute ihrem hilfreichen Wollen und ihrer Ehrlichkeit: diese unausgemünzten Schätze waren wie Goldkörner, die jeder nehmen und brauchen konnte, ohne daß man ihn des Diebstahls hätte bezichtigen können.
Plötzlich fiel ihr ein, was ihr Mann ihr einmal vor Jahren gesagt hatte: »Wenn du späterhin mal jemanden brauchst, um Ordnung zu schaffen, so wende dich nur an einen einzigen: Holger Asmussen.«
Erstaunt hatte sie gefragt: »Warum gerade an den? Der ist doch kein Dichter –.«
»Nein, wenn Verse aufs Papier werfen ein Dichter sein heißt, dann ist Holger Asmussen keiner. Dafür hat er aber das sicherste dichterische Gefühl, die allerfeinste Wägung für den Wert eines dichterischen Werkes. Wenn er meine Sachen vorträgt, so werden sie wie mit einem neuen wertvollen Wesen durchtränkt. Er ist der einzige, der mich ganz lebendig halten wird. Also wende dich an ihn.«
Und Astrid Börgesen, der noch jetzt jedes Gebot des toten Gatten Gesetz war, schrieb an Holger Asmussen, er möge sie aufsuchen, um mit ihr ein Vermächtnis des Toten zu besprechen.
Er war ihr seit langem kein Fremder mehr.
Holger Asmussen gehörte zu jenem halben Hundert hervorragender Persönlichkeiten, die in der gesellschaftlichen Oberschicht der Hauptstadt jeder kannte. Man hätte sich keine Erstaufführung im königlichen Theater denken können, wo nicht in der Mitte der ersten Parkettreihe sein feiner blasser Kopf mit der wundervoll geschnittenen Nase und dem lockigen angegrauten Haar sichtbar gewesen wäre. Sein Profil war von vornehmster Reinheit, alle Bilder zeigten ihn so, und es war seine besondere Kunstfertigkeit, sich immer so zur Schau zu stellen, daß jeder, auf den es ihm ankam, gerade nur dies Profil sah.
Die Kinder auf der Straße kannten ihn, die jungen Mädchen sammelten seine Ansichtspostkarten, die Ehemänner faßten ihre Frauen schärfer ins Auge, wenn er irgendwo in der Gesellschaft erschien. Wilde und unheimliche Gerüchte über seine Liebesgeschichten waren im Umlauf, ohne daß man irgend etwas Gewisses gewußt hätte.
Man behauptete, daß nur Ehefrauen ihn reizten, und daß es ihm eine grausame Lust bereite, sie wieder fortzuschicken, wenn sie ihm zu Willen gewesen seien . . . Dann hieß es, daß nur die älteren Frauen auf einer gewissen Altersgrenze es ihm antäten, dann wieder, daß Frauenliebe für ihn überhaupt nicht in Betracht käme. Wo eine Frau sich mit ihm im Theater oder Vortragssaal zeigte, galt sie für bloßgestellt, aber alle waren mit Freuden bereit, sich bloßzustellen.