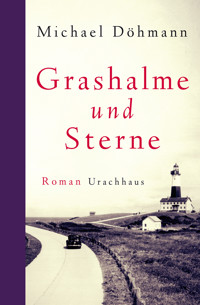
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anfang 1944: Der junge Soldat Jim ist unterwegs nach Europa, wo die Amerikaner Hitlers Armee endgültig in die Knie zwingen wollen. Doch der Abschied fällt ihm schwer – gerade erst ist er Shannon begegnet, der er die schönsten Monate seines Lebens verdankt. Mit seiner poetischen, bilderreichen Sprache zieht Michael Döhmann uns von der ersten Seite an in den Bann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Michael Döhmann
GrashalmeundSterne
Roman
GRASHALME
Ein Kind sagte: Was ist Gras?
und brachte es mir mit vollen Händen;
Wie konnte ich dem Kind Antwort geben?
Ich weiß es ebenso wenig.
Ich meine,
es müsste die Fahne meines Herzens sein,
ganz aus einem hoffnungsgrünen Stoff gewoben.
… und jetzt scheint es mir das schöne
unverschnittene Haar von Gräbern zu sein.
Walt Whitman
Inhalt
PROLOG
Grashalme und Sterne
ÜBER DEN AUTOR
PROLOG
Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange. Immer noch befindet sich fast ganz Europa in den Händen der deutschen Streitkräfte. Als die USA nach dem Angriff auf Pearl Harbor in den Krieg eintreten, scheint sich das Blatt langsam zu wenden. Die deutsche Front beginnt zu bröckeln.
Um den Widerstand von Süden her weiter zu brechen, befreien die Alliierten zunächst die besetzten nordafrikanischen Gebiete. Sie sollen als Basis für einen Angriff auf die sogenannten Achsenmächte dienen. Inzwischen hat die italienische Armee kapituliert, und so geht der Vormarsch auf der Halbinsel schnell voran; es gibt praktisch keine Gegenwehr.
Vielerorts werden die amerikanischen Soldaten als Helden überschwänglich empfangen. Wenig später übernehmen jedoch die Deutschen das Oberkommando. Sie entwaffnen einen Großteil der italienischen Armee, verstärken ihre eigenen Kräfte und errichten eine undurchdringbare Linie quer durch die Abruzzen.
Die Invasion der Alliierten kommt sofort ins Stocken. Es folgt ein blutiger Stellungskrieg, der noch bis zum Frühling 1945 andauert und unzählige Menschen das Leben kostet.
Das Jahr 1944 hatte gerade erst begonnen. Eine Flotte amerikanischer Kriegsschiffe war in Richtung Europa unterwegs. Nach einer langen stürmischen Überfahrt erreichten sie die Meerenge von Gibraltar. Ziel sollte das von den Briten eroberte Tunesien sein, das als Stützpunkt für den Angriff auf Italien galt.
ES WAR NACHT. Ein kalter Wind wehte über das Meer. Jim hielt sich mit beiden Händen an der Reling fest. Das mächtige Schiff sank tief in die Wellentäler ein. Jedes Mal wenn sich der Bug wieder erhob, kamen Jim die Sterne entgegen. Er fühlte sich wie ein kleiner Junge auf einer großen Schiffschaukel – die Leichtigkeit des Schwebens war allerdings völlig verloren gegangen, dieses Schaukeln hier hatte etwas sehr Schweres und Bedrohliches an sich. Er hörte auch keine scheppernde Karussellmusik, keine aufgeregten Kinderstimmen, nur das gewaltige Rauschen des Meeres umgab ihn.
Die Sterne sind immer gleich. Hier, auf dem Meer, leuchteten dieselben Sterne über ihm wie im rabenschwarzen Himmel über Long Island. Das Schiff musste auf einem ähnlichen Breitengrad die halbe Weltkugel umfahren haben, es hatte sich da oben beinahe nichts verändert. Die Sterne waren Jims Begleiter – überallhin.
VOR EIN PAAR WOCHEN saß er noch in seinem Zimmer und stöberte in einer Pappschachtel nach Fotos. Die Kinderzeit und die Tage seiner Jugend rasten an ihm vorüber, zwanzig Jahre in wenigen Minuten.
Er fand das Bild eines schmächtigen Jungen mit wirrem Lockenkopf, der neben einer Sandburg kniete. Der erste Roller, der Stoffwimpel mit seinem Namen, der erste Sturz. Jim hoch oben auf den breiten Schultern seines Vaters, ein riesiges Heftpflaster bedeckte die verletzte Stirn. Das demolierte Auto von Onkel Mitch, der dicke gestreifte Kater von Tante Caroline.
Manchmal drehte er die zerknickten Bilder um, las die ausgeblichenen Jahreszahlen und die handgeschriebenen Notizen.
Der Tag war lang gewesen, Jim wurde müde, er knipste die Schreibtischlampe aus. Er blieb noch eine Weile im Dunkeln sitzen, dann öffnete er das Fenster. Die Luft roch nach Schnee. Er steckte einen Brief ein und lief ins Erdgeschoss hinunter. Er stolperte über ein loses Holzbrett auf der Veranda und humpelte dann weiter über den Rasen. Das Gras schimmerte grau, und bei jedem seiner Schritte brachen die gefrorenen Halme unter seinen Füßen. Jim öffnete das Garagentor, klopfte liebevoll auf die rundliche Motorhaube seines Autos, der weinrote Lack hatte schon etliche rostige Flecken. Jims Hände wurden kalt, er versuchte, sie mit seinem Atem zu wärmen.
Auf der Straße ratterte ein Lieferwagen entlang. Im Haus klingelte das Telefon, aber niemand hob ab. Rauch quoll aus dem Kamin. An der Dachkante flimmerte ein heller Stern.
Er lag eine ganze Weile dort, als würde er sich ausruhen.
Im Garten war es still. Die kräftigen Böen verfingen sich in den Baumkronen und den dicht gewachsenen Hecken, die den Platz umschlossen. Jim nahm Abschied. Draußen schlief die kleine Stadt.
Ein letztes Mal wollte er die Wege gehen, die er so oft gegangen war. Seine Müdigkeit schien verflogen, die Kälte hatte ihn wachgerüttelt.
Er blieb vor den Häusern seiner Freunde stehen, vor den geschlossenen Türen, hörte das Klappern der Briefkästen im Wind, sah die alte Schule, die abgenutzten Stufen. Nach all den Jahren empfand er immer noch eine seltsame Enge. Er kam an der Shell-Tankstelle vorbei. Das orange-gelbe Muschellicht hatte einen Kurzschluss und flackerte.
Er berührte einen Stapel abgefahrener Autoreifen. Er sog die Benzinluft ein. Dampfender Teer, frisch gemähtes Gras, die Brise des Meeres, gemahlener Kaffee und eben Benzin, das waren Jims Lieblingsgerüche.
Vorsichtig stieg er den steilen Weg hinauf zum Aussichtsturm und setzte sich auf eine morsche Bank. Die Rücklichter des Lieferwagens verschwanden zwischen den weichen Hügeln.
Der abnehmende Mond zog über den Ozean. Er sah blass und erschöpft aus, wirkte wie ein weißer Lampion, der schon zur Hälfte zusammengefaltet war. Der Mond wurde von düsteren Wolken verfolgt. Jim nahm Abschied. Er fuhr mit seinen Fingerkuppen über das Holz, über die eingeritzten Namen. Seiner war nicht dabei, auch nicht der Name von Shannon. Jim spürte ein Herz mit Pfeil.
Shannon … Shannon. Ihr Name stand auf dem Brief.
Jim streckte die Arme aus, als wollte er die Luft fest an sich drücken. Die ersten Schneeflocken landeten in seinen Händen und schmolzen zu Wasser.
Er zündete ein Streichholz an. Das schenkte ihm für einen Augenblick Wärme. Doch obwohl er schützend seine Hand darum breitete, war der ungleiche Kampf gegen den kalten Wind nach einer Sekunde verloren. Der Schnee wirbelte in sein Gesicht. Er lief zurück in die schützende Stadt. Die rote Erde auf dem kümmerlichen Sportplatz war gefroren, die Reste eines Netzes hingen an einem Basketballkorb. Jim würde morgen in den Krieg ziehen.
An einer grauen Kirche, die von dicken Ästen umschlungen war, hielt er inne. Zwei Grablichter funkelten in der Mitte des Friedhofs wie zwei vergessene Feuer in einem Wald aus Stein. Die Glocke schlug einmal. Der Schnee fiel herab wie nasses Konfetti, bald würde er die kleinen Lämpchen zudecken, und irgendwann würde das Leuchten aufhören.
Am Schaufenster der Bäckerei sah er jemanden vorbeieilen. Jim dachte, es wäre sein Freund David. Er rief laut seinen Namen, aber niemand antwortete. Es blieben nur frische Fußspuren auf dem Gehweg. In der Nähe des Postladens wurden Jims Schritte langsamer. Er zögerte.
Mit einer zärtlichen Handbewegung strich er über den Briefkasten. Er zog den Brief aus der Tasche, hielt ihn eine Weile zwischen den Fingern. Die Schneeflocken lösten einige der Buchstaben auf. Jim warf den Brief ein, schloss die Augen. Es war vollkommen still, er konnte sogar das leise Knistern des Schnees hören. Ein anderer Geruch kam ihm noch in den Sinn, er hatte nichts mit Benzin, Teer oder Kaffee zu tun – es war eigentlich auch kein Geruch, vielmehr ein Duft. Diesen Duft liebte er am meisten. Es war der Duft von Shannons Parfüm.
Es hatte in Strömen geregnet, als Jim Shannon an der Bushaltestelle stehen sah. Er hielt an und nahm sie im Auto mit – und sofort hatte der intensive Duft das Innere seines Wagens erfüllt.
Shannon mochte nicht nach Hause. Sie fuhren einen großen Umweg und gingen am Meer spazieren. Es war das letzte Mal, dass sie sich sahen.
Als Jim wieder in seiner Straße ankam, brannte kein Licht mehr. Das Haus wirkte dunkel, fast schwarz und hob sich wie ein wuchtiger Kasten gegen die milchigen Wolken ab, die inzwischen den fliehenden Mond gefangen und in eine Schlafdecke gepackt hatten.
Eine zierliche Gestalt lehnte im Türrahmen. Es war seine Mutter. Sie sagte nur »Ach, Jim« – und umarmte ihn mit ihrer ganzen Kraft. Dann begann ihr Körper zu zittern. Jim wusste nicht, ob vor Kälte oder aus Angst.
DER WIND NAHM an Stärke zu. Die Gischt der Wellen spritzte über die Bordwand. Die jagenden Tropfen schmerzten auf seiner Haut. Er suchte Schutz hinter einem riesigen Schornstein.
Dort stand eine Kiste, das Holz fühlte sich glatt und neu an, es roch nach Farbe, es waren keine Namen eingeritzt. Jim zog sich die nasse Kapuze über den Kopf. Er dachte an den Brief, dachte an die fallenden Schneeflocken, sah das S von Shannon, wie es in einer blauen Tintenträne zerfloss. Unter ihre Adresse hatte er den Titel eines bretonischen Liedes geschrieben »An hini a garan«. Der Brief war bestimmt schon lange bei ihr angekommen.
Er sah ihr Gesicht im Schein der Lampe vor sich, hörte das leichte Rascheln ihrer Haare, wenn sie den Kopf bewegte. Er sah die vollen geschwungenen Brauen, sah, wie ihre Augäpfel hin und her wanderten, wie sie die Worte verfolgten, sah ihre schönen, zarten Hände, wie sie das Papier hielten.
Das Schiff glitt leicht schlingernd durch die Wellen. Direkt über einem Rettungsring, der an der Reling befestigt war, lag ein Stern und ruhte sich aus. Das ließ Jim noch einmal an den Garten vor seinem Haus denken. Aber hier auf dem Schiff war es nicht annähernd so still, es fehlten die schützenden Bäume. Der Qualm des Schornsteins senkte sich, kreiselte erneut in die Höhe, schien die Reinheit der Sterne zu beschmutzen.
Jim begann zu frieren, tief in seinem Innern fühlte er einen Eisblock, der nicht schmelzen wollte. Er war vollkommen erschöpft, seine Knochen taten ihm weh. Schwerfällig erhob er sich von der Kiste und machte sich auf den Weg in den Schlafsaal, unten im Bauch des Schiffes.
Die Wellen hatten sich beruhigt, der Wind blies sanfter als zuvor durch den freien Gang. Es roch nach Land. Jim glaubte, weit in der Ferne Lichter zu sehen, es waren keine Sterne, es sei denn, sie hätten sich alle am Horizont brav und ordentlich zu einer langen Kette gereiht.
Im Innern des Schiffes stand die Luft. Er tastete sich eine schmale Wendeltreppe hinunter und öffnete langsam eine schwere Tür. Es war dunkel, die anderen schliefen bereits. Jim stieß gegen den Eisenfuß eines Bettes, hörte ein leises Murren.
Im Waschraum brannte ein trübes Licht, eine leere Flasche rollte auf dem Boden von einer Seite zur anderen. Jim zog sich aus, wusch sein Gesicht und kroch in seine Koje. Die Decke war kalt. Über ihm, eine Matratze höher, lag David. Fragend flüsterte Jim seinen Namen, es kam keine Antwort.
Es blieb still, bis auf ein leises Schnarchen in seiner Nähe und das anhaltende Dröhnen der Schiffsmotoren. Jim versuchte einzuschlafen, aber es gelang ihm nicht. Er wälzte sich hin und her, so wie die Flasche im Waschraum.
Er fischte eine kleine Taschenlampe unter seinem Kissen hervor, zerrte die viel zu kurze Decke über den Kopf und blätterte in einem abgegriffenen Heftchen. Unter den Titel hatte er mit weißer Farbe einige Sterne gemalt und sie durch Linien verbunden, das »Himmels-W« und Pegasus, mit einem Pfeil zum Andromedanebel. Außerdem war der Einband voller Flecken, einer der Flecken sah aus wie Blut.
Grashalme von Walt Whitman. Ein paar Seiten fehlten schon, etliche Passagen hatte Jim mit Bleistift unterstrichen. Beim Blättern fiel ihm sein Lesezeichen heraus, eine weiße Taubenfeder mit einer schönen Musterung. Er las:
… in kabinenreichen Schiffen auf hoher See, wo grenzenloses Blau ringsum sich weitet, beim Pfeifen des Winds und der Musik der Wogen … und den Äther durchschneidet mitten im Funkeln und Schaum des Tages, oder unter den zahllosen Sternen der Nachtzeit … hier überspannt uns das Firmament, hier fühlen wir den Boden unter den Füßen schaukeln.
Hier fühlen wir den großen Pulsschlag endlos ebbender und flutender Erregung … Meerduft und leises Knarren des Tauwerks mit seinem melancholischen Rhythmus, den grenzenlosen Blick finden wir hier und den fernen verhüllten Horizont. Ja, das ist das Gedicht des Ozeans.
Das Lesen unter der Decke erinnerte ihn an früher, er dachte an die Nächte in seinem Zelt, damals, als er noch ein Junge war. Er spürte sogar noch den Wind, der an den Stangen zerrte, hörte die lauten Regentropfen, die unablässig auf den Stoff trommelten.
David schien tief und fest zu schlafen, aber plötzlich drehte er sich zur Seite und stammelte etwas Unverständliches vor sich hin.
Sein Körper lag dicht am Rand des schmalen Bettes. Sein rechter Arm rutschte über die Matratze, und seine offene Hand hing schlaff und wehrlos ins Dunkle. Jim leuchtete mit seiner Taschenlampe nach oben. Die Hand war kräftig, und doch war es ihm unmöglich, sich vorzustellen, dass diese Hand bald töten sollte.
Jim sah die lange Narbe, die sich quer über den ganzen Handballen zog. Wie eine Lebenslinie, nur viel breiter und gezackt wie ein wilder Fluss. Es war wie ein Zeichen. Er wusste nur zu gut, dass er Schuld an dieser Narbe hatte.
AN EINEM TRÜBEN MORGEN hielt ein Wagen vor dem Grundstück der Nachbarn. Leute stiegen aus, lehnten sich an den Gartenzaun und schüttelten den Kopf. Seitdem vor einiger Zeit ein starker Sturm dem alten Holzhaus zugesetzt hatte, war nichts daran repariert worden. Die Hälfte des Daches fehlte und war notdürftig mit einer Plane abgedeckt worden. Sämtliche Fensterscheiben waren zersplittert, die Haustür lag mitten auf der Wiese. Das Haus war für wenig Geld in der Zeitung angepriesen worden und hatte endlich einen Käufer gefunden. Der zehnjährige David gehörte zu dieser kleinen Familie. Es vergingen viele Monate, bis das Haus bezogen werden konnte. Inzwischen hatte sich David längst eingerichtet. Jeden Tag lief er durch den Garten und sammelte die morschen Holzreste ein. Daraus baute er sich zwischen den starken Ästen einer Eiche, die den Sturm überstanden hatte, ein Baumhaus. Seine erste »Amtshandlung« bestand darin, eine schwarze Piratenflagge zu hissen.
Seit dem Tag, an dem Jim die wacklige Strickleiter hinauf zu David klettern durfte, waren sie Freunde. Die Piraten tranken gemeinsam heiße Schokolade aus einer Tasse. Die ganze Welt lag ihnen buchstäblich zu Füßen.
In all den Jahren hatte sich daran nichts geändert. Nur ein einziges Mal war ihre Freundschaft auf eine ernste Probe gestellt worden.
JIM KNIPSTE DIE TASCHENLAMPE aus und verstaute sie zusammen mit dem Walt Whitman-Heft unter seinem Kopfkissen. Er war müde, das monotone Brummen der Motoren ließ ihn endlich Schlaf finden.





























