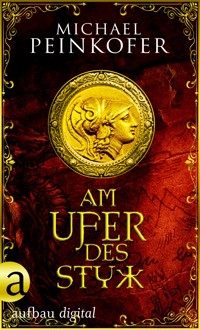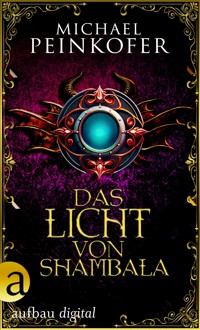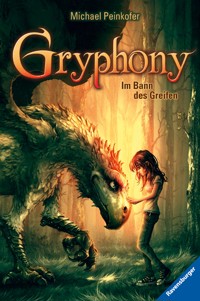
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gryphony
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Band 1 der fesselnden Tierfantasy-Reihe von Bestseller-Autor Michael Peinkofer! Das Mädchen Melody entdeckt in einem unterirdischen Friedhof für Fabelwesen ein Ei, aus dem ein kleiner Greif schlüpft. Dieses Wesen, das halb Löwe, halb Adler ist, kann in Gedanken mit Melody sprechen und warnt sie vor einer unheilvollen Bedrohung. Folge dieser einzigartigen und fesselnden Reihe: Band 1: Im Bann des Greifen Band 2: Der Bund der Drachen Band 3: Die Rückkehr der Greife Band 4: Der Fluch der Drachenritter
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2014Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2014 by Michael Peinkofer und Ravensburger Verlag GmbHDie Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln.Lektorat: Iris PraëlUmschlag- und Innenillustrationen: Helge VogtAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN978-3-473-47542-1www.ravensburger.de
Vor vielen Hundert Jahren,während des dunklen Zeitalters …
Im spärlichen Mondlicht, das durch die Wolken fiel, war der Ring der Steine für das menschliche Auge kaum zu erkennen. Die Blicke des Greifen jedoch durchdrangen die Dunkelheit mühelos. Kaum hatte er das Ziel ausgemacht, legte er die Schwingen an und ging in den Sturzflug über. Erst kurz vor dem Boden breitete er die Flügel wieder aus und bremste seinen Fall.
Der Nachtwind zerrte an ihm und an seinem Reiter, als der Greif leichtfüßig innerhalb des Kreises landete. Der Ritter tätschelte den Hals des Tieres, dann stieg er aus dem Sattel. Seine Rüstung klirrte leise, sein Umhang flatterte.
„Malagant!“, rief der Ritter laut, doch der Wind trug seine Worte davon, ohne dass sie erwidert wurden.
Der Greif schnaubte und warf unruhig den Kopf zurück, während er mit den Krallen scharrte. „Schon gut“, sprach der Ritter beruhigend auf das große Tier ein, das den Körper eines Löwen und den Kopf und die Schwingen eines Raubvogels besaß. „Ist schon gut, altes Mädchen.“
Plötzlich gab es außerhalb des Steinkreises ein Geräusch. Der Ritter und sein Greif blickten auf.
„Wer ist da?“, fragte der Ritter in die Dunkelheit. Wieder keine Antwort. Doch als würden die Schatten der Nacht lebendig, tauchte im nächsten Moment eine Gestalt zwischen den Steinblöcken auf. Der Ritter wunderte sich gar nicht erst darüber. Die Diener des Chaos beherrschten manche dunkle Kunst.
Der fremde Besucher trug eine Kutte aus schwarzem Stoff. Die Kapuze hing weit herab, sodass sie sein Gesicht verbarg, doch der Ritter wusste auch so, mit wem er es zu tun hatte.
„Malagant“, knurrte er. „Du hast also doch den Mut hierherzukommen?“
Der Fremde schlug die Kapuze zurück. Sein eingefallenes Gesicht hatte etwas Totenähnliches. Aus den tief liegenden Augen leuchtete eine unheilvolle Glut.
„Du vergisst, dass dieses Treffen mein Einfall war“, widersprach er und entblößte dabei seine Zähne.
„Was willst du?“
„Mit dir reden“, sagte Malagant. „Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie lange dieser unselige Kampf zwischen uns noch weitergehen soll?“
„Oft“, gab der Ritter zu.
„Einst waren wir viele – nun gibt es nur noch uns beide. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind, die letzten Ritter der Lüfte.“
„Ich bin der letzte Ritter“, widersprach der Greifenreiter. „Du bist auf den falschen Weg geraten. Sieh nur, was aus dir geworden ist!“
Malagant warf seinen Umhang zurück, sodass die schwarze Rüstung darunter zum Vorschein kam. „Es ist wahr: Wir stehen auf verschiedenen Seiten“, gab er zu. „Trotzdem muss der Kampf nicht für immer so weitergehen. Er kann enden, noch in dieser Nacht.“
„Was schlägst du vor?“, fragte der Ritter vorsichtig. „Einen Waffenstillstand?“
„Frieden“, sagte Malagant nur.
„Wie soll das gehen?“ Der Greifenritter schüttelte den Kopf. „Licht und Finsternis schließen sich gegenseitig aus, wie du sehr wohl weißt.“
„Vielleicht“, räumte Malagant ein. „Aber müssen wir uns deshalb bekämpfen? Warum lassen wir die Menschen nicht selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen? Seit so vielen Jahren kämpfen wir gegeneinander, und sieh, wohin es uns gebracht hat! Viele von uns haben den Kampf mit dem Leben bezahlt, tapfere Streiter wie du und ich. Sehnst du dich nicht auch danach, dich auszuruhen? Dein Schwert endlich niederzulegen?“
„Sogar sehr“, musste der Ritter zugeben.
„Genau wie ich. Deshalb biete ich dir einen Friedensschluss an.“
„Warum sollte ich dir glauben, Malagant? Hat nicht deine Seite den Krieg begonnen?“
„Aber jetzt ist es Zeit, ihn zu beenden“, beharrte der Mann in der schwarzen Rüstung. „Ansonsten wird er immer weitergehen und irgendwann die Menschheit vernichten!“
„Das ist wahr“, musste der Ritter zugeben.
„Lassen wir also davon ab! Sollen die Menschen künftig selbst über ihr Schicksal entscheiden, wir haben genug für sie getan. Alles, was du dafür tun musst, ist dein Schwert zurückzulassen, so wie ich das meine.“ Mit diesen Worten zückte Malagant sein Schwert, dessen geschwärzte Klinge in der Dunkelheit kaum zu sehen war, und rammte es in den Boden. Dann trat er in die Mitte des Steinkreises, die Hände erhoben. „Was ist nun?“, fragte er. „Willst du meinem Beispiel folgen?“
Der Ritter zögerte.
Er blickte sich nach dem Greifen um. Das Tier war noch unruhiger geworden, schüttelte heftig den Kopf. Es traute Malagant nicht. Nicht nach allem, was der schwarze Krieger den Greifen angetan hatte. Doch hatte der Ritter eine Wahl? Musste er nicht alles tun, um zukünftiges Blutvergießen zu verhindern? Wer war er, dass er ein Friedensangebot ausschlagen konnte?
Obwohl der Greif lautstark protestierte und ein schrilles Kreischen in die Nacht schickte, zückte der Ritter sein Schwert und stieß es ebenfalls in den Boden. Dann machte auch er sich zur Mitte des Steinkreises auf.
„Geben wir uns das Wort, dass kein Blut mehr fließen soll“, sagte er.
„Ein Wort unter Brüdern“, bestätigte Malagant.
Dann standen sie einander gegenüber.
Der Greifenritter und der Drachenkrieger.
„Geben wir uns die Hand und besiegeln den Frieden“, schlug der Ritter vor und wollte Malagant die Rechte reichen – als er ein hässliches Geräusch vernahm.
Es war ein Fauchen, heiser und gefährlich, und jenseits des Steinkreises wuchs etwas empor, was ungeheuer groß und bedrohlich war: ein schwarzer Schatten mit langem Hals und Augen, die glutrot in der Dunkelheit leuchteten. Dampf waberte auf und der Gestank von Rauch und Schwefel lag plötzlich in der Luft. Da sah der Ritter das Grinsen in Malagants knochigem Gesicht.
„Wie leichtgläubig du doch bist“, sagte Malagant, während das Geschöpf hinter ihm zu riesenhafter Größe emporwuchs. Als es seine Schwingen ausbreitete, war es, als hätte etwas den Mond verschluckt. So dunkel wurde es plötzlich.
„Du … hast mich getäuscht“, stieß der Ritter hervor.
„Nein“, widersprach Malagant. „Der Krieg wird enden, noch in dieser Nacht, und danach wird es Frieden geben. Aber anders, als du es dir vorgestellt hast.“
Der Drache stampfte in den Kreis. Wo sein schuppenbesetzter Körper gegen die aufgerichteten Steine stieß, stürzten sie um oder gingen zu Bruch. Der Greif kreischte ohrenbetäubend. Der Ritter wollte zurückweichen, um sein Schwert zu holen – aber es ging nicht! Er konnte nicht einen Schritt tun.
„Da staunst du, was?“ Malagant warf den Kopf in den Nacken und lachte. „Ich habe Vorkehrungen getroffen!“
„W…was hast du getan?“
Erst jetzt bemerkte der Ritter die Zeichen, die in den Boden geritzt waren – Zauber-Runen, die einen Bannkreis um ihn legten. Sie sorgten dafür, dass er sich nicht wehren konnte.
„Auf diesen Augenblick habe ich lange gewartet“, sagte Malagant und wandte sich dem riesigen Drachen zu, der hinter ihm stand. „Devorax, erkläre unserem Freund, warum sein Kampf zu Ende ist. Sag ihm, warum wir den Krieg gewonnen haben.“
Mit einem grässlichen Pfeifen sog der Drache die kalte Nachtluft in seine Lunge, dann konnte man das Fauchen der Flamme hören, die in seiner Brust loderte. Im nächsten Augenblick spie er Feuer und verwandelte den Steinkreis in ein Flammenmeer.
Sie hieß Melody.
Melody Campbell. Nicht gerade ein gewöhnlicher Name. Aber ihre Eltern hatten Musik und Melodien geliebt, also konnten sie wohl nicht anders. Leider war dieser Name so ziemlich das Einzige, was Melody von ihren Eltern geblieben war. Sie waren beide gestorben, als sie noch ganz klein gewesen war – bei einem tragischen Fährunglück. Seither lebte sie bei ihrer Oma Fay, die sie einfach nur „Granny“ nannte, im alten Stone Inn unten an der Hauptstraße. Das Stone Inn war eine Pension, in der Touristen vom Festland abstiegen, wenn sie zum Wandern oder Bergsteigen auf die Insel kamen. Außergewöhnliche Dinge passierten hier eigentlich nie.
Wenn morgens der Wecker piepste und Melody aus den Federn riss, wusste sie schon ziemlich genau, was der Tag bringen würde: aufstehen, Schule, Hausaufgaben – und dazwischen eine Menge Ärger. Dabei hatte sie eigentlich gar nichts dagegen, auf einer Insel zu leben. Sie liebte es, unten am Meer zu sein, wenn der Wind um die Klippen brauste und die Wellen an den Strand rauschten. Sie wünschte sich eigentlich nur etwas Abwechslung.
Auch an diesem Morgen hatte Melody nicht das Gefühl, dass etwas Besonderes passieren würde. Sie stand auf, ging ins Bad und betrachtete sich im Spiegel.
Glattes rotes Haar.
Grüne Augen.
Blasse Haut.
Sommersprossen um die Nase.
Während andere Mädchen in ihrer Klasse – allen voran natürlich Ashley McLusky – eine Model-Figur hatten, sah Melodys Körper eher so aus, als hätte sie ihn sich von einem Jungen geborgt. Also versuchte sie gar nicht erst, sich zu stylen. In der Schule trug sie schwarze Hosen und Pullover wie alle anderen. Zu Hause hatte sie aber am liebsten Flanellhemden an mit Karomuster und in allen möglichen Farben, dazu Jeans und Stiefel. Ihre Granny sagte immer, dass sie damit ein bisschen aussah wie ihr Vater, als er in ihrem Alter war. Und das fand sie eigentlich ziemlich cool. Auch wenn sie dadurch nicht grade in der Beliebtheitsskala nach oben kletterte.
Was Freunde betraf, so hatte sie eigentlich nur einen einzigen. Er wohnte ein paar Häuser weiter und hieß Roddy McDonald. Seine Eltern hatten eine kleine Zoohandlung in Brodick, wo auch Melody lebte. Brodick war ein kleiner Hafenort, wo jeder jeden kannte. Das war manchmal gut, manchmal schlecht, je nachdem. In Notlagen halfen Nachbarn einander – so wie im vergangenen Jahr, als auf der gesamten Insel der Strom ausfiel.
Gerüchte allerdings verbreiteten sich auf der Insel wie ein Lauffeuer. Ganz besonders, wenn es sich um schlechte Neuigkeiten handelte. Und davon hatte es bei Melody und Granny Fay in letzter Zeit ziemlich viele gegeben.
Das Stone Inn, seit vier Generationen im Besitz von Melodys Familie, war nämlich so gut wie pleite. Granny Fay hatte einen Riesenhaufen Schulden. Nicht bei der Bank, sondern bei einem Mann namens Buford McLusky, einem reichen Baulöwen, dem ohnehin schon die halbe Insel gehörte.
Nun wollte er auch noch das Stone Inn, um es abzureißen und an seine Stelle ein nagelneues Hotel zu setzen. Melody machte das nur wütend, ihrer armen Granny aber brach es fast das Herz.
Trotzdem empfing sie Melody fröhlich, als sie an diesem Morgen in die Küche kam, in der es nach Butter, Zimt und Rosinen roch.
„Guten Morgen, Liebes!“, rief Granny Fay und lächelte so, wie nur sie es konnte. Als Melody klein gewesen war und noch an Elfen geglaubt hatte, war ihre Großmutter ihr immer wie eine weise alte Zauberin vorgekommen mit ihren rosigen Wangen und dem weißen Dutt. „Hast du gut geschlafen?“
„Danke, kann nicht klagen“, erwiderte Melody.
„Alles Gute zum Geburtstag“, sagte Granny und drückte sie ganz fest, und wie immer roch sie dabei nach Pfefferminz und Lavendel. „Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen.“
„Danke, Granny.“
„Ich hab dir deine Lieblingspfannkuchen gemacht.“ Granny deutete auf den Tisch, wo sich schon ein duftender Stapel davon türmte. „Ein anderes Geschenk habe ich dieses Jahr leider nicht für dich. Du weißt ja, das liebe Geld …“ Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht, ihre Augen wurden feucht.
„Keine Sorge, Granny“, sagte Melody. „Es wird schon alles gut werden. Die Bank gibt uns bestimmt das Geld, dann kann uns McLusky nicht rauswerfen.“
„Wenn du es sagst.“ Sie seufzte. „Du bist ein liebes Mädchen, Melody. Und wie groß du geworden bist! Deine Eltern wären so stolz, wenn sie dich jetzt sehen könnten.“
„Ja? Meinst du?“ Ein wenig ratlos blickte Melody an sich herab.
„Bestimmt.“ Das Lächeln kehrte wieder in Grannys Gesicht zurück. „Jetzt setz dich“, sagte sie zu Melody und trug so viele Leckereien auf, dass der alte Küchentisch fast zusammenbrach: Pfannkuchen mit Marmelade, dazu heiße Schokolade – einfach himmlisch.
Deshalb nahm Melody später gleichmütig zur Kenntnis, dass ihr Fahrrad einen Platten hatte, den sie erst mal flicken musste, bevor sie zur Schule fahren konnte. Auch ihr Geburtstag war eben ein Tag wie jeder andere.
Noch wusste sie nicht, wie sehr sie sich täuschen sollte.
Roddy wartete an der Kreuzung.
Mal davon abgesehen, dass er manchmal ein bisschen ängstlich war, war er wirklich okay. Da er und seine Eltern nur ein Stückchen die Straße rauf wohnten, kannten Melody und er sich seit einer Ewigkeit und hatten schon im Sandkasten zusammen gespielt. Aber das war nicht der einzige Grund, warum sie Freunde waren.
Roddy war kleiner als die meisten Jungs seines Alters und ein bisschen pummelig, hatte eine Brille mit dicken Gläsern und Haare, die so aussahen, als würden sie unter Strom stehen. Genau wie Melody war er am liebsten zu Hause und steckte seine Nase in Bücher, die er verschlang wie andere Leute Kartoffelchips. Bei den Jungen in der Schule war er deshalb ungefähr so beliebt wie Melody bei den Mädchen, also hatten sie tatsächlich viel gemeinsam. Sie waren verwandte Seelen, irgendwie.
„Guten Morgen, Melody“, grüßte Roddy schon von Weitem und strahlte über sein ganzes blasses Gesicht. „Alles Gute zum Geburtstag!“
„Daran hast du gedacht?“ Melody hielt ihr Fahrrad an und stieg ab. „Das ist lieb von dir!“
„Klar“, meinte Roddy. „Und ich hab sogar ein Geschenk für dich!“ Mit diesen Worten öffnete er die Satteltasche seines Fahrrads und kramte darin herum, so als müsste er nach etwas suchen. Dann zauberte er mit einer großen Geste ein Geschenk hervor, das in buntes Papier gewickelt war. Es war ein bisschen zerquetscht und die Schleife darauf ziemlich zerknittert, aber Roddys Begeisterung tat das keinen Abbruch.
„Für dich!“, verkündete er aufgeregt.
„Ehrlich?“
Er nickte eifrig.
Melody nahm das Geschenk entgegen und packte es aus. Heraus kam ein wollener Schal, lila mit orangeroten Streifen.
„Deine Lieblingsfarben“, sagte Roddy dazu. „Hab ich selbst gestrickt. Meine Mom hat mir gezeigt, wie’s geht.“ Ein stolzes Lächeln glitt über sein rundliches Gesicht. Dann wurde er plötzlich ernst. „Gefällt er dir?“
„Ob er mir gefällt?“ Melody konnte gar nicht anders, als Roddy zu umarmen. „Das ist das schönste Geschenk, das ich je zum Geburtstag bekommen habe. Vielen Dank!“
„Puh“, machte Roddy und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Da bin ich aber echt froh. Ich dachte schon …“
„Er ist wunderschön“, versicherte Melody und legte sich den Schal gleich um. Dass er nicht recht zur Schuluniform passte, störte sie nicht. Er war flauschig weich und mollig warm.
Dann machten die beiden sich auf den Weg zur Schule, sie waren ohnehin schon ziemlich spät dran.
Die Arran Highschool lag in Lamlash, dem nächsten Ort die Hauptstraße runter. Am Morgen hatte sie etwas von einem Ameisenhaufen mit all den Schülern, die überall herumwimmelten, bis der Unterricht endlich anfing.
Für Melody und Roddy glich der Gang über den Schulhof einem Spießrutenlauf. Schließlich konnte man nie wissen, von wem man angepöbelt wurde. An diesem Morgen schien es zunächst so, dass alles gut gehen würde. Aber obwohl es Melodys Geburtstag war, war es nicht ihr Tag. Denn im Eingang zum Klassenzimmer stand Ashley McLusky.
Ashley war das mit Abstand beliebteste Mädchen der Schule, ein blonder Traum auf zwei Beinen – oder Albtraum, je nachdem, wie man es sah. Alle Jungs fanden sie toll, sogar solche, die sich angeblich gar nicht für Mädchen interessierten. Und die Mädchen bewunderten sie und hätten wer weiß was darum gegeben, so zu sein wie sie. Ashley hatte immer die neuesten Klamotten und das teuerste Handy, außerdem einen kleinen Pudel mit rosa gefärbtem Fell, der auf den Namen Pom Pom hörte. Den schleppte sie überall herum, sie nahm ihn sogar mit in die Schule, obwohl Tiere dort eigentlich verboten waren.
Aber dagegen sagte niemand etwas. Denn Ashleys Vater war Buford McLusky – der Mann, der das Stone Inn abreißen wollte und dem die halbe Stadt gehörte.
„Also wirklich, Leute! Was ist das denn?“, sagte Ashley zu Kimberley und Monique, ihren beiden besten Freundinnen, die sie stets umkreisten wie zwei Satelliten die Erde. „Ist wohl der allerletzte Schrei in der Modewelt?“
Melody brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass Ashley den Schal meinte, den Roddy ihr geschenkt hatte.
„Wirklich, Campbell“, stichelte Ashley weiter. „Dass du dich geschmacklos kleidest, wissen wir ja alle. Aber dass du jetzt Streifen zu deiner Schuluniform trägst, noch dazu in diesen grässlichen Farben, das geht nun wirklich gar nicht! Und wer hat das Ding denn gestrickt? Ein einarmiger Blinder? Da sind ja jede Menge Fehler drin!“
Monique und Kimberley kicherten schadenfroh. Roddy bekam einen roten Kopf. Wut brannte in Melodys Bauch wie ein runtergeschlucktes Bonbon, aber sie beschloss, den Mund zu halten. Mit Ashley McLuskys Bemerkungen war es wie mit einem tropfenden Wasserhahn – am Anfang nervten sie, aber mit der Zeit gewöhnte man sich dran. Außerdem endeten Auseinandersetzungen mit Ashley stets damit, dass Melody zum Rektor musste und Strafarbeiten aufgebrummt bekam. Und sie hatte keine Lust, ihren Geburtstag mit Nachsitzen zu verbringen. Also schob sie sich wortlos an Ashley vorbei ins Klassenzimmer, was dieser ganz und gar nicht passte.
„Hörst du nicht, Campbell?“, rief sie ihr hinterher. „Ich rede mit dir!“
„Schon“, räumte Melody ein. „Aber ich nicht mit dir.“
In der Hoffnung, dass die Sache damit erledigt wäre, zog sich Melody auf ihre Sitzbank ganz hinten im Klassenzimmer zurück. Aber es wurde ein unruhiger Tag.
Die ganze Zeit über tuschelte Ashley mit ihren Freundinnen, und Melody konnte sehen, wie sie kleine Botschaften schrieben und austauschten. Natürlich kochten sie etwas aus, und Melody war klar, dass sie das Ziel dieser Pläne war. Sie beschloss, auf der Hut zu sein, auch wenn das letztlich nicht viel nützen würde.
Die Bombe platzte in der letzten Stunde. Die Mädchen hatten Sport bei Mrs Brown gehabt und waren gerade in der Umkleide, als Ashley und ihre beiden Schatten auftauchten.
„He, Campbell!“
Melody blickte auf.
„Also gut“, sagte Ashley, die vor ihr stand, ihren Pudel auf dem Arm, der mindestens ebenso giftig dreinschaute wie sie selbst. „Da du von Mode keine Ahnung hast, haben wir beschlossen, dir ein bisschen Nachhilfe zu geben.“ Sie nickte Kimberley zu, die sich kurzerhand den Schal schnappte, den Melody von Roddy bekommen hatte.
„He!“, rief Melody. „Was soll das? Gib das sofort wieder her!“
„Was denn?“ Ashley zog eine Schnute, während sie Pom Pom streichelte. „Hängst du etwa an dem Fetzen?“
„Es war ein Geschenk“, erklärte Melody.
„Na klar, wer würde sich so was auch kaufen?“ Ashley zuckte mit den Schultern. „Wer hat dieses hässliche Ding eigentlich verbrochen? Vielleicht deine altersschwache Großmutter? Oder dein schwachsinniger Freund, das Frettchen?“
Die anderen Mädchen lachten. Nicht nur Monique und Kimberley, sondern auch der Rest der Klasse, der sich neugierig um sie versammelt hatte.
„Gib den Schal wieder her!“, verlangte Melody. „Auf der Stelle!“
„Du kriegst ihn ja gleich wieder“, beschwichtigte Ashley. „Aber so, wie das Ding aussieht, kannst du es unmöglich tragen. Lila und Orange gehen gar nicht. Du brauchst dringend Nachhilfe in Sachen „Styling“. Schwarz ist gerade angesagt, wusstest du das nicht?“
Monique trat vor und stellte etwas auf den Boden. Es war ein Topf mit pechschwarzer Farbe, den die Zicken offenbar aus der Werkstatt des Hausmeisters geklaut hatten. Kimberley und Monique nahmen den Deckel ab – und waren im nächsten Moment dabei, den Schal in die Farbe zu tauchen!
„Nein!“, schrie Melody und wollte aufspringen. Aber sie wurde von ein paar anderen Mädchen festgehalten, die vor Ashley glänzen wollten. Allen voran Sondra Lucklin, das mit Abstand größte Mädchen der Klasse. Melody wehrte sich nach Kräften, aber gegen Sondra hatte sie keine Chance. Und so musste Melody hilflos zusehen, wie Roddys Geschenk unter hämischem Gelächter in den Farbtopf gestopft wurde.
Tränen schossen ihr in die Augen. Roddy hatte sich so viel Mühe gegeben, um ihr eine Freude zu machen. Doch jetzt war sein Werk nur noch ein schwarzer Lappen.
„So“, meinte Ashley zufrieden. „Damit siehst du viel besser aus als vorher. Probier ihn doch gleich mal an!“
Mit zwei Fingern hielt Kimberley den Fetzen hoch und kam damit auf Melody zu – und ihr wurde klar, dass sie sofort verschwinden musste.
In ihrer Not stampfte sie mit dem Fuß und Sondra heulte auf wie eine Nebelboje, offenbar hatte Melody ihre Zehen erwischt. Sie spürte, wie sich Sondras Griff lockerte. Im nächsten Moment hatte sie sich auch schon losgerissen und stürzte Hals über Kopf aus der Umkleide.
„Hinterher! Holt sie zurück!“, hörte sie Ashley rufen.
So schnell sie konnte, rannte Melody den Gang hinab, was gar nicht so einfach war, denn sie war von der Sportstunde noch ziemlich außer Puste. Trotzdem schaffte sie es aus dem Schulgebäude, ohne eingeholt zu werden. Aber wohin jetzt?
Zu ihrem Fahrrad konnte sie nicht, da wäre sie ihren Verfolgerinnen geradewegs in die Arme gelaufen. Also am besten in die Stadt und irgendwo ein Versteck suchen.
Sie rannte an der Schule vorbei die Straße entlang. Die anderen Mädchen kreischten wütend hinter ihr – und holten rasch auf. Jäh bog Melody in eine Seitenstraße ab, dann in eine schmale, von alten Steinhäusern gesäumte Gasse und dann gleich noch mal in eine andere – und stand plötzlich vor der Tür mit der Aufschrift:
CLUE‘S CURIOSITIES
Melody konnte nicht sagen, ob es der Zufall gewesen war, der sie hierhergeführt hatte, oder ob sie in ihrer Verzweiflung einfach den vertrauten Weg genommen hatte. Aber eines war klar: Der Antiquitätenladen des alten Mr Clue war ihre Rettung. Deshalb stürmte sie die Treppe hinauf und platzte hinein.
Das Windspiel über der Tür begrüßte sie mit warmem Klang. Dann umfing sie beruhigende Dunkelheit, die durchsetzt war mit dem Geruch von altem Papier und knorrigem Leder. Erst jetzt in der Stille merkte Melody, wie laut ihr Herz pochte.
Durch das schmutzige Glas der Eingangstür konnte sie ihre Verfolgerinnen draußen vorbeihetzen sehen, wild kreischend und den versauten Schal wie eine Trophäe schwenkend. Offenbar hatten sie Melodys Verschwinden noch nicht bemerkt. Das Kreischen verebbte.
Melody atmete auf.
Fürs Erste war sie gerettet.
„Guten Tag“, sagte da eine tiefe Stimme hinter ihr.








![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)