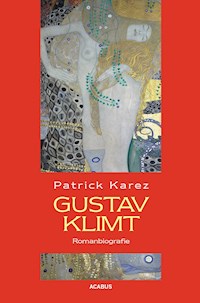
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien. Anno 1862. Ein Ausnahmekünstler wird geboren. Gustav Klimt. Gebiert wiederum. Die Moderne. New York. Anno 2012. Eine frisch geschiedene Endvierzigerin. Gebiert nichts. Und niemanden. Und scheitert. An der Härte des modernen Lebens. 150 Jahre. Nach seiner Geburt. Und rund 100 Jahre nach seinem Tode. Taucht Gustav Klimt plötzlich in einem schäbigen New Yorker Diner auf. Und trifft dort auf eine frustrierte und frisch geschiedene Endvierzigerin… Dieser biographische Roman führt nicht nur das Leben und Werk des Wiener Ausnahmekünstlers Gustav Klimt (1862-1918) vor Augen, sondern zeichnet auch ein Sittenbild einer legendären Ära, der Belle Époque, die im Bombenhagel des Ersten Weltkriegs unterging. Seinerzeit ein umstrittener und vehement angefeindeter Skandalkünstler, weil Erotikmaler, zählt Klimt heute zu den bekanntesten und beliebtesten Künstlern überhaupt. Nach einer äußerst entbehrungsreichen Kindheit, startet Klimt in den frühen 1880er Jahren eine kometenhafte Karriere als Dekorationsmaler für die Prachtbauten auf der neuen Wiener Ringstraße, bevor er im Jahre 1897 seine eigene moderne Künstlervereinigung sowie seinen eigenen, unverkennbaren Kunststil, die Secession, begründet. Als erster (und einziger) Künstler seit dem Mittelalter, führt er das Gold wieder programmatisch in die Kunst ein, schafft die Perspektive und die Schattenwürfe ab, womit er zu einem der Gründungsväter der Moderne wird. Sein ambivalentes Verhältnis zu Frauen hat, neben den Theorien Sigmund Freuds, einen ebenso großen Einfluß auf sein Werk wie auch seine Auslandskontakte und Reisen - so etwa nach München, Berlin, Venedig, Ravenna, Paris, Madrid, Toledo oder London. Dennoch haftet ihm, als eine Art "malender Freud", zeitlebens der Ruf eines "Perversen" an, weil er seine "Kirchenkunst" mit hocherotischen Motiven verbindet. Klimt, der am stärksten angefeindete und mißverstandene Künstler im Wien der Jahrhundertwende, umgibt sich in jenen Jahren mit den bedeutendsten Künstlern und Intellektuellen seiner Zeit. Bemerkenswerte zeitgenössische Persönlichkeiten wie Alma und Gustav Mahler, Auguste Rodin, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Ludwig Hevesi, Hans Makart, Emil Jacob Schindler, Franz Matsch, Carl Moll, Koloman Moser, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Emilie Flöge, Tina Blau, Bertha Zuckerkandl, Kaiserin Elisabeth, Kaiser Franz Joseph, etc., kreuzen dabei seinen Lebensweg und geben sich in diesem historischen Roman ein Stelldichein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1493
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Karez
Gustav Klimt
Karez, Patrick: Gustav Klimt, Hamburg, ACABUS Verlag 2014
Originalausgabe
PDF-eBook : ISBN 978-3-86282-296-6
ePub-eBook : ISBN 978-3-86282-297-3
Print-ISBN : 978-3-86282-295-9
Lektorat : Roxanne König, Jonas Lunte, ACABUS Verlag
Satz: Elisabeth Hofmann, ACABUS Verlag
Cover : © Marta Czerwinski, ACABUS Verlag
Covermotiv : „Wasserschlangen I“, Gustav Klimt; Belvedere, Wien; Detail
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek :
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http ://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© ACABUS Verlag, Hamburg 2014
Alle Rechte vorbehalten.
http ://www.acabus-verlag.de
Anmerkungen des Autors
Einen großen Dank an das Lektorat (Daniela Sechtig, Roxanne König und Jonas Lunte), welches mir, auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin, alle semantischen, syntaktischen und orthographischen Schrullen sowie den einen oder anderen unkonventionellen Einfall durchgehen ließ. Ganz im Sinne Ludwig Hevesis und der Wiener Secession:
„(Der Zeit ihre Kunst.) Der Kunst ihre Freiheit.“
(Der Autor, 2014)
Der Leser ist herzlich dazu eingeladen, ein illustriertes Zweitmedium, wie zum Beispiel einen einschlägigen Bildband oder das Internet hinzuzuziehen, um dort die besprochenen Gemälde Klimts zu recherchieren – aber ferner auch die vorkommenden Bauwerke und Personen.
(Der Autor, 2011/2012)
„Kommentar zu einem nicht existierenden Selbstportrait:
Malen und zeichnen kann ich. Das glaube ich selbst und auch einige Leute sagen, daß sie das glauben. Aber ich bin nicht sicher, ob es wahr ist. Sicher ist bloß zweierlei:
1. Von mir gibt es kein Selbstportrait. Ich interessiere mich nicht für die eigene Person als ‚Gegenstand eines Bildes’, eher für andere Menschen, vor allem weibliche, noch mehr jedoch für andere Erscheinungen. Ich bin überzeugt davon, daß ich als Person nicht extra interessant bin. An mir ist weiter nichts besonderes zu sehen. Ich bin ein Maler, der Tag um Tag vom Morgen bis in den Abend malt. Figurenbilder und Landschaften, seltener Portraits.
2. Das gesprochene wie das geschriebene Wort ist mir nicht geläufig, schon gar nicht dann, wenn ich über mich oder meine Arbeit etwas äußern soll. Schon wenn ich einen einfachen Brief schreiben soll, wird mir Angst und bang wie vor drohender Seekrankheit. Auf ein artistisches oder literarisches Selbstportrait von mir wird man aus diesem Grund verzichten müssen. Was nicht weiter zu bedauern ist. Wer über mich – als Künstler, der allein beachtenswert ist – etwas wissen will, der soll meine Bilder aufmerksam betrachten und daraus zu erkennen suchen, was ich bin und was ich will.“1
(Gustav Klimt, undatiertes, mit Schreibmaschine geschriebenes Blatt)
1874
1
Er schloß die Augen. Prompt erschienen sie. In einem wahren Strudel. Aus Menschenleibern. Rote. Blonde. Brünette. Schwarzhaarige. Aber vor allem Rote. Ja. Das war es. Rote. Er führte seine Hand hinab. Viel war noch nicht da. In diesen frühen Tagen. Es würde aber noch kommen. Dessen war er sich sicher. Behutsam strich er über den Flaum. Dieser war erst vor kurzem erschienen. Wie durch Geisterhand. Etwa zeitgleich. Mit dem ersten Flaum. An seinem Kinn. Wie seltsam, daß das Gesicht, das Alleröffentlichste, sich ausgerechnet parallel zum Genital entwickelt, dachte er, dem Allerintimsten. Dem Verstecktesten. Dem Verbotensten. Dem Unaussprechlichen. Künftig würde er sie in einem völlig neuen Licht betrachten. Die Bärte. Und Bartansätze.
Bei den Frauen. Verhielt es sich diesbezüglich völlig anders. Da waren es die Brüste, die Aufschluß über die sexuelle Reife gaben. Aber viel war von ihnen nicht zu erhaschen. In diesen Tagen. Als die Frauen sich noch verhüllten. Verschleierten. Regelrecht verpackten. So daß man nichts von ihnen zu Gesicht bekam. Außer ihrem Gesicht eben. Nicht einmal die Handgelenke. Geschweige denn das Décolleté. Oder gar die Fesseln. Frauen. Diese seltsamen Wesen. Zauberhaft. Und geheimnisvoll. Überall waren sie anzutreffen. In diesen Tagen. Und dann doch auch wieder nicht. Sie führten ein Schattendasein. In dieser Gesellschaft. Die ganz und gar den Männern vorbehalten war. In diesen Tagen. Waren es die Frauen auch. Rote. Blonde. Brünette. Schwarzhaarige. Aber vor allem Rote. Ja. Das war es. Rote.
Seine Finger wanderten nun tiefer hinab. Sie waren sehr geschickt. Diese Finger. Die ganz und gar jenen der Primaten glichen. Dieser verrückte Darwin hatte es unlängst behauptet. Mensch und Affe seien praktisch dasselbe. Ausgelacht hatte man ihn. Und ausgebuht. Schockiert war man gewesen. All diese noblen Herren. In ihren Fräcken. Und Zylindern. Mit ihren goldenen Taschenuhren. Und den weißen Seidenhandschuhen. Und die Damen erst! Mit ihren wagenradgroßen Hüten. Ihren Sonnenschirmchen. Ihren Krinolinen. Und Tournuren. Affen! Welch Hohn! Und doch. Der Flaum. Verriet es.
Unlängst hatte er es mit eigenen Augen gesehen. Auf einer Photographie. Auf einer verbotenen Photographie. Der darauf abgelichtete Mann hatte Haare gehabt. Wie ein Hund. Auf dem Handrücken. Auf den Armen. Auf den Beinen. Auf der Brust. Und sogar auf dem Rücken. Seine Freunde hatten lauthals darüber gelacht. Ihn hatte es jedoch irgendwie erregt. Und abgestoßen. Zugleich. Hatte dieser Mann auf der Photographie einem Affen gar nicht mal so unähnlich geschaut.
Und nun wurde er allmählich selbst zu einem. Rund um seine Warzenhöfe. War ebenfalls Flaum erschienen. Und er würde stärker werden. Dessen war er sich sicher. Nein. Er wünschte es sich sogar. Er selbst wollte ebenfalls zu einem Affen werden. Zu einem Mischwesen. Einer Chímaira. Aus Mensch. Und Affe. Einem Affenmenschen. Einem Menschenaffen. Einem Tiermenschen. Einem Menschentier. Einem modernen Faun. Einem darwinistischen Satyr.
Er würde dieses ganze verlogene Spiel nicht mitmachen. Er verachtete bereits jetzt schon die lächerliche Maskerade seiner Gesellschaft. Niemals würde er selbst einen Zylinder tragen. Dachte er. Und einen Frack schon gar nicht. Er würde nackt sein. So oft es eben nur möglich war. Er würde nackt arbeiten. Oder nur mit einem leichten Baumwollhemd bekleidet. Oder besser noch: Mit einer Kutte. Wie die Urmenschen. Wie die Eingeborenen. In fernen Ländern. Ja. Die waren der Natur noch viel näher als wir. Hier. In Europa. Dachte er. In dieser verlogenen Gesellschaft. Wo man sich für seinen Körper schämte. Wo man sich für sein Menschsein schämte. Beziehungsweise. Für seinen animalischen Ursprung. Und dabei war es doch nur die natürlichste Sache der Welt. Da war er mit Darwin einer Meinung.
Er würde Tabus brechen. Wie Darwin. Nur eben auf einem anderen Gebiet. Denn das Reisen war nicht so seine Sache. Er war ein heimatverbundener Mensch. Ein erdverbundener Mensch. Ein Mensch. Wie ein Stier. Mußte er stets mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen. Die Erde spüren können. Sie riechen und berühren können. Und die Bäume. Und das Wasser. Und die Berge. Ja. Hier. Im wunderschönen Österreich. Im schönweibigen Wien. Da war er zu Hause. Hier hatte er alles. Was sein Herz begehrte. Warum also abschweifen? Wozu in ferne Länder? Was würde er in Afrika oder in Amerika schon finden können, was er nicht auch hier finden konnte? Schließlich liegt doch die Lösung zu allem in einem selbst. Dessen war er sich sicher. Man müßte es bloß befreien. Es aus sich selbst herausholen. Es herauskitzeln. Es ans Licht befördern. Aus dem Dunkel. Aus jenem Dunkel, das die Gesellschaft und die Kirche über die Dinge legten. Über die natürlichsten Dinge der Welt. Wie zum Beispiel die Nacktheit. Und die Sexualität. Das Menschsein. Das Einssein. Mit der Natur. Ob sie nun Gottes Natur war. Oder Darwins.
Er dachte an die Rothaarige. Und seine Finger schlossen sich zur Faust. Wohlige Schauer liefen seinen Rücken hinunter. Und wieder hinauf. Ein wahrlich elektrisches Gefühl. Von dem jeder sprach. In diesen Tagen. Überhaupt sprach man von nichts anderem mehr. In diesen Tagen. Beziehungsweise. In einigen Jahren.
Darwin. Edison. Marx. Und Freud.
Evolutionstheorie. Elektrizität. Sozialismus. Und Psychoanalyse.
(Und somit auch von der Sexualität.) Die vier neuen Grundpfeiler. Einer völlig neuen Gesellschaft. Dessen war er sich sicher. Einerseits. Entfernten sie den modernen Menschen rasant vom Affesein. Andererseits. Brachten sie ihn diesem auch wieder näher. So nah. Wie schon seit dem Neolithikum nicht mehr. (Die Elektrizität einmal ausgenommen.) So dachte er zumindest. Und er würde es noch. In einigen Jahren.
Das, was er nun an sich tat, war laut der alten Gesellschaft eine Sünde. Es war verboten. Und böse. Es war verboten. Weil es böse war. Und dabei war es doch die natürlichste Sache der Welt. Die älteste Sache der Welt. Wie er meinte. Er würde sein ganzes Leben danach ausrichten. Er würde Konventionen brechen. Sie sprengen. Und er würde daran zugrunde gehen. Auch dessen war er sich sicher. Allmählich. War sein ganzer Körper von diesem elektrischen Gefühl erfüllt. Er spürte regelrecht das Göttliche daran. Und das Animalische. Blind werden würde man davon. Angeblich. Und an Rückenmarkschwund erkranken. Man würde zappelig werden. Ungeduldig. Und schließlich debil. Nun, so dachte er, lieber debil, als sich diesen Spaß entgehen zu lassen! Diesen teuflischen Spaß. Der doch so göttlich war. Denn das war der Mensch in seinen Augen. Die perfekte Mischung. Aus Gott. Und Tier.
Nur war es eben das Problem des Menschen seiner Zeit, so dachte er weiter, daß er das Tier in sich zur Gänze verleugnete. Und in allen Dingen Gott nachstrebte. Denn das entsprach dem Menschen nun mal nicht. Beziehungsweise. Nur zum Teil. Nur die perfekte Mischung aus beidem, würde zur Glückseligkeit führen. Wobei noch eher das gänzliche Tiersein zum Heil führen würde. Debil. Und triebhaft. Wie die Schimpansen. Im Tiergarten. Ja. So wollte er leben. Und er wollte es allen vormachen. Man würde ihn hassen. Aber man würde ihn auch beneiden. Denn er allein fand den Mut, so zu leben, wie er selbst es für richtig hielt. Und Gottes Strafe, die interessierte ihn nicht. Denn er glaubte nicht daran.
Allmählich spürte er den Höhepunkt seiner elektrischen Anspannung kommen. Die Entladung. Nach der statischen Aufladung. Er war kurz davor.
„Gustav!“, hörte er plötzlich seine Mutter rufen.
Sofort lagen seine Hände wieder über der Bettdecke.
„Wo bleibst du denn nur?“ Allmählich näherten sich ihre Schritte dem Zimmer. „Du wirst noch zu späth zur Schule kommen!“
Mit einem Mal waren sie fort. Die Frauen. Diese herrlichen Geschöpfe. Aus seiner Phantasie. Rote. Blonde. Brünette. Schwarzhaarige. Aber vor allem Rote. Nun trat eine aus Fleisch und Blut ein. Sie war auch nicht schlecht. Aber sie war seine Mutter.
„Raus aus den Federn!“, rief sie.
Und noch bevor er irgend etwas tun konnte, riß sie bereits die Tuchent fort. Sofort inspizierte sie ihn mit kritischem Blick. Dann verließ sie wortlos das Zimmer.
Da lag er nun. Bloßgestellt. Abgedeckt. Wie ein Sonntagsbraten. Auf dem Präsentierteller. Dieser Satansbraten. Vermutlich hatte sie es gesehen. Den Fahnenmast. Das Circuszelt en miniature. Das bereits wieder im Begriff war, einfach so in sich zusammenzufallen. Außer Spesen nichts gewesen. Dachte er bitter. Es war ihm nicht einmal peinlich. Intimität gab es ohnehin nicht. In diesem Zimmer. Schliefen neben ihm die Geschwister. Zumindest aber taten sie so. Sie schliefen mehr oder weniger. In Schichten. In Lagen. Aus Stoff. Und Leibern. Wie ein Schichtkuchen. Der nun allmählich zu Leben erwachte. Darüber spannte sich die Wäsche. Sie stapelte sich. Zu allen Seiten des Zimmers. Die Wände entlang. Sieben Kinder. Und zwei Erwachsene. Benötigten schließlich einiges an Wäsche.
Nun begann die Kleine zu schreien. Auch das noch, dachte Gustav. Und erhob sich. Seine Schwester Klara sah ihn an. Sie hatte ganz bestimmt nicht geschlafen. Ihr Blick verriet es. Aber es war ihm egal. Er hatte schließlich auch Bedürfnisse. Wir sind schließlich alle keine Engel, dachte er. Beim Aufstehen stolperte er prompt über den Nachttopf. Gott sei Dank war er leer gewesen. Was für Zustände! Er konnte sich kaum noch an andere erinnern. An die „besseren Zeiten“, welche die Eltern immer wieder mit Wehmut heraufbeschworen. Und unter Tränen. Denn vor allem die Mutter litt scheinbar sehr darunter. Der Vater vermutlich auch. Doch er zeigte es nicht. Schließlich war er ja schuld. Schließlich hatte er ja versagt. Die Wirtschaftskrise sei schuld. Sagte er wiederum. Der Börsenkrach. Die Finanzkrise. Die große Weltausstellung. Die Mißernte. Und so weiter. Und so fort.
Aber nein. Der Vater war schuld. Dessen war Gustav sich sicher. Denn schließlich war er nicht in der Lage, sieben hungrige Mäuler zu stopfen. Neun. Um genau zu sein. Seines und das der Mutter miteingerechnet. Auch sie mußten schließlich Hunger haben. Doch sie zeigten es nicht. Gab es einmal etwas auf dem Tisch, so verzichteten die Eltern darauf. Sie überließen es den Kindern. Gustav hatte also bereits in jungen Jahren lernen müssen, was ein schlechtes Gewissen bedeutet. Das Stück Brot schmeckte unter diesen Umständen weit weniger gut. Manchmal hatte er darauf verzichtet. Und es den jüngeren Geschwistern überlassen. Um dann mit knurrendem Magen zur Schule zu gehen. So auch heute. Dabei mußte er gar nichts überlassen, weil es heute erst gar nichts gab. Nichts. Nicht einmal ein Stück trockenes Brot.
Er stellte es sich einfach in seiner Phantasie vor. Ein Stück frisches, knuspriges Brot. Noch warm. Direkt aus dem Ofen. Vor seinem geistigen Auge wurde es sichtbar. Es war plötzlich da. Und doch stillte es seinen Hunger nicht. Eines Tages, so dachte er, werde ich Brot im Überfluß haben. Ich werde so viel Brot haben, daß ich sogar die Enten damit füttern kann. Und meine Geschwister natürlich gleich mit. Und die Eltern. Der Vater würde dann sehen, daß es auch anders geht. Daß es nicht damit getan ist, lediglich zu jammern. Und anderen die Schuld zu geben. Sondern zu handeln. Ja. Er würde etwas tun. Er würde kein bloßes Opfer sein. Er würde ein schönes Haus haben. Eine Villa vielleicht. Und es würde ihm gut gehen. Frauen würde er haben. So viele er nur wollte. Rote. Blonde. Brünette. Schwarzhaarige. Aber vor allem Rote. Ja. So würde es sein.
„Gustav!“, die energischen Schritte der Mutter näherten sich erneut bedrohlich dem Zimmer, „Ich sage es dir nicht zweimal! Geh lernen! Wissen ist das einzige, das dir in dieser Welt weiterhelfen wird! Wer nicht lernt, der bleibt dumm. Und wer dumm ist, der findet keine Arbeit. Und wer keine Arbeit hat, der hat kein Leben. Also: Wer nicht lernt, der hat keine Zukunft! So einfach ist das. Ich weiß, wovon ich da rede!“
Ja. Ja. Ja.
Bla. Bla. Bla.
Dachte er trotzig. Und verließ das Zimmer.
2
Der Weg zur Wiener Volks- und Bürgerschule, die er nunmehr seit sechs Jahren besuchte, gefiel ihm sehr. Immerzu gab es etwas Neues zu sehen und zu entdecken. Und immerhin war es besser als daheim. Falls man überhaupt von einem Daheim sprechen konnte. Denn an seinem ursprünglichen Zuhause, in der Linzer Straße № 247, wohnten sie längst nicht mehr. Als er fünf Jahre alt wurde, mußte die Familie von dort ausziehen. Immerhin nach Wien hinein. Nämlich in die Lerchenfelderstraße. Dort blieben sie aber nur kurz. Und nur wenig später. Ging es in die Neubaugasse №5.
An Baumgarten, in der Wiener Vorstadt, wo er geboren ist, konnte er sich kaum mehr erinnern. Es war weit draußen gewesen. Vor den Toren der Stadt. Praktisch auf dem Lande. Grün war es gewesen. Mit hohen Bäumen. Und Gärten. Das wußte er noch. Hier in der Stadt, war längst alles verbaut. Nicht umsonst hieß er Wien-Neubau. Der VII. Wiener Gemeinde-Bezirk. Man hatte sich der Sache also angenähert. Der Stadt Wien. Dem Centrum. Immerhin. Lebte man nicht mehr in Baumgarten. Bei Wien. Sondern in Neubau. In Wien. Wo die Häuser, die man in jenen Tagen errichtete, gut fünfmal so hoch waren wie jene in Baumgarten. (Dort waren sie nämlich nur ebenerdig.) Es hatte ihn also hinaufbefördert. Von der Vorstadt. In die Stadt. Die zwar nicht die Innere Stadt war. (Also Wien I.) Aber immerhin die Stadt. (Nämlich Wien VII.) Theoretisch eine Verbesserung. Theoretisch.
Von der Neubaugasse №5 war es nicht weit bis zur Stadtmitte. Nach Wien I. Das richtige Wien. Ein Katzensprung bloß. Nur einige Häuserblocks weit entfernt. Natürlich erlaubte die ängstliche Mutter es den Kindern nicht, allein „in die Stadt“ zu gehen. Und sie taten es dennoch. Immer. Und immer wieder. Zumindest versuchten sie es. Weit kamen sie meistens nicht. Zunächst tasteten sie sich an das Glacis heran, wo in diesen Tagen die große Ringstraße angelegt wurde. Ein heilloses Chaos. Ganz Wien stand im Umbruch. Denn es waren ja die Gründerzeitjahre. Die riesigen Baustellen, die nicht allzu weit von ihrem Haus entfernt lagen, interessierten die Kinder natürlich brennend. Vor allem Gustav. Und seinen jüngeren Bruder. Ernst. Die waren wie magisch angezogen davon. Und sie waren ausgezogen. Um die Mutter das Fürchten zu lehren. Schritt. Für Schritt. Machten sie sich auf. Und davon. Und aus dem Staub. Beziehungsweise mitten hinein. Nämlich in die Groß-Baustelle.
Die alten Stadtmauern der Reichshauptstadt waren bereits im Jahre 1857 niedergelegt worden. Das war nur fünf Jahre vor Gustav Klimts Geburt. So ein garstiges und trotziges Mauerwerk. Aus alten Zeiten. War in diesen Tagen nicht mehr modern. So ein Bollwerk. Gegen den Feind. Das übrigens gleich zwei Türkenstürmen standgehalten hatte. Also wurde es nun im Eiltempo geschleift, wie andernorts in Europa auch, um an seiner statt eine Prachtstraße anzulegen. Einen Pracht-Boulevard. Einen Grand-Boulevard. Ganz nach Pariser Vorbild. Und da die alte Stadtmauer nun einmal einen kreisrunden Ring um das historische Zentrum gebildet hatte, wurde auch der Pracht-Boulevard ringförmig. Weshalb man ihn also Ringstraße nannte. Der Einfachheit halber. Wurde bereits ein Jahr später mit ihrem Bau begonnen. Seither teilte sich die Reichshauptstadt Wien in neun Bezirke auf. Die Vororte, wo auch Gustav Klimt geboren war, blieben freilich von der Stadt isoliert. Dazwischen. Also zwischen Stadt. Und Vorstadt. Verlief der sogenannte Linienwall. Kreisförmig, beziehungsweise halbkreisförmig, um die inneren neun Bezirke gelegt. Denn von Osten her bildete die Donau, beziehungsweise der Donau-Canal, eine natürliche Grenze. Und somit Schutz. Im Angriffsfall.
Nicht die Ringstraße. Sondern dieser Linienwall. War die eigentliche Grenze. Zwischen Stadt. Und Land. Zwischen Bürger. Und Ländler. (Beziehungsweise Vorstädter. Was ja noch schlimmer war.) Zwischen Arm. Und Reich. Zwischen Gut. Und Böse. Schon der Unterschied von der Ersten Stadt, also der historischen Innenstadt, zu den anderen Bezirken, die rundherum angelegt worden waren, war beachtlich. Aber der Linienwall, stellte eine weitaus größere und bedeutsamere Grenze dar. Alles was außerhalb des Linienwalls lag, gehörte nicht mehr zu Wien. Und konnte somit im Notfall nicht verteidigt werden. Also war der Linienwall auch eine Grenze zwischen Krieg. Und Frieden. Zudem war ab dem Jahre 1829 eine sogenannte „Verzehr-Steuer“ erhoben worden. Und zwar auf alle Lebensmittel, die just über diesen Linienwall in die Stadt gebracht wurden. Ein Grenzposten also. Wie zu einem ganz anderen Reich. Und dementsprechend war auch der Unterschied. Zwischen Innen. Und Außen. Erst im Jahre 1899 wurde diese Steuer wieder aufgehoben – und drei Jahre später, Anno 1902, erfolgte schließlich und endlich die offizielle Eingemeindung der Vororte. Nun gehörte man also hochoffiziell zu Wien dazu. Endlich. War man nicht mehr „die da drüben“. Außerhalb der Reichshauptstadt. Sondern „waschechte Wiener“. Und es gab da noch einen weiteren Nebeneffekt. Durchaus beabsichtigt. Wenn nicht gar erst der Antrieb für dieses ganze Unterfangen: Durch die Eingemeindung der Vororte nämlich, wurde Wien über Nacht zur Millionen-Metropole. (Was zu dieser Zeit natürlich als „très chic“ galt. Beziehungsweise als „très moderne“.)
Sie hatten es also geschafft. Die Klimts. Von Draußen. Nach Drinnen. Aus dem Vorort. Jenseits des Linienwalls. In die Stadt. Innerhalb des Linienwalls. In die Reichshauptstadt sogar. Also von Pfui. Nach Hui. Nun gab es da nur noch eine einzige Hürde zu überwinden. Eine allerletzte Grenze. Die allerdings nicht unerheblich war. Und nur sehr schwer zu überwinden. Nämlich die Ringstraße. Wer es bis hier hinein schaffte, der zählte in Wien zu den ganz großen Gewinnern. Der konnte sich nämlich wirklich als „waschechter Wiener“ bezeichnen. Alles andere waren bloß „Zugereiste“. Und dementsprechend wurden sie auch behandelt. Nämlich abschätzig. Zumindest aber, wurden sie sehr kritisch beäugt.
Diese Ringstraße also, beziehungsweise die Groß-Baustelle dazu, übte eine geradezu magische Anziehungskraft auf die beiden jungen Burschen aus. Haus. Um Haus. Erkämpften sich Gustav und Ernst Klimt ihre neue Freiheit. (In einem wahren Häuserkampf.) Wie frisch geschlüpfte Küken. Die sich anfangs nicht allzu weit von ihrem Nest fortwagen. Und die stets vom Muttertier bewacht werden. Der Nestglucke. Mit ihren Argusaugen. (Denn Hühneraugen sind etwas anderes.) Denen nichts entgeht. Dann aber, nach einiger Zeit, wird der Radius der entdeckungsfreudigen und erfindungsreichen Jungküken immer größer. Das ist wichtig. Dachte der junge Gustav. Sonst bleibt man dumm. Und wird somit zur leichten Beute. Seiner Freßfeinde. Die stets und überall lauern. So sagte es zumindest das ängstliche und stets besorgte Muttertier. Die Glucke. Der nichts entging. Nicht die leiseste Regung. Kein Wunder. Bei sieben Kindern. Weshalb er in diesen frühen Jahren die Innere Stadt nur wenig kannte. Dafür aber seinen Bezirk. Und zwar in- und auswendig. Der war ja schließlich sein Zuhause. Deshalb würde er freiwillig nicht mehr von hier wegwollen. Er würde hier sterben. So dachte er. Aber zumindest würde er hier bis zu seinem Tode leben wollen. Und das tat er auch.
Derzeit war es also ihr Zuhause. Beziehungsweise lebten sie hier. Unter schwierigsten Bedingungen. Alle zusammen. Alle Neune. In einem winzigen Zimmer. Im hinteren Teil des Gebäudes. Wo es dunkel und feucht war. Arbeitete der Vater im Hof. Insofern das Wetter es zuließ. Damit die Kinder in Ruhe ihre Schulaufgaben machen konnten. Herinnen. Im Zimmer. In einem Zimmer. Einem einzigen. Für Vater. Mutter. Und sieben Kinder. Aber immerhin. Hatten sie ein Dach über dem Kopf. Noch. Denn es sollte nicht ihre letzte Adresse bleiben. Noch ganze dreißig Jahre lang. Sollten sie herumvagabundieren. Nach diesem letzten Umzug. Bis sie endlich ein feste, endgültige Bleibe finden sollten. Also ein richtiges Zuhause. Dreißig ganze Jahre. Fast bis auf den Tag genau. Der Vater sollte dies leider nicht mehr erleben. Und der Bruder auch nicht. Und die Schwester auch nicht. Dann wäre nurmehr ein letzter, trauriger Troß im Ziel- und Endhafen angekommen. Ein Torso. Von Familie. Nur sechs. Von Neunen. Beziehungsweise nur vier. Von ihnen. Da zwei weitere sich in der Zwischenzeit verselbständigt haben sollten.
Aber dazwischen. Während dieser dreißig Jahre. Während dieser ewig langen, unendlichen, dreißig Jahre, sollten sie immer wieder umziehen müssen. Immer. Und immer wieder. Mit Sack. Und Pack. Mit Kind. Und Kegel. Mit all der Wäsche. Und dem Kochgeschirr. Und den sieben kleinen Kindern unterm Arm. Möbel hatten sie ohnehin keine. Wie Nomaden. Wie Vertriebene. Wie Heimatlose. Wie Obdachlose. Dachte Gustav. Und doch. War das alles bloß ein großer Spaß für ihn. Noch. War es bloß ein Spiel. Denn er kannte es ja nicht anders. Aber später dann. Sollte es ihm peinlich sein. Später dann. Sollte es die Hölle werden für ihn. Ein Albtraum. Ein Trauma. An dem er sein ganzes Leben lang zu leiden hatte. Vor allem wegen seiner Mutter.
Die arme Mutter! Sie tat ihm leid. Schrecklich leid. So hatte sie sich ihr Leben ganz sicher nicht vorgestellt. Als Mädchen. Als Backfisch. Hatte sie noch von einer Karriere geträumt. Von einer Künstler-Karriere sogar! Das hatte sie ihm gesagt. Als Opernsängerin. Auf der ganz großen Bühne. Auf den Brettern. Die die Welt bedeuten. Daraus ist natürlich nichts geworden. Denn oft kommt es eben anders. Im Leben. Erstens. Und zweitens. Als man denkt. Anstatt in der Oper aufzutreten, von den Massen umjubelt und gefeiert, in ein Meer aus Blumen und Applaus getaucht, hatte sie ihren täglichen Auftritt hier. Auf den Brettern. Einer halbverrotteten Ein-Zimmer-Wohnung. Nur wenige Häuserblocks entfernt. Von der Oper. Und von der größten Baustelle Europas. Mit all ihrem Dreck. Und Staub. Den man erst gar nicht zu putzen beginnen brauchte. Denn nur eine Stunde später war er ohnehin schon wieder da. In dieser jämmerlichen und schändlichen Bruchbude. Wo sie Kindermädchen, Wäscherin, Näherin, Köchin und Putzfrau zugleich war. Im falschen Beruf also. Im falschen Film sozusagen. Beziehungsweise. Im falschen Roman.
Der Vater war schuld. Das war Gustav von Anfang an klar. Dieser Vater. Ernst. Ernsthaft. Ganz im Ernst. Dieser Versager ! Dieser Ober-Versager! Schaffte der es nicht einmal, seine Angetraute und seine elende Brut durchzufüttern! Aber Hauptsache Künstler! Er haßte den Vater dafür. Einen einfachen Graveur. Nicht einmal angestellt. Sondern bloß selbstständig. Ohne festes Einkommen. Ohne Schutz. Ohne eine jegliche Sicherheit. Ohne Netz. Und ohne doppelten Boden. Ein einfacher Graveur. Dessen miserables Gehalt bei weitem nicht ausreichte. Zumal für eine Familie. Zumal mit sieben kleinen und unmündigen Kindern. Von wegen Künstler! Hungerkünstler vielleicht! Denn selbst zum Lebenskünstler reichte es nicht. Hatte er denn nicht nachgedacht, bevor er sie alle in diese Katastrophe geführt hatte? Hätte er es sich nicht besser überlegen können? Hätte er es sich nicht verkneifen können? Das eine. Oder andere. Kind? Hatte er schließlich nichts anderes im Kopf als das? Konnte er denn nicht Eins und Eins zusammenzählen? Beziehungsweise Zwei und Sieben? Nein. Er hatte sie alle in diese Bredouille hineingeritten. Dieser Vater. Und der Sohn haßte ihn dafür.
Sogar zu Weihnachten. Hatte es diesmal kein Brot gegeben. Nicht einmal Brot! Geschweige denn Geschenke. Gut. Auf Geschenke konnte man gut und gerne verzichten. Obwohl. Als Kind eher nicht. Aber auf Brot? Zu Weihnachten? Wo andere im fetten Gänsebraten schwelgen? Beziehungsweise im panierten Karpfen?2 Auch da war der Vater schuld. Deshalb haßte der Sohn ihn dafür. Sehr oft. Hatte der Sohn nicht einmal eine Hose zum anziehen. Eine Hose! Die Grund-Ausstattung eines jeden Menschen! So dachte er. Ein Menschen-Recht! Ein Grund-Recht! Aber das hatte er nun mal nicht. Und zwar sehr oft. Mußte er deshalb zu Hause bleiben. Und konnte nicht zur Schule gehen. Sehr oft. Deswegen. Wegen seines unfähigen Vaters. Deshalb haßte ihn der Sohn.
Einzig das Zeichnen. Mit dem Vater. Das war schön. Und es hatte bereits sehr früh begonnen. Eigentlich sobald er denken konnte. Und die Hände bewegen. Und einen Stift halten. Hatte der Vater mit ihm gezeichnet. Der Sohn hatte sich bereits sehr früh im Zeichnen geübt. Denn früh übt sich. Was ein Meister werden will. Der Sohn zeichnete also. Und zwar immerzu. Dank des Vaters. Das immerhin. Hatte der Vater gut hingekriegt. Dachte er. Verbittert. Und das in derart jungen Jahren. Also zeichnete er. Förmlich. Um sein Leben. Er sollte es ja schließlich eines Tages besser haben. Sagte der Vater. Immerzu. Zeichnete er. Und zwar jene Dinge. Die er in der reellen Welt nicht bekommen konnte. Er zeichnete. Um der Realität zu entfliehen. Er zeichnete. Wenn er mal wieder keine Hose zum anziehen hatte. Dann zeichnete er sich eben eine. Und alles war wieder in Ordnung. Im Lot. Beziehungsweise. Auf dem Papier. Beziehungsweise. Auf dem Trottoir. Denn das war billiger. Beziehungsweise. Kostete es gar nichts. Wenn sie kein Brot zu essen hatten. Wie leider so oft. Dann zeichnete er sich eben eines. Und wenn es nur auf dem Trottoir war. Mit einem Stückchen Kohle. Aus dem Keller stibitzt. Erkannte er bereits früh. Die Macht. Der Phantasie. Die Macht. War mit ihm. Und mit ihr. Ließ es sich gut leben. Wenn es in der reellen Welt nicht mehr auszuhalten war. So erschuf man sich eben geschwind eine neue. Eine Phantasie-Welt. Eine Parallel-Welt. Eine Gegen-Welt. Eine Schein-Welt. In welcher alles anders war. Nämlich genau das Gegenteil. Und schöner Schein. Leicht. Und fröhlich. Und reich. In der reellen Welt hingegen. War es schwer. Und traurig. Und bitterarm. Der Vater war schuld! Deswegen haßte ihn der Sohn so sehr.
Es ist die Weltausstellung. Klagt der Vater. Es ist die Mißernte. Klagt der Vater. Es ist der Börsenkrach. Klagt der Vater. Es ist die Finanzkrise. Klagt der Vater. Es ist die Wirtschaftskrise. Klagt der Vater. Es ist die miserable Auftragslage zur Zeit. Klagt der Vater. Aber die Weltausstellung, die Mißernte, der Börsenkrach, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise und die miserable Auftragslage zur Zeit, wie der Vater stets behauptete, waren es jedenfalls nicht. Denn der Sohn konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, daß es ihnen jemals besser ergangen sei. Es stimmte zwar, daß es ihnen jetzt, nach der Weltausstellung, nach der Mißernte, nach dem Börsenkrach, in der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise und aufgrund der miserablen Auftragslage zur Zeit, noch schlechter ging als zuvor. Aber noch schlechter als ohnehin schon schlecht – das machte dann auch keinen großen Unterschied mehr. Ob man nun bloß ein Stückchen Brot für neun Personen auf dem Tisch liegen hat. Oder ein halbes. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Denn Hunger hat man. So. Oder so. Aber ja. Es stimmte. Seit dem großen Börsenkrach, da ging es seiner Familie tatsächlich noch schlechter.
Der Vater konnte seit Beginn der Wirtschaftskrise kaum mehr Aufträge erhalten. Denn wo neue Geschäfte fehlten, da verlangte man auch nicht nach gravierten Schildern. Immerzu machte der Vater die große Weltausstellung dafür verantwortlich. Immerzu. Wie eine defekte Schellack-Platte. Auf einem Grammophon. (Nur, daß jenes erst dreizehn Jahre später erfunden werden sollte.) Ach, die große Weltausstellung! Wehmütig dachte der Sohn daran zurück. Das waren tatsächlich noch bessere Zeiten gewesen! Er erinnerte sich daran, wie sein Vater noch viel zu tun hatte. Damals. Bis vor einem Jahr. Dem Jahr. Es war zwar bloß ein Jahr. Aber es erschien ihm wie eine halbe Ewigkeit. Denn Kinder haben eine andere Zeitrechnung. Außerdem war seither viel passiert. Zu viel.
Die Welt war noch eine andere gewesen. Bis kurz vor der Eröffnung. Der großen Weltausstellung. Anno 1873. Keine bessere unbedingt. Aber eine andere. Da hatte der Vater zumindest noch Arbeit gehabt. Ab und an. Hatte er Schilder gravieren müssen. Viele sogar. Denn es kam ein Großauftrag. Für die Weltausstellung. Tag und Nacht. Arbeitete der Vater daran. Und der Sohn schaute ihm dabei genau zu. Und dann, eines Tages, hatte er sie hinbringen sollen. Zum Weltausstellungsgelände. Hatte er den Sohn mitgenommen. Den Ältesten. Den Thronfolger. Den Kronprinzen. Der ja in seine unseligen Fußstapfen treten sollte. Eines schönen Tages.
Die Kutschfahrt quer durch die ganze Stadt war so ziemlich das Aufregendste, was der junge Gustav bis dahin erlebt hatte. Denn eine Kutsche konnte man sich für gewöhnlich nicht leisten. Nur davon träumen. Genauso wie von einem Grammophon. Oder Heizkohle. Oder Heißwasser. Oder Hosen. Oder Brot. Aber bei diesem Gefährt hier handelte es sich auch nicht wirklich um eine Kutsche. Eher um ein Fuhrwerk. Ein elendes Gespann. Von Schindmähren gezogen. Für das die Handwerker zusammengelegt hatten. Um ihre Waren gemeinsam anzuliefern. Dementsprechend voll war es. Und laut. Und unbequem. Den jungen Gustav kümmerte es nicht. Denn sein großes Abenteuer hatte gerade erst begonnen.
Erst jetzt. Konnte er das ganze Ausmaß der Baustelle überblicken. Die Ringstraße. Beziehungsweise das, was eines schönen Tages die Ringstraße werden sollte. Der prächtigste Boulevard ganz Europas. Wenn nicht gar der ganzen Welt. Wien hatte sich viel vorgenommen. In diesen Tagen. Zu viel. Denn vieles befand sich noch im Bau. Die beiden Zwillingsbauten der Museen. Zum Beispiel. Waren noch lange nicht fertig. Aber man konnte ihre baldige Pracht und Größe bereits erahnen. Kunsthistorisches links. Naturhistorisches rechts. Beziehungsweise umgekehrt. Je nachdem. Von wo man kam.
Man passierte den Donau-Canal. Über die Rotunden-Brücke. Und dann ging es geradewegs hinein. In den Prater. Über die Rotunden-Allee. Rechts. Die Jesuitenwiese. Links. Der Constantin-Hügel. Der eigens für die Weltausstellung aufgeschüttet worden war. Damit man auch ja einen schönen Ausblick hätte. Auf die Rotunde. Und das ganze Ausstellungsgelände. Und später auf das Riesen-Rad. Vierundzwanzig Jahre später. Ein ganzer Hügel also. Ein richtiger Berg. Denn der Glaube versetzt ja bekanntlich sogar Berge. Der Glaube. An den Fortschritt. An das Wachstum. An den Reichtum.
Das alles ist mächtig in die Hose gegangen. Man hatte sich mit alledem übernommen. Ringstraße. Und Weltausstellung. Das war zu viel. Des Guten. Purer Größenwahn. Eines riesigen Reiches. Das munter weiter expandierte. Weshalb sogar Berge versetzt wurden. Um es der ganzen Welt zu zeigen. Nämlich wer hier die Hosen anhatte. In Europa. Und zwar im Prater. Mittendrin. Hatte man also einen ganzen Berg aufgetürmt. Mit einem großen künstlichen See. Zu seinen Füßen. Und an seinem Abhang. Einen echten Wasserfall sogar! (Natürlich nicht minder künstlich.)
Im Galopp ging es nun. Quer über die Prater-Haupt-Allee. Über die schnurgerade Kaiser-Allee. Mit ihren Hunderten Kastanienbäumen. Und dann. Und dann. Dann. Endlich. Die Rotunde! Dieses gigantische, dieses kolossale Bauwerk, das man schon von weitem sehen konnte! Schon vom Linienwall aus! Dem Jungen stand der Mund offen. Er bekam ihn gar nicht mehr zu. Je näher sie diesem Ungetüm kamen. Diesem Gebirge. Aus Stahl. Und Glas.
Die Weltausstellung war zwar in diesen Tagen noch nicht eröffnet, aber es war für den elfjährigen Buben nicht minder aufregend, hier zu sein. Das alles sehen zu dürfen – und wenn es auch nur von außen war. Draußen. Hinter dem Bauzaun. Hinter der Absperrung. Verfolgte er das bunte Treiben herinnen. Wie so viele Wiener. Die nie und nimmer das Geld für die Eintrittskarte hätten aufbringen können. Genauso wie die Klimts. Drängten sich viele an der Absperrung. Die Zaungäste. Und beobachteten alles ganz genau. In diesen Tagen. Befand sich das alles hier noch im Bau. Legten die Arbeiter gerade letzte Hand an. Gaben dem Ganzen hier noch den letzten Schliff. Fasziniert schaute der Bub zu. Wie man die großen Glasscheiben nach oben zog. Auf die Rotunde. Die so riesig war, daß man den Kopf ganz weit in den Nacken legen mußte. Und noch weiter.
Es war das größte Bauwerk, das er überhaupt je gesehen hatte. Außer dem Stephansdom natürlich. Aber das hier, das erschien ihm wesentlich massiger, imposanter. Mit diesem aus Stein geschlagenen, mit riesenhaften Menschenfiguren verzierten Triumphbogen in seiner Mitte. Und dieser langgestreckten Halle. Schier unendlich. Und komplett aus Glas. Und darüber. Dieses gigantische Zeltdach. Diese Kuppel. Ganz aus Glas. So etwas hatte man bis dato noch nie gesehen. Zumindest in Wien nicht. Das war eine moderne Kathedrale. Und sie bestand nurmehr aus Glas. Und Stahl. Kein einziger Stein. Bis auf das Portal. Das lediglich schmückendes Beiwerk war. Und das mit dem Glaspalast an sich, mit dessen Statik und tragendem Konzept, nicht das geringste zu tun hatte.
Man zog die riesigen Glasscheiben hinauf. Unter lauten Zurufen. Die das Ganze noch viel dramatischer machten. Man schrie. Und man zog. Bis ganz nach oben. Mit Lastkränen. Über hölzerne Baugerüste. Welche um die kreisrunde Stahlkonstruktion errichtet worden waren. Wie ein Korsett. Wie ein Mieder. Aus Holz. Das neue Material. Der Stahl. Löste nun das alte Baumaterial ab. Stahl. Und Glas. Und sonst nichts. Das war der Beginn einer neuen Ära. Jeder spürte es. Und auch der Bub spürte es.
Unten nun ein Riesenradau. Die Maschinen wurden angeliefert. Die Ausstellungsstücke. Die Exponate. Der kleine Junge drückte sein Gesicht ganz fest an den Zaun. Mein Gott. Was war das bloß? Gigantische Turbinen. Schwarz. Und mächtig. Wie Walfische. Nein. Noch größer! Es brach eine neue Ära an. Eine Ära der schieren Größe. Eine Ära des schieren Größenwahns. Alles wurde größer. Alles wurde riesig. Kolossal. Gigantisch. Unüberschaubar. Die Ozeandampfer. Die Lokomotiven. Die Brücken. Alles aus diesem neuen Material. Aus Stahl. Sogar die Bauwerke.
Man hatte die Gleise bis hierher verlängern müssen. Um die Waren aus aller Welt bis in die Hallen hineintransportieren zu können. Schnaubend. Und brüllend. Stampften die riesigen Dampf-Lokomotiven ein. Unzählige Waggons hinter sich herziehend. Bis an den Rand vollgefüllt. Mit Waren. Aus aller Welt. Den neuesten. Den kostbarsten. Und darüber. Über dem allem. Die gigantische Rotunde. Der Glaspalast. Wie eine Kathedrale. Wie ein Himmelszelt. Ein neues Firmament. Unter dem sich die gesamte Welt zusammenfinden sollte. In Wien. Staunend. Sprachlos. Und zutiefst beeindruckt. Von Wien. Dem Zentrum Mitteleuropas. Und bald schon. Zentrum der Welt. In wenigen Tagen nur.
Und über diesem allen. Noch weit darüber. Da stand der Vater. Sein Vater. Der große Held. Der Erretter der Weltausstellung. Denn ohne seine gravierten Schilder, könnte das Ganze hier erst gar nicht vonstatten gehen. Dessen war der Bub sich sicher. Schließlich mußten doch die Herrschaften aus aller Welt ganz genau wissen, wo es langgeht! Und dafür war sein Vater zuständig! Sein Vater machte den wichtigsten Job hier bei der ganzen Weltausstellung! Das Herz des kleinen Jungen schlug schneller. Nein. Es hämmerte regelrecht in seiner Brust. Wie der Stahlkolben dieser gigantischen Dampflokomotive neben ihm. Und plötzlich wurde ihm alles klar. Dies war der Augenblick. Der alles entzündende Funke. Die Initialzündung. Als er sich entschloß. Künstler zu werden. Wie sein Vater.
Er wollte fortan Künstler sein. Und nur das. Denn dann würde er ebenfalls so wichtige Aufgaben zu erledigen haben. Wichtige Menschen treffen. An einer wichtigen Ausstellung mitarbeiten. Einer welt-wichtigen Ausstellung sogar. Im Grunde erschien es ihm, als sei dies alles nur für seinen Vater erbaut worden. Diese prächtige, kolossale Rotunde! Als Monument. Und Mahnmal. Für seinen Vater. Den Helden. Den größten Vater von allen! Doch da hatte er noch nicht verstanden, daß sein Vater bloß ein einfacher Handlanger war. Ein gewöhnlicher Handwerker. Die Welt-Ausstellung hätte auch genausogut ohne dessen gravierte Schilder über die Bühne gehen können. Aber für den Sohn war der Vater an diesem Tag der große Held. Ein Vorbild. Dem es tunlichst nachzueifern galt.
3
Aber das alles war bereits ein Jahr her. Inzwischen hatte sich einiges verändert. Die Welt hatte sich verändert. Wien hatte sich verändert. Die Wirtschaftslage hatte sich verändert. Die Auftragslage hatte sich verändert. Der Vater hatte sich verändert. Und der Sohn hatte sich verändert. Inzwischen war er zwölf Jahre alt. Und das ist ein großer Unterschied. Ein Riesenunterschied. In diesem Alter. Ob man nun elf. Oder zwölf Jahre alt ist. Mit elf Jahren ist man noch ein Kind. Da sieht man die Welt noch durch eine rosarote Brille. Durch die Augen eines Kindes eben. Mit zwölf hingegen, ist man fast schon erwachsen. Da sieht man die Welt dann plötzlich klar und nüchtern. Eben so. Wie sie nunmal ist. Auch den Vater. Und der beschwerte sich immerzu. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. So kam es dem Sohne jedenfalls vor. Der Vater jammerte. Und beklagte sich. Und schließlich. Bemitleidete er sich sogar. Selbst. Ach! Und. Oh! Weh! Wäre seine Familie doch niemals von Böhmen hierher nach Wien gezogen! Pflegte er immerzu zu sagen. Schließlich traf es ja bei einem Börsenkrach und bei einer Wirtschaftskrise die Hauptstadt stets zuerst. Und zudem noch unmittelbarer. Und um ein Vieles härter. Als die Provinzen.
Die Mutter weinte oft. In letzter Zeit. Tat es der Vater vermutlich auch. Aber wenn, dann nur heimlich. Und nicht vor den Kindern. Natürlich. War er ein eigenbrötlerischer Typ. Nicht ungesellig. Aber ein ruhiger und wortkarger Mensch. Der seinen Kummer stets in sich hineinfraß. Und cholerisch war er auch. Wenn ihm alles zu viel wurde. Da wußte er sich nicht besser zu helfen. Als zu schreien. Und zu brüllen. Wie ein Affe. Wie ein Pavian. Und zu toben. Und sogar Watschen auszuteilen. Das hatte er wiederum von seinem Vater geerbt. Es vererbte sich. Das Übel. Von Vater. Auf Sohn. Von Generation. Zu Generation. Auch Gustav würde dies noch zu spüren bekommen. Es sollte ihm sehr vieles verbauen. Genauso wie dem Vater. Andere, die nicht cholerisch waren, die sich beherrschen konnten, wurden sogar mitunter in den Adelsstand erhoben. Choleriker hingegen nicht.
Die Mutter jedoch, eine „waschechte Wienerin“, wie sie sich selbst zu bezeichnen pflegte (obwohl ihre Familie aus dem Burgenland stammte) war genau das Gegenteil. Sie hielt nicht lange mit ihrer Meinung zurück. Und hinterm Berg. Das konnte sie nicht. Denn ihr fehlte es an Selbstkontrolle. Ihr Temperament war es. Das ging stets mit ihr durch. Oftmals weinte sie. Und schrie. Um im nächsten Augenblick wieder zu lachen. Stets redete sie drauflos. Ohne zuvor überhaupt nachgedacht zu haben. Eigentlich immer. So zumindest empfand es der junge Gustav. Sie plapperte. Und schnatterte. Und übertrieb. Und bauschte auf. Und sah schwarz. Wo noch Licht war. Und keinen Ausweg. Wo ein letzter Funke Hoffnung war. Zerstörte Träume. Rächen sich. Immer. Und führen stets zu großem Frustrationspotential. Und somit zu großen Emotionsausbrüchen. Zumal bei Menschen mit Temperament. Zumal bei kreativen Menschen. Deren Kreativität niemals gefördert wurde. Deren Kreativität brutal im Keim erstickt wurde. Und somit niemals ausgelebt wurde. Das führte dann zu diesen ganz großen Emotionsausbrüchen. Bühnenreif. Das ganz große Drama.
Wüste Streitereien zwischen den Eltern waren daraufhin die unausweichliche Folge. Stets wurde alles nach Außen gekehrt. Laut. Und theatralisch. Zumindest von Seiten der Mutter. Die keinen Hehl daraus machte, daß sie gerne Opernsängerin geworden wäre. Wenn sie gutgelaunt war (was immer seltener war). So sang sie fröhliche Arien. Cosi fan tutte. La Traviata. La Cenerentola. Während sie die Wäsche aufhängte. Ging es ihr jedoch schlecht (was immer öfter der Fall war). So glich es der Aufführung eines Dramas. Norma. Medea. Macbeth. Der Gesang wurde dann schnell zum Geschrei. Hoch. Schrill. Und durchdringend. Es drang. Durch Mark und Bein. Und es ging. Einem ans Herz. Vor allem den Kindern. Denn die Kinder vermochten es nicht auseinanderzuhalten. Was denn nun Theater war. Und was bitterer Ernst. Wenn die Mutter fröhlich war. Dann richtig. (Und zwar so, daß es der halben Nachbarschaft zuteil wurde.) War sie aber unglücklich. Dann ebenfalls richtig. (Und zwar so, daß die ganze Nachbarschaft die Fensterläden schließen mußte.) Himmelhoch jauchzend. Und zu Tode betrübt. Eigentlich hätte sie die Böhmin sein müssen. Und der Vater der Wiener. Aber es war genau umgekehrt. Dann hieß es stets: „Ich hätte eine große Carrière im K.u.K. Hof-Opern-Theater machen können! Alle meine Musik-Lehrer bescheinigten mir stets ein ausgesprochenes Talent! Doch was ist statt dessen geschehen? Da sitze ich nun in der Vorstadt, in einem Loch von Behausung, mit sieben Kindern am Hals – und weiß nicht einmal, wie ich sie durchfüttern soll!“
Für Gustav und seine Geschwister lag es auf der Hand. Sie waren das Problem! Gäbe es sie nicht, so hätte das Leben der Mutter keine derart unerfreuliche Wendung genommen. Dann wäre sie heute eine gefeierte Operndiva. Mit Audienzen. Beim Kaiser. Und mit einer Villa. Nahe Schönbrunn. Doch es war alles ganz anders gekommen. Eben weil sie gekommen waren. Seine um zwei Jahre ältere Schwester, Klara, pflegte ihn in derartigen Situationen stets beiseite zu nehmen und zu trösten. Der Vater sagte zu alledem nichts. Er schwieg sich aus. Und so waren es die Frauen. Welche das Leben des Jungen bestimmten. Allem voran die Mutter. Mit ihrem ausgeprägten Sinn für Theatralik. Vom Gemüt folgte der Sohn ganz seinem Vater. Und doch verstand er sich besser mit der Mutter. Eben weil sie so lebhaft war. Und irrational. Denn war schließlich nicht das ganze Leben so? Sind nicht gerade dies die beiden Hauptattribute des Lebens? So dachte er. Lebhaftigkeit. Und Unvernunft. Schienen ihm zudem auch die Hauptattribute einer jeden Frau zu sein. Schließlich kannte er es ja nicht anders.
Außerdem förderte die Mutter seine Phantasie. Sie bestätigte ihn. Sie bestärkte ihn. Im Zeichnen. Und zwar im freien Zeichnen. Kritisiert ein Vater seinen Sohn durchaus. Und zwar immerzu. Zumal, wenn er selbst ein Künstler ist. Also ein Fachmann. In diesen Dingen. Dann weist er stets auf die falsche Proportion hin. Selbst wenn diese vom Sohne durchaus beabsichtigt war. Er weist auf die schiefe Optik und auf die unschlüssige Perspektive hin. Selbst wenn diese vom Sohne beabsichtigt war. Er kritisiert die unzulängliche Schraffur. Selbst wenn diese vom Sohne beabsichtigt war. Muß er es einfach tun. Ob er will. Oder nicht. Denn schließlich obliegt ihm die korrekte Schulung seines Sohnes. Eine Mutter hingegen, die lobt ihren Sohn. Sie findet alles gut. Was er macht. Und zwar immer. Selbst wenn er ein Meuchel- und Massenmörder ist. Das liegt in der Natur. Der Sache. Und einer Mutter. Denn Mutter und Sohn. Das ist eine ewige, verzwickte und vertrackte Geschichte.
Sie ermunterte ihn. Zum Malen. Mit Farben. Fehlte natürlich das Geld. Und zwar völlig. Also zeichnete er. Mit Stift. Und Papier. Allerdings auch nicht. Denn dafür fehlte das Geld ebenfalls. Aber er zeichnete dennoch. Und trotz alledem. Und zwar mit allem. Was er finden konnte. Manchmal. Wenn der Köhler kam. Und dem Jungen ein paar Bruchstücke Kohle in die Hand drückte. Manchmal. Bei Aushubarbeiten. Unweit des Hauses. Wenn alte Tonziegelscherben zum Vorschein kamen. Wurden diese schnell eingesackt. Denn mit ihnen ließ es sich ebenfalls vortrefflich zeichnen. Auf dem Boden. Vor dem Haus. Kohlrabenschwarz. Und Ziegelrot. Was bei den Nachbarn natürlich immer wieder auf grobes Unverständnis stieß. Und ihm regelmäßig Ärger einbrachte. (Denn die Bewunderung für sein Genie hielt sich in diesen jungen Jahren noch in Grenzen.) Die zwei kläglichen Schulstifte. Und die drei teuren Schulhefte. Dienten wohl kaum als Zeichenmaterial. Obwohl er es heimlich dennoch versuchte. Aber er hatte da natürlich auch die Kreiden. Und die kleine Schiefertafel. Die dienten ihm bald täglich als Zeichenwerkzeug. Ein sehr vergängliches allerdings. Aber war es nicht mit allem so? Wie gewonnen. So zerronnen. Dachte er. Nichts ist für die Ewigkeit. Und ins Grab geht man schließlich nackt. Und so weiter. Und so fort. Alles schlaue Sprüche der Mutter. Die ja nun wirklich nichts hatte. Was sie ins Grab hätte mitnehmen können. Sie hatte ja nicht einmal etwas. Zu verlieren.
Längst schon hatten sich die Lehrer damit abgefunden. Der junge Klimt ist ein fleißiger Zeichner. Sagten sie. Und überdies sehr talentiert. Ständig wurde er nach vorn gerufen. An die Tafel. Weil er die schönste Handschrift hatte. Und zwar mit Abstand. Und wie er es liebte! Da vorn zu stehen. So prominent. Und von allen bewundert. Wenn schon nicht daheim. Dann hier. In der Schule. Ja. Er liebte es. Zur Schule zu gehen. Denn hier war es besser als daheim. Viel besser. Man hatte mehr Platz. Man hatte sogar ein eigenes Pult. (Mit einem Geheimfach sogar!) Und eine eigene Sitzbank. Hier war es warm. Auch im Winter. Immer geheizt. Was man von seinem Zuhause nicht unbedingt behaupten konnte. Er liebte die Schule. Und er war ein außerordentlich guter Schüler. Sehr gut sogar. Niemals hatte er schlechte Noten. Er liebte es. Dieses Gefühl. Gebraucht zu sein. Zu etwas nütze zu sein. Eine Aufgabe zu haben. Eine Beschäftigung. Denn wahres Genie muß beschäftigt werden. Und zwar immerzu. Es muß lernen. Und er liebte es. Zu lernen. Zu schreiben. Und zu zeichnen. Auf dieser Tafel. Vor den Augen aller. Mit diesen Kreiden. Das war pure Magie für ihn. Ein Inbegriff der Schönheit. Und der Vergänglichkeit. Alle Liebesmüh war bald schon wieder hinweggewischt. Mit einem nassen Schwamm. Und dennoch. Auf zu neuen Taten! Die Übung macht ja schließlich und bekanntlich den Meister! Sie hatten ebenfalls einen Löwenanteil an seiner späteren Künstlerkarriere. Diese Tafel. Und diese Kreiden. Sogar farbige Kreiden gab es! Die Reste, die zu Boden fielen, die steckte er sich manchmal in die Tasche, um daheim damit arbeiten zu können. Eigentlich mehr spielen. Als arbeiten. Denn ein anderes Spielzeug hatte er selbstverständlich nicht.
Den Lehrern war es nur recht so. Daß da wer an der Tafel stand. Und ihnen die Arbeit abnahm. Die halbe Arbeit. Zumindest. (Denn kein Lehrer liebt es, an die Tafel zu schreiben.) Und mehr noch. Einige von ihnen förderten und unterstützten ihn noch darin. Ein Handwerk konnte schließlich niemals schaden. Zumal in Zeiten wie diesen. Wo Wien praktisch neu entstand. Wo es völlig neu erfunden wurde. Da brauchte man Handwerker. Aller Art. Und gute obendrein. Das sagte nicht nur der Vater. Das sagte auch der Zeichenlehrer. Der dem Jungen ab und an Bleistifte und Papier zusteckte. Damit er üben könne. Brav. Und fleißig. War er selbst unverheiratet. (Wie fast alle Kunstlehrer. Ergo gescheiterten Künstler.) Und verdiente recht passabel. Somit konnte er den Jungen fördern. „Er hat nun mal ein ausgesprochenes Talent, dieser Klimt.“ Pflegte sein Zeichenlehrer stets zu sagen. Nicht zu ihm direkt. Aber zu den anderen. Zu seinen Mitschülern. Und die bewunderten ihn dafür. Neidisch waren sie nicht. Als Kind ist man neidisch auf anderes. Auf die Glasmurmeln der anderen. Zum Beispiel. (Weil man selbst nur eine Handvoll Murmeln aus Ton besitzt.) Auf die Bonbons der anderen. Auf die schönen Zöpfe. Oder auf die neuen Strümpfe. Aber niemals auf Talent. Das kommt erst später. Wenn man erwachsen ist.
Aber schließlich fällt der Apfel ja nie weit vom Stamm. Immerhin verfügte sein Vater als Graveur über eine außerordentlich ruhige Hand. Und war selbst ein sehr guter und genauer – wenn auch ein wenig phantasieloser – Zeichner. Aber dieses Manko an Phantasie, machte dann seine Mutter mit einem Streich wieder wett. Auch wenn es ihnen, materiell gesehen, am schlechtesten ging, fertigte sie für die Kinder rasch Kostüme aus Stoffresten, Decken oder Laken an. Und ließ sie damit Szenen aus den derzeit modernen Opern nachspielen. Durch sie empfing der junge Gustav sein gutes Gehör und seine tiefe Liebe zur Musik. Und was war es schließlich anderes. Das Malen. Als lediglich eine Art visuelle Umsetzung kosmischer Musik. Die man als Künstler immerfort empfängt. Entweder, man gibt sie, mittels eines Instruments, wieder. Oder aber man sublimiert sie. Und läßt sie, lediglich mittels eines anderen Mediums, sich manifestieren. Zu Materie werden. Die sich dann sehen lassen kann. AN.sehen. Und AN.fassen. Also ER.fassen. Beziehungsweise. AN.greifen. Und BE.greifen. Und zwar für alle. Auch für jene, welche nicht imstande sind, diese kosmische Musik zu hören.
Da das Geld für ein Piano oder eine Violine bei weitem fehlte, übertrug der junge Klimt seine Musik in Striche und Kurven. Unter besseren Umständen wäre er wohl ein Klaviervirtuose geworden. Doch die Umstände dienen stets dem Schicksal. Das konnte er in diesen jungen Jahren noch nicht wissen, aber bald wüßte er es. Das Schicksal hatte Größeres mit ihm vor. Wäre er als verzogener Sohn reicher Eltern zur Welt gekommen, so hätte er wohl die Bank- oder Produktionsgeschäfte seines Vaters übernommen. Sie übernehmen müssen. Zumindest damals. Wäre dann, in seinem pflichterfüllenden Alltagsleben, mit Sicherheit kein Platz mehr für Musik, oder gar für Malerei, gewesen. Da er jedoch in völliger Armut heranwuchs, lernte er bereits sehr früh, sich in die Welt der Kunst zu flüchten. Seine Phantasie auszuleben. Auf sein Gefühl zu vertrauen. Und nicht auf das Gefühl anderer. Auf die göttliche Stimme zu hören. Und nicht auf die Stimmen anderer. Somit schult man sich im Schöngeistigen. Denn ein Schöngeist, der ist und bleibt immer ein Schöngeist. Und ein Künstler, der ist und bleibt immer ein Künstler. Komme, was wolle. Denn er ist es. Schon vom Augenblicke seiner Geburt an. Und er bleibt es. Auch lange über den Augenblick seines Todes hinaus. Ein Künstler ist immerwährend. Er ist universell. Wie die göttliche Musik. Die er immerzu empfängt. Oder die Worte. Oder die Bilder. Er wird aber erst durch seine Lebensumstände zu dem, was er ist. Zu dem, was er sein soll.
Das alles wußte der junge Mann noch nicht. Der sich soeben auf der Schwelle befand. Vom Kindsein. Zum Mannesalter. Dessen Bartflaum erst in den letzten Tagen zu sprießen begann. Ganz vorsichtig. Und am liebsten. Spielte er. Mit Tieren. Oder mit der Stoffpuppe seiner Schwestern. Auf der anderen Seite aber. War er für sein junges Lebensalter ausgesprochen ruhig. Und vernünftig. Teilweise. Nahezu. Weise. Denn er verstand es bereits in jungen Jahren. Im Einklang mit der Natur zu leben. Was bedeutet: im Einklang mit seiner Natur. Im Einklang mit sich selbst. Er erkannte seine Aufgabe. Er erkannte seine Bestimmung. Und die lautete: Künstler werden. Und der Welt Schönes zu geben. Sie an seiner inneren Schönheit teilhaben zu lassen. Eine Welt, die an sich nicht gerecht war. In der es unbeschreiblich mehr Verlierer als Gewinner gab. Das wußte er. Denn das hatte er am eigenen Leibe erfahren müssen. Seine ganze Familie gehörte eindeutig dazu. Zu den Verlierern.
Wenn man kein Geld für Schönes hat. Dann muß man das Schöne eben ersinnen. Man muß es sich ausdenken. Es zum Vorschein bringen. Mittels weniger Striche. Oder Gesten. Es in die Welt bringen. Es sich materialisieren lassen. Ein Künstler ist ein Medium. Er vermittelt zwischen zwei Welten. Der sichtbaren. Und der unsichtbaren. In der sichtbaren Welt. Lebten die Klimts wie Vagabunden. Zu neunt in einem Zimmer. In Bassena-Wohnungen. Mit morschen und knarrenden Pawlatschengängen. Winzigen Fenstern. Und feuchten Wänden. Die Jüngsten weinten. Immerzu. Weil sie Hunger litten. Die Ältesten hielten tapfer den Mund. Immerzu. Doch da gab es noch die innere Welt. Die Welt des Lichts. Die Welt des Reichtums. Die Welt des Glücks. Im Grunde, so sollte er später erkennen, ist der Künstler nichts anderes als ein Priester. Ein Geistlicher. Auch er erkennt die andere Welt. Auch er sieht sie als gegebene Realität an. Auch er macht sich diese andere Welt zu nutze. Um anderen Menschen zu helfen. Um sie glücklich zu machen. Denn ein Künstler schafft stets für andere. Niemals. Für sich allein.
Und schließlich, doch auch das sollte er erst viel später erkennen, gibt es kein Glück. Ohne Leid. Keine Schönheit. Ohne Häßlichkeit. Denn erst das Leid. Erzeugt das Glück. Es erzeugt die Fähigkeit. Das Glück überhaupt erst erkennen zu können. Und genauso verhält es sich mit der Häßlichkeit. Nur wer die Häßlichkeit kennt. Wer sie gesehen hat. Der kann sie von der Schönheit unterscheiden. Und der. Der nichts hatte. Der die absolute Armut und den totalen Verzicht am eigenen Leibe erfahren hat. Nur der ist überhaupt in der Lage. Das zu schätzen. Was er später hat. Und überdies. Anderen etwas davon zu geben. Etwas von Herzen zu geben. Zu teilen. Und sei es nur sein Mitgefühl. Es ist insofern nur gerecht. Unter Umständen. Daß man als Künstler Geld dafür bekommt. Einen Lohn. Eine Entschädigung. Eine Kompensation. Für all die aufgebrachte Mühe. Und Zeit. Denn auch ein Künstler. Lebt nicht. Allein. Von Luft. Und Liebe. Aber es ist keine Voraussetzung. Fürs Geben. Zudem mindert dieser Lohn die Art der Gabe nicht. Und genauso wenig vergrößert er sie. Denn ein Meisterwerk ist. Und bleibt. Für immer. Und ewig. Ein Meisterwerk. Auch wenn es nichts kostet. Kostet es viel. Umso besser. (Für den Künstler.)
4
Sieben kleine Kinderlein.
Die trafen eine Hex’.
Eines kochte sie sich ein.
Da waren’s nur noch sechs.
Heute war etwas anders. Irgend etwas stimmte nicht. Das fiel Gustav sofort auf. Was es war, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber bald wüßte er es. Es war still. Verdächtig still. Die Ruhe vor dem Sturm. Denn die Kleine schrie nicht. Sie weinte nicht. Wie sonst immer. Den ganzen Tag lang. Und die ganze Nacht. Aber vor allem am Morgen. An diesem Morgen. Jedoch. Blieb alles still. Totenstill. Er wagte also einen Blick nach rechts. Irgendwie hatte er es im Gefühl gehabt. So eine Art Vorahnung. Denn die Kleinste, Anna, war ja immerzu krank gewesen. Ihr Herz war schwach. Und ihre Lungen auch. Sie litt unter Atemnot. War ständig verschleimt. Hatte immerzu gehustet. Und eine graue Gesichtsfarbe. In einem Gesicht. Das nicht das Gesicht eines Säuglings war. Oder das eines Kleinkindes. Es war das Gesicht. Einer Erwachsenen. Einer alten Frau. Die bereits alles gesehen und erlebt hatte. AN.NA. Wie die Mutter. So die Tochter.
Heute war ihr Gesicht noch grauer als sonst. Nein. Es war geradezu grün. Grüngrau. Graugrün. Und ihre Lider waren halb geöffnet. Und ihr Mund auch. Sie gab keinen einzigen Mucks von sich. An diesem Tag. Der alles verändern sollte. Und sie rührte sich auch nicht. Auch dann nicht, als er sie anstieß. Erst zaghaft. Und vorsichtig. Dann schließlich fester. Aber es tat sich nichts. Zudem fühlte sie sich kalt an. Unnatürlich kalt. Wie eine Puppe. Oder wie eine Skulptur. Aber nicht wie ein Mensch. Aus Fleisch. Und Blut. Es war nicht das erste Mal. Daß er einen toten Menschen gesehen hatte. Aber es war immerhin seine kleine Schwester. Sein eigen. Fleisch. Und Blut. Und das machte es schlimm. Es war übrigens die Zweitkleinste. Anna. Nicht die ganz Kleinste. Johanna. Denn die war gerade erst ein Jahr alt.
„Mama!“, flüsterte er schließlich, „Mit dem Annerl stimmt was nicht. Ich glaube, sie ist thot!“
Was nun geschah, sollte sein Leben für immer und ewig verändern. Und das seiner Geschwister ebenfalls. Vor allem das. Der ältesten beiden Schwestern. Denn die Mutter reagierte. Sie reagierte über. Sie überreagierte. Sie drehte durch. Und zwar völlig. All das Leid. Und die Frustration. Der letzten Jahre. Über ihre Lebenssituation. Über ihre Wohnsituation. Über ihre finanzielle Situation. Über ihre ausweglose Situation. Entluden sich plötzlich. In einer Art unkontrolliertem Gewitter. Wie bei einem defekten Generator. Der ständig unter Strom steht. In einem völligen Nervenzusammenbruch. Noch nie hatte Gustav seine Mutter in einem derartigen Zustand erlebt! Sie war außer sich. Sie schrie. Sie weinte. Sie wehklagte. Wie in einem Shakespeare’schen Drama. Oder wie in einer antiken Tragödie. Streckte die Mutter das tote Kind gen Himmel. Sie verfluchte Gott. Und sie verfluchte ihren Ehemann. Und dies würde sich auch fortan nicht mehr ändern. Es würde niemals wieder besser werden. Das wußte er.
Es gibt ja bekanntlich verschiedene Stadien der Trauer. Zunächst einmal. Glaubt man das alles nicht. Man kann es einfach nicht glauben. Kann es nicht fassen. Man verweigert sich. Der Realität. Die viel zu schmerzhaft wäre. Dann jedoch. Reagiert man mit Wut. Und Haß. Mit Enttäuschung. Dann versinkt man. In Selbstmitleid. Und in Kummer. Man resigniert. Und schließlich. Wenn Gott will. Akzeptiert man es. Seine Mutter allerdings. Bewegte sich bloß zwischen Stadium zwei und drei. Sie glaubte es. Wollte es aber nicht akzeptieren. Mit ihrer Verzweiflung. Und Trauer. Marterte und zerfleischte sie sich selbst. Mit ihrer Wut. Und ihrem Haß. Marterte und zerfleischte sie den Vater. Denn der war ja schuld! Das alles wäre nicht passiert. Wenn er doch nur eine vernünftige Anstellung gefunden hätte. Wenn er fleißiger arbeiten würde. Wenn er mehr wirtschaftliches Geschick an den Tag legen würde. Wenn er mehr Mut besäße. Und Durchsetzungswillen. Denn dann hätte man auch genug zu essen. Man hätte genug Kohle, um einzuheizen. Und dann müßten auch keine kleinen, fünfjährigen Kinder sterben. Anna. Ach. Anna. Wie die Mutter. So die Tochter.
Für Gustav war diese Erfahrung extrem belastend. Traumatisierend. Er selbst würde keine Familie haben wollen. Zumindest nicht in dieser Form. Es würde ohnehin in die Hose gehen. Und nur weiterhin Unglück verbreiten. Das sah er jetzt. Er hatte seine Lektion gelernt. Und seine beiden ältesten Schwestern ebenfalls. Denn sie kamen. Und sahen. Wie die Mutter sich quälte. Wie sie sich aufgab. Und zwar völlig. Wie sie jeglichen Lebenswillen verlor. Auch den allerletzten Rest davon. Während der Vater sich in Schweigen hüllte. Und zwar völlig. Wie immer eben. Während die Mutter schrie. Und weinte. Und tobte. Blieb er völlig ruhig. Je mehr sie schrie. Und weinte. Und tobte. Desto ruhiger wurde er. Er saß bloß da. Mit glasigem Blick. Aber er weinte nicht. Er weinte niemals. Auch jetzt nicht. Er zog sich zurück. Und zwar völlig. In sich selbst.
Die Kinder, zumal die vier ältesten – also Klara, Hermine, Gustav und Ernst – mißinterpretierten dies völlig. Sie verstanden es nicht. Und sie ließen sich vom Theater der Mutter beeindrucken. Und beeinflussen. Sich in die Irre leiten. Vom Wege abbringen. Sie hielten den Vater für kalt. Gleichgültig. Unbarmherzig. Herzlos. Ja. Der Vater. Dieser Vater. Der ihnen ohnehin schon dies alles hier angetan hatte. Und der jetzt womöglich auch noch froh war. Und erleichtert. Daß es ein Maul weniger war. Das er zu stopfen hatte. Dieser Rabenvater. Der hatte kein Herz. Jetzt sahen sie es. Jetzt wußten sie es. Wie konnte es schließlich anders sein. Wo ja der Vater keine einzige Träne vergoß? Zumal für sein soeben erst verstorbenes Kind. Seine kleine Tochter. Von nur fünf Jahren. Ja. Der Vater war schuld. Tatsächlich. War der Vater an allem Schuld. An allem! Denn er war ja schließlich für alles verantwortlich. Auch für den Tod. Dieses Kindes. Seiner Tochter. Und ihrer kleinen Schwester. Dieser elende Vater. Der Gevatter. Tod. ER. Hatte sie erst alle in diese Lage gebracht. ER. Schaffte es nicht. Sie alle zu ernähren. ER. Schaffte es nicht. Eine warme und komfortable Wohnung zu beschaffen. Für neun Leute. ER. Schaffte es nicht. Einen guten Arzt zu holen. Und somit das Leben seiner kleinen Tochter zu retten. Und zu erhalten. Denn das wollte er womöglich gar nicht. Schließlich hatte er ja noch sechs andere Gefraster in petto. Nein. Der Vater war ein Versager. Jetzt war es also offiziell. Das war der Beweis. Definitiv. Und unumstößlich.
Die Mutter hingegen. Stieg mit einem Schlag auf. Mit einem Ritterschlag. In der Familienhierarchie. Und in der kanonischen. Da schaffte sie es bis ganz hinauf. In den Rang einer Heiligen. Nein. Der Heiligsten. In den Rang. Einer Madonna. Einer Schutzmantelmadonna. Einer Schmerzensmadonna. Noch oft hatte Gustav daran denken müssen. Später. In seinem Leben. Wie die Mutter dasaß. Mit leerem Blick. Völlig apathisch. Und die Kleine in ihrem Arm wog. Beziehungsweise das. Was von ihr übriggeblieben war. Dieser letzte Rest. An schlaffem Köper. Leblos. Und winzig. Zerbrechlich. Grau. Und gläsern. Mit blauen Adern durchsetzt. Noch oft hatte er daran denken müssen. Später. In seinem Leben. An diesen Anblick. Der herzzerreißend war. Und der ihn niemals wieder losließ. Der ihn festhielt. In einer lähmenden und erstickenden Umklammerung. Wie die Pietà. Von Michelangelo. Aus Stein. Grauweiß. Und kalt. Mit blauen Adern durchsetzt. Die Mutter war eine Madonna. Eine Schmerzensmadonna. Eine Heilige. Sancta Anna.





























