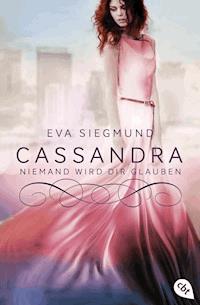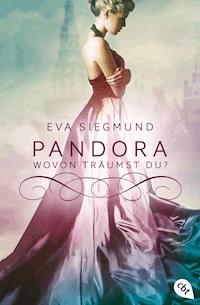9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die H.O.M.E.-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Fremde Welt, vertraute Feinde
Es ist so weit. Die Akademie hat Zoë und ihre Crew auf die Mission geschickt, auf die sie so lange und akribisch vorbereitet wurden. Doch die Vorzeichen könnten schlechter nicht sein: Zoë weiß inzwischen, welche finsteren Motive ihre Ausbilder antreiben und wie sehr sie getäuscht wurde. Auch das lange ersehnte Wiedersehen mit Jonah wird von der Anwesenheit seines Rivalen Kip überschattet und als die Crew am Ziel ihrer Mission ankommt, scheint ihr Scheitern vorprogrammiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Ähnliche
© Random House/Isabelle Grubert
DIE AUTORIN
Eva Siegmund, geboren 1983 im Taunus, stellte ihr schriftstellerisches Talent bereits in der 6. Klasse bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb unter Beweis. Nach dem Abitur entschied sie sich zunächst für eine Ausbildung zur Kirchenmalerin und studierte dann Jura an der FU Berlin. Nachdem sie im Lektorat eines Berliner Hörverlags gearbeitet hat, lebt sie heute als Autorin an immer anderen Orten, um Stoff für ihre Geschichten zu sammeln.
Mehr zur Autorin auch aufwww.eva-siegmund.de und Instagram@eva_siegmund_schreibt.
Von Eva Siegmund sind bei cbt erschienen:
H.O.M.E. – Das Erwachen (31230, Band 1)
PANDORA – Wovon träumst du? (31059)
CASSANDRA – Niemand wird dir glauben (31183)
LÚM – Zwei wie Licht und Dunkel (16307)
Mehr über cbj und cbt auf Instagram unter @hey_reader
EVA SIEGMUND
DIE MISSION
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage 2019
Originalausgabe April 2019
© 2019 by Eva Siegmund
© 2019 by cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München
Umschlagmotive © Shutterstock (Who is Danny, nabil refaat, Rapax, Thanit Weerawan, Natalia Perchenok, 3000ad, Daniel Indiana, Mark Smith, Bartlomiej Magierowski)
MI · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22640-4V001www.cbj-verlag.de
Prolog
Die Sonne wärmte meine Haut, doch sie brannte nicht. Es roch nach frisch gemähtem Gras und Erde, der Boden unter meinen Füßen fühlte sich weich an. In der Ferne hörte ich fröhliches, entspanntes Stimmengewirr.
Ich kannte diesen Geruch und die Geräuschkulisse nur allzu gut. Mich umgab der Garten, der sich vor dem zentralen Akademiegebäude erstreckte. Es war immer mein Lieblingsort auf dem gesamten Gelände gewesen.
Ich suchte in meinem Körper nach Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung war, doch ich fühlte mich gut. Keine Schmerzen, kein Unwohlsein. Nichts.
Langsam hob ich die rechte Hand und fuhr mir damit über den Kopf. Meine Finger glitten über weiches Haar, das in meinem Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden war. So, wie ich es immer getragen hatte. Davor.
»Zoë?«
Die Stimme kam von hinten und war mir sehr vertraut. Doch sie klang unsicher, zögerlich. Ich schlug die Augen auf und drehte mich um.
Er sah anders aus. Glatter, makelloser und gesünder. Nicht so geschunden. Seine Haut zeigte keine Sorgenfalten, doch seine Augen waren noch genauso traurig wie zuvor.
»Kip«, sagte ich und lächelte. Es war unbeschreiblich schön, ihn zu sehen, auch wenn ich wusste, dass ich nicht den echten Kip vor mir hatte. Seine Tätowierungen fehlten, vermutlich hatten sie keine Zeit gehabt, die aufwendigen Fische in das Interface einzuspeisen.
Er trat auf mich zu und nahm mich fest in die Arme. Zu meiner Überraschung wurde ich von einer Welle aus Gefühlen überrollt, die mich mitriss. Ich wurde von heftigem Schluchzen geschüttelt, fühlte Glück und Erleichterung, Scham und Verzweiflung, alles gleichzeitig und alles durcheinander.
Kip hielt mich fest und ließ mich weinen, strich mir mit seinen großen Händen über den Rücken, die Arme und den Kopf, und aus irgendeinem verrückten Grund wusste ich, dass ich ihm nichts erklären musste. Er verstand mich auch so. Kip wusste, dass es mir leidtat. Er wusste, wo wir waren. Irgendwann würde ich ihm das ganze Ausmaß dessen, was passiert war, erklären, doch jetzt war nicht der Augenblick dafür. In diesem Moment verabschiedete ich mich von allem, was ich nicht ändern konnte, trauerte um das, was ich verloren hatte, und war erleichtert über das, was mir geblieben war. Ich weinte, weil es die einzige Option war, die ich in diesem Augenblick hatte.
Weil ich keine Angst und keine Wut mehr in mir hatte.
»Hey, was ist denn hier los?«
Ich zuckte zusammen, weil ich nicht mit Jonahs Stimme gerechnet hatte. Schnell machte ich mich von Kip los und wischte mir übers Gesicht.
Und da stand er. Groß, muskulös, mit seinen wirren Haaren und dem wunderbaren, entwaffnenden Grübchen. Sein Blick verriet mir, dass er sich keinen Reim auf das machen konnte, was er gerade sah. Wie könnte er auch?
»Nichts«, beeilte ich mich zu sagen, und Jonah zog die Augenbrauen hoch.
»Nach nichts sah das aber gar nicht aus«, sagte er.
Hörte ich da etwa Eifersucht in seiner Stimme?
Ich wollte gerade Luft holen, um irgendeine an den Haaren herbeigezogene Erklärung für die Situation vom Stapel zu lassen, als es geschah.
Erst flackerte die Welt um uns herum ganz leicht. Wie bei einer Stromschwankung. Wir alle drei bemerkten es und richteten unsere Blicke nach oben, so als läge die Erklärung für das Flackern am Himmel.
Ein zweites Mal verschwand der Garten, diesmal länger. Es dauerte sicher zwei oder drei Sekunden, bis unsere Umgebung wieder erschien.
»Scheiße, was ist denn hier los?«, hörte ich Jonah noch fragen.
Dann wurde alles schwarz.
0
Als die ersten Bomben fielen, waren alle überrascht. Selbst diejenigen, die damit gerechnet hatten, die Wochen und Monate gerungen und diskutiert hatten, um diesen Krieg in letzter Sekunde zu verhindern. Auch die Flugzeugpiloten und Politiker waren überrascht über die Wucht der Detonationen, über die Zerstörung und den plötzlichen, allgegenwärtigen Tod. Seit weit über hundert Jahren hatte es in Europa keinen Krieg mehr gegeben. Niemand war diese Form der Gewalt mehr gewöhnt, kein Mensch hatte jemals ein solches Inferno erleben müssen. Während der großen Dürren und der Völkerwanderung hatten alle viel durchstehen müssen, sie waren ein hartes Leben gewöhnt, doch Krieg und Zerstörung waren Dinge, die sie sich dennoch nicht hatten vorstellen können. Dieser Krieg, davon waren die südlichen Staaten überzeugt, war unumgänglich geworden. Was nützten ihnen all ihre Waffen, ihr Geld und ihre Kultur, wenn sie kein Wasser hatten? Und Deutschland war schuld daran. Manchmal musste man töten, um überleben zu können.
Zuerst traf es Berlin. Auch darüber waren alle überrascht, obwohl es absehbar gewesen war. Die meisten Leute hatten sich mit dem Gefühl schlafen gelegt, eine weitere ruhige Nacht vor sich zu haben. Jeder hatte getan, was er um diese Uhrzeit immer tat. Was vielleicht der Tatsache geschuldet war, dass es keinen Evakuierungsplan für die Stadt gegeben hatte und die alten Luftschutzbunker längst vergessen waren. Um eine Panik zu vermeiden, hatte man die Bevölkerung nicht informiert. Man hatte ja ohnehin bis zum Schluss nicht damit gerechnet, dass die Südstaaten Ernst machen würden. Warum also alle Welt beunruhigen?
Die Nachtschwärmer feierten, die Busfahrer fuhren Bus, manch einer wälzte sich unruhig im Schlaf hin und her, geplagt von kleinen Alltagsproblemen, doch ohne Angst vor den Bomben, die in den Bäuchen der Flugzeuge direkt über ihnen darauf warteten, fallen gelassen zu werden.
Die Einzigen, die nicht überrascht waren, waren die Mitglieder der HOME-Fundation. In letzter Sekunde hatten sie alle Habseligkeiten, von denen sie sich nicht hatten trennen wollen, in den Lagerbunkern untergebracht. Um ein Haar wären sie nicht mehr rechtzeitig vor dem Angriff in den Wohnbunker gelangt, weil ausgerechnet der Ministerpräsident Italiens die Einlagerung seiner teuren Oldtimer höchstpersönlich hatte überwachen wollen. Doch als der erste, heftige Schlag den Berliner Boden erzittern ließ, saßen sie alle sehr selbstzufrieden im großen Salon des Bunkers und stießen mit feinstem Champagner an – auf das Ende der Welt.
I
Die Übelkeit war unbeschreiblich. Noch bevor ich richtig wach war, wurde mein Körper von heftigen Krämpfen geschüttelt, bäumte sich auf und zog sich wieder zusammen. Ich würgte und schnappte nach Luft, würgte wieder, doch bis auf ein bisschen bittere Galle wollte nichts meinen Körper verlassen. Um mich herum war kein Licht, aber es war auch nicht richtig finster, sondern vielmehr auf eine Art dunkel, bei der man genau weiß, dass in der Nähe irgendwo Licht brennt. Künstliches, blau-grünes Licht. Ein sanftes, stetiges Summen lag in der Luft, und es roch steril, irgendwie medizinisch, aber nicht unangenehm. Eher neu. Unverbraucht.
Viel erkennen konnte ich nicht, da ein Tränenschleier über meinen Augen lag, der sich nicht wegblinzeln ließ, solange die Krämpfe meinen Körper beherrschten. Mit aller Kraft versuchte ich, mich aufs Atmen zu konzentrieren. Ein und wieder aus. Ein. Aus. So tief ich konnte.
Zu Beginn zitterte mein Atem noch, doch dann beruhigte er sich allmählich, und schließlich ließen auch die Krämpfe nach. Ich konnte spüren, wie sich mein Herzschlag wieder normalisierte. Das war doch schon mal was. Mit geschlossenen Augen zählte ich langsam bis zwanzig und versuchte, mich weder von Angst noch von Übelkeit überwältigen zu lassen. Ich war orientierungslos und verwundbar, doch das war nichts, womit ich nicht klarkam. Es war nicht mein erstes Mal.
Noch so einen Krampf konnte ich jedenfalls nicht gebrauchen, mein Bauch fühlte sich jetzt schon an, als hätte ich mehr als hundert Sit-ups hinter mir. Was ich jetzt wirklich brauchte, waren all meine fünf Sinne in Hochform.
Als ich das Gefühl hatte, ganz ruhig zu sein, öffnete ich die Augen wieder und versuchte zu verstehen, was ich sah. Offenbar lag ich unter einer Glaskuppel oder in einer Glasröhre. Über mir wölbte sich eine dicke Scheibe. Ich hob die rechte Hand und prüfte, ob sich das Glas bewegen ließ, doch es saß fest und rührte sich nicht. Augenblicklich drohte ich von der Angst zu ersticken übermannt zu werden, doch ich mahnte mich zur Ruhe. Wenn der Sauerstoff im Inneren dieser Röhre knapp wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst aufgewacht. Meine Atemluft wirkte frisch und unverbraucht, wahrscheinlich gab es ein integriertes Lüftungssystem. Kein Grund zur Beunruhigung.
»Guten Tag, Kapitän Baker«, erklang eine professionell wirkende weibliche Stimme, und ich zuckte zusammen. Sie war so nah an meinem Ohr, dass ich das Gefühl hatte, jemand müsse neben mir sitzen, doch als ich den Kopf drehte, war um mich herum nichts als Dunkelheit. »Herzlich willkommen auf der Mother«, sagte die Stimme. »Ich bin IRA, der intelligente Raumschiff-Assistent. Bitte identifizieren Sie sich mittels einer Stimmprobe!«
Mother. Irritiert schüttelte ich den Kopf. In meinem Geist setzten sich Bruchstücke zu einem Bild zusammen, doch das ging nur quälend langsam voran.
»Bitte identifizieren Sie sich mittels einer Stimmprobe«, wiederholte die Stimme.
Vorsichtig räusperte ich mich. Es tat nicht halb so weh, wie ich befürchtet hatte. »Hallo«, sagte ich und kam mir dabei irgendwie dämlich vor. Doch der Computer schien zufrieden zu sein.
»Vielen Dank«, sagte die Stimme. »Ihre Probe stimmt mit der hinterlegten Stimme überein. Sie sind Zoë Alma Baker, Kapitän der HOME-Fundation und dieses Schiffs. Von nun an bin ich rund um die Uhr für Sie da. Als Kapitän der Mission stehe ich Ihnen exklusiv zur Verfügung. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, wenden Sie sich einfach an mich.«
»Danke«, murmelte ich, noch immer leicht verwirrt.
»Gern geschehen. Bevor Sie nun ihre Suite beziehen können, muss ich Kapsel- und Kabinendruck ausgleichen. Dieser Prozess kann noch eine Weile in Anspruch nehmen, dient aber ausschließlich Ihrer Sicherheit. Machen Sie es sich bequem und bewahren Sie Ruhe.«
»Okay«, seufzte ich, mehr zu mir selbst.
»Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden«, sagte die Stimme.
»Nichts.«
»Okay.«
Wollte die mich etwa verarschen? Ich atmete einmal tief durch und versuchte, mich zu entspannen, doch das gelang mir kaum, da ich mehr und mehr begriff, was hier vor sich ging. Mein Gehirn nahm seine Arbeit auf, als hätte man ein Licht eingeschaltet. Ich befand mich also auf der Mother, dem Raumschiff, das mich und meine Crew auf den erdähnlichen Planeten Keto bringen sollte, damit wir dort eine Kolonie für wohlhabende Erdbewohner aufbauen konnten, die keine Lust hatten, im Wasserkrieg ihr Leben zu lassen. Die über Leichen gegangen waren, um ihr Ziel zu erreichen, und mich nur am Leben gelassen hatten, weil sie mich brauchten, um ihre reichen Ärsche zu retten.
Die Erinnerungen kamen nun beinahe im Sekundentakt. Alles, was mir in Berlin widerfahren war, all die Emotionen, Menschen, Freude, Liebe, Angst und Wut prasselten auf mich ein und nahmen mir schier den Atem. Am liebsten hätte ich die Geschwindigkeit gedrosselt, mich Stück für Stück erinnert, doch ich hatte keinen Einfluss darauf. Es war, als wäre in meinem Kopf ein Damm gebrochen, als hätte die Flut eine Mauer eingerissen und ergösse sich nun schwallartig in mein Gehirn. Es war wie ertrinken.
Ich konnte mich an alles erinnern. Wie die HOME-Fundation arme Familien erpresst hatte, damit diese ihre Kinder zu Forschungszwecken abgaben. Wie mich Professor Bornkamp vom Akademie-Interface entfernt hatte, um die Mission zu sabotieren, und dafür mit seinem Leben bezahlt hatte. So wie schon viele andere vor ihm. Darunter Zac de los Santos. Mein kleiner Schützling – Kips kleiner Bruder.
Kip. Jonah. Mein Bruder Tom. Clemens und Ma. Doktor Akalin. Wenn Doktor Jen Wort gehalten hatte, dann mussten sie sich allesamt mit mir auf diesem Schiff befinden. Was bedeutete, dass von nun an ich für ihre Sicherheit verantwortlich war. Leider hatte ich gelernt, dass man sich auf Doktor Jen nicht verlassen konnte. Die Frau, die mich großgezogen hatte, war eine skrupellose Verbrecherin, die selbst vor Mord nicht zurückschreckte. Ich wollte so schnell wie möglich sichergehen, dass mit den anderen alles in Ordnung war. Doch solange ich hier in dieser Kapsel festsaß, konnte ich überhaupt nichts tun. Obwohl.
»Hallo? Computer?«, fragte ich.
»Nennen Sie mich Ira«, antwortete die Stimme prompt.
»In Ordnung, Ira«, sagte ich. »Weißt du, ob Jonah Schwarz auf diesem Schiff ist?«
»Leider nein. Ich bin nur für Sie und ihre direkten Belange zuständig, Kapitän. Wenn Sie auf der Brücke sind, können Sie alles selbst überprüfen.«
Als wäre mein Verlobter keines meiner direkten Belange. Ich schnaubte und versuchte, mich zusammenzureißen. Eigentlich wollte ich keine Sekunde länger auf meine Antwort warten. Ich dachte angestrengt nach. »Kannst du mir sagen, wie viele Menschen insgesamt auf diesem Schiff sind?«
»Es sind genau vierzehn, Kapitän!«
Was hatte sie da gerade gesagt? Mein Herz begann zu rasen. Vierzehn waren viel zu wenig. In dem Raum mit den Betten hatten sich mindestens dreißig Kinder befunden, auf der Akademie weit mehr. Vielleicht hatte ich mich ja auch verhört und sie hatte vierzig gesagt?
»Vierzig Menschen?«, fragte ich daher und verfluchte mich selbst dafür, dass meine Stimme so ängstlich klang.
»Vierzehn«, wiederholte Ira. »Vierzehn lebende Menschen und eine Leiche.«
»Was?«, schrie ich, und der Schall meiner Stimme wurde von dem gewölbten Glas schmerzhaft laut zu mir zurückgeworfen.
»Vierzehn lebende Menschen und eine Leiche.«
Die Übelkeit kam mit unerwarteter Heftigkeit zurück. Das beinahe Schlimmste war, dass Ira den Tod eines Menschen verkündete, wie andere Leute über das Wetter sprachen. Natürlich war das ganz normal, sie war schließlich kein lebendes Wesen, sondern ein Computerprogramm. Trotzdem. Es klang so banal – als hätte sie mir die Bestandsliste eines Lagers vorgelesen. Und irgendwie hatte sie das ja auch.
Meine Gedanken rasten, die Fragen überschlugen sich regelrecht. Wer von ihnen war gestorben? Waren Jonah, Kip und Tom noch am Leben? Und was war mit meinen Eltern? Was mit Akalin? Ich allein war der Grund dafür, dass sie hier auf diesem Schiff waren. Wenn einer von ihnen nicht mehr lebte, dann … Und wo zur Hölle waren die anderen? Was war mit dem Rest der Akademie passiert?
»Ich muss hier raus!«, stöhnte ich und begann, mit der Faust gegen die Scheibe zu schlagen.
»Bleiben Sie bitte ruhig, Kapitän Baker!«, sagte Ira.
»Wie zur Hölle soll ich ruhig bleiben?«, schrie ich. Es tat gut, Ira anzuschreien. Immerhin war es das Einzige, was ich überhaupt tun konnte. »Du hast mir gerade gesagt, dass ein Mensch während der Reise hierher gestorben ist!«
»Das ist eine gute Quote«, sagte Ira, und ich schloss die Augen. Eine gute Quote. Ich hätte es ahnen müssen. Dr. Jen und ihre Arbeitgeber hatten die ganze Zeit schon unser aller Leben mit einer Selbstverständlichkeit gefährdet, die einem den Verstand rauben konnte.
»Was meinst du mit ›gute Quote‹?«, fragte ich so ruhig wie möglich.
»Es wurde ein Schwund von mindestens 20 % erwartet. Lediglich ein Toter ist also ein zufriedenstellendes Ergebnis.«
»Zufriedenstellendes Ergebnis«, murmelte ich fassungslos. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Versuchte, mir vor Augen zu halten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einem meiner Lieben etwas zugestoßen war, immerhin nicht besonders hoch war. Allzu niedrig war sie aber auch nicht.
Wer war gestorben? Ich musste es wissen, wollte es aber gleichzeitig nicht erfahren. Einerseits wollte ich so schnell wie möglich aus dieser Röhre raus und nachsehen, andererseits wollte ich nichts weniger als das. Denn egal, wer die Reise nicht überlebt hatte: Ich würde eine Leiche finden. Jemand hatte irgendwo zwischen der Erde und hier sein Leben verloren und wir anderen hatten das einfach verschlafen. Was für ein trauriger Tod.
Noch mehr Bilder aus meiner Zeit in Berlin kamen zu mir zurück. Wie ich in Professor Bornkamps Haus die Treppe hochgegangen war und seine Leiche dort im Arbeitszimmer gefunden hatte. Was sein Anblick in mir ausgelöst hatte. So viel Traurigkeit, so eine nagende Leere. Fassungslosigkeit. Unglauben. Und ja: Angst.
Ich fragte mich, ob es leichter für mich gewesen wäre, vorher schon zu wissen, dass ich einen toten Menschen finden würde, oder ob es das noch schlimmer gemacht hätte. Ich hatte keine Antwort.
Endlich zischte es an meinen Ohren und das Glas über meinem Kopf glitt zur Seite. Gleichzeitig merkte ich, wie sich Bänder aus Metall um meinen Körper legten.
»Hey, was soll denn das?«, fragte ich unwirsch, während sich die Metallbänder fest um meinen Körper schlossen. Das Glas war mittlerweile verschwunden, doch aufstehen konnte ich noch immer nicht.
»Um Ihren Kreislauf zu aktivieren, werden Sie nun in eine aufrechte Position gebracht«, antwortete Ira. »Wenn Sie zu schnell aufstehen, könnten Sie sich ernsthaft verletzen. Die Metallbügel dienen nur Ihrem Schutz.«
Rührend, wie hier alles darauf ausgelegt war, meine Sicherheit zu gewährleisten, dachte ich bitter. Als wäre ihnen ein Menschenleben tatsächlich etwas wert.
»Entspannen Sie sich«, sagte Ira.
Wie auf Kommando begann mein Bett, sich sachte zu bewegen. Quälend langsam ging es von der horizontalen in eine vertikale Position über. Es fühlte sich merkwürdig an, einfach so »aufgestellt« zu werden. Ein wenig kam ich mir vor wie eine fabrikneue Menschenpuppe, die nun den letzten Feinschliff bekam, bevor sie ausgeliefert wurde. Ich konnte es einfach nicht leiden, keine Kontrolle zu haben, und ausgerechnet ich hatte schon sehr oft keine Kontrolle über mein eigenes Leben gehabt. Es blieb mir nur, zu hoffen, dass sich dieser Zustand irgendwann mal ändern würde. Immerhin war ich nun Kapitän dieser Mission und Dr. Jen war weit weg. Auf der Erde. Hier konnte sie nicht mehr auf mich zugreifen. Der Gedanke daran, dass ich mich auf einem Raumschiff mitten im All befand, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Und dass ich nun geweckt worden war, konnte nur bedeuten, dass wir unserem Ziel schon sehr nahe waren.
»Ira, wie lange noch bis zu unserer Zielposition?«
»Der Planet Keto ist noch genau 28 Stunden Flugzeit entfernt«, antwortete Ira, und ich schluckte. Das bedeutete, dass ich drei Jahre lang in diesem Bett geschlafen hatte.
Endlich lösten sich die Metallbügel, die meinen Körper hielten, und ich wurde erstaunlich sanft auf die Füße gestellt. Augenblicklich fingen meine Beine an zu zittern.
Der Raum erhellte sich langsam, als wollte auch er mir Zeit geben, auf dem Schiff anzukommen. Doch viel war nicht zu entdecken. Es war ein kleiner Raum mit hellen, kahlen Wänden, in die hier und da Leuchtplatten eingelassen waren. Die Kapsel war das einzige Möbelstück, das sich darin befand. Wenn man so was überhaupt als Möbelstück bezeichnen wollte. Aber wie sonst?
Neben mir erklang ein hydraulisches Zischen und eine Klappe ging auf. Darin befand sich ein Glas mit einer trüb-weißen Flüssigkeit.
»Trinken Sie das!«, forderte Ira mich auf.
»Was ist das?«
»Eine hochkomplexe Nährlösung. Sie sollte helfen, die Folgen des Schlafs auf Ihren Körper deutlich zu reduzieren.«
Ich griff nach dem Glas und leerte es in einem Zug. Es schmeckte irgendwie nach flüssigen Kartoffeln. Und tatsächlich hörten kurz darauf meine Beine auf zu zittern und auch mein Magen beruhigte sich. Ich konnte nur hoffen, dass es auf diesem Schiff literweise von dem Wunderzeug gab. Ich würde es brauchen – und die anderen auch. Mit dem Handrücken wischte ich mir über den Mund und straffte entschlossen die Schultern. Genug getrödelt.
Mit ein paar Schritten war ich an der schmalen Metalltür, die automatisch und geräuschlos zur Seite glitt und den Blick auf ein luxuriös eingerichtetes Zimmer freigab.
»Willkommen in Ihrer Suite«, sagte Ira, doch mit meiner Suite konnte ich mich jetzt nun wirklich nicht beschäftigen. So schnell es meine dünnen Beine zuließen, durchquerte ich das Zimmer und lief auf die nächste Tür zu, die sich ebenfalls geräuschlos öffnete. Ehe ich mich’s versah, stand ich in einem kargen Flur. Nach links und rechts bot sich mir dasselbe Bild: Türen über Türen, die einen weißen Flur säumten.
»Ira, wo sind die anderen untergebracht?«
»Spezifizieren, bitte!«
»Ich möchte wissen, wo meine Crew ist!«
»Die anderen menschlichen Lebensformen befinden sich in Sektion C.«
»Und wie komme ich da hin?«
»Sektion C befindet sich auf Deck 5«, antwortete Ira.
Ich atmete einmal tief durch. »Okay«, sagte ich genervt. »Versuchen wir es anders: Wie komme ich zur Brücke?«
»Links entlang. Aber Sie dürfen die Brücke nur in Ihrer Uniform betreten, Kapitän!«
Ich blickte an mir hinunter. Mein Körper steckte in einem hellen Kittel, der mich stark an die Kleidung erinnerte, die ich in der Charité hatte tragen müssen. Ich war barfuß, doch der Boden, auf dem ich stand, war angenehm warm.
»Ich bin ja nicht nackt«, gab ich ungehalten zurück und wandte mich nach links.
Der Flur kam mir endlos vor. Er verlief in einer leichten Rechtsbiegung, und ich vermutete, dass die Mother, wie die meisten Raumschiffe, vorne rund zulief, um der Crew auf der Brücke einen Panoramablick zu bieten.
Und endlich führte der Flur an einen Scheitelpunkt, an dem sich eine große Flügeltür öffnete. Ich trat hindurch.
»Der Kapitän ist auf der Brücke«, sagte Ira. Automatisch gingen sämtliche Lichter der Kommandozentrale an und auch die Computer erwachten zum Leben.
Ich musste trotz meiner Eile einen Augenblick innehalten, denn was ich nun sah, raubte mir schlichtweg den Atem. Es war nicht die Brücke selbst, die mich gefangen nahm – mein Blick huschte nur kurz über die weißen Ledersessel, die unzähligen Bildschirme und Touchscreens –, sondern die Aussicht, die sich mir durch das tatsächlich riesige Panoramafenster bot. Etwas so Schönes hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Durch das Fenster erblickte ich unzählige Sterne. Tausende, Abertausende, Millionen. Meine Augen reichten nicht aus, sie alle zu erfassen, dabei wollte ich jeden einzelnen von ihnen ansehen. Auf der Akademie hatten wir selten Sterne gesehen, da es uns nicht erlaubt gewesen war, nachts das Gebäude zu verlassen, und in Berlin … in Berlin gab es so gut wie keine Sterne – dafür war die Stadt zu hell und die Luft zu schmutzig. Doch so oder so war ich mir sicher, dass sich nirgendwo auf der Erde solch ein Anblick bot – selbst in der einsamsten Wüste nicht. Beinahe wirkte es, als hätte jemand ein schwarzes Ballkleid mit unzähligen, funkelnden Steinen vor dem Fenster ausgebreitet. Es sah aus, als würde sich die Mother gar nicht bewegen, dabei wusste ich doch, dass sie mit aberwitziger Geschwindigkeit durch den Raum raste. Doch es wirkte, als schwebe sie in einem Meer aus winzigen, brennenden Kerzen. Das Weltall umschloss uns und ich fühlte mich geborgen und unendlich einsam zugleich.
Was mich daran erinnerte, dass ich nicht allein auf diesem Schiff war. Das Wichtigste war nun, erst einmal die anderen zu finden, zu sehen, wen ich auf dem Flug verloren hatte. Beim Gedanken an Kip und Jonah wurde mir der Hals eng und mein Herz begann sofort zu schmerzen. Ich atmete durch, riss mich zusammen und ging ein paar Schritte weiter in den Raum hinein, auf den Sessel zu, der mir zugedacht war.
Ich kannte diese Brücke. Im Simulator hatte ich unzählige Male auf diesem Sessel im Zentrum gesessen und das Landemanöver geübt. Da ich den großen Computer in der Mitte am besten kannte, ging ich darauf zu und tippte ihn an.
»Machen Sie Ihre Eingabe«, forderte mich die vertraute männliche Computerstimme auf, und ihr Klang beruhigte mich ein wenig. Es war, wie einen alten Freund zu treffen. Und das, obwohl wir in der Vergangenheit nicht immer gut miteinander ausgekommen waren. Diese Kleinigkeit schaffte es, mir Mut einzuflößen.
»Suche nach Sektion C, Deck 5«, sagte ich mit fester Stimme, und augenblicklich erschien ein Modell des Schiffs auf dem Bildschirm. Dort, wo ich stand, leuchtete ein roter Punkt, Sektion C auf Deck fünf blinkte grün. Ich stöhnte auf. Die Sektion lag genau am anderen Ende des Schiffs. Ich befand mich in Sektion A auf Deck 1. Weiter entfernt konnten die anderen gar nicht sein.
»Zeig mir den Weg«, forderte ich, und eine rote Route erschien. Hinter der Tür zur Brücke lagen Fahrstühle, die mich zu Sektion fünf bringen würden. Den Rest musste ich leider laufen.
Natürlich wusste ich, dass ich gerade großem Schmerz entgegenlief. Doch vor ihm wegrennen konnte ich ohnehin nicht. Es würde schrecklich werden, das war mir klar, aber wenigstens würde ich in wenigen Minuten Gewissheit haben, wen von meiner Crew ich verloren hatte, während ich schlief, und wer auf der Erde zurückgelassen worden war. Oder sich gerade sonst wo befand. Hannibal und Dr. Jen war alles zuzutrauen.
Ich wusste, dass mein Herz in wenigen Minuten brechen würde. Zum hundertsten Mal. Trotzdem lief ich, so schnell mich meine Füße trugen.
II
Ich bewegte mich wie ferngesteuert. Alles um mich herum wirkte unecht und bizarr, fremd, steril und unbewohnt. Natürlich wusste ich, dass es einfach daran lag, dass ich auf der Erde eingeschlafen und auf einem Raumschiff Jahre später wieder aufgewacht war, noch dazu als Erste der gesamten Crew, doch ich hätte erwartet, vertrauter mit der Mother zu sein. Mich besser auf dem Schiff auszukennen. Ich war für die Mission ausgebildet worden, doch ich wusste nicht, was ich als Nächstes zu tun hatte, musste dieses Schiff steuern und landen, ohne es wirklich zu kennen. Sollte ein Kapitän sein eigenes Schiff nicht kennen wie seine rechte Hand?
Die Mother war riesig. Viel größer, als ich sie mir jemals vorgestellt hatte. Sie wirkte zudem luxuriös, hochwertig, eher wie ein Kreuzfahrtschiff für den Weltraum. Für eine militärische Operation hätten weniger Platz und Ausstattung ausgereicht. Natürlich mussten wir eine Unmenge Material, Ausrüstung und Vorräte transportieren, wir mussten schließlich eine Kolonie auf Keto aufbauen, dennoch irritierten mich die hellen, hochwertig ausgestatteten Räume und Flure. Selbst die Aufzüge wirkten wie in einem teuren Hotel. Einer von ihnen trug mich gerade lautlos nach unten, in Richtung Deck 5. Ich hatte mehr als tausend Fragen, doch ich versuchte, sie wegzuschieben, da sie mir ja doch niemand beantworten konnte. Die oberste Priorität war, dass ich zu den anderen gelangte.
Die Aufzugtür glitt auf, und ich entschied mich für den rechten äußeren Flur, der mich in die hinterste Sektion des Decks bringen würde. Ich hätte auch den linken nehmen können, auf jedem Deck zogen sich die Außenflure ringförmig durch das Raumschiff. Ich versuchte zu rennen, doch mein Körper wollte nicht mitmachen. Das war nur normal, immerhin hatte ich jahrelang gelegen, und obwohl ich mich nicht halb so schlecht fühlte wie beim letzten Mal, so war ich doch noch ziemlich wackelig auf den Beinen. Endlich erreichte ich eine große Metalltür am Scheitelpunkt des Flurs. Hinter dieser Tür musste sich der Raum befinden, in dem die anderen lagen.
Ich stellte mich vor den Netzhautscanner. Kurz darauf glitt die Tür auf, und ich musste für einen Augenblick innehalten, um das Bild, das sich mir bot, zu verarbeiten.
Der Raum an sich wirkte wie ein Lagerraum, kahl und funktional, nicht so wie das Hinterzimmer, in dem ich aufgewacht war. Er hatte nichts von dem hellen, sterilen Luxus des restlichen Schiffs, sondern wirkte leblos und irgendwie verlassen. Was besonders merkwürdig war, befanden sich hier doch alle anderen Menschen, die mit mir reisten.
Es war ein verstörender Anblick. Die anderen lagen in sanft beleuchteten Glasröhren, die genauso aussahen wie meine. Alle trugen dasselbe weiße Nachthemd, das auch meinen Körper bedeckte, die Augen geschlossen, die Köpfe auf weiße Kissen gebettet. Damit hatte ich gerechnet, doch was mir den Atem raubte, war die schiere Menge der leeren Röhren, die in unzähligen Reihen den Raum ausfüllten. Es mussten Hunderte sein.
Das bestätigte mein Gefühl, dass dieses Schiff wohl ursprünglich zu einem anderen Zweck gebaut worden war und viel mehr Menschen eine Überfahrt hatte ermöglichen sollen. Doch warum waren dann nur vierzehn von uns hier an Bord, warum hatte man nicht alle Schüler der Akademie in den Weltraum geschickt? Unbehagen überfiel mich, während ich begann, langsam auf die Röhren zuzugehen, in denen die anderen lagen. Es sah so falsch aus. Menschen sollten nicht reglos in Glasröhren liegen – sie wirkten beinahe wie Konservendosen auf mich. Ein menschliches Vorratsregal.
An jeder Röhre war ein kleiner Bildschirm angebracht, der Herzschlag, Atem und Hirnfrequenzen aufzeichnete und den Namen desjenigen zeigte, der sich in der Röhre befand. Meine Erleichterung war grenzenlos, als ich Imogene und Katy erkannte. Wenig später fand ich die Röhre mit meinem Bruder und hielt einen Augenblick inne, um mich zu vergewissern, dass sich seine Brust gleichmäßig hob und senkte. Das Glück, das ich empfand, als ich ihn ansah, war kaum in Worte zu fassen. Mein großer Bruder war mit mir auf diesem Schiff. Ich war nicht allein. Wir waren zusammen und das erfüllte mich mit Zuversicht. Natürlich wusste ich, dass es eine egoistische Freude war, doch ich genoss sie in vollen Zügen. Nun fühlte ich mich stärker. Tom war ein Mensch, der mit beinahe jeder Situation umgehen konnte, der es schaffte, aus allem das Beste zu machen. Einer, den jeder gern in seiner Crew hätte. Die Jahre, die vergangen waren, sah man ihm deutlich an, ihm war ein wilder Bart gewachsen, und auch seine Haare waren, wie die von allen hier, ziemlich lang.
Unwillkürlich fasste ich mir selbst an den Kopf und stellte fest, dass auch ich mittlerweile recht lange Haare hatte. Gut. Die kurzen, lückenhaften Stoppeln würde ich sicher nicht vermissen.
Mein Blick glitt zur Seite und ich schnappte nach Luft. Zwei Röhren von Tom entfernt lag Jonah. Dieses Profil würde ich überall erkennen. Ich wollte nach ihm sehen, wollte mich vergewissern, dass alles in Ordnung war – doch was, wenn nicht? Was, wenn Jonah derjenige war, der nicht mehr atmete? Dessen Brust sich nicht mehr hob und senkte? Dessen Herz nicht mehr schlug? Wie sollte ich dann überhaupt weiterleben? Langsam, wie von einem unsichtbaren Seil gezogen, ging ich auf ihn zu. Als ich vor seiner Röhre stand, entfuhr mir ein lautes Schluchzen. Es war, als würde mein ängstliches Herz aufatmen und gleichzeitig entzweibrechen, eine Mischung aus unbändiger Freude und riesigem Schmerz. Jonah atmete. Die Werte auf seinem Bildschirm waren normal, sein schönes Gesicht sah friedlich und beinahe vergnügt aus. Jonah Schwarz lächelte sogar im Koma.
Ich wollte stark sein, mich zusammenreißen, aber ich schaffte es nicht. Für wen auch? Der Schmerz und die Freude in meiner Brust waren zu überwältigend. Ich sackte über Jonahs Röhre zusammen und weinte eine Weile, wobei ich das blank polierte Glas mit Tränen und Rotz verschmierte. Als ich mich ausgeweint hatte, putzte ich die Scheibe leicht verschämt mit dem Ärmel meines Hemds blank. Ich wollte nicht, dass Jonah aufwachte und durch verschmiertes Glas schauen musste. Es war auch so schon alles einschüchternd genug.
Ich atmete durch. Zwei der Menschen, die ich liebte und die mir am Herzen lagen, waren gesund und am Leben. Doch die beiden waren nicht die Einzigen, um deren Wohlergehen ich gebangt hatte. Ich musste weitersuchen. Also riss ich mich von Tom und Jonah los und ging weiter, nur um ein paar Röhren weiter wieder zusammenzuklappen.
Auch Kip war okay. Sein breiter Körper füllte die Röhre beinahe vollständig aus, dennoch konnte ich sehen, dass auch er stark abgenommen hatte. Beim Anblick seiner wunderschönen Tätowierungen, die am Hals und an seinen Armen hervorblitzten, kamen mir Erinnerungen an die Zeit mit ihm. An seine wunderbare, traurige Art. Sein Angebot, mit ihm gemeinsam zu leben. Unser Kuss, der keiner hätte sein dürfen, weil er nie für ihn bestimmt gewesen war. Sein Geruch, seine feste, warme Haut. Die großen Hände. Daran durfte ich jetzt am allerwenigsten denken – und tat es trotzdem. Ich legte meine rechte Hand auf Höhe seines Herzens auf die Scheibe und sah ihn einfach nur an. Wenn ich gekonnt hätte, so hätte ich mich einfach neben ihn gelegt. Ich wusste, dass es mich getröstet hätte. Keine Ahnung, wie lange ich so dort stand. Ich konnte mich einfach nicht an seinem Gesicht sattsehen, hatte Angst, dass er verschwinden würde, sobald ich mich umdrehte. Dass er mich wieder verließ, dass seine Anwesenheit nur ein Traum gewesen war. Dass er aufhörte zu atmen, sobald ich ihm den Rücken zukehrte. Am liebsten hätte ich an seiner Röhre gewacht, bis er die Augen aufschlug. Doch das konnte ich mir nicht leisten, dafür hatte ich viel zu viel zu tun.
Sie waren alle drei in Ordnung. Nur das zählte. Ich schämte mich für die Erleichterung, die ich empfand, wusste, dass ich mich nicht freuen sollte, da ich noch immer nach einer Leiche suchte, doch ich konnte es nicht ändern. Meine Angst, dass es einen der drei getroffen hatte, war zu groß gewesen.
Ich schritt weiter die Röhren ab und fand auch meine beste Freundin Sabine, der ich immer noch nicht verziehen hatte, dass sie Jonah geküsst hatte. Obwohl sie es ja gar nicht wirklich getan hatte – mein Kopf hatte es sich nur ausgedacht. Sie konnte überhaupt nichts dafür. Trotzdem hatte es mir gereicht zu sehen, wie es aussehen könnte, wenn sie sich küssten. Und das hatte dazu geführt, dass ich meine Freundin nun mit ganz anderen Augen sah. Natürlich war das Sabine gegenüber nicht fair, aber ich konnte nichts dagegen tun.
Alle, an denen ich vorbeiging, waren am Leben, ihre Vitalfunktionen waren normal. Das war zwar eine gute Sache, doch meine Unruhe wuchs mit jedem Schritt. Wo waren die anderen Schüler der Akademie? Wie sollte ich diese Mission mit nur einer Handvoll Crewmitglieder leiten? Und wo befand sich der oder die Tote? Meine Eltern, so musste ich feststellen, waren in keiner dieser Röhren. Und ich hatte schon bis dreizehn gezählt. Entweder waren sie nicht auf diesem Schiff oder einer von ihnen war mitgeflogen und hatte es nicht überlebt. Eine Option furchtbarer als die andere. Ich wollte nicht daran denken, wie ich all das Tom erklären sollte. Er wusste nicht einmal die Hälfte von dem, was Kip und ich herausgefunden hatten. Und er hätte sein Leben gegeben, um Clemens und Ma zu schützen. All seine Sorge hatte sich stets nur um die beiden gedreht und nun war er von ihnen getrennt. Vielleicht würden wir niemals erfahren, was mit ihnen geschehen war.
Nur mit Mühe konnte ich mich zwingen, ruhig durchzuatmen. Wenn Clemens und Ma nicht auf diesem Schiff waren, dann hieß es, dass sie in Berlin zurückgelassen worden waren. Und das hieß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr lebten. Wie konnten unsere sanften, schwachen Eltern wohl einen Krieg überstehen?
Ich schloss für einen Moment die Augen. Bei dem Gedanken, dass ich es nicht mehr geschafft hatte, Ma zu sagen, dass ich ihr verzieh, tat mein Herz unendlich weh. Meine Zuneigung war alles gewesen, was sie gewollte hatte, und ich hatte sie ihr verweigert, war kalt und hartherzig gewesen, überzeugt davon, noch so viele Möglichkeiten zu haben, mich mit ihr zu versöhnen. Doch das Leben hatte es anders gewollt und ich hatte sie nicht mehr wiedergesehen. Weil sie als Geiseln genommen worden waren, um mich gefügig zu machen. Und jetzt war es zu spät.
Trotzig kämpfte ich die Tränen nieder, die in mir aufstiegen. Das brachte doch jetzt alles nichts.
Der Countdown, der auf den Displays zu lesen war, verriet mir, dass der Zeitplan vorsah, die anderen in 48 Stunden zu wecken. Bis auf Jonah und Sabine – meine beiden engsten Offiziere würden mir, wie es aussah, bei der Landung assistieren. Ihr Timer zeigte noch 24 Stunden an. Doch daran wollte ich jetzt noch gar nicht denken.
Mein Blick wanderte über die ordentlich aufgereihten, leeren Glasröhren, die den ganzen Raum ausfüllten. Irgendwo hier auf dem Schiff musste sich ein toter Mensch befinden. Und ich musste unbedingt wissen, wo. Um zu erfahren, wer.
Ira zu fragen, wäre sicherlich genauso nutzlos wie zuvor, doch an der linken Wand entdeckte ich eine Schaltzentrale.
Ich aktivierte sie und fand Übersichten zu allen Röhren und deren »Bewohnern« sowie einen Lageplan der Sektion. Es gab ein Kamerasystem, auf das ich zugreifen konnte, und nach wenigen Minuten wusste ich Bescheid. In einem kleinen Nebenraum stand eine einzelne Röhre.
Mit zitternden Knien machte ich mich auf den Weg. Wie ein kleines Kind wünschte ich mir nichts sehnlicher, als einfach nur weglaufen zu können. Ich wollte mich unter einer weichen Bettdecke verkriechen und nichts mehr sehen und hören müssen, sondern tagelang nur weinen. Doch das war mein Leben, es war mir nicht vergönnt, mich wegzuducken.
Ich stellte mich vor den Netzhautscanner und die Tür glitt mit einem leisen hydraulischen Zischen beiseite. Im Gegensatz zum restlichen Schiff war der kleine Raum, in dem ich nun stand, eiskalt. Sofort begann ich zu zittern, ob aus Kälte oder Nervosität wusste ich nicht zu sagen. Vermutlich verstärkte sich beides gegenseitig.
Der Körper, der in der Glasröhre lag, war komplett von einer feinen Eisschicht überzogen. Natürlich. Nach seinem Tod war er automatisch von den anderen separiert und eingefroren worden, damit keine Verwesung stattfand und sich keine Krankheiten auf dem Schiff ausbreiten konnten. Es war sinnvoll und gut so. Dennoch fand ich den Anblick bizarr.
Der schneeweiße, glitzernde Körper hatte eine unwirkliche Schönheit an sich. Obwohl der Bildschirm an der Seite der Röhre schwarz war, erkannte ich den Toten sofort. Vor mir lag Doktor Akalin. Von Frost überzogen, leblos. Vollkommen still.
Seit ich ihn kannte, war er immerfort müde gewesen. Nun schlief er für immer.
Trotz der Kälte sank ich neben der Röhre auf den Boden und lehnte die Stirn gegen das kalte Metall. Die Traurigkeit in meiner Brust fühlte sich dumpf und kraftlos an. Ausgerechnet den Unschuldigsten von uns allen hatte es getroffen. Akalin hatte sein ganzes Leben in den Dienst seiner Patienten gestellt, war immer nur gut und großzügig, fleißig und gütig gewesen, stets bemüht, so viele Menschen wie möglich zu retten. Er hatte sich nie geschont.
Für die Menschheit, für meine Mission und mein eigenes Leben war es ein großer Verlust, dass er nicht mehr da war. Voller Schmerz dachte ich an die Fotos, die ich in der Geheimschublade seines Schreibtischs an der Charité gefunden hatte. Die schöne Frau auf den Bildern, die lachenden Kinder. Waren sie ebenfalls bereits tot? War Akalin wieder mit ihnen vereint, an einem anderen Ort? Oder hatten sie schon lange vor der Mission aufgehört, ihn zu vermissen, weil er sein Leben der Medizin gewidmet hatte?
Mein Herz schmerzte beim Gedanken daran, dass er keine Gelegenheit bekommen hatte, sich von seinen Kindern zu verabschieden. Genauso wenig wie Clemens und Ma. Zur Trauer mischte sich blanke Wut in mein Herz. Wie viele Familien hatte diese Mission auseinandergerissen, wie viele Leben zerstört? All die Kinder, die so ahnungslos nebenan schliefen, würden ihre Familien niemals wiedersehen. Und das nur, weil es Menschen gab, die sich selbst für wertvoller hielten als andere. Die genug Geld hatten, für das Leben eines anderen Menschen einen Preis festzusetzen. Wir waren nur Zahlen für sie.
Ich rappelte mich hoch und aktivierte das Display, das Akalins Daten zeigte. Offensichtlich war er bereits kurz nach dem Start gestorben, eine Todesursache war jedoch nicht verzeichnet. Stirnrunzelnd tippte ich auf dem Screen herum, doch es waren keine Komplikationen oder Ähnliches zu finden. Es schien, als hätte sein Herz ganz einfach aufgehört zu schlagen.
Ich betrachtete den Körper des Arztes. Er war in guter Verfassung. Akalin war zwar nicht mehr ganz jung gewesen, doch auch noch lange nicht alt, vielleicht Mitte vierzig. Viel zu jung, um einfach so zu sterben. Gut, vielleicht hatte er zu wenig geschlafen und sich nicht allzu gesund ernährt, aber alles an ihm erschien kräftig und gesund. Da er kurz nach dem Start gestorben war, wirkte er auch noch recht gut genährt, kein Vergleich zu uns anderen.
Plötzlich schoss mir ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf. Was, wenn der Arzt Keto nie hatte lebend erreichen sollen? Akalin war der einzige Mensch, der keine Ahnung von der Fundation und der Mission gehabt hatte, der nicht irgendwie in der ganzen Sache mit dringehangen hatte. Ein intelligenter Mann, der den Dingen gern auf den Grund gegangen war, durchaus in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu erkennen. Er hätte unendlich viele Fragen gestellt und damit die gesamte Crew ins Wanken bringen können. Vielleicht hatten Dr. Jen und Hannibal dafür gesorgt, dass er starb. Vielleicht hatte Akalin nie eine Chance. Bei dem Gedanken kroch die Kälte auch in mein Herz.
Als auf einmal große, rote Buchstaben auf dem Bildschirm erschienen, zuckte ich zusammen. »Abstoßung einleiten« stand dort. Zitternd blickte ich mich um und bemerkte eine Klappe in der Wand des Schiffs, genau am Ende des Raums. Auch fiel mir auf, dass die Röhre auf Schienen stand, die zu eben dieser Klappe hinführten. Langsam drehte ich mich um die eigene Achse, und mein Blick fand ein kleines Häuschen aus Metall, das sich gegenüber der Klappe befand. Durch eine kleine Fensterscheibe konnte ich ein Bedienfeld erspähen. Natürlich. Alles war vorbereitet, um Akalins Körper in den Weltraum zu entlassen. Seine Leiche sollte auf ewig dort draußen zwischen den Sternen schweben. Irgendwie hatte diese Vorstellung etwas Tröstliches – auch wenn er dann niemals am Ziel sein würde. Wäre es nicht besser, ihn auf Keto anständig zu bestatten? Ich fragte mich, ob ich ihm nicht vielleicht eine richtige Trauerfeier schuldete. Tom und Kip, die ihn ebenfalls gekannt hatten, könnte ich so die Möglichkeit geben, sich von ihm zu verabschieden. Andererseits war es ein schauerlicher Gedanke, die Mission gleich mit einer Trauerfeier zu beginnen. Die anderen wussten ja nicht mal, dass die Akademie nur ein virtueller Ort war und die Mission von ein paar skrupellosen Menschen finanziert wurde. Dass wir und unsere Familien nur benutzt worden waren, nichts weiter als Marionetten in einem grausamen Spiel. Dass nichts von dem, was sie zu wissen glaubten, tatsächlich der Realität entsprach. Würden sie mich womöglich verantwortlich machen, weil ich der Kapitän war und die Wahrheit kannte? Es würde schwer genug werden, Jonah, Sabine und den anderen zu erklären, warum ich in Berlin gewesen war, warum mein Bruder und ein Freund plötzlich mit auf dem Schiff waren. Warum sie nicht ausgebildet waren. Warum ich die Mission trotzdem leitete, obwohl ich die Wahrheit kannte. Zum wiederholten Mal fragte ich mich, ob es nicht meine Pflicht gewesen wäre, mein Leben zu beenden, als ich noch Gelegenheit dazu gehabt hatte. Doch nach wie vor kannte ich die Antwort nicht. War dieses Leben hier besser als gar keins? Ungeduldig schüttelte ich den Kopf – meine Grübelei führte ja doch zu nichts.
Ich gab es ungern zu, doch ich wollte den Mitgliedern meiner Crew nicht auch noch erklären müssen, wer die fremde Leiche war und was mit Akalin passiert war. Was sollte ich ihnen auch sagen? Was geschehen war, lag jenseits des Erklärbaren.
Zwar war es egoistisch von mir, doch ich fasste den Entschluss, Akalin allein zu verabschieden. Die Aussicht, Kip und Tom niemals davon erzählen zu müssen, wenn ich nicht wollte, erschien mir zu verlockend. Keiner der beiden wusste, dass der Arzt mit aufs Schiff gekommen war. Ich hatte die Möglichkeit, Akalins Tod als Geheimnis zu behandeln. Und obwohl ich ahnte, dass Dr. Jen und Hannibal genau darauf gebaut hatten, wollte ich mich nicht anders entscheiden. Ich konnte einfach nicht.
Mein Blick glitt an mir hinab. Was ich allerdings konnte, war, mich wenigstens anständig anziehen und so dafür sorgen, dass Akalins Abschied etwas Würde bekam. Also verließ ich den kalten Raum, um mir nun doch noch meine Uniform anzuziehen.
III
Als ich in meiner Suite ankam, zitterte ich am ganzen Leib. Ich hatte zu lange neben Akalins Leiche in dem kalten Raum gestanden und war nun vollkommen durchgefroren. Es kostete mich all meine Willenskraft, das große, sehr weich und luxuriös wirkende Bett zu ignorieren, das so einladend im Zentrum des Zimmers stand. Schlafen durfte ich jetzt auf keinen Fall. Ich fragte mich sogar, ob ich überhaupt Gelegenheit bekommen würde, eine Nacht in diesem Bett zu verbringen. Ich hoffte es. In solch dicken Kissen hatte ich nämlich in meinem ganzen Leben noch nie gelegen.
Doch als ich in meinem privaten Badezimmer die riesige Dusche sah, vergaß ich kurz alles andere um mich herum. Ein schwacher, blumiger Duft hing in der Luft, das dunkel geflieste Badezimmer war angenehm warm, und die ebenerdige Dusche war eine funkelnde, glänzende Einladung. Wie lange war es her, dass ich ausgiebig warm geduscht hatte? Wegen der enormen Wasserknappheit war so was in Berlin gar nicht möglich gewesen, und auf der Akademie hatte ich zwar geduscht, doch das war nur eine Illusion gewesen, so wie alles andere im Interface. Während ich gedacht hatte, dass ich in einem der Waschräume unter der warmen Dusche stehe, hatte ich in Wahrheit in einem Berliner Keller im Bett gelegen, an einen Computer angeschlossen, der mir das Gefühl von warmem Wasser auf der Haut vorgegaukelt hatte. Wahrscheinlich hatte ich in Wahrheit seit fünfzehn Jahren nicht mehr heiß geduscht. Fünfzehn Jahre. Das kam mir aberwitzig vor. Doch konnte ich mir jetzt eine warme Dusche leisten, wo es so viel zu tun und herauszufinden galt?
Spätestens als mein Blick den Spiegel traf, der über dem Waschbecken hing, schmolzen die restlichen Bedenken dahin. Ich sah furchtbar aus. Meine braunen, schulterlangen Haare mit den pinken Spitzen hingen stumpf und strähnig um meinen Kopf herum, auf meiner Gesichtshaut klebten Rückstände von Tränen, Sabber, Galle und was weiß ich noch alles. Und mein Mund, das fiel mir in diesem Augenblick auf, schmeckte nach toter Katze. Alles in allem bot ich ein jämmerliches Bild. Ich zog mir das Nachthemd über den Kopf, stellte mich zitternd unter die Dusche und drehte das heiße Wasser voll auf.
Und in diesem Augenblick war ich mir ganz sicher, dass Glück aus einem Duschkopf strömen konnte. Mir war, als fühlte ich das erste Mal seit vielen Jahren etwas, mein ganzer Körper vibrierte vor Entspannung und Wohlbefinden. Mein Kopf war zwar schon seit einer Weile wach, doch jetzt erst erwachte mein Körper richtig. Jede meiner Hautzellen schien lebendig zu werden und sich dem himmlisch warmen Wasser entgegenzurecken.
Die Seife, die in einem Spender neben der Duscharmatur angebracht war, roch wundervoll und schäumte wie verrückt, sodass ich trotz allem vor Verzückung seufzen musste und sich ein Lächeln auf meine Lippen stahl. Kurz schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass gerade das letzte bisschen Berlin, das ich noch in Form von Dreck und Staub an mir getragen hatte, einen Abfluss hinabgespült wurde, doch das machte mich nicht allzu traurig. Schließlich hatte ich Tom und Kip. Dass die beiden bei mir waren, bedeutete mir alles.
Als meine Haut so rot war, dass ich fürchten musste, sie würde Blasen schlagen, stieg ich schließlich aus der Dusche und wickelte meinen Körper in ein riesiges, flauschig-weiches Handtuch, das genauso frisch und sauber roch, wie ich mich in diesem Augenblick fühlte.
Im Badezimmerschrank fand ich alles, was ich brauchte, und wenige Minuten später stand ich mit geföhnten Haaren, die ich zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und geputzten Zähnen vor meiner Uniform, die neu und glänzend in einem der großen Kleiderschränke hing.
Es war ein bittersüßer Augenblick für mich. Während meiner gesamten Ausbildung hatte ich mich immer unbändig auf diese Uniform gefreut. Ich hatte mir ausgemalt, wie es sein würde, sie zum ersten Mal anzuziehen. Wie stolz und glücklich ich mich fühlen würde, wenn ich sie endlich überstreifen durfte. An dem Tag, auf den ich jahrelang hingearbeitet hatte. Heute, um genau zu sein.
Doch natürlich fühlte ich nun weder Stolz noch Glück. Alles, wofür diese Uniform in meiner Vorstellung gestanden hatte, war hinfällig. Sie erinnerte mich nur noch daran, dass ich eine Gefangene in meinem eigenen Leben war und es für mich nur einen Weg gab: den, der mir von anderen Leuten zugedacht war. Kein Platz für Träume.
Trotzdem rührte der Anblick der Uniform etwas in mir. Kapitän Zoë Alma Baker stand mit goldenem Garn gestickt auf Höhe meiner rechten Brust. Dieses Kleidungsstück sagte mir, wer ich war und was meine Aufgabe war. Es verkörperte alles, was ich durchgemacht hatte, und alles, was noch vor mir lag. Die Uniform war wie ein leuchtender Wegweiser, der in die Richtung zeigte, in die ich nun zu gehen hatte.
Abgesehen davon hatte ich sie immer gemocht. Ich fand, es war ein schönes Kleidungsstück. Schwarz und elastisch, mit einem langen Reißverschluss am Rücken und gestickten Rangabzeichen am hochgeschlossenen Kragen, das Oberteil und die Schultern mit dunklem, rautenförmig aufgesticktem Gummi verstärkt. Die Armbündchen waren in verschiedenen Farben gearbeitet, um den Rang und die Sektion des Crewmitglieds anzuzeigen. Blau für die Technik, Grün für die Architekten und Rot für den militärischen Teil meiner Crew, der von Jonah befehligt wurde. Meine Bündchen waren golden – ich war der einzige Mensch auf diesem Schiff, der Gold als Farbe tragen durfte.
Ich ließ das Handtuch auf den Zimmerboden gleiten, schlüpfte in die bereitliegende Unterwäsche und stieg schließlich in meine Uniform. Mit etwas Mühe gelang es mir, den Reißverschluss zu schließen. Dann zog ich die festen Lederstiefel an, die mir bis zu den Knien reichten und jeweils zwölf Schnallen aufwiesen. Diese Stiefel liebte ich ebenfalls, auch wenn die Schnallen ein wenig nervten. Doch mit ihnen konnte jeder seine Stiefel so einstellen, wie er sie brauchte. Das Leder war dick und fest genug, um uns vor giftigen Tieren wie Schlangen oder Skorpionen zu schützen.
Zu meiner Überraschung fand ich zwischen den ganzen neuen Klamotten für jede nur denkbare Gelegenheit die Sachen, die ich in Berlin getragen hatte, als Dr. Jen mich erwischt hatte. Die blaue Jeans und die weiße Bluse wirkten zwischen den ganzen hochglänzenden Fundations-Klamotten wie Relikte aus einer vergangenen Zeit. Als wären sie etwas, das eine untergegangene Zivilisation zurückgelassen hatte. Und irgendwie stimmte das ja auch.
Einer Eingebung folgend, nahm ich die Jeans in die Hand, und meine Finger ertasteten etwas Hartes in der rechten Hosentasche. Ich zog es hervor und hielt kurz darauf einen silbernen Schlüssel zwischen den Fingern, den ich von allen Seiten betrachtete.
Die Erinnerung traf mich wie ein Hammerschlag. Kip, der mir den Schlüssel in die Hand drückt und mich bittet, diesen wegzuwerfen, weil er das Zimmer, zu dem der Schlüssel gehört, nie wieder betreten will. Dort hatte er all die Sachen eingeschlossen, die zu seinen toten Familienmitgliedern gehörten. Um Platz für sich und mich zu schaffen, damit wir in der großen Altbauwohnung ein neues Leben beginnen konnten. Als ich an das wunderschöne Zimmer mit dem honigfarbenen Licht dachte, das ich nie wieder betreten würde, krampfte sich mein Herz schmerzlich zusammen. Für einen kurzen Augenblick hatte ich gehofft, doch noch eine Chance auf ein ganz normales Leben zu haben. Wie hatte ich nur so blöd sein können? Ein ganz normales Leben wäre mir niemals vergönnt gewesen. Und eigentlich hatte ich das auch immer gewusst.
Immerhin eines konnte ich jetzt aber tun: Ich konnte das Versprechen halten, das ich Kip gegeben hatte. Zwar war es jetzt sowieso hinfällig, da wir die Erde und Berlin wohl niemals wiedersehen und die Wohnung niemals wieder betreten würden, doch versprochen war nun mal versprochen. Ich würde den Schlüssel an einen Ort bringen, an dem ihn niemand finden konnte.
Mit neu gewonnener Entschlossenheit klappte ich die Schranktür zu und betrachtete mich im Spiegel. Wie ich so dastand, in voller Montur, mit strengem Pferdeschwanz und blassem, müdem Gesicht, fiel mir schlagartig auf, wie erwachsen ich wirkte. Und das war ich ja auch irgendwie. Immerhin waren wir drei Jahre unterwegs gewesen. Auch wenn mir Dr. Jen versichert hatte, dass unsere Körper auf der Reise kaum altern würden, war Zeit vergangen, die mir deutlich anzusehen war. Meine Wangenknochen stachen deutlicher aus meinem Gesicht hervor, mein Hals wirkte länger als früher, und meine Augenbrauen schienen an Strenge gewonnen zu haben. Sie wölbten sich in einem herausfordernden Bogen über meine Augen, als wollten sie sagen: »Na, mal sehen, was das wird.« Vielleicht hatte ich mir aber auch einfach nur den Pferdeschwanz zu fest gezogen. Trotzdem hatte ich das deutliche Gefühl, keinem Teenager, sondern einer jungen Frau gegenüberzustehen. Einer Erwachsenen.
Ich erschrak, als ein leises Summen die Luft erfüllte, und der Spiegel, der gerade noch völlig normal auf mich gewirkt hatte, anfing, blau zu leuchten. Unwillkürlich trat ich ein paar Schritte zurück, bis meine Fersen an das Bettgestell stießen. Was war denn jetzt los?
Gebannt sah ich zu, wie sich auf der Oberfläche des Spiegels eine Projektion aufbaute, und kurz darauf stand ich meiner Ausbilderin Dr. Jen gegenüber.
»Guten Tag, Baker!«, sagte sie mit ihrer autoritären Stimme, und es ärgerte mich, als ich merkte, dass sich mein ganzer Körper wie auf Kommando versteifte. Als wäre ich ein Hund, der darauf trainiert war, seinem Besitzer bedingungslos zu gehorchen. Und die HOME-Fundation besaß mich tatsächlich, dachte ich bitter. Sie besaß mich voll und ganz.
Doch das hier war nicht die echte Dr. Jen, sondern nur eine Projektion. Also ließ ich mich auf das weiche Bett fallen und genoss diesen kleinen Akt der Rebellion. Wenigstens einmal in meinem Leben musste ich vor dieser Frau nicht strammstehen.
»Schön zu sehen, dass du wohlauf bist und die Reise gut überstanden hast.«
Ich schnaubte hörbar, doch die Projektion verzog keine Miene. Natürlich nicht. Das, was ich gerade sah, war vor Jahren aufgezeichnet worden. Dr. Jen trug dieselbe Kleidung wie an dem Tag, an dem sie Professor Bornkamp ermordet hatte. Wahrscheinlich hatte sie die Aufzeichnung kurz nach dem Mord gemacht. Ihre Miene war regungslos. Diese Frau, die gerade einen Menschen erschossen hatte, schien völlig ungerührt und wirkte so selbstzufrieden und aufgeräumt, als wäre sie gerade vom Einkaufen gekommen. Ich spürte, wie kalte Wut in mir aufstieg.
»Diese Nachricht dient einzig und allein dem Zweck, sicherzugehen, dass du dir deiner Aufgaben für die kommenden Stunden, Tage und Wochen vollauf bewusst bist, sowie deiner Verantwortung für dich selbst und deine gesamte Crew. Euer aller Leben liegt in deiner Hand, Baker, also versau es nicht. Wir alle hier verlassen uns auf dich. Ich persönlich musste Hannibal davon überzeugen, dass du trotz allem in der Lage bist, die Mission zu leiten, also enttäusch mich nicht.«
Was für eine riesengroße Ehre, dachte ich bitter.
»Ich bin mir sicher«, sagte Dr. Jen in geschäftsmäßigem Ton, »dass du der Verantwortung, die dir übertragen wurde, vollauf gerecht werden wirst. Wir haben gesehen, wie weit du zu gehen bereit bist, um andere Menschen zu schützen. Und dieses Talent kannst du jetzt zum Wohle aller voll und ganz ausleben. Also konzentrier dich und hör mich jetzt genau zu, Baker. Du darfst dir von nun an keine Fehler mehr erlauben. Jedes deiner Crewmitglieder trägt eine Metallplatine im Kopf. Bisher hat sie die Signale aus dem Interface empfangen und an eure Gehirne weitergeleitet, aber sie kann genauso gut Strom weiterleiten. Und genau das ist die Aufgabe, die ihr von nun an zufällt. Ab heute werden dir die Platinen als kleine Motivationsstütze dienen. Solltest du bei einer deiner Aufgaben versagen, muss ein Crewmitglied im Gegenzug dafür büßen. Leichte Stromstöße verursachen große Schmerzen, starke Stromstöße führen zum Tod.«
Ich sprang vom Bett auf, mir wurde heiß und kalt. Was sagte sie da? Mein Herz begann zu rasen, und ich musste mich zusammenreißen, um nicht loszuschreien. Die Welt um mich herum wankte, ich hatte das Gefühl, dass mir der Boden unter den Füßen wegrutschte. Sie blufft, schoss es mir durch den Kopf. Sie muss bluffen. Das kann einfach nicht wahr sein!
»Hör mir jetzt gut zu, Baker, das ist lebenswichtig: Dein GPS- und Kommunikationsgerät PIPER erfüllt gleichzeitig die Aufgabe eines Überwachungstools. Du darfst das Raumschiff nicht ohne dein Gerät verlassen. Du musst die Aufgaben, die es dir stellt, mit vollem Einsatz verfolgen und pünktlich erfüllen. Du darfst keine Anstalten machen, das Gerät zu manipulieren oder zu zerstören. Jedes Zuwiderhandeln mündet in einer Bestrafung. Kurz gesagt: Wenn du aus der Reihe tanzt, zahlen andere den Preis dafür. Und somit auch du selbst.«
Mein Hals wurde ganz trocken. Ich versuchte zu schlucken, doch es gelang mir nicht.
»Die Mother selbst ist die kontaktlose Stromquelle, die den Stromstoß im jeweiligen Fall ausführen würde. Solltest du auf die Idee kommen, das Schiff abzuschalten oder zu entfernen, wird ein tödlicher Stromstoß an alle Platinen bis auf deine ausgeschickt.
Und glaub bloß nicht, dass wir bluffen. Hannibal ist nicht in der Stimmung dazu. Ich denke, dir dürfte der Tod deines Arztes als Warnung dienen«, fügte Dr. Jen hinzu.
Ich schloss für einen Moment die Augen. Natürlich. Ich hatte es ja gewusst. Wie konnte diese Frau nur so grausam und eiskalt sein? Fühlte sie denn gar nichts? War ihr nichts heilig, ihre Zuneigung zu mir nur gespielt gewesen? Die Tatsache, dass ich einmal zu ihr aufgesehen hatte, praktisch um ihre Liebe und Anerkennung gebettelt hatte, machte mich fast krank. In meinem Kopf drehte sich alles, doch ich zwang mich, tief durchzuatmen. Dr. Jen war noch nicht fertig. »Deine erste Aufgabe wird sein, ihn vom Schiff zu entfernen, bevor ihr landet. Seine Leiche ist lediglich auf der Mother verblieben, um unseren Standpunkt zu unterstreichen. Es tut mir leid, dass wir zu solchen Maßnahmen greifen müssen, Baker, doch deine Eskapaden in Berlin haben uns keine andere Wahl gelassen.« Die Projektions-Jen drehte sich um und sprach mit jemandem, den ich nicht sehen konnte. Vermutlich war Hannibal ins Zimmer gekommen. Ich wurde schon wütend, wenn ich nur an ihn dachte. Worüber sie wohl gesprochen hatten? Darüber, dass Kip, Tom und die anderen nun bereit waren, mit dem Interface verbunden zu werden? Darüber, dass die Mother startklar war? Was es auch war, Dr. Jen sah angespannter aus, als sie sich mir wieder zuwandte.
»Wenn du die Leiche abgestoßen hast, muss der letzte Satellit abgeworfen werden. Mit deinem Erwachen wurden einige Bereiche des Autopiloten abgeschaltet, du musst den Abwurf selbst übernehmen. Der Satellit verbindet euch mit den anderen Satelliten, die die Mother bereits auf der Reise selbstständig ins All gesetzt hat, und somit mit uns. Aber damit nicht genug: Ohne diesen Satelliten funktionieren eure GPS-Geräte nicht. Ihr könnt euch auf Keto nicht orientieren, ihr könnt keine Landmarken setzen, und ihr könnt nicht miteinander kommunizieren. Wenn dein Gerät nicht binnen drei Stunden nach der Landung mit dem Satelliten gekoppelt und in Betrieb genommen wird, wird das System davon ausgehen, dass ihr abgestürzt seid, und eine tödliche Stromdosis aussenden, um euch allzu langes Leiden zu ersparen. Auch in diesem Szenario bist du natürlich ausgenommen. Solltest du allerdings beschließen, dich allein mit der Mother aus dem Staub zu machen, wird der Stromstoß dir gelten. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das nötig sein wird.«
Und nun lächelte sie. Wie konnte sie nur? Mir drehte sich der Magen um. Wenn ich dieser Frau jemals wieder begegnen sollte, würde ich ihr auf die Füße kotzen, so viel war sicher. Sofern ich mich nicht sofort auf sie stürzte, um ihr an die Gurgel zu gehen. Der Gedanke verschaffte mir grimmige Genugtuung.
»Mach dir keine Sorgen. Du musst dich nur daran erinnern, was wir vor allem in der letzten Phase deiner Ausbildung miteinander trainiert haben, Baker, dann wird alles wie von selbst laufen. Du bist gut ausgebildet und bestens vorbereitet. Und abgesehen von deiner rebellischen Ader bist du immer noch meine beste Schülerin. Kümmere dich jetzt erst einmal um die ersten beiden Aufgaben und lande sicher auf Keto, für den Rest orientierst du dich an dem Strategieplan, der auf deinem Gerät gespeichert ist.«
Ich sollte mir keine Sorgen machen? Hatte sie das gerade tatsächlich gesagt? Was Dr. Jen mir eröffnete, sprengte sogar noch den Rahmen dessen, was ich ihr zugetraut hätte. Dafür hätte selbst meine wildeste Fantasie niemals ausgereicht.
»Das Wichtigste ist, dass ihr die Sendestation zum Laufen bringt, damit wir miteinander kommunizieren können. Das muss eure oberste Priorität sein. Und falls du einmal nicht weiterwissen solltest, erinnere dich einfach daran, was alles auf dem Spiel steht.«
Noch einmal umspielte das ekelhaft falsche Lächeln ihre Mundwinkel. »Eines noch!«
Ich wollte es gar nicht hören.
»Sollte dir etwas Tödliches zustoßen, kann PIPER