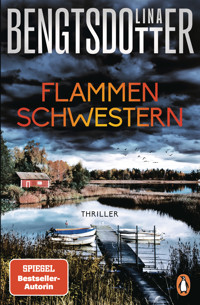9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Charlie-Lager-Serie
- Sprache: Deutsch
Sie ist Stockholms beste Ermittlerin. Doch dieser Fall kann sie alles kosten.
Nie wieder wollte Charlie Lager in ihren Heimatort Gullspång zurückkehren. Doch die brillante Stockholmer Ermittlerin ist gezwungen, diesen Schwur zu brechen, als sie von einem ungelösten Fall Wind bekommt: Vor dreißig Jahren verschwand die sechzehnjährige Francesca aus Gullspång und wurde nie gefunden. Das große verfallene Herrenhaus ihrer Familie steht seitdem leer. Sobald das düstere Gebäude vor Charlie aufragt, spürt sie, dass ihr dieser Fall alles abverlangen wird – denn sie erinnert sich dunkel an diesen Ort. Und Charlie ahnt, dass sie alles zu verlieren hat: Wenn sie die Wahrheit um Francescas Verschwinden ans Licht zerrt, kann sie ihr eigenes Leben für immer zerstören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Löwenzahnkind in der Presse:
»Ein Weltbestseller!« Sunday Times»Lina Bengtsdotter vermengt geschickt verschiedene Erzählstränge, die in einem verblüffenden Finish zusammenlaufen. Die vielschichtige, interessante Heldin macht Lust auf mehr.« stern»Am Himmel der Krimis gibt es einen neuen Stern. Das Debüt von Lina Bengtsdotter vereint alle Zutaten eines perfekten Schwedenkrimis.« Kölner Express»Spannender Thriller nicht nur für Schwedenkrimi-Fans. Ein äußerst vielschichtiger Roman, bei dem die Spannung konstant hoch bleibt.« hr2 »Büchertipp«
Außerdem von Lina Bengtsdotter lieferbar:LöwenzahnkindBesuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook.
Lina Bengtsdotter
Hagebuttenblut
Thriller
Aus dem Schwedischen von Sabine Thiele
Die schwedische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Francesca bei Bokförlaget Forum, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.Copyright © 2018 by Lina Bengtsdotter
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Penguin Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published in the German language by arrangement with Bonnier Rights, Stockholm, Sweden
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: © Johner Images/Getty Images; STILLFX/Shutterstock; Lars Steenberg/Shutterstock; Julian Dewert/Shutterstock; Ihnatovich Maryia/Shutterstock
Redaktion: Maike Dörries
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23537-6V003www.penguin-verlag.de
Für meine SchwesternDie, die mich begleitenUnd die, die mir vorausgegangen sind.
Es ist seltsam, ein Kind zu sein, das man nicht lieben kann.Man ist unglücklich, gleichzeitig aber auch frei.
Johanne Lykke Holm, »Natten som föregick denna dag«
Prolog
Die Gruppe stand hinter der Kapelle. Ich kam vom See, aber keiner bemerkte mich, bis ich ganz nah war. Im schwachen Licht der Kirchenbeleuchtung waren ihre Gesichter geisterhaft blass über den schwarzen Fracks. Es war diese widerliche Clique mit den Königsnamen, Erik, Gustav, Oscar, Magnus und dann er, Henrik Stiernberg, der selbstverliebte Freund meiner Schwester.
Henrik sah mich als Erster. Offensichtlich hatte ich ihn erschreckt, denn er sah zutiefst verängstigt aus, als er mich fragte, was zum Teufel ich hier wolle. Ich starrte ihn eine Weile schweigend an, dann begann ich zu lachen.
»Was lachst du so blöd?«, fragte er. »Wieso bist du immer so komisch?«
Ich antwortete nicht, weil ich nicht wusste, worüber ich lachte oder warum ich so komisch war.
»Lauf zurück zum Ball, du Irre«, sagte Erik. »Geh rein und tanz einen Walzer oder so was.«
»Mein Tanzpartner ist weg«, erwiderte ich.
In diesem Augenblick schlug meine Stimmung um, und ich war den Tränen nahe. Paul war schon eine Ewigkeit verschwunden, und es war völlig sinnlos ohne ihn auf dem Herbstball. Er hatte mir den ersten und den letzten Tanz versprochen, und bald würde das Orchester in der Turnhalle das letzte Lied spielen. Vielleicht hatte es das schon längst. Ich weiß nicht, warum ich deswegen so traurig war, weil mir eigentlich meine Tanzpartner gar nicht wichtig waren – geschweige denn das Tanzen an sich –, aber in diesem Fall ging es um Paul.
»Schau in seinem Zimmer nach«, sagte Erik. »Er ist wahrscheinlich zu besoffen.«
Ich sagte, dass er dort nicht sei.
»Hier ist er auf jeden Fall nicht«, erklärte Henrik. »Du wirst wohl weitersuchen müssen.«
Ich blieb stehen, denn mir fiel nichts mehr ein, wo ich noch nach Paul suchen könnte. Am See und bei der Trauerweide war ich schon gewesen, und sein Zimmer im Internatswohnheim Talludden war leer. Die Bank bei den Familiengräbern hinter der Kapelle war meine letzte Hoffnung.
»Was ist los?«, fragte Henrik, als ich plötzlich schwankte.
»Mir ist … schwindelig«, sagte ich und streckte meine Hand aus, um mich an einem Grabstein abzustützen. Ich verschätzte mich und stürzte. Als ich auf der Erde lag, sah ich die Rose. Sie hatte dieselbe Farbe wie mein Kleid, und sie hatte in Pauls Frackbrusttasche gesteckt.
»Paul muss hier gewesen sein«, sagte ich und hielt den Jungen die gelbe Rose entgegen.
»Was redest du da?«, fragte Henrik. »Wir haben deinen kleinen Freund nicht gesehen.«
Ungefähr ab diesem Punkt begannen unsere Geschichten sich zu trennen.
Kapitel eins
Charlie versuchte, in dem nach hinten geneigten Stuhl eine bequeme Position zu finden. Links von ihr saß Eva, ihre Psychologin.
Eva hatte gerade mit ihr die Rahmenbedingungen für ihre Sitzungen besprochen. Es war wichtig, sich an die festgelegten Zeiten zu halten, zu sagen, wenn man sich mit etwas nicht wohlfühlte, und zu wissen, dass alles, was in diesem Raum besprochen wurde, natürlich nicht nach außen drang.
Eva sprach freundlich, doch an ihrem Blick merkte man, dass sie auch streng sein konnte, falls nötig. Charlie hatte sie recherchiert, sie war Mitglied im Fachverband der Psychologen und hatte fünfzehn Jahre Berufserfahrung. Das war Charlies erste Bedingung gewesen, als Challe forderte, sie müsse sich therapeutisch behandeln lassen. Sie würde nur zu jemandem mit professioneller Ausbildung gehen, nicht zu irgendeiner selbstgefälligen Person, die gerade mal einen mehrwöchigen Kurs zum Thema »Persönliche Entwicklung« absolviert hatte. Sie wollte auf keinen Fall Zeit bei jemandem verschwenden, der Allgemeinplätze daherplapperte oder zu viel über sich selbst sprach. Am liebsten würde sie sich das Ganze sowieso ersparen, weshalb sie die erste Sitzung so lange rausgeschoben hatte wie möglich. Sie hatte versucht, Challe zu zeigen, dass es ihr gut ging, dass sie sich hervorragend um sich selbst und ihren Job kümmern konnte, aber nach den Ereignissen des Sommers vertraute ihr Chef ihr nicht mehr uneingeschränkt.
Jetzt saß sie jedenfalls in dem unbequemen Stuhl in Evas Behandlungszimmer. Der Regen rann in dünnen Rinnsalen das Fenster herunter, hinter dem eine große Eiche mit buntem Herbstlaub stand.
»Charline, warum sind Sie hier?«, fragte Eva.
»Sie können mich Charlie nennen.«
»Warum sind Sie hier, Charlie?«
»Wegen meines Chefs. Er hat mir ein Ultimatum gestellt. Er findet, dass ich Hilfe brauche.«
»Aha.« Eva musterte sie prüfend, als ob sie sich eine stille Notiz machte: eventuelle fehlende Selbsteinsicht. »Und finden Sie das auch?«
»Dass ich Hilfe brauche?«
»Ja.«
»Ja, schon, aber ich säße vermutlich nicht hier, wenn das nicht die Bedingung dafür wäre, dass ich meinen Job behalten kann.«
»Erzählen Sie bitte in groben Zügen von sich. Ich weiß, was Sie beruflich machen, aber sonst kaum etwas.«
»Was müssen Sie denn noch wissen?«, entgegnete Charlie.
Eva lächelte und sagte, dass ein Mensch schließlich mehr sei als nur seine Arbeit. Vielleicht könne sie einfach ganz allgemein sagen, wer sie sei.
»Natürlich«, antwortete Charlie. »Ich mag …« Sie unterbrach sich. Was mochte sie eigentlich? Lesen, trinken, allein sein. Im Moment fiel ihr nichts ein, was nicht deprimierend klang. »Ich lese gern.«
Sie sah, dass Eva eine ausführlichere Antwort erwartete, und wollte fast schon »Sport« als weiteres Hobby angeben, aber warum sollte sie lügen?
»Waren Sie schon einmal in psychologischer Behandlung?«, fragte Eva nach einer Weile.
»Ja, ein paar Sitzungen als Erwachsene sowie eine längere Therapie als Jugendliche. Meine Mutter starb, als ich vierzehn war.«
»Das ist ein schwieriges Alter, um einen Elternteil zu verlieren.«
Charlie nickte.
»Und Ihr Vater?«
»Unbekannt.«
»Ich verstehe. Wie war das Verhältnis zu Ihrer Mutter?«
»Es war …« Charlie wusste nicht, was sie sagen sollte. Kompliziert? »Meine Mutter war sehr speziell.«
»Inwiefern?«
»Sie war nicht wie andere Mütter. Ich kämpfe sehr dagegen an, nicht wie sie zu werden.«
»Das ist ganz natürlich«, antwortete Eva, »dass man nicht die Fehler der Eltern wiederholen will. Aber solange Sie versuchen, nicht so wie Ihre Mutter zu werden, bleibt sie Ihre Referenz. Erst wenn Sie unabhängiger von ihr agieren können, werden Sie sich freier fühlen.«
»Ja.«
»Wir können später noch darüber reden. Mich würde zuerst der Grund für das Ultimatum Ihres Chefs interessieren. Dass Sie eine Therapie machen sollen.«
Bettys Stimme meldete sich in Charlies Kopf. Die Sätze, die sie immer sagte, wenn sie eine schlechte Phase hatte. Ich habe das Gefühl, als würden mich die Unterströmungen nach unten ziehen. Wenn ich zu viel nachdenke, dann sinke ich auf den Grund. Am besten also nicht nachdenken, nichts sagen. Sonst wird alles nur noch schlimmer.
»Der Alkohol war schuld«, antwortete Charlie. »Manchmal trinke ich zu viel. Bisher hatte ich es im Griff und habe nur getrunken, wenn ich freihatte, und auch nicht am Abend vor der Arbeit – oder dann zumindest nur wenig –, aber in letzter Zeit habe ich diese Regel öfter gebrochen und im Büro dann nach Alkohol gerochen. Mein Chef Challe ist eine wahre Spürnase.«
»Vielleicht ist das Ihr Glück gewesen«, sagte Eva. »So konnten Sie sich rechtzeitig Hilfe suchen.«
»Woher wollen Sie wissen, dass es rechtzeitig war?«, konnte sich Charlie nicht verkneifen.
»Sie akzeptieren Ihr Problem und sprechen offen darüber. Das ist eine sehr gute Ausgangslage.«
»Ich weiß es schon lange, konnte aber trotzdem nichts dagegen tun. Ich bin mir also nicht sicher, ob das so viel zu bedeuten hat.«
»Haben Sie nicht gerade gesagt, dass Sie das Problem im Griff haben?«
»Es kam schon vor, dass ich die Kontrolle verloren habe«, gestand Charlie.
»Und jetzt sind Sie hier.«
»Ja, jetzt bin ich hier.«
Nach einigen Minuten oberflächlichen Gesprächs kehrte Stille ein. Charlie betrachtete die gerahmten Bilder hinter Eva an der Wand. Rorschachtests. Sie versuchte, Formen in den Farbklecksen zu erkennen, um etwas über ihren psychischen Zustand zu erfahren, doch Eva wollte mehr über ihre Arbeitsaufgaben wissen.
Charlie erzählte von ihrer Arbeit als Ermittlerin bei der Nationalen Operativen Abteilung, dass sie und ihre Kollegen bei schweren Verbrechen im ganzen Land hinzugerufen wurden und die örtliche Polizei unterstützten.
»Wie sieht Ihr sonstiges Leben aus?«, fragte Eva.
»Single, keine Kinder.«
»Um noch mal auf Ihren Alkoholkonsum zurückzukommen«, fuhr Eva fort, ohne auf Charlies Familienstand einzugehen. »Wie lange würden Sie das schon als Problem bezeichnen?«
»Ich weiß es nicht genau. Das kommt eher darauf an, wen man fragt.«
»Ich frage Sie.«
»Seit ich angefangen habe, Alkohol zu trinken, habe ich es geliebt, und ich habe schon immer mehr als andere getrunken. Ich habe noch nie verstanden, wie man nach nur einem Glas aufhören kann. Aber ich würde mich nicht als Alkoholikerin bezeichnen, nur weil ich mehr als andere trinke. Es ist eher phasenweise.«
»Und wann begann die Phase, die unserer Sitzung heute vorausging?«
»Ich kann mich nicht genau erinnern, aber vor ein paar Monaten kam ich zurück nach Gullspång, wo ich aufgewachsen bin. Eine Kleinstadt in Västergötland«, fügte sie hinzu, als sie merkte, dass Eva den Ort nicht kannte. »Ich habe dort bis zum Tod meiner Mutter gelebt. Dann bin ich nach Stockholm gezogen.«
»Hatten Sie hier Verwandtschaft?«
»Nein, ich kam zu einer Pflegefamilie.«
»Wie war das für Sie?«
Charlie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. Gab es irgendetwas Berichtenswertes über das Leben in dem kleinen Reihenhaus in Huddinge? Sie sah den Garten vor sich, den geharkten Kiesweg, die Blumenbeete, in denen alles in Reih und Glied wuchs, den kleinen Apfelbaum, der nie Früchte trug. Sie dachte an die erste Begegnung mit den Pflegeeltern Bengt und Lena und ihrer Tochter Lisen, wie die drei sie steif in ihr klinisch sauberes Heim aufgenommen hatten. Von außen betrachtet war die neue Familie genau das, was sich Charlie immer gewünscht hatte, wenn Betty ausgeflippt war: ruhige, ordentliche Menschen mit festen Schlafenszeiten, gemeinsamen Mahlzeiten und einer Mutter, die Turnbeutel packte und Hausmannskost kochte, ohne zusammenzubrechen. Lena lag nie auf dem Sofa und verlangte völlige Dunkelheit und Ruhe. Sie veranstaltete nie ausufernde Feste oder lud Menschen ein, die sie gar nicht kannte. Charlie dachte an ihr kleines Zimmer im Reihenhaus, die frisch gewaschene Bettwäsche, den Duft nach Waschmittel und Rosen. Fühl dich wie zu Hause, hatte Lena an diesem ersten Abend gesagt. Ich hoffe wirklich, dass du dich hier wie daheim fühlst, Charline, und dass du und Lisen wie Schwestern füreinander sein könnt.
Doch Charlie hatte sich nie daheim gefühlt in dem Haus in Huddinge, und sie und Lisen wurden nie wie Schwestern.
Eva räusperte sich.
»Es hat funktioniert in der Pflegefamilie«, antwortete Charlie schließlich. »Es herrschte Ordnung, und ich konnte mich auf die Schule konzentrieren.«
»Das ist schön«, meinte Eva. »Aber gehen wir noch mal zurück zu dem Zeitpunkt, an dem die letzte Phase begann. Sie sind Anfang des Sommers nach Gullspång gefahren. Warum?«
»Aus beruflichen Gründen. Ein junges Mädchen war verschwunden, Annabelle Roos. Vielleicht haben Sie von dem Fall in der Zeitung gelesen.«
»Ja, das habe ich.«
»Wir sollten die Arbeit der örtlichen Polizei unterstützen, und die Rückkehr war hart, sehr viel härter, als ich gedacht hatte.«
»Inwiefern?«
»Sehr viele Erinnerungen kamen wieder hoch, und ich …«
Charlie sah vor sich, wie Annabelles magerer Körper aus dem schwarzen Wasser des Flusses gezogen wurde, sah Bettys Freund Mattias zwanzig Jahre vorher in denselben schwarzen Tiefen verschwinden. Sah zwei Mädchen mit einem weinenden kleinen Jungen zwischen sich, lange vor ihrer Geburt.
»Und Sie …?«, fragte Eva und beugte sich vor.
»Nun, ich habe mich persönlich in den Fall verwickeln lassen. Und dann unterlief mir ein Fehler, und ich wurde von dem Fall abgezogen, was mich schwer getroffen hat. Als ich wieder in Stockholm war, dachte ich, dass sich alles wieder einrenken würde, aber da hatte ich mich geirrt. Es wurde sogar noch schlimmer.«
»Was wurde schlimmer?«
»Die Angst, ein Gefühl der Sinnlosigkeit, Schlafprobleme. Ich schlafe schlecht, und wenn, dann habe ich Albträume.«
»Beschreiben Sie sie.«
»Die Träume?«
»Ja.«
»Es hat angefangen, als ich aus Gullspång zurückkam, zwischendurch war es ein wenig besser, aber jetzt arbeite ich an einem Fall, der mich mehr mitnimmt, als ich es will.«
Eva fragte nach dem Fall, und Charlie erzählte von den zwei jungen ermordeten Frauen aus Estland, die man in einem Waldstück am Stadtrand gefunden hatte. Eine hatte eine dreijährige Tochter, ein hohläugiges, halb verhungertes Mädchen, das mindestens zwei Tage allein in einer Wohnung gewesen war. Vor zwei Wochen hatte man sie gefunden, und seitdem hatte sie kein Wort gesprochen.
Eva fand es nicht so verwunderlich, dass Charlie der Fall an die Nieren ging, denn ein verlassenes kleines Kind weckte bei den meisten solche Gefühle. Und das Mädchen hatte es doch geschafft?
»Sie war am Leben«, sagte Charlie. »Aber auch nicht viel mehr. Heute Nacht habe ich geträumt, es wäre mein Kind und ich die Mutter. Ich wollte nach Hause laufen und es retten, aber das konnte ich nicht, weil ich ja tot war. Im nächsten Traum war ich das Kind und … Sie verstehen schon.«
»Nehmen Sie Medikamente?«, fragte Eva, ohne etwas zu den Träumen zu sagen.
»Hundert Milligramm Sertralin.« Charlie verschwieg, dass sie manchmal eine Sobril oder eine Schlaftablette oder beides zusammen nahm.
»Sonst nichts?«
Charlie schüttelte den Kopf.
»Sie wissen vielleicht, dass Albträume eine verbreitete Nebenwirkung von Sertralin sind?«
Charlie nickte. Das wusste sie alles, aber sie nahm das Medikament seit Jahren, weshalb die Träume sicher nicht daher rührten.
Eva verschränkte die Hände über dem Knie.
»Dieser Fehler, von dem Sie gesprochen haben«, fuhr sie fort. »Darüber würde ich gern reden.«
Charlie dachte an den Abend und die Nacht in der Motelbar zurück. Die Lakritzshots in den Gläsern, der Wein, das Bier, Johan. Sie war so dumm gewesen, zurück in Stockholm Nachforschungen über ihn anzustellen. Wenn man nach vorne schauen wollte, musste man Vergangenes abschließen und ruhen lassen, das wusste sie ganz genau, doch stattdessen hatte sie immer weiter geforscht. Erst wollte sie wissen, wo er wohnte, dann, ob er unverheiratet war und ob Bettys Freund wirklich sein Vater gewesen war. Alles schien zu stimmen.
»Charlie?« Eva sah sie an.
»Entschuldigung, was haben Sie gesagt?«
»Ich würde gern mit Ihnen über den Fehler reden, den Sie erwähnt haben.«
»Ach ja, genau. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber ich habe zu viel getrunken und einen Journalisten mit aufs Zimmer genommen. Am nächsten Tag standen vertrauliche Informationen zu dem Fall in der Zeitung. Aber ich habe nichts ausgeplaudert, auch wenn das natürlich alle glaubten. Und ja, ich habe Ärger bekommen.«
Eva wartete schweigend, ob Charlie noch mehr sagen würde. Schließlich antwortete sie: »Hätten Sie die Nacht mit dem Mann verbracht, wenn Sie nüchtern gewesen wären?«
»Um Himmels willen, nein!«
»Warum nicht?«
Charlie wusste nicht genau, was sie sagen sollte, weshalb sie ehrlich erwiderte, dass sie keine Ahnung hatte, wann sie das letzte Mal nüchtern mit einem Mann ins Bett gegangen war. War das schlimm?
»Was denken Sie?«, fragte Eva.
»Ich denke, dass es dumm war, aber sonst? Ich meine, wenn ich nicht im Dienst bin? Finden Sie solche flüchtigen Kontakte verwerflich?«
»Ist es Ihnen wichtig, was ich davon halte?«
Charlie sagte, dass es das nicht sei, aber das stimmte nicht. Denn wenn sie mit jemandem nicht zurechtkam, dann mit Menschen, die urteilten.
»Es fällt mir nicht leicht, darauf eine Antwort zu geben, aber sich für Sex zu entscheiden, anstatt Rücksicht auf sein eigenes Wohlbefinden zu nehmen«, fuhr Eva fort, »erscheint mir nicht besonders konstruktiv.«
»Aber doch auf jeden Fall besser als Alkohol?«
»Wenn ich es richtig verstanden habe, machen Sie ja beides – Sex haben und trinken.«
Charlie seufzte, sah aus dem Fenster und folgte einer vorbeifliegenden Amsel mit dem Blick.
»Ich sage nicht, dass Sex mit Fremden falsch ist. Ich sage nur, dass Sie darüber nachdenken sollten, warum Sie es tun. Wozu es Ihnen dient.«
»Reicht es nicht, dass es mir damit besser geht? Muss es immer einen tieferen Sinn geben? Warum kann man nicht einfach mal nur tun, womit es einem gut geht?«
»Natürlich kann man das. Aber das, was Ihnen für den Moment hilft, hilft Ihnen vielleicht nicht auf lange Sicht.«
Charlie nickte. Das war ernüchternd, aber wahr.
»Ich meine, einem drogenabhängigen Menschen geht es auch gut mit seinen Drogen«, führte Eva weiter aus, »aber das heißt nicht, dass …«
»Ja, ja, ich verstehe schon.«
Charlie begann zu bereuen, dass sie sich für eine professionelle Psychologin entschieden hatte. Es wäre einfacher gewesen, sich mit einem fröhlichen Lebenscoach zu treffen, der ihr neue Yogastellungen und Meditation empfahl. Wenn sie sich auf die professionelle Hilfe einließ, würde sie sehr tief in sich hineingehen müssen, und sie wusste nicht, ob sie das schaffte. Sie war so müde.
»Sprechen wir noch mal über Ihre Mutter«, sagte Eva. »Wie war sie?«
»Sie war … anders.«
Charlie sah auf die Uhr. Nicht weil sie wissen wollte, wie lange die Sitzung noch dauerte, sondern weil sie Betty nicht beschreiben konnte, selbst wenn sie ein Leben lang dafür Zeit hätte. Betty war voller Gegensätze und Kontraste gewesen, hatte Dunkelheit und Licht in sich vereint, Kraft und Kraftlosigkeit. Als Charlie Psychologie studierte, hatte sie versucht, eine Diagnose für ihre Mutter zu finden, doch nichts hatte richtig gepasst. Alle Kategorisierungen schienen zu eng gefasst zu sein für Betty Lager.
Kapitel zwei
In einer halben Stunde begann die Morgenbesprechung. Charlie hatte noch genug Zeit, als sie Evas Praxis verließ.
Es hatte aufgehört zu regnen, die Luft war frisch. Der Herbst war Charlies liebste Jahreszeit. Die Zeit der Fäulnis, hatte Betty immer gesagt. Betty, die schon vor Mittsommer Panik bekam, wenn die Kirschblüten abfielen. Für Charlie war der Herbst eine Wiedergeburt, ein Versprechen der Ordnung, Routine, Aufgeräumtheit. Sie liebte den Duft von Hagebutten und neuen Büchern, alles erinnerte sie an den Schulanfang nach den unsäglich langen und chaotischen Sommerferien. In diesem Herbst war es anders. Während sie vorgab, ihre Umgebung wahrzunehmen, zu arbeiten, sich an Gesprächen zu beteiligen, zu leben, wirkte alles auf widersprüchliche Weise überwältigend und Angst einflößend. Letztens war sie kurz davor gewesen, eine Decke vor das Fenster im Schlafzimmer zu hängen, um das Licht auszuschließen, das zwischen den Jalousienlamellen hereinfiel. Allein schon die Tatsache, auf so eine Idee zu kommen, erschreckte sie. Sie wollte nicht wie Betty werden. Niemals.
Charlie holte ihr Handy aus der Tasche, um zu sehen, ob Susanne zurückgerufen hatte, doch das hatte sie nicht. Als der Fall in Gullspång abgeschlossen war, hatten sie und Susanne einander versprochen, in Kontakt zu bleiben und sich bald wieder zu treffen. In den ersten Wochen hatte ihre alte Freundin fast jeden Abend angerufen, wenn sie mit dem Hund Gassi ging. Sie hatten über Susannes Ehe gesprochen, um die es schlechter stand als je zuvor, und alles, was sich in ihren Leben anders entwickelt hatte, als sie es sich vorgestellt hatten. Doch vor einer Weile hatte Susanne keine Anrufe mehr angenommen und nur noch kurze Nachrichten geschickt, dass es ihr gut gehe, wenn Charlie fragte, ob etwas passiert sei. Es sei nur alles gerade etwas viel.
Charlie wählte Susannes Nummer und ließ es läuten, bis sich die Mailbox einschaltete. Vielleicht musste sie einfach respektieren, dass Susanne ihre Ruhe haben wollte.
Die Rezeptionistin Kristina war gerade aus dem Urlaub zurück, aber obgleich sie vor der Abreise über nichts anderes gesprochen hatte, hatte Charlie schon wieder vergessen, wo sie gewesen war. Jetzt stand sie an der Kaffeemaschine in der Küche beim Besprechungsraum und erzählte, wie toll es gewesen sei, die warme Luft, das warme Meer, der warme Pool, und was sie alles gesehen hatte. Sie sei ja so froh, dass sie weggefahren war, denn in Schweden war es ja wirklich nicht warm gewesen, von den heißen Wochen im Juni mal abgesehen, aber da hatte sie ja arbeiten müssen. Und danach war der Sommer nicht mehr richtig in Schwung gekommen.
Charlie versuchte, sich an den Sommer zu erinnern. Sie hatte nie über das Wetter nachgedacht. Die wenigen Male, die sie seit der Rückkehr aus Gullspång freigehabt hatte, hatte sie verschlafen.
Kristina sagte, dass sie sich schon nach dem nächsten Sommer sehne.
»Ich nicht«, erwiderte Charlie und nahm ein Gebäckstück von dem Teller auf dem Tisch.
»Machst du Witze?«
»Nein. Ich mag den Sommer nicht, genauso wenig wie Urlaub oder Feiertage und all das. Ich mag auch nicht verreisen«, fügte sie hinzu und bereute ihre Worte im selben Moment, denn sie wusste genau, dass es Zeitverschwendung war, Kristina ihre Eigenheiten erklären zu wollen. Warum lernte sie es einfach nicht, die Klappe zu halten? Wie oft hatten sie sich schon in endlose Diskussionen über die unwichtigsten Themen verstrickt, weil sie sich über etwas geärgert hatte oder schlicht und ergreifend gelangweilt gewesen war? Mit Kristina konnte man über Rezepte, das Wetter und Quadratmeterpreise für Wohnungen reden. Einfache, gewöhnliche, konkrete Sachen.
»Das ist aber schon ganz schön traurig«, sagte Kristina, »den Sommer nicht zu mögen.«
»Warum denn? Es gibt doch noch mehr Jahreszeiten als den Sommer, es ist also viel trauriger, nur dafür zu leben. Und wenn man von jedem Tag enttäuscht ist, an dem die Sonne nicht scheint, wie viele Tage gibt es denn dann noch, an denen man glücklich sein kann, wenn man unbedingt so viel Glück wie möglich anhäufen will?«
Kristina starrte sie mit leerem Blick an.
»Himmel«, sagte sie schließlich. »Du musst doch nicht gleich aggressiv werden, nur weil ich mich ein wenig über das Sommerwetter und die Jahreszeit beschwere.«
»Ich bin nicht aggressiv, ich finde es nur nicht okay, dass du mich als traurig bezeichnest.«
»Ich habe nie gesagt, dass du traurig bist.«
Hugo kam in die Küche, und Kristina strahlte.
»Du warst im Warmen, wie ich sehe«, sagte er.
Er lächelte Kristina an und nickte Charlie kurz zu.
Kristina vergaß Charlie und erzählte wieder von der Hitze, was sie alles gesehen hatte, den Ausflügen. Dann unterbrach sie sich plötzlich und gratulierte Hugo mit den Worten, ein kleiner Vogel hätte ihr da was geflüstert.
»Danke«, erwiderte Hugo. »Wir freuen uns sehr.«
Er warf Charlie einen Blick zu.
»Hast du es schon gehört, Charlie?«, fragte Kristina. »Hier wird jemand Vater!«
»Nein, aber jetzt erfahre ich es ja.« Charlie wandte sich zu Hugo und lächelte, so breit es ihr möglich war. »Wie schön. Alles Gute für euch.«
»Danke«, sagte Hugo und errötete.
Wenigstens schämt er sich, dachte Charlie. Das ist schon was wert.
»Und wie geht es Anna?«, fragte Kristina, die die angespannte Stimmung im Raum nicht bemerkte.
»Anfangs ging es ihr ganz schön schlecht«, erzählte Hugo, »aber jetzt ist es glücklicherweise besser.«
»Kommst du nicht zur Teamsitzung?«, fragte Kristina, als Charlie sich erhob und zur Tür ging.
»Doch, aber bis dahin sind es ja noch drei Minuten.«
Charlie ging zur Toilette und ließ eiskaltes Wasser über die Handgelenke laufen. Das hatte Betty ihr beigebracht. Wenn das Blut kocht und der Schädel brennt, dann ist eiskaltes Wasser das Beste. Halte die Handgelenke so, nein, zieh sie nicht weg, bald spürst du nichts mehr, bist wie betäubt. Halte aus, Liebling. Halte durch. Na, spürst du es jetzt? Spürst du, wie sich alles einfach auflöst?
Charlie schloss die Augen, versuchte alles zum Verschwinden zu bringen, an gar nichts zu denken, nur ein weißes Zimmer mit weißem Boden, weißer Decke, weißen Wänden ohne Fenster. Doch ständig schob sich das Gesicht von Hugos Frau dazwischen, die Hände auf den Bauch gelegt, Hugos Arm beschützend um ihre Schultern, die Freude über das Kind.
Noch vor einem Monat hatte Charlie mit Hugo geschlafen. Er hatte in ihrer Stammkneipe an der Bar gestanden, dümmlich gelächelt und so getan, als wäre er rein zufällig dort. Als er sie zu einem Drink einladen wollte, hatte sie zuerst abgelehnt, gesagt, dass sie privat fertig miteinander seien, doch er hatte nicht nachgelassen. Sie könnten doch wohl etwas zusammen trinken und darüber sprechen, was zwischen ihnen gewesen war. Schließlich hatte Charlie nachgegeben, aber nur diesen Drink, hatte sie gesagt, und nicht noch einmal ihre Affäre durchkauen. Sie wusste alles, was sie wissen musste: Hugo war ein feiger und verlogener Kerl, der zu viel von sich selbst hielt. Das wusste sie alles, doch ihre Gefühle ließen sich davon nicht beeindrucken. Charlie bekam oft zu hören, dass sie ein rationaler Mensch sei, doch bei Hugo hatte der Intellekt keine Chance gegen die körperliche Anziehungskraft, denn als sie dort mit ihrem Long Island Iced Tea saßen, wollte sie ihn nur noch mit nach Hause nehmen und die ganze Nacht Sex mit ihm haben. Was sie nach dem dritten Drink dann auch getan hatte.
Sei einfach nur froh, dass er nicht dein Mann ist, Charline. Was willst du mit so einem gewissenlosen Kerl? Warum einem Mann ohne Gewissen hinterherschmachten?
Charlie öffnete die Augen. Sie wollte Hugo überhaupt nicht. Das hatte sie irgendwann einmal geglaubt, weil sie sich eingeredet hatte, dass er ein anderer war, viel tiefgründiger. Aber er war nur …
Er ist nur ein ganz normaler Mann, Liebling. Verschwende deine Zeit nicht mit ihm.
Jemand drückte die Türklinke.
»Entschuldigung«, hörte sie Anders’ Stimme vom Flur. »Ich habe nicht gesehen, dass abgeschlossen ist.«
Charlie drehte den Wasserhahn zu, tupfte sich etwas Wasser unter die Augen, trocknete sich die Hände ab und ging nach draußen.
»Alles in Ordnung?«, fragte Anders.
»Ja, nur ein wenig erkältet.«
»Wollen wir nach der Arbeit was trinken gehen? Das letzte Mal ist schon ewig her.«
»Acht Monate«, bestätigte Charlie.
»So lange schon?« Anders runzelte die Stirn, als ob er es nicht glauben könnte. »Ja, stimmt wohl. Im letzten Monat vor Sams Geburt war ich nur daheim und danach … kein einziges Mal mehr unterwegs.«
»Maria wird dich nicht weglassen«, sagte Charlie lächelnd.
»Ich habe immer noch einen freien Willen.«
»Okay, dann trinken wir nach der Arbeit was.«
»Ich rufe Maria sicherheitshalber nur noch mal an«, sagte Anders.
»Gut«, meinte Charlie. »Dann reden wir nachher noch mal.«
Kapitel drei
Nach der Besprechung bat Challe Charlie, kurz zu ihm ins Büro zu kommen. Sie folgte ihm und schloss die Tür hinter sich.
»Ich habe mir die Überstunden und ausstehenden Urlaube der Abteilung angesehen«, eröffnete Challe das Gespräch, als er sich an seinen Schreibtisch setzte.
»Und?«, fragte Charlie.
»Und ich war nicht überrascht, dass du noch die meisten Urlaubstage hast.«
»Aha.«
»Willst du die Tage irgendwann nehmen?«
»Ich habe doch zwei Wochen im Juli Urlaub genommen.«
»Eineinhalb«, korrigierte Challe sie. »Und im letzten Sommer nicht einmal eine Woche.«
»Ja, aber jetzt stecke ich mitten in einem wichtigen Fall.«
»Alle Fälle sind wichtig«, sagte Challe. »Wir haben immer genug Arbeit.«
Charlie ahnte, worauf das Gespräch hinauslief. Gleich würde er sagen, dass niemandem damit gedient sei, wenn sie sich persönlich zu sehr in den Fall involvierte. Er kenne das Muster, hatte er beim letzten Mal gesagt, als sie über das Thema gesprochen hatten, dass die Fälle mit jungen missbrauchten Frauen sie zu sehr mitnähmen, dass sie riskiere, sich völlig zu verausgaben, was weder den Opfern und deren Angehörigen noch ihr selbst nütze.
Charlie sah die nackten Frauenleichen vor sich, den Blick des dreijährigen Mädchens in der Wohnung. Wie sollte man da nicht hineingezogen werden?
»Ich will damit nicht sagen, dass du jetzt sofort Urlaub nehmen sollst, Charlie. Ich finde nur, dass du – genau wie alle anderen Menschen – zwischendurch längere Erholungsphasen brauchst.«
Grundsätzlich stimme sie ihm zu, antwortete Charlie, gab jedoch zu bedenken, dass Menschen vielleicht unterschiedliche Erholungsbedürfnisse hätten.
Challe gab ihr recht, doch es sei auch seine Pflicht, einzuschreiten, wenn er das Gefühl habe, dass seine Leute eine Pause bräuchten. Denn niemand sei unentbehrlich. Wie man an den vollen Friedhöfen sehe.
Charlie verzog keine Miene bei seinem seltsamen Vergleich. Stattdessen fragte sie ihn, ob ihr Gespräch etwas mit den Ereignissen im Sommer zu tun habe.
»Das hat mit vielem zu tun«, sagte Challe. »Was in Västergötland passiert ist, deine Trinkerei, und du siehst sehr müde aus. Ich habe schon viel zu viele ehrgeizige Menschen in diesem Beruf untergehen sehen, und ich kann es mir nicht leisten, dich zu verlieren.«
»Das tust du auch nicht«, antwortete Charlie und schluckte den Zusatz herunter: Hast du nicht gerade gesagt, dass jeder entbehrlich ist? Was willst du eigentlich?
»Das weißt du nicht, man kann ja schlecht beschließen, keinen Burn-out zu bekommen. Das solltest gerade du doch wissen.«
»Ja, das weiß ich, aber dann wäre ich jetzt wohl schon an diesem Punkt. Und ich habe mir eine Therapeutin gesucht. Ich habe alles getan, was du verlangt hast.«
»Was gut ist«, sagte Challe. »Aber ich finde trotzdem, dass du ein paar Wochen am Stück freinehmen solltest. Zum Beispiel, wenn dieser Fall hier abgeschlossen ist. Ich werde dich nicht zwingen«, fuhr er bei Charlies Blick rasch fort, »aber denk darüber nach.«
»Natürlich. Das werde ich.«
Charlie verließ das Büro ihres Vorgesetzten mit einem leichten Erstickungsgefühl. Sie mochte Challe sehr viel lieber, wenn er den fordernden Chef spielte und nicht den väterlichen.
Und wenn er schon so viel darüber nachdachte, was gut für sie war, dann müsste er doch wissen, dass ein längerer Urlaub zu diesem Zeitpunkt katastrophal wäre. Womit sollte sie ihre Tage füllen? Lesen? Und dann? So ein Urlaub barg das Risiko, dass sie in die nächste Kneipe ging, ein Bier trank, und noch eins, und wenn sie wieder zu arbeiten anfing, noch erholungsbedürftiger sein würde als jetzt.
Zurück in ihrem Büro, widmete sich Charlie der zeitraubenden Suche nach Menschen aus der näheren Umgebung der beiden Estinnen. Es war ein einziges Durcheinander aus Spitznamen, Prepaid-Telefonnummern und Sackgassen. Es stresste Charlie, dass die Ermittlungen nicht voranschritten. Die DNA der beiden Frauen war nicht im System, und die wenigen Hinweise, die sie erhalten hatten, führten ins Leere.
Nach einigen Stunden brauchte sie eine Pause. Um sich von dem Fall abzulenken, tippte sie »Johan Ro« bei Google ein. Das hatte sie schon länger nicht mehr gemacht. Ein ihr unbekannter Artikel erschien als erster Treffer. Was geschah mit Francesca Mild? Charlie rief den Text auf. In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1989 verschwand die sechzehnjährige Internatsschülerin Francesca Mild vom Gutshof der Familie, Gudhammar, außerhalb der Gemeinde Gullspång in Västergötland.
Charlie hielt inne und las den Satz noch einmal. Die Gemeinde Gullspång in Västergötland. Dann das Jahr, 1989. Warum hatte sie kein Wort von diesem Mädchen gehört, als sie nach Annabelle suchten? Sie schüttelte den Kopf und las weiter. Die Eltern waren an dem betreffenden Abend eingeladen gewesen, Francesca und ihre ältere Schwester allein daheim. Die Schwester war früh eingeschlafen, und man hatte erst am nächsten Morgen gemerkt, dass Francesca verschwunden war.
Vor siebenundzwanzig Jahren ist Francesca Mild spurlos verschwunden, und man weiß bis heute nicht, was ihr zugestoßen ist. Es gab viele Theorien. Ihr Pass war ebenfalls nicht auffindbar, weshalb man zuerst dachte, sie wäre freiwillig von zu Hause weggegangen.
Charlie scrollte weiter und las von Selbstmordverdacht, Tauchgängen im See und Gesprächen mit Klassenkameraden, Freunden und Verwandten. Alles war ergebnislos geblieben. Ein Foto zeigte die Familie Mild auf einer großen Steintreppe vor dem herrschaftlichen Haus. Ein Mann und eine Frau hinter zwei Töchtern im Teenageralter, die ungefähr gleich alt zu sein schienen. Alle lächelten steif, außer der einen Tochter, die nur ergeben und zugleich trotzig in die Kamera starrte: Francesca Mild.
Weiter unten war noch ein Foto. Es zeigte das Internat Adamsberg, Schüler in dunkelblauen Uniformen, die Jungen in Hosen, die Mädchen in Faltenröcken. Eine jüngere Version von Francesca Mild stand in der ersten Reihe, das einzige Mädchen. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt.
Was war ihr zugestoßen?
Charlies Blick blieb an Johans Namen unter dem Artikel hängen. Sollte sie sich bei ihm melden? Nein, besser nicht. Was sollte das denn bringen?
Francesca
Das Licht brannte in meinen Augen, als ich durch die Krankenhaustüren ins Freie trat. Nachdem ich über eine Woche im Bett gelegen hatte, fühlte ich mich seltsam zerbrechlich. Die Welt hatte sich verändert. Ich weiß nicht, ob es an den Farben, den Geräuschen oder der Luft lag, aber etwas war definitiv anders. Ich hielt mich an Papas Arm fest, schloss die Augen und ließ mich zum Auto führen.
»Warum hast du die Augen zu, Francesca?«, fragte Mama.
»Das Licht«, antwortete ich. »Das viele Licht tut weh.«
Papa nahm meine Hand von seinem Arm, doch ich tastete mich mit ausgestreckten Händen und geschlossenen Augen weiter vor. Als ich einmal blinzelte, sah ich, wie Mama zu Papa blickte und den Kopf schüttelte. Sie ertrug es überhaupt nicht, wenn ich mich wie eine Verrückte benahm.
»Wohin fahren wir?«, fragte ich, als ich mich auf den Rücksitz von Papas Sportwagen gequetscht hatte. Mit meinen langen Beinen hätte ich vielleicht besser vorne sitzen sollen, aber um nichts in der Welt würde Mama sich nach hinten setzen.
»Nach Gudhammar«, sagte Papa. Er hatte alle Besprechungen in der Schweiz aufgeschoben. Erst da erkannte ich den Ernst der Lage. Papa hatte noch nie Termine abgesagt. Ein Termin war ein Termin, eine Vereinbarung eine Vereinbarung. Und auf dem Gutshof waren wir nur zu Feiertagen und im Urlaub.
»Und dann?«, fragte ich. »Was sollen wir in Gudhammar machen?«
»Wir werden darüber sprechen, wie wir dir helfen können«, erwiderte Papa. »Wir müssen uns in Ruhe unterhalten, bevor wir beschließen, wie es weitergeht.«
»Warum soll ich nicht zurück nach Adamsberg?«
»Das ist dir doch sicher klar.«
Ich antwortete, dass mir das überhaupt nicht klar sei. Und wenn jemand das Internat verlassen sollte, dann doch wohl Henrik Stiernberg und seine Freunde.
»Schluss mit dem Gerede über Henrik Stiernberg«, sagte Papa. »Wir haben lange genug über ihn gesprochen.«
Ich dachte, dass ich nie genug über ihn würde sprechen, nie genug darüber würde nachdenken können, wie man ihn bestrafen konnte. Denn selbst wenn es stimmte, was sie gesagt hatten, die Jungen der Königsclique, dass sie Paul am Ballabend nicht gesehen hatten, waren doch alle schuld an seinem Tod. Seit Paul in Adamsberg angefangen hatte, hatten sie ihn wegen seiner Kleider aufgezogen, seiner Art, beim Sprechen zu gestikulieren, seines Dialekts. Sie hatten ihn verhöhnt, weil er so viel las, im Unterricht ins Philosophieren geriet, wegen seines Interesses für das Gehirn, den Körper, das Leben und den Tod. Nicht einmal über seine Witze hatten sie gelacht, auch wenn er der Lustigste von uns allen war. Sie quälten ihn nicht nur psychisch, sondern rempelten ihn oft auf den Gängen an, als wäre er unsichtbar.
Ich bin wie ein Schwan, antwortete er immer auf meine Frage, wie er es schaffte, ihnen keine reinzuhauen, das perlt alles an mir ab. Einmal habe ich ihn verbessert und gesagt, dass Wasser nur an Gänsen abperlte, nicht an Schwänen. Und Paul hatte gelacht und geantwortet, dass es bei Schwänen genauso sei, dass die Kälte nie bis zu ihrer Haut durchdringe. Aber egal, ob Gans oder Schwan, es war ihm einfach gleichgültig, was eine Gruppe Arschlöcher von ihm hielt.
Habe ich ihm das geglaubt? Ich erinnere mich, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich ist es das Beste, die ganzen Gemeinheiten einfach an sich abperlen zu lassen. Erst später wurde mir klar, dass es nicht funktioniert hatte, dass die Kälte trotzdem Pauls Schutzschichten überwunden haben und bis in sein Herz gedrungen sein musste. Und dann kam meine Schwester auch noch ausgerechnet mit Henrik Stiernberg zusammen, dem Gemeinsten der Gruppe. Sie hat sich nicht einmal von ihm getrennt, nachdem das mit Paul passiert war. Als ich sie danach fragte, sprach sie mir nur ihr Beileid aus, als wären wir entfernte Bekannte: Der Tod deines Freundes tut mir wirklich leid, Francesca. Im nächsten Atemzug sagte sie, dass sie Henrik glaube, dass sie ihn liebe, dass es niemals die Schuld eines anderen sei, wenn ein Mensch sich das Leben nahm.
Ich dachte an meine Schwester, an ihre Besuche bei mir im Krankenhaus. Beim ersten Mal weinte sie, als wäre ich tot, beim zweiten Mal, als ihr klar war, dass ich überleben würde, weinte sie, weil ich furchtbare Lügen über ihren Freund erzählte. So etwas hätte ich früher schon getan, sagte sie und spielte damit auf meine Anklagen gegen Erik Vendts großen Bruder an. Ich hatte nicht einmal die Kraft, mich zu wehren.
»Und Cécile?«, fragte ich, als Papa auf die Autobahn fuhr. »Was passiert mit Cécile?«
Papa sah mich im Rückspiegel an und sagte, dass nichts mit ihr passieren werde.
»Ich fasse es nicht, dass ihr sie weiter dorthin gehen lasst.«
»Du konzentrierst dich auf die falschen Dinge, Francesca«, sagte Mama. »Du sollst jetzt nur daran denken, gesund zu werden.«
Ich erwiderte, dass ich gesund sei. Krank sei dagegen, wie man seine Tochter weiter auf eine Schule gehen lassen könne, die …
»Schluss jetzt mit dem Thema«, unterbrach mich Papa. »Wir sprechen über etwas anderes.«
Ich wollte aber nicht über etwas anderes sprechen. Ich hatte es so satt, dass immer Papa bestimmte, über was man reden durfte. Deshalb schloss ich die Augen und gab vor zu schlafen, genoss die Erleichterung, wenigstens nicht zurück in die Schule zu müssen.
Doch zuerst mussten wir noch in Adamsberg vorbeifahren und ein paar Kleider holen.
»Komm mit«, sagte Mama, als wir auf dem Parkplatz stehen blieben. »Du kannst dich doch wenigstens von Cécile verabschieden.«
Ich schüttelte den Kopf, weil ich mich nicht von Cécile verabschieden wollte, außerdem wollte ich nicht riskieren, Henrik Stiernberg oder einen der anderen zu treffen. Denn dann würde ich wahrscheinlich einen Aufstand machen. Das war eines meiner vielen Probleme: meine gestörte Impulskontrolle.
Als Mama und Papa gegangen waren, setzte ich mich auf den Beifahrersitz und sah zu dem großen weißen Hauptgebäude des Internats Adamsberg. Der Ort hatte etwas Abweisendes und Kaltes an sich. Ich dachte, wie unglaublich es doch war, wie lange ich es dort ausgehalten hatte. Fast fünf Jahre hatte ich vor jeder Mahlzeit gebetet und dämliche Lieder über die Größe der Schule gesungen. Ich hatte das schlecht sitzende Jackett mit den Adlern auf der Brust getragen, versucht, mich anzupassen und eine gute Schulkameradin zu sein, aber letztendlich hatte ich alles von der ersten Sekunde an verabscheut.
Um das Hauptgebäude herum waren die Wohnheime verteilt: Majoren, Talludden, Norra und Högsäter, in dem ich seit meinem Eintritt in die Schule wohnte. Esse non videri stand über der Eingangstür. Sein, ohne gesehen zu werden, hatte mir Papa erklärt, als wir zum ersten Mal durch das Schultor gegangen waren. Er sagte es, als wären das positive Worte.
Ich war erst elf, als ich ins Haus Högsäter einzog, die jüngste Schülerin von ganz Adamsberg. Cécile und ich sollten beide in die sechste Jahrgangsstufe kommen, aber in Parallelklassen, und wir sollten auch nicht zusammen wohnen. Damit wir neu anfangen konnten. Mama wollte das so. Als Papa am ersten Schultag meine Taschen in das kleine Haus auf der Anhöhe trug, konnte ich die Tränen kaum zurückhalten. Ich wollte nicht bei Menschen schlafen, die ich nicht kannte, und warum konnte ich nicht wenigstens im selben Haus wie Cécile wohnen? Papa tätschelte meinen Kopf und sagte, dass ich hier die schönste Zeit meines Lebens verbringen würde. So wie er.
Aber ich war nicht wie Papa, nicht wie Mama und auch nicht wie Cécile. Ich war eine Fremde in der Welt, eine Fremde in meiner eigenen Familie.
Beschreib sie mir, bat mich Paul einmal, als ich mich darüber beschwerte, wie ausgeschlossen ich mich fühlte. Beschreib mir deine Familie.
Ich erzählte ihm die Kurzfassung, dass meine Schwester eine Blenderin war, mein Vater ein Lügner und meine Mutter … meine Mutter war eine im Wind flatternde Papierpuppe.
Für Papa musste es sich wie persönliches Versagen anfühlen, dass seine eigene Tochter der Schule verwiesen wurde, die für ihn der Grundstein seiner Karriere gewesen war. Rikard Mild hatte das Beste aus seiner Zeit in Schwedens nobelstem Internat gemacht. Sein Bild hing an der Wand vor dem Speisesaal, zusammen mit den Fotos aller anderen Schüler, die ihren Abschluss mit Bestnoten in allen Fächern gemacht hatten.
Papa sah albern aus auf dem alten Foto. Das sorgfältig mit Wasser gekämmte Haar klebte über der Stirn, die Zähne waren schief.
Seltsam, dass er Mama erobern konnte, sagte Cécile einmal, als wir uns das Bild zusammen ansahen. Dass er mit seinem Aussehen Stockholms hübscheste Frau bekommen hat.
Ich fragte, woher sie wisse, dass Mama Stockholms hübscheste Frau war, und Cécile erwiderte, das habe Papa erzählt.
Ich sagte, dass Papa in Sachen Mama eine sehr unzuverlässige Quelle sei. Für ihn war sie der perfekteste Mensch der Welt, und da hatte er unrecht, denn wenn man mehr als fünf Minuten mit Mama verbrachte, war einem klar, dass sie sehr viele Fehler hatte. Für die Papa, ansonsten sehr klarsichtig, völlig blind war.
Cécile sagte, dass das wohl Liebe sei, das Gute in einem Menschen zu sehen. Sie wollte auch einen Mann heiraten, der das Gute in ihr sah.
Ich antwortete, dass ich, sollte ich jemals heiraten, nur einen Mann nehmen würde, der mich zum Lachen bringt und nicht fremdgeht. Denn was spielten Beteuerungen, man sei die perfekte Frau, für eine Rolle, wenn man am Ende doch nur betrogen wurde?
Cécile sagte, dass ich nicht von Sachen reden solle, von denen ich keine Ahnung hätte.
Ich erinnerte sie an Mamas und Papas nächtliche Streite zu genau diesem Thema. Wenn wir hinter der Tür gestanden und Mama weinen gehört hatten und wie Papa alles abstritt. Und ich hatte genug von Papas Blicken und seinen Händen auf anderen Frauen gesehen, um zu wissen, dass Mamas Anschuldigungen nicht aus der Luft gegriffen waren.
Mama und Papa ließen sich Zeit. Ich wurde unruhig und stieg aus dem Wagen. In der Zigarettenschachtel in meiner Tasche war nur noch eine Zigarette. Trotzig stand ich da, für alle sichtbar, am helllichten Tag, und rauchte. Ich hoffte beinahe, dass jemand aus dem Abschlussjahr oder einer der Lehrer mich sehen würde. Es wäre so schön, unerreichbar für ihre Drohungen zu sein. Ich war ausgeschlossen, allein, hatte nichts zu fürchten, nichts konnte schlimmer werden. Ich näherte mich dem Kiesweg, der zum Schulgelände führte, stellte mich neben die Inschrift in Goldbuchstaben auf der Eisenplatte, die die Tore zusammenhielt, und las die lateinischen Wörter (in Adamsberg war Latein immer noch die Weltsprache). Non est ad astra mollis e terris via. Ich hatte vergessen, was das bedeutete, aber ich erinnerte mich, dass ich es beängstigend fand, als es mir jemand mal übersetzte.
Mama und Papa waren nirgends zu sehen, wahrscheinlich sprachen sie noch mit irgendeinem Lehrer. Ohne so richtig zu wissen, warum, ging ich zur Kapelle. Da Gottes Haus immer offen war, trat ich ein. Langsam ging ich den Mittelgang entlang bis zu dem Platz, an dem Paul und ich immer bei den Gottesdiensten gesessen hatten. Ich setzte mich und sah zu Jesus am Kreuz empor. Wie oft hatte ich an diesem Platz schon an ganz andere Dinge gedacht? Ich strich mit den Fingern über die Buchstaben, die Paul in das Fach mit den Gebetbüchern geritzt hatte. Gott ist t. Weiter war er nicht gekommen, weil Fräulein Asp ihn erwischt und für eine Verwarnung gesorgt hatte. Jetzt suchte ich in meinen Taschen nach etwas Spitzem. Im Krankenhaus hatte man mir alles abgenommen, womit ich mich hätte verletzen können, aber bei der Entlassung hatte ich zumindest meinen Schlüsselbund zurückbekommen. Ich holte ihn aus der Tasche und vollendete Pauls Werk. Gott ist tot.
Danach ging ich zum Auto zurück.
Nach zwanzig Minuten kamen Mama und Papa mit einer Tasche zurück.
»Cécile lässt grüßen«, sagte Mama, nachdem sie mich gebeten hatte, auszusteigen und mich wieder auf den Rücksitz zu setzen.
Ich fragte, warum Cécile nicht mit zum Auto gekommen sei und mich selbst begrüßt hätte. Weil sie für den Bundestest in Englisch lernen müsse, sagte Mama.
Ich erwiderte, der Test sei im Frühjahr.
Mama seufzte und meinte, dass sie es vielleicht falsch verstanden habe. Es spielte aber auch keine Rolle, da ich ja sowieso nicht mit ihr sprach. Es war nicht besonders erbaulich, mit jemandem zu sprechen, der einen wie Luft behandelte.
Ich wollte sagen, dass ich wieder mit ihr sprechen würde, wenn sie mir glaubte, wenn sie ihrer eigenen Schwester glaubte statt ihrem Idiotenfreund, aber das wäre sinnlos gewesen. Mama und Papa glaubten immer nur Céciles Version von Ereignissen. Bei mir gingen sie davon aus, dass ich log, bis das Gegenteil bewiesen war. Daraus machten sie kein Geheimnis und rechtfertigten es damit, dass es meine eigene Schuld sei, weil ich so oft log. Dieses Verhalten konnte man aber auch durchaus als die Folge des ständigen Misstrauens sehen, das mir entgegengebracht wurde. Wie Papa selbst zu sagen pflegte, wusste man nicht, was zuerst da war: das Huhn oder das Ei.
»Das hier lag in deiner Schreibtischschublade«, sagte Mama und reichte mir einen Umschlag.
Ich nahm ihn und las meinen Namen in Pauls verschnörkelter Handschrift darauf. Das verwirrte mich. Hatte er doch einen Abschiedsbrief geschrieben?
»Ist der von ihm?«, fragte Mama.
Ich nickte.
»Willst du ihn nicht aufmachen?«
»Später.«
Kapitel vier
Kurz nach fünf klopfte es an Charlies Tür. Anders fragte, ob sie bald fertig sei. Sie musste kurz überlegen, bis sie sich erinnerte, dass sie ja etwas trinken gehen wollten.
»Darfst du denn?«, konnte sie sich nicht verkneifen.
Sie hatte eigentlich nicht damit gerechnet und wäre lieber im Büro geblieben, während die Dunkelheit sich vor den Fenstern senkte, und hätte versucht, mit den aktuellen Ermittlungen weiterzukommen. Doch sie wusste auch, dass Pausen ihr halfen, neue Sichtweisen zu entwickeln.
»Ich bin ja kein Leibeigener«, antwortete Anders, und Charlie unterdrückte einen Kommentar, dass es für sie aber schon ganz danach aussah.
»Deine oder meine Ecke?«, fragte sie.
Anders verstand erst nicht, was sie meinte, strahlte jedoch, als sie das Riche vorschlug.
Es war laut im Riche, obwohl es noch nicht einmal sechs Uhr abends war. Anders konnte rasch die Aufmerksamkeit eines Kellners erregen, und sie bekamen einen kleinen Tisch weiter hinten im Lokal.
»Du hast doch sicher Hunger?«, fragte er.
Sie nickte.
»Was willst du?«
»Bestell einfach irgendwas«, sagte Charlie. »Ich bin so hungrig, dass ich es nicht mal schaffe, die Speisekarte zu lesen und mich für etwas zu entscheiden.«
Anders sah zu einer Bedienung, die rasch zu ihnen an den Tisch kam. Er bestellte zweimal das Rinderfilet-Carpaccio und zwei Gläser Rotwein, dessen Namen sie nicht verstand. Anders zögerte und fragte, ob sie vielleicht einen anderen Wein wolle, doch sie schüttelte den Kopf, nein, sie vertraue ihm. Die verschiedenen Weinsorten interessierten sie nicht. War es schon so lange her, dass sie zusammen unterwegs waren, dass er vergessen hatte, dass sie überhaupt keinen Unterschied schmeckte? Außerdem mochte sie lieber Bier, aber es war ihr zu mühsam, ihn jetzt daran zu erinnern.
Anders’ Handy piepste. Er sah aufs Display und lächelte.
»Was ist los?«, fragte Charlie.
»Sam«, antwortete er. Er zeigte ihr das Telefon, auf dem ein kleines Video abgespielt wurde, in dem sein Sohn mit etwas Speichel am Kinn auf dem Boden auf einer Decke saß. »Er sitzt ganz allein.«
»Ganz schön früh«, sagte Charlie, auch wenn sie keine Ahnung hatte, ob das stimmte. Sie wusste nichts über die Entwicklung von Kleinkindern.
»Er entwickelt sich ganz normal«, erklärte Anders, »aber für uns ist es trotzdem ein Wunder.«
Er drückte wieder auf »Play«. Charlie versuchte, ihre Langeweile dadurch zu kompensieren, dass sie ihm das Telefon aus der Hand nahm und sich das Video genau anschaute.
»Er ist süß«, sagte sie, als sie ihm das Gerät zurückgab.
»Himmel, habe ich einen Hunger«, verkündete Anders. »Ich glaube, das ist der Schlafmangel, ich bin die ganze Zeit am Snacken.«
»Ich auch«, sagte Charlie. »Ich esse permanent, wenn ich übermüdet bin.«
»Leidest du auch unter Schlafmangel?«
»Ja.«
»Und was hält dich wach?«
»Ich weiß es nicht. Gedanken, die nicht zur Ruhe kommen.«
»Was für Gedanken?«
»Dieser furchtbare Fall zum Beispiel, den wir gerade bearbeiten.«
»Und sonst nichts?«
Warum hatte sie das Gespräch in diese Richtung steuern lassen? Sie wusste doch, dass Anders nachfragen würde. Es hatte ihn schon immer interessiert, wer sie war und was sie umtrieb, aber nach ihren Ermittlungen in Gullspång hatte er mehr Fragen zu ihrem Hintergrund und ihrer Verfassung gestellt als je zuvor. Sie wusste nicht, ob aus Sorge oder Neugier oder vielleicht auch beidem.
»Nur normale Schlafprobleme«, antwortete sie. »Der böse Kreislauf. Ich denke, dass ich jetzt unbedingt schlafen muss, und bin dann erst recht wach und … du weißt schon.«
»Ja, das tue ich«, sagte Anders. »Vielleicht bist du deshalb niedergeschlagen. Also, wegen des Schlafmangels.«
»Es geht mir gut.«
»Nein, es geht dir nicht gut, Lager. Nicht, seit wir aus Västergötland zurück sind, und davor ging es dir auch schon nicht gut. Wenn ich so darüber nachdenke, weiß ich nicht, ob ich dich überhaupt anders kenne.«
Charlies Ärger wuchs. Anders war zweifellos der Kollege, mit dem sie sich am besten verstand. Auch wenn sie völlig unterschiedliche Leben führten und gegensätzliche Hintergründe hatten, hatten sie sich gefunden. Sie waren selten einer Meinung, diskutierten oft, lachten aber noch mehr. Doch es hatte sich etwas zwischen ihnen verändert. Sie konnte nicht vergessen, wie er sie Challe nach dem Fehler in Gullspång ausgeliefert hatte. Vielleicht hätte sie an seiner Stelle dasselbe getan, doch es schmerzte noch immer.
»Ich habe eine Therapie angefangen«, antwortete sie knapp. »Ich versuche, alles in Ordnung zu bringen.«
»Was ist passiert?« Anders legte sein Besteck zur Seite und sah sie an. »Was war eigentlich in Gullspång im Sommer los?«
»Was los war?« Charlie erwiderte seinen Blick. »Ein siebzehnjähriges Mädchen ist verschwunden und wurde tot bei den Dammschleusen gefunden. Sie hieß Annabelle Roos. Ich glaube, du warst auch dort.«
»Darüber hinaus ist aber noch viel mehr passiert«, sagte Anders. »Glaubst du nicht, dass mir das klar ist? Du warst wirklich nicht du selbst.«
Das Essen wurde serviert, und Charlie merkte, wie hungrig sie war. Sie aß einen Bissen Fleisch mit Rucola und Pinienkernen. Es schmeckte himmlisch.
»Auf jeden Fall ist es schön, dass wir es mal wieder nach der Arbeit geschafft haben«, sagte sie. »Dass du wieder der Alte bist.«
»Das bin ich nicht«, antwortete Anders.
»Warum?«
Anders gab Öl, Salz und Pfeffer über sein Essen. »Maria. Ich glaube, wir haben unsere erste richtige Krise.«
Charlie legte das Besteck beiseite. »Was meinst du mit Krise?«
Ihrer Ansicht nach war Anders’ und Marias Beziehung eine einzige lange Krise.
»Wir streiten uns wegen allem und jedem«, erzählte Anders. »Und vor ein paar Tagen hat sie gesagt, dass sie nicht wisse, was sie eigentlich für mich empfindet. Okay, sie war wütend, aber trotzdem. Ich muss immer daran denken. ›Soll das alles sein?‹, hat sie gefragt. ›Soll das Leben immer so weitergehen?‹ Als ob alles für sie eine Hölle wäre.«
»Vielleicht braucht ihr ein wenig Abstand«, sagte Charlie. »Zum Durchatmen, Nachdenken …«
»Das will ich nicht. Ich will mit ihr zusammen sein.«
»Ich verstehe«, antwortete Charlie, auch wenn sie es nicht verstand. Sie und Maria hatten sich nicht oft gesehen und waren sich vom ersten Moment an unsympathisch gewesen. Ihr Verhältnis hatte sich auch nicht gebessert, als Maria von Charlies Affäre mit Hugo erfahren hatte. Danach hatte sie Anders verboten, allein mit Charlie zu arbeiten, und nicht einmal dagegen hatte Anders protestiert. Stattdessen hatte er ihre Zusammenarbeit heruntergespielt. Charlie konnte nicht nachvollziehen, wie man es mit einem Menschen wie Maria aushielt.
»Sie ist unglücklich«, fuhr Anders fort. »Sie ist wirklich nicht glücklich.«
»Bist du es denn?«
»Ja, ich glaube schon. Ich meine, natürlich bin ich nicht ständig euphorisch, aber … Für mich ist Scheidung einfach keine Alternative.«
»Warum nicht?«
»Weil das in meiner Welt, also so, wie ich und Maria aufgewachsen sind … ein Scheitern ist.«
Und da, wo ich herkomme, ist man gescheitert, wenn man sich einem anderen unterordnet und nicht für sich selbst einstehen kann, dachte Charlie.
Es war eben nicht immer so einfach, auf der Sonnenseite des Lebens geboren und aufgewachsen zu sein.
»Aber vielleicht hast du ja sogar recht«, sagte Anders. »Dass wir Zeit für uns brauchen. Ich fürchte nur, dass wir dann erkennen, dass es nicht funktioniert, und uns trennen. Und vor dem Alleinsein … habe ich Angst.«
»Was macht dir daran Angst?«
»Die Frage ist doch eher, warum du dich nicht davor fürchtest.«
»Das habe ich nie behauptet. Mir macht nur viel mehr die vorgetäuschte Gemeinschaft Angst, der Glaube, dass man einem Menschen gehört, die Vorstellung, dass man durch Versprechen, Ringe, Kinder immun gegen die Einsamkeit wird.«
»Aber macht es dich glücklich?«, fragte Anders.
Charlie überlegte, ob er das vielleicht ironisch meinte. »Was meinst du mit Glück?«
»Na, einfach Glück.«
»Die Menschen haben unterschiedliche Definitionen von Glück.«
»Und wie sieht deine aus?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Charlie. »Wenn man Glück als diesen prickelnden, trunkenen Zustand definiert, dann glaube ich nicht, dass er lange anhält. Mir ist es am wichtigsten, keine Angst zu haben. Ich glaube, dieses Gefühl ist mir wichtiger als alles andere. Keine Angst zu haben, ist für mich Glück.«
»Das klingt frustrierend.«
»Wieso?«
»Dass Glück bedeutet, keine Angst zu haben. Das klingt nach einem ganz schön unglücklichen Menschen.«
Und du klingst wie ein Mensch, der noch nie richtige Angst erlebt hat, dachte Charlie.
Sie bestellten eine Flasche von dem Wein, den sie bisher schon getrunken hatten. Anders’ Handy klingelte. Es war natürlich Maria. Er stellte das Gerät auf lautlos.
»Sie weiß, dass ich unterwegs bin«, erklärte er. »Aber ich schaffe es gerade nicht, zu lügen und nicht zu sagen, dass ich mich mit dir treffe. Ich schicke ihr eine SMS und frage kurz, ob mit Sam alles in Ordnung ist.«
Mach, was du willst, dachte Charlie.
»Schau nicht nach rechts«, fuhr Anders fort. »Da drüben sitzt ein Typ an der Bar und schaut die ganze Zeit zu dir.«
Charlie drehte sich natürlich sofort nach rechts und sah, wen Anders meinte. Ihre Blicke trafen sich. Sie erkannte ihn sofort. Johan Ro. Nein, dachte sie. Nicht jetzt.
Räume in der Zeit
Du hast also schon einen toten Menschen gesehen?, frage ich Paul, als er erzählt, dass sein Vater ein Bestattungsunternehmen hat. Wir kennen uns erst eine Woche, aber ich habe bereits am ersten Tag erkannt, dass er anders ist.
Natürlich, antwortet Paul. Sicher über hundert. Mein Bruder und ich helfen in den Ferien immer mit.
Das klingt nach einer spannenden Arbeit, sage ich.
Die meisten finden es wohl eher abstoßend. Die meisten Menschen leben, als ob es den Tod nicht gäbe. Sie wollen am liebsten gar nicht daran denken.
Ich denke jeden Tag an den Tod, sage ich. Ich glaube, seit ich abstrakt denken kann.
Du scheinst auch nicht wie die meisten anderen zu sein, erwidert Paul und lächelt.
Ich bitte ihn, von der Arbeit zu erzählen. Muss er … die Toten anfassen?
Paul nickt. Er bereitet sie für den Sarg vor, kämmt die Haare, zieht ihnen Kleider an, die die Angehörigen ausgewählt haben, und faltet die Hände.
Könntest du mich herrichten?, frage ich.
Was meinst du?
Wie eine Tote?
Warum?
Ich weiß nicht, es wäre einfach … spannend.
Klar, sagt Paul, klar könnte ich das, aber es wäre komisch.
Wie sind sie?
Wer?
Die Körper. Wie sehen sie aus? Wie fühlen sie sich an?
Die meisten sehen jedenfalls nicht aus, als schliefen sie, erzählt Paul. Sie sind steif, kalt, haben Leichenflecken und sehen einfach tot aus. Das Charakteristischste ist aber der Geruch.
Er soll ihn mir beschreiben, doch Paul schüttelt den Kopf und sagt, das geht nicht. Der Geruch ist … unbeschreiblich. Wenn man ihn einmal gerochen hat, wird man ihn nie wieder vergessen. An schwülen Sommertagen glaubt er manchmal, ihn im ganzen Haus zu riechen.
Und die Würmer, frage ich, woher kommen die? Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie aus dem Nichts einfach auftauchen.
Das tun sie auch nicht, sagt Paul und lächelt. Eine Leiche lockt Fliegen an, die ihre Eier ablegen, aus denen Maden werden.
Ich dachte immer, sie kommen aus dem Nichts.
Nichts kommt aus dem Nichts.
Kapitel fünf
Charlie trank einen großen Schluck Wein.
»Wer ist das?«, fragte Anders.
»Erkennst du ihn nicht? Glotz nicht so auffällig.«
»Er kommt mir bekannt vor«, sagte Anders, »aber ich kann mir Gesichter so schlecht merken. Sollte ich ihn kennen?«
»Johan Ro«, antwortete Charlie. »Der Journalist, vom letzten Sommer.«
Anders’ Gesicht leuchtete auf. »Ja, jetzt erinnere ich mich.«
Charlie konnte ihren Ärger darüber nicht unterdrücken, wie fröhlich er wirkte. Hatte er das Nachspiel vergessen, das ihre Bekanntschaft gehabt hatte?
»Wegen ihm wurde ich von dem Fall abgezogen.«