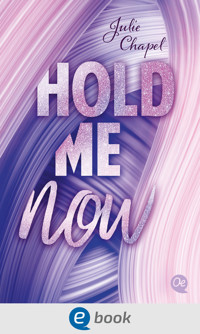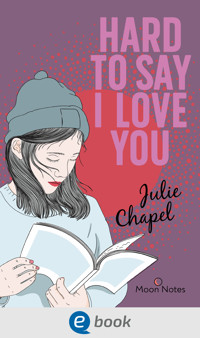
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niemals hätte Layla gedacht, dass es ihr gelingen könnte, aus dem Schatten ihrer verstorbenen Zwillingsbrüder zu treten. Sie hat gerade ein Journalismusstudium begonnen, als sie sich bei einem Creative-Writing-Workshop anmeldet – eigentlich nur ihrer Freundin Stella zuliebe. Aber dieser Workshop wird zu einer echten Herausforderung für Layla und sie wächst über sich selbst hinaus. Erst mit ihren Worten, dann mit ihrem ganzen Wesen. Daran nicht unwesentlich beteiligt ist ihr Coach Jordan. Ein Mann, der im Gegensatz zu Layla keine Probleme damit hat, über seine Gefühle zu sprechen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Laylas Mitbewohnerin Stella schleppt sie mit zu einem Creative-Writing-Workshop. Zwar studiert Layla Englisch, doch selbst zu schreiben, war nie ihr Ziel. Ginge es nach ihrem unausstehlichen Coach Jordan, sollte das auch lieber so bleiben. Oberflächlich und einfallslos sind ihre Texte also? Layla wäre nicht sie selbst, wenn sie diese Bemerkungen einfach so hinnehmen würde …
Eine Lovestory unter der sanften Sonne des Indian Summer und ein Creative-Writing-Kurs, der nicht nur Layla an ihre Grenzen bringt
Kapitel 1
29. September
Ich habe viele Talente. Ich kann einen Zauberwürfel in elf Sekunden lösen, freihändig Rad fahren, Skulpturen aus Handseife schnitzen, Delfingeräusche nachmachen, Mandarinen nach Mikamuki-Kunst schälen, mit nur einem Strich einen Schwarm Flamingos zeichnen, auf einer Karotte Flöte spielen, Moby Dick aus Dollarnoten falten und jeden der einhundert wichtigsten Romane der Literaturgeschichte anhand eines Satzes, irgendeines Satzes, identifizieren. All so was halt.
Absolut kein Talent, ein Anti-Talent sozusagen, habe ich für diese eine Sache: das Schreiben.
Bei aller Liebe für das geschriebene Wort überlasse ich diese Kunst den Menschen, die dafür geboren wurden. Entweder hat man dieses Talent oder eben nicht. Ohne lebt man sicher auch ruhiger, ist zufrieden mit einem Nine-to-five-Job und muss nicht schauen, wie man mit dem angeborenen Segen drei bis vier Blueberry Muffins pro Woche verdient.
Manche behaupten, jeder könne schreiben. Ist die Idee da, müsse man sich nur auf den Hosenboden setzen und losschreiben, je abgefahrener desto besser, und für den Schliff gibt es das Lektorat. Meiner Meinung nach braucht es aber nicht nur eine interessante Story, sondern auch ein Gespür für die Sprache, für den richtigen Ton, den Klang, den Rhythmus, für die Leichtigkeit und die Schwere, die Belanglosigkeit und den Wert. Wer das Talent des Schreibens hat, kann die Neugier im Dunst der Langeweile wecken und die Abenteuerlust in der Enge des Alltags.
Das Schreiben ist eine Kunst wie das Malen, das Komponieren, die Comedy und das Schauspielen. Hätte jeder das Talent dazu, wäre es keine Kunst mehr. Es wäre gewöhnlich. Daraus entstehen würde eine mit Fast Food vergleichbare Fast Art, an die sich in zweihundert Jahren kein Mensch mehr erinnert.
Als ich zehn war, habe ich eine Art Tagebuch geführt. Aber ich habe meine Erlebnisse der Tage nicht so festgehalten, wie sie sich tatsächlich ereignet haben, sondern wie ich sie hätte erleben wollen. Ganze dreizehn Tage habe ich das getan. Nachdem meine Mutter das Buch gefunden und gelesen hatte, habe ich es geschreddert. Ich hatte nur für mich geschrieben, eben nicht, um andere zu unterhalten oder, wie in Moms Fall, aufzuregen.
Ich habe mir nie gewünscht, schreiben zu können. Was zum Teufel habe ich also hier verloren?
Ich bin umgeben von Erstsemestlern, die entweder glauben, schreiben zu können, oder davon überzeugt sind, es in anderthalb Monaten zu lernen. Wie ich studieren sie Englisch als Master. Mehr als dreihundertfünfzig Studienanfänger wurden in diesem Jahr für das Englischstudium zugelassen. Jetzt sind wir nur zweiundzwanzig. In einem Seminarraum der Mason Hall, wo die meisten Kurse stattfinden, haben wir uns versammelt.
Professor Carter, die den Workshop »The Mood of Indian Summer« leitet, hat gerade in die Runde gefragt, welche Schreiberfahrungen wir haben. Eine Studentin, mit der ich vor zwei Stunden noch im Shakespeare-Kurs gesessen habe, erzählt, dass sie seit der Grundschule Gedichte über ihre Katzen schreibt, und wird dafür höflich ausgelacht. Danach geht es los: Chefredakteur der Schulzeitung, freie Mitarbeit bei den Ann Arbor News, mehrfacher Gewinner des Detroit Teen Poetry-Slams, erster Platz beim Short Story Contest, zehntausend verkaufte Exemplare des Self-Publishing-Romans, zweihundertfünfzigtausend Follower auf einem Fan-Fiction-Blog.
Schau mal, ob du ein Talent fürs Vom-Erdboden-verschluckt-Werden hast, ächzt der Spott in mir.
Ich rutsche auf dem Stuhl ein bisschen tiefer, damit mich Professor Carter nicht anspricht und in die Verlegenheit bringt, die Katzengedichte zu toppen und mein Dreizehn-Tagebuch zu erwähnen. Obwohl?! Vielleicht würde sich das Problem so von allein lösen. Vielleicht schmeißt sie mich dann raus.
Am Englischinstitut der University of Michigan, die man hier in Ann Arbor nur U of M nennt, ist Professor Carter eine Art Star. Zwei ihrer sechs Romane haben Auszeichnungen eingeheimst. Sie ist Assistenz-Professorin für Kreatives Schreiben. Ihre Kurse sind rappelvoll, auch dieser Zusatzkurs, für den es Extra-Credits gibt. Es ist daher gut möglich, dass sie mit einem Untalent wie mir keine Zeit verplempert.
»Kannst du mal aufhören, so herumzuzappeln?«, flüstert Stella und wirft mir einen genervten Blick zu. »Du machst mich nervöser, als ich sowieso schon bin.«
Meine Mitbewohnerin Stella ist in zweien meiner drei regulären Kurse, die ich neben der obligatorischen Basic-Vorlesung für meine fünfzehn Semester-Credits belege. Jeden Dienstag- und Donnerstagmorgen steht für Stella und mich Storytelling »Von Dickens zu Dexter« auf dem Programm. Montags und mittwochs sind wir bei Shakespeare. Dieser Kurs aus dem Bereich Literatur vor 1700 wird Erstsemestlern wärmstens empfohlen. Dementsprechend viele bekannte Gesichter sehe ich jetzt wieder, aber nur wenige Namen sind bisher hängen geblieben.
Stella linst zu Elijah, dem Grund allen Übels. Seit einem Monat, ziemlich genau seit dem Semesterbeginn Ende August, rackert sie sich schon an ihm ab. Praktisch in der Sekunde als er ihren Stift, der heruntergefallen war, aufgehoben und ihr gegeben hat, hat sie sich in ihn verliebt. Der Stift ist inzwischen so etwas wie ein Heiligtum. Sie schreibt ausschließlich damit. Als sie herausgefunden hat, dass Elijah diesen Workshop besucht, hat sie sich dafür eingeschrieben. Und mich gleich mit, um nicht allein zu sein.
Ich hätte einfach Nein sagen sollen, aber ich wollte Stella den Gefallen tun. Ich mag sie. Ich habe das Gefühl, wir werden von Mitbewohnerinnen zu Freundinnen. Für Stella scheint das eine selbstverständliche Entwicklung zu sein. Für mich ist es etwas Besonderes. Freunde sind schwer zu finden.
»Er tut so, als wäre ich nicht da«, wispert sie. »Vorhin, nach Shakespeare, sind wir zusammen aus dem Raum gegangen, und ich habe ihm gesagt, dass wir uns im Workshop sehen. Er fand das cool. Warum ignoriert er mich jetzt?«
Ich könnte auf meinen umfangreichen Wissensschatz zugreifen und ihr verschiedene Optionen vorstellen, warum Männer Frauen ignorieren. Aber dieses Wissen habe ich ausschließlich aus Romanen, und das Gefühl solchen Frustes kenne ich nicht einmal. Ich bin zwar oft ignoriert worden, aber nie auf diese Weise. Ich war auch noch nie verliebt. Lässt man Phillip Pirrip, Sherlock Holmes, Sir Lanzelot, Huckleberry Finn und Mister Darcy einmal außen vor.
Es ist also besser, wenn ich die Klappe halte. Ohnehin sollten wir Professor Carter zuhören.
»Sie werden lernen, Geschichten fesselnd zu erzählen«, sagt sie mit bedeutungsschwangerer Stimme. »Das können große Themen sein, aber auch vermeintlich unscheinbare. Es geht um Gefühle. Um Ihre Gefühle.«
Lächelnd schaut sie in die Gesichter ihrer Zuhörer. Wie in einem Gottesdienst schweigen wir alle andächtig und warten auf mehr. Die Prof wendet sich den vier Personen zu, deren Anwesenheit mich schon hat rätseln lassen.
»Ich habe mir Unterstützung geholt. Nick, Gloria, Daphne und Jordan studieren inzwischen im siebten Semester. In meinen Kursen gehören sie zu den Besten des Jahrgangs, daher bin ich überzeugt, dass sie Ihnen wunderbare Coaches sein werden.«
Die Studentin mit dem Selfpublishing-Roman meldet sich zu Wort: »Also lernen wir gar nicht von Ihnen?«
Ein paar andere stöhnen und schütteln die Köpfe. Professor Carter ignoriert das und antwortet: »Wir arbeiten in Gruppen. Nur so sind intensive Arbeit und individuelle Entwicklung möglich. Natürlich werde ich die meiste Zeit da sein, von Gruppe zu Gruppe gehen und zuhören. Außerdem lese ich Ihre Arbeiten. Zur Halbzeit und am Ende des Workshops, am fünften November, werde ich sie einsammeln.«
Damit übergibt sie das Wort an die vier Studenten.
Daphne macht den Anfang. Sie arbeitet neben dem Studium als Kolumnistin für die Detroit Free Press und glaubt zu wissen, worauf es beim kreativen Erzählen ankommt. Mit Freude will sie uns dieses Wissen vermitteln. Sie erntet freundlichen Applaus.
Gloria zählt ein paar Autoren auf, deren Werke sie bewundert, und ist gespannt auf die kreative Zusammenarbeit mit uns. Sie erntet freundlichen Applaus.
Nick hat Humor. Er erzählt von seinen ersten Texten, die heute in einer Schublade verstauben, die er sich nicht einmal mehr zu öffnen traut. Seiner Ansicht nach kann man nur lernen, gute Texte zu schreiben, wenn man regelmäßig schreibt, auch schlechte Texte. Er erntet freundlichen Applaus.
Jordan ist an der Reihe, doch ihm scheinen die Worte zu fehlen. Er schiebt die Hände in die Hosentaschen, mustert uns stumm.
Stella beugt sich zu mir und will gerade etwas sagen, da macht er den Mund auf.
»Die Anklage lautet: Totschlag«, sagt er.
Ein paar Leute kichern.
Er beachtet sie nicht und fährt fort: »Die Tatwaffe ist schnell gefunden. Es sind öde Texte.«
Das Kichern wird zu einem Lachen. Mir kriecht ein Schauder über die Arme.
Jordan hebt seine Stimme über das Lachen. »Neunzig Prozent aller, die meinen, schreiben zu müssen, sind die Täter. Sie haben die Literatur auf dem Gewissen.«
Ein paar Leute finden das noch lustig. Das Lachen klingt jetzt aber eher verhalten. Vermutlich bin ich nicht die Einzige, die sich bei den Worten dieses Typen ein bisschen gruselt.
Stella murmelt: »Irgendwas stimmt mit seinen Augen nicht. Sind die zweifarbig?«
In der Tat! Nicht allein was er von sich gibt ist irritierend, sondern auch sein Blick. Der ist nicht nur zweifarbig, sondern auch so kühl und hart, dass ich ihm ausweiche, als er bei mir ankommt. Für ein paar Sekunden schaue ich auf meine Knie, dann sehe ich wieder zu Jordan hin.
Seine Haare sind dunkelblond und ein bisschen länger. Wirr fallen sie um sein kantiges Gesicht. Sein Kinn könnte eine Rasur vertragen. Er ist schlank und größer als die anderen drei. Seine Kleidung ist schlicht. Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit weißem Herzfrequenz-Print auf der Brust, schwarze Jeans und schwarze Sneaker mit weißen Sohlen.
»Ich war mir nicht sicher, ob ich hier mitmachen soll«, sagt er, als das Lachen ganz verstummt. »Ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Professor Carter weiß das.«
Bei diesen Worten wirft er ihr einen Blick zu und grinst schief. Sie schmunzelt und wiegt den Kopf hin und her.
»Wie auch immer …« Jordan stellt das Grinsen ab. »Ich habe weder Zeit für noch Lust auf langweilige Texte.«
Nimm deine Füße in die Hände und lauf!, ruft die Angst.
»Ach du Scheiße!«, raunt Stella.
Mir bleibt die Spucke weg. Wer in der Gruppe dieses Typen landet, kann sich eigentlich gleich beerdigen lassen, wenn er nicht schon einen Bestseller veröffentlich hat.
»Wenn wir fantastisch schreiben könnten, wären wir aber nicht hier. Find ich ein bisschen krass, was du da sagst«, kontert der Student, der schon dreimal den Poetry-Slam gewonnen hat.
Sein Name ist AJ. Zusammen mit ihm und Simon, der neben ihm sitzt, habe ich ebenfalls dienstags und donnerstags ein Seminar, das sich Mark Twain und großen amerikanischen Schriftstellern widmet.
»Klar doch«, gibt Jordan zurück. »Meine Zeit verschwendet ihr auch erst dann, wenn ihr nicht lernt, nicht zuhört und stur in eurer Spur fahrt, entweder weil ihr nicht anders wollt … oder weil ihr nicht anders könnt. Letzteres wäre traurig, Ersteres einfach nur dumm. Gebt mir eure Ehrlichkeit, gebt mir eure Emotionen, gebt mir Texte, die Regeln brechen, dann bin ich zufrieden. So schwer ist das eigentlich nicht.«
Er setzt sich. Ich atme tief durch.
»Ich will auf gar keinen Fall in seine Gruppe«, flüstert Stella.
»Das will garantiert keiner«, gebe ich noch leiser zurück.
Ich schaue mich um. Die meisten schweigen, andere flüstern miteinander. Applaus gibt es keinen. Jordan scheint das nichts auszumachen.
Professor Carter greift sich eine kleine Box, in der gefaltete Zettel sind. Sie erklärt, dass unsere Namen auf den Zetteln stehen und dass die Coaches nacheinander einen Papierschnipsel ziehen werden. Aufgrund der Teilnehmerzahl, zweiundzwanzig, werden die Gruppen unterschiedlich stark sein. Daphne und Jordan haben sich bereit erklärt, jeweils sechs Studenten zu unterrichten. Leider steigt damit das Risiko, bei dem Sympathiebolzen zu landen.
Die Auslosung beginnt. Professor Carter geht von Coach zu Coach und lässt sie Zettel ziehen. Nervös rutsche ich auf dem Stuhl herum und schimpfe im Stillen wieder mit mir, weil ich nicht Nein gesagt habe. Als Elijah von Gloria gezogen wird, beginnt Stella neben mir, leise Stoßgebete gen Himmel zu senden. Wer auch immer da oben verantwortlich ist, hört sie scheinbar, denn in der nächsten Runde fischt Gloria ihren Namen aus der Box. Stella hat Mühe, ihre Freude nicht rauszujubeln.
Weiter geht es. Inzwischen bibbere ich vor mich hin, die Stirn auf die Hand gestützt, den Blick auf die Stuhllehne vor mir getackert. Rund herum atmen Leute auf oder freuen sich, wenn sie von Daphne, Gloria oder Nick gezogen werden. Wann immer Jordan einen Namen liest, wird verdrießlich geschwiegen.
»Layla Sullivan«, höre ich ihn schließlich sagen.
Nein!, protestiert der Trotz in mir. Warum sollst du dir das antun? Du musst hier nichts lernen. Du willst deine Blaubeer-Muffins nicht mit dem Schreiben verdienen, sondern mit dem Lesen. Du solltest jetzt gehen.
Vor Ärger brodelnd bleibe ich sitzen und starre die vordere Stuhllehne weiter an.
»Tut mir echt leid«, nuschelt Stella, während die Auslosung in die letzte Runde geht. »Vielleicht ist er gar nicht so schlimm.«
Ich drehe ihr den Kopf zu und ziehe eine Braue hoch.
Kapitel 2
1. Oktober
Jordan hat den letzten Mittwoch, an dem wir in die Teams gelost wurden, als Tag null bezeichnet. Heute will er mit uns durchstarten. Heute ist Workshoptag eins.
Für mich ist heute in erster Linie Freitag. Sechzehn Uhr. Eigentlich hätte ich schon um zehn Uhr, nach der Basic-Vorlesung im Auditorium der Angell Hall Schluss gehabt und wäre nach Hause gefahren. Stattdessen muss ich heute drei und morgen sechs Stunden in Raum 1460 der Mason Hall absitzen, lächerlicherweise im Zeichen des Indian Summers. Zu Hause, in Charlevoix, einer Kleinstadt im Norden am Lake Michigan, kann man den schönsten Indian Summer genau jetzt erleben. In Ann Arbor gibt es zwar einige Parks, aber die werden nicht so grandios bunt wie die Wälder rund um meine Heimatstadt. Und auch das Sonnenlicht schimmert hier nicht so warm und sanft wie ein zugleich wehmütiger und tröstender Abschiedsgruß des Sommers.
Ich setze mich auf einen der letzten beiden freien Plätze im Stuhlkreis. Jordan kommt kurz nach mir, schließt die Tür und nimmt mir gegenüber Platz. Links von mir sitzt Fan-Fiction-Blogger Bob, der freiwillig beginnt und uns seinen Blog vorstellt, auf dem er »Per Anhalter durch die Galaxis« mit immer neuen Geschichten weitererzählt. Selfpublisherin Cathryn, die auf Bobs anderer Seite sitzt, möchte einfach Cat genannt werden. Sie hat ihren Bestseller in nur einem Monat hingeklimpert, wie sie es nennt, und war vom Erfolg selbst überrascht. Neben Jordan hockt Benedict, der Benedict genannt werden will und nicht Ben. Er schreibt auch schon lange, und zwar neue Songtexte zu alten Liedern. Das tut er ausschließlich mit dem versilberten Luxusfüller seines Großvaters. Als er das in der Vorstellungsrunde sagt, hebt Poetry-Slammer AJ die Hand vor den Mund und nimmt sie erst wieder herunter, als er an der Reihe ist. Er hat zu slammen begonnen, nachdem er den Film »8 Mile« mit Eminem gesehen hatte. Auf Simon, rechts von mir, hatte ich alle Hoffnung in puncto Normal-Sein gesetzt, bis er erzählt, dass er seinen ersten Roman im Alter von zwölf verfasst hat, seither drei weitere, aber sich einfach nicht überwinden kann, sie einem Verlag vorzustellen.
Unglaublich! Das ist keine Vorstellungsrunde, sondern ein Contest, als würden sich hier alle auf einen, auf den einzigen Studienplatz bewerben.
Ja, und du wirst gleich in der Vorrunde ausscheiden, höhnt der Spott.
Aber davon abgesehen, wie crazy sie alle auch sein mögen, immerhin schreiben sie und sind damit mehr oder weniger erfolgreich.
Als Simon fertig ist, schaut mich Jordan an, auffordernd und dann abwartend. Jetzt erkenne ich seine Augenfarben; das linke Auge ist grün, das rechte bernsteinfarben. Wieder trägt er nur schwarze Klamotten. Statt einer Herzfrequenz hat er eine Bärensilhouette vorm Vollmond auf dem T-Shirt. »Papa Bear« steht darunter.
Absicht!, grummelt der Trotz. Er will sich als gutmütiger, vertrauenswürdiger Kuschelpapi präsentieren.
»Layla?« Jordans Blick ist durchdringend, als wolle er hinter meine Stirn schauen.
Ich blinzele. Ich bin dran. Immer noch.
Erzähl, dass du einen Poetry-Contest gewonnen und die Schulzeitung geleitest hast!, wispert die Hinterlist. Und einen teuren Füller hast du auch, aber deiner ist vergoldet.
Innerlich schüttele ich den Kopf.
»Das einzig halbwegs Kreative, was ich in den letzten Jahren geschrieben habe, waren Schulaufsätze«, gebe ich zu.
Ich höre, wie Cat kichert.
Jordan verzieht keine Miene. »Aber du willst schreiben lernen?«
»Ehrlich gesagt bin ich bloß hier, weil meine Mitbewohnerin darauf bestanden hat.«
»Vermutet sie ein schlummerndes Talent in dir oder warum?«
»Ich weiß es nicht.«
Jordan zieht eine Braue hoch. »Ah ja! Na dann.«
»Heißt ja nicht, dass sie kein Talent hat«, sagt jemand anderes. Mein Blick fliegt über die kleine Runde. Von AJ kam das. Er zwinkert mir zu. Ich spüre, dass mein Kopf rot wird, und sehe weg. Auch nicht zu Jordan, sondern auf meine Knie.
»Gut, dann lasst uns loslegen.« Jordan holt einen kleinen Stapel daumendicke, in festen Karton gebundene Hefte aus seiner Tasche. »Hier hab ich eure Journale. Das sind eure Schreibbegleiter. Ihr nutzt sie für Notizen und Textexperimente, haltet Ideen und Gedanken darin fest. Eure Storys schreibt ihr natürlich auch hinein.«
Während er die Journale austeilt, redet er weiter. »Wir wollen lernen, die Regeln zu brechen, um mit den Erwartungen der Leser zu spielen. Das ist ein Drahtseilakt. Und ihr wollt zu den Artisten werden.« Er wirft mir einen Blick zu. »Oder vielleicht auch nur schauen, ob ihr hier richtig seid. Wir werden sehen.«
Mach den Adler!, nörgelt der Frust. Wieso bist du noch hier? Stella und Elijah sind in einer Gruppe und jetzt dazu verdammt, ihr Glück zu finden. Mission accomplished.
Jordan geht zum Whiteboard und nimmt einen Stift. »Lerne die Regeln wie ein Profi, damit du sie brechen kannst wie ein Künstler!«, sagt er, schreibt es dabei auf und dreht sich wieder zu uns. »Diese Worte stammen von Pablo Picasso.«
Er schaut von einem zum anderen. »Um die Regeln brechen zu können, muss man sie aber erst einmal kennen. Was also sind die Regeln des kreativen Schreibens?«
»Gib dem Leser einen Charakter, mit dem er sich identifizieren kann«, schlägt AJ vor.
Verstohlen betrachte ich ihn.
Hipster-AJ nenne ich ihn im Stillen. Dass er diesen Poetry-Slam schon dreimal gewonnen hat, liegt ganz sicher nicht nur an seinem lyrischen Talent, sondern auch an seiner ungewöhnlichen Optik. Ohne den Hipster-Bart und die runde Hipster-Brille im John-Lennon-Stil, ohne die schwarzen Tattoos, die aus seinem von Hosenträgern in der Hose gezüchtigten Leinenhemd gucken, wäre er einfach ein attraktiver Typ. Mit all dem ist er außergewöhnlich. Die Mädels der Poetry-Slam-Szene verleitet er sicher zu Road-Movie-Träumen, deren Titel intellektuell und inhaltlich eigentlich viel zu anstrengend, aber trotzdem so romantisch sind.
AJ verunsichert mich, ohne dass ich weiß, warum. Am liebsten möchte ich durch ihn hindurchschauen, wie durch jeden anderen, aber sein Bart, seine Brille, die Tattoos und die Hosenträger halten mich davon ab.
»Jeder Satz muss entweder etwas über den Charakter verraten oder die Handlung voranbringen«, fügt AJ an, während Jordan die Regel notiert.
»Man soll sich Zeit lassen«, meint Benedict. »Die richtigen Worte kommen nicht auf Kommando.«
Jordan schüttelt den Kopf. »Das mag sein, ist aber keine Regel des kreativen Schreibens.«
»Zeigen, nicht erzählen«, zwitschert Cat und wirft sich die kupferrot gefärbten Haare über die Schultern zurück. »Und sparsam mit Adjektiven und Adverbien umgehen.«
»Gut, und stattdessen?«, hakt Jordan nach.
»Man sollte starke Substantive und Verben verwenden, um Gefühle oder Zustände erkennbar zu machen.«
Jordan notiert beide Regeln an der Tafel. »Auf Adjektive kann und sollte man natürlich nicht völlig verzichten«, erläutert er dazu. »Manchmal braucht man sie für die Anschaulichkeit, aber in vielen Fällen wirken sie blähend und nehmen der Sprache die Kraft und die Klarheit. Adjektivitis nennt man es, wenn Texte diese Krankheit haben.«
Cat weiß noch mehr: »Sei ein Sadist! Du musst gnadenlos sein mit deinen Charakteren, die schlimmsten Dinge müssen ihnen passieren.«
Jordan formuliert das um: »Enthülle die wahre Natur deiner Charaktere und ihr Potenzial, indem du sie an ihre Grenzen bringst.«
»Man soll im Aktiv formulieren und das Passiv möglichst vermeiden«, schlägt Bob vor.
»Vermeide Fremdwörter, Fachwörter oder geschwollen klingendes Geschwurbel«, legt AJ nach.
»Gib den Lesern so bald wie möglich so viele Informationen wie möglich«, sagt Simon. »Vor einer Weile dachte man noch, man solle es möglichst spannend machen und einiges für sich behalten, aber das ist wohl Blödsinn.«
Jordan notiert den ersten Teil und gleich darauf die Regel, die AJ noch einfällt: »Arbeite ausschließlich an einem Text so lange, bis er fertig ist.«
»Okay, neun wichtige Regeln haben wir.« Er dreht sich um und schaut mich an. »Eine fehlt mir noch. Layla, warum so still?«
Mein Herz rast los, als wäre es mit einem Peitschenhieb angetrieben worden. Ich spüre, wie mir Hitze in den Kopf steigt, und höre Cat neben mir amüsiert schnauben. Wahrscheinlich wundert sie sich, wie ausgerechnet mir die eine Regel einfallen soll, die keinem der Asse in den Sinn gekommen ist. Mir, die von allen hier ganz offenbar kein Schreibtalent besitzt und aus sekundären Gründen anwesend ist. Und da wundert sie sich zu Recht.
Ich könnte etwas sagen, das mir schon eine Weile auf der Zunge liegt, beiße mir aber lieber auf ebendiese und entscheide mich für ein: »Ich weiß es nicht.«
Leider lässt Jordan das nicht gelten.
»Dann denk nach. Na los, bemüh deine kleinen grauen Zellen.« Er hockt sich auf die Kante eines Tisches, verschränkt die Arme vor der Brust, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Was hat jede Geschichte?«
Es will nicht aus meinem Mund. Es ist, als hätte ich einen Knoten in meiner Zunge. Jordan wartet weiter. Ich kann unserem starr verbandelten Blick nicht länger standhalten, schaue weg und knurre: »Ich hab echt keinen Schimmer.«
»Mach es dir nicht so leicht. Was hat denn jede Geschichte, egal wie sie erzählt wird?«
»Eine spannende Handlung«, platzt es aus mir heraus.
Er wiegt den Kopf hin und her, gibt sich aber nicht zufrieden. »Manche guten Geschichten sind nicht spannend, sondern hoch emotional oder auf witzige Weise erzählt.«
»Unterhaltung!«, sagt Bob, aber Jordan bringt ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen und fixiert mich weiter mit seinem zweifarbigen Blick, der mich immer mehr nervt.
»Denk simpler!«, sagt er in mein trotziges Schweigen hinein.
Ja, verdammt! Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich total blamiere, denn simpler geht es nicht, aber gut. »Jede gute Geschichte braucht einen Anfang, ein Zentrum und ein Ende.«
Jordan lächelt. »Na bitte.«
Während er diese letzte Regel notiert, grummele ich im Stillen vor mich hin, kann meine Gedanken aber nicht länger zurückhalten und spucke sie aus.
»Das ist doch selbstverständlich. Diese Dinge sind essenziell.«
»Erzähl das den Leuten, die heutzutage Bücher veröffentlichen«, kontert Jordan, ohne sich umzudrehen. »Viele sehen einen Storybeginn. Dann überlegen sie sich, wie die Sache ausgeht, und füllen den Raum dazwischen mit einer Reihe Belanglosigkeiten. Oder sie zerren das Ende an den Haaren herbei.«
Er setzt ein Ausrufezeichen hinter die Regel und dreht sich wieder zu uns um.
»Jack trifft Diane in der S-Bahn zur Arbeit«, wirft er in den Raum. »Jack verliebt sich in Diane. Diane verliebt sich in Jack. Über die Spanne von vierhundert Seiten eiern sie von Date zu Date, mal gehen sie ins Kino, mal ins Restaurant. Am Ende sagen sich Jack und Diane endlich, dass sie einander lieben. Reizt dich diese Geschichte, Layla? Würdest du das lesen wollen?«
Ich schüttele den Kopf. »Das hätten sie sich schon dreihundertfünfzig Seiten eher sagen können.«
Im Augenwinkel sehe ich, dass AJ ein paar Worte mit Simon wechselt, und schaue hinüber. Sie wirken vertraut, scheinen befreundet zu sein. Beide sehen mich an, und ich erwarte Spott in ihren Blicken, aber der von Simon ist nichtssagend, während AJs freundlich ist. Zu allem Überfluss lächelt er mich an und bringt mich damit ziemlich durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, und konzentriere mich lieber auf Jordan, der zu einem anderen Thema übergegangen ist. Gemeinsam nehmen wir uns die erste Übung vor, die er das ABC nennt. Er sagt einen Satz, der mit dem Buchstaben A beginnt, und übergibt an AJ, der einen thematisch passenden Satz mit B anfügen soll. Simon macht mit C weiter, ich mit D. So geht es reihum und wird von Runde zu Runde lustiger. AJ fallen die witzigsten Sätze ein. Einmal ist unser Gelächter so laut, dass man es sicher sogar im Park vor der Mason Hall hören kann. Als ich mir eine Lachträne von der Wange wische und zu AJ schaue, sieht er mich wieder an und zwinkert mir zu. Pünktlich zur kurzen Pause haben wir das Alphabet voll.
AJ und Simon sprechen mit Jordan, Bob und Benedict beschäftigen sich mit ihren Handys. Cat verlässt den Raum. Ich gehe auch, um die Toilette aufzusuchen, und treffe dort auf Cat, die ihr Make-up auffrischt. Im Spiegel mustert sie mich auffallend lange und konzentriert sich dann wieder auf sich selbst.
Ich zögere einen Moment und überlege, ob ich etwas sagen soll, das das Eis zwischen uns brechen lässt. Ich könnte Cat fragen, welche Kurse sie belegt, aber wahrscheinlich verstünde sie das nur als hilflosen Versuch, ein Gespräch zu beginnen. Also lasse ich es, verschwinde in einer der Kabinen und komme erst wieder heraus, als ich die Tür hinter Cat ins Schloss fallen höre. Vor dem Spiegel strubbele ich mir durch die Haare und lasse meine Gedanken wegtrudeln. Dann trotte ich zurück, um die zweite Hälfte des Kurses hinter mich zu bringen.
Wenig überraschend sollen wir unsere eigenen Alphabet-Geschichten schreiben.
»Verbinden wir diese Übung mit einer zweiten«, sagt Jordan. »Eure ABC-Story darf von nur einem einzigen Charakter erzählen. Gebt ihm einen Namen, den ihr gut findet, und schreibt über diese Person. Erzählt, wer er oder sie ist und was er oder sie im Sinn hat.«
Ich brauche nicht lange, um einen Namen zu finden: Millicent Morales fällt mir prompt ein. Mit ihrer Geschichte tue ich mich aber schwer, würge an den Sätzen herum und bin froh, dass sich AJ und Bob melden, als Jordan eine Stunde später fragt, wer vorlesen möchte.
Jordan betrachtet uns andere, die ihre Hände unten gelassen haben, einen nach dem anderen.
»Heute kommt ihr so davon.« Er schmunzelt. »Es ist nicht mehr genug Zeit für sechs Texte, aber in Zukunft lesen immer alle.«
Nachdem AJ und Bob ihre ABC-Geschichten vorgetragen haben, verkündet Jordan unsere bis morgen zu erledigende Aufgabe. Wir sollen einen Text über unseren Lebenstraum mit nicht mehr als einhundert Wörtern verfassen.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Leben noch einmal Hausaufgaben wie an der Highschool bekomme. Aber davon abgesehen, das hat mir gerade noch gefehlt! Für nächste Woche muss ich mich auf eine Diskussion zu Shakespeares Richard III. vorbereiten, moralische Stellenwerte in Twains Huckleberry Finn in einem Essay analysieren und zwei von Dickens Erzählungen für einen Vergleich lesen. Vorhin, in den sechs freien Stunden nach dem Grundkurs bin ich mit dem Essay und der Diskussion vorangekommen, aber längst nicht fertig. Und die Erzählungen werden meine Bettlektüre fürs Wochenende. Die fürs kreative Schreiben offenbar zu erledigenden Hausaufgaben sind definitiv ein weiteres Argument gegen diesen Workshop.
Missmutig packe ich meinen Kram zusammen und gehe aus dem Raum, da ruft mich jemand. AJ, wie ich mit einem Blick über die Schulter feststelle.
»Kommst du gleich mit zum Fluss?«, fragt er.
Zum Fluss? Jetzt? Er und ich? Warum würde er mit mir zum Fluss wollen? Außerdem hat er doch mindestens genauso viele Kurse wie ich und sollte ebenso vielbeschäftigt sein.
»Es ist Freitag«, fügt er an. »Der Workshop trifft sich. Ist doch klar. Bist du da?«
»Ich, ähm …«
Stella taucht an meiner Seite auf.
»Wir treffen uns gleich alle am Fluss im Riverside Park«, plappert sie. »Wir müssen los, komm! Das wird mega.«
Damit schleppt sie mich mit sich. Auf dem Weg zu unserem Appartement geht sie in Gedanken ihren Kleiderschrank durch und stellt mir ihre möglichen herbstlichen Flussparty-Outfits vor. Die Auswahl ist umfangreich, und ich verliere schnell den Überblick. Klamottentechnisch ticke ich ein bisschen simpler. Um dennoch eine Hilfe zu sein, überlege ich, welche Farben am besten zu ihren schwarzen, glatten Haaren und ihrem dunkleren Teint passen. Stella hat asiatische Wurzeln; ihre Großeltern sind in jungen Jahren aus Malaysia eingewandert.
In ihrem Zimmer angekommen, fachsimpeln wir vor ihrem Schrank von Kleiderbügel zu Kleiderbügel und grübeln, womit sie Elijah, der meist Hemd oder Pullover und Jeans trägt, am meisten beeindrucken kann. Nach einer halben Stunde entscheidet sich Stella für ein weißes Strickkleid, eine rote Strickjacke und schwarze knöchelhohe Boots. Ihre dicken weißen Kniestrümpfe irritieren mich, aber das behalte ich für mich. Außerdem verwirrt mich ihre plötzliche Eile, vermutlich weil ich mich innerlich damit abgefunden hatte, vor dem Schrank zu bleiben. Es ist kurz nach sieben und dämmert schon. Jetzt noch rausgehen zu müssen, nervt mich eigentlich völlig, aber Stella freut sich so auf die Party, und ich will keine Spielverderberin sein.
Von unserem Wohngebäude aus, dem South Quadrangle, das alle nur South Quad nennen, ist es nicht weit bis zum Riverside Park. Zehn Minuten später sind wir dort. Die anderen haben schon ein Lagerfeuer an einer dafür vorgesehenen Stelle entzündet. Eine Soundbox spielt Musik ab. Aus diversen Rucksäcken schauen Flaschenhälse, angebrochene Sixpacks Bier stehen im Sand. Lisha, die wie Stella in Glorias Gruppe ist, stürmt beschwipst kreischend auf uns zu und fällt Stella um den Hals. Ihre Freude, Stella zu sehen, als sei es eine Ewigkeit her, triggert etwas in mir. Vielleicht auch, weil sie mich mit der gleichen Überschwänglichkeit begrüßt. Ich muss grinsen und habe das Gefühl, gleich wie Stella und Lisha auszuflippen. Einfach nur, weil ich hier bin. Vielleicht habe ich allen Grund dazu.
Ich bin am Wasser aufgewachsen, auf einer gerade einmal tausend Meter breiten Landzunge zwischen Lake Michigan und Lake Charlevoix. Aber ich habe nie eine Party an unserem Hausstrand veranstaltet, und ich wurde nie zu einer eingeladen. Wäre ich eingeladen gewesen, wäre ich nicht hingegangen. Mit den Leuten, die die Partys in Charlevoix organisiert haben, hatte ich nie etwas zu tun.
Etwa zehn Sekunden lang fühle ich mich jetzt wie ein Teil von allem … und gleich darauf wieder wie der Außenseiter. Stella ist die, die hier alle kennt, die alle begrüßen. Ich bin bloß ihre Begleitung. Ich hätte im Appartement bleiben und Dickens lesen sollen!
Stella nimmt die Weinflasche, die ihr Lisha hinhält, und setzt sie an. Ich schüttele den Kopf, als Stella mir davon anbietet. Im nächsten Moment lässt sie sich von Lisha fortziehen, zu Elijah, der gerade auf der Bildfläche erschienen ist. Während ich den beiden nachsehe, wächst dieses nagende, nervende, schreckliche Gefühl in mir.
Was soll ich machen? Stella nachlaufen? Oder mich irgendwo dazustellen, mich ins Gespräch einklinken und hoffen, dass ich beachtet werde?
Ich hasse das!
Ich gehöre nicht hierher. Habe ich noch nie. Ich sollte verschwinden.
Mein Blick fällt auf AJ. Er und Simon unterhalten sich mit zwei Mädels, die in Nicks Gruppe sind. Tammy und Lucy heißen die beiden, glaube ich. Alle vier lachen. AJ nimmt keine Notiz von mir.
Noch einmal schaue ich nach Stella, die ein Gespräch mit Elijah begonnen hat, dann mache ich einen Schritt zurück. Dem folgt ein weiterer, und dann bin ich auf dem Rückweg zum Appartement.
Kapitel 3
2. Oktober
Der Samstagskurs mit seinen sechs Stunden dürfte der härteste der drei wöchentlichen Workshoptage sein. Um zehn Uhr geht es los. Ausschlafen am Wochenende ade! Missmutig habe ich mich schon um halb neun aus den Federn zu gewühlt, um mit einer unerträglich gut gelaunten Stella zu frühstücken. Ich glaube, auch die anderen fünf in meiner Gruppe haben unerträglich gut gelaunt gefrühstückt. Ich glaube, sie mögen diesen Workshop und freuen sich auf jede Stunde, auch wenn sie den schwierigsten Coach erwischt haben.
Sie haben weniger als einhundert Worte geschrieben und dennoch alles gesagt. Alle haben große oder besondere Lebensträume. Besonders sind sie auch, weil alle so schöne Worte dafür gefunden haben. Worte, die ihre Träume lebendig und greifbar wirken lassen. Wem auch immer ich heute zuhöre, ich glaube, dass jeder einzelne von ihnen seinen Traum früher oder später verwirklichen wird, weil die geschriebenen Worte so sehr überzeugen.
Simon will sich ein Waldhaus in der kanadischen Wildnis kaufen und dort schreiben. Ob er damit erfolgreich sein wird oder nicht, spielt für ihn keine Rolle. Er will einfach nur an diesen Ort und das tun, was er liebt und von dem er glaubt, dass es das Einzige ist, das er kann.
Cat träumt von einem Leben in einem Vorort von New Jersey. Sie sieht sich an der Seite ihres Mannes, der in der ersten Liga Football spielt, und als Mutter ihrer zwei oder drei Kinder, denen sie Gutenachtgeschichten vorliest, die sie geschrieben hat. Ein Golden Retriever komplettiert die familiäre Idylle ihres Lebenstraums, der mich überrascht. Ich hätte sie eher als überzeugte Singlefrau mit heißen, aber flüchtigen Beziehungen an die Upper East Side von New York verortet.
Benedict will das Grundstück seiner verstorbenen Großeltern kaufen. Es wurde wegen Schulden zwangsversteigert, die Großeltern sind in einem Seniorenpflegeheim verstorben. Benedict hat in diesem Haus einen Großteil seiner Kindheit verbracht und will es sich zurückholen, um dort zu leben. Seine Geschichte rührt mich so sehr, dass ich Tränen wegblinzeln muss.
Bob will zum Saturn fliegen. Mit seinem Lebenstraum dreht er voll auf, erzählt uns von einer Mensch-Alien-Multikulti-Gesellschaft, die vollkommen abgefahren klingt, unfreiwillig lustig an manchen Stellen, aber trotzdem richtig gut.
AJ möchte zusammen mit seinem Bruder, der geistig behindert ist und am liebsten Abenteuerfilme schaut, eine Wüstenrallye durch die Sahara fahren. Sich und seinem Bruder will er das Gefühl endloser Freiheit und Unabhängigkeit geben, wenn auch nur für einen Monat. Er will ein solches Abenteuer einmal erlebt haben, und er will es mit seinem Bruder teilen.
Noch mehr als bei Benedicts Geschichte kämpfe ich jetzt mit den Tränen. Die anderen sind ähnlich gerührt. Jordan gibt ein anerkennendes »Wow, sehr gut geschrieben« von sich und äußert damit mehr Lob als bei jedem zuvor. Zwar hat er keinen der anderen heruntergeputzt, aber immer mindestens einen Kritikpunk gehabt.
Ich bin dran! Und ich will nicht.
Ich schüttele den Kopf, aber Jordan tut das auch.
»Leg los«, sagt er. »Wir sind gespannt.«
Meine Hände zittern, als ich mein Journal aufschlage. Ich habe den Text gestern nach meinem kurzen Partybesuch geschrieben und zehnmal neu angefangen. Es wäre leichter gewesen, über den Beruf der Buchhändlerin oder Englischlehrerin zu schreiben, aber diese beiden sind nur Optionen, falls ich knapp am Ziel vorbeischramme. Also habe ich mir Gedanken über den Job der Lektorin gemacht, an Sätzen herumgedoktert, Worte ausgetauscht. Gegen zwei war ich fertig, da kam Stella von der Party und hat gemeckert, weil ich so früh verschwunden bin. Ihre Fortschritte bei Elijah waren glücklicherweise wichtiger als mein unentschuldigter Abgang.
»Ich möchte Lektorin sein«, lese ich und möchte das Journal am liebsten in eine Ecke klatschen, weil schon dieser eine Satz so dämlich, so uninteressant klingt im Vergleich zu allem, was ich bisher gehört habe. »Mir ist ganz egal, wo ich für diesen Job leben werde. Der Verlag spielt auch keine Rolle. Ich möchte einfach nur lesen. Ich möchte tolle Geschichten finden, ihnen eine Plattform und ein Publikum geben. Dabei will ich mich nicht von den gerade gefragten Themen leiten lassen, sondern vom tatsächlichen Potenzial. Ich will keinen Trends treu sein und Storys nur deshalb veröffentlichen, weil sie einer Erfolgsgeschichte ähneln. Ich möchte, dass die Leser mit den von mir entdeckten Romanen etwas Unerwartetes zu lesen bekommen. Ganz neue Geschichten sollen es sein, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit zu Weltbeststellern werden.«
Das sind ganz genau neunundneunzig Worte. Nur eins weniger, als ich gedurft hätte. Vorhin fand ich meine Gedanken noch richtig gut, insbesondere den zum Unerwarteten. Schließlich hat Jordan gesagt, man soll mit der Erwartung der Leser spielen. Inzwischen habe ich aber gar kein gutes Gefühl mehr.
Nach meinem letzten Wort herrscht Schweigen. Das ist okay. Wir haben nach jeder Geschichte geschwiegen. Als ich aufsehe, entdecke ich jedoch nirgends Tränen der Rührung oder ein seliges Lächeln. Cat zieht eine spitze Schnute, Simon kratzt sich an der Schulter, Benedict runzelt die Stirn, Bob bläst die Backen auf, AJ verzieht den Mund wie zu einem bedauernden Das war nix. Jordan starrt mich an, als würde er auf mehr warten.
Mehr gibt es nicht.
»Das war’s?«, fragt er.
»Das waren neunundneunzig Worte.«
Mit einem »Das waren Worte, ja« verschränkt er die Arme vor der Brust. »Tut mir leid, Layla, aber ich habe selten so viele seelenlose Worte gehört.«
Obwohl ich es fast geahnt habe, trifft mich sein Urteil wie eine Faust in den Magen. Alle Gedanken schwirren aus meinem Kopf und lassen Leere zurück. Wie durch einen Schleier sehe ich, dass Jordan den Kopf in den Nacken legt, durchatmet, sich wieder gerade hinsetzt.
»Du hast das Wort Job verwendet«, sagt er. »Und das war wie ein Intro zu allem weiteren. Wir alle machen irgendwann einen Job. Wenn dieser sogenannte Job unser Lebenstraum ist, nennen wir ihn nicht so.«
Ich will aufspringen und weglaufen, bin aber wie gelähmt.
Und Jordan redet weiter.
»Du willst Lektorin sein. Du willst, wie du es nennst, tolle Geschichten finden.« Das Adjektiv kommt mit einiger Verachtung über seine Lippen. »An deiner Stelle würde ich mich auf die Suche nach grandiosen, fantastischen, ergreifenden Geschichten machen. Dazu fühlst du dich berufen, wenn das dein Lebenstraum ist, richtig? Solche Geschichten brauchst du wie die Luft zum Atmen. Du willst umgehauen werden davon, von diesen Outsidern, vermeintlichen Underdogs, und du willst, dass jede dieser Geschichten wie eine Flut über diesen Planeten rauscht und auch jeden anderen umhaut. Sie sollen Herzen erobern, Diskussionen auslösen, die Gefühle verrücktspielen lassen. Die Leser sollen sie auslesen, die von dir gefundenen Geschichten, und davon so berührt sein, dass sie wochenlang nichts anderes lesen können.«
Ein Frösteln jagt das nächste. Jedes einzelne Wort könnte meins sein. Jeder Satz, genauso formuliert, könnte meiner sein. Was Jordan sagt, ist genau das, was ich denke. Es fand seinen Weg aber nicht über meine Finger und den Stift in mein Journal. So wenig, wie es jetzt irgendein Wort aus meinem Mund schafft.
Jordan klingt plötzlich sauer: »Bei dem, was ich von dir gerade gehört habe, frage ich mich ganz ehrlich, ob du als Lektorin wirklich glücklich werden willst oder halt doch einfach nur einen passabel bezahlten, relativ sicheren Job.«
Erschrocken starre ich ihn an. Dann klappe ich mein Journal zu und lasse es in meiner Tasche verschwinden. Als ich aufstehe, vermeide ich den Blick in die Runde.
»Ich gehöre nicht hierher«, murmele ich, füge noch ein »Sorry« an und husche aus dem Raum. Der Flur ist wie ausgestorben. Ich tappe ein paar Schritte in Richtung Ausgang, lehne mich dann an die Wand und versuche, einen klaren Kopf zu bekommen. Das will mir nicht gelingen, denn einerseits bin ich froh, diesen Workshop verlassen zu haben, andererseits habe ich ein schlechtes Gefühl deswegen, als hätte ich einen Fehler gemacht, in jedem Fall aber versagt.
Ich sehe AJ erst, als er vor mir steht.
Wie eben noch verzieht er den Mund zu einem mitleidigen Lächeln. Ich will sein Mitleid nicht und sehe an ihm vorbei.
»Ich finde nicht, dass du aufgeben solltest«, höre ich ihn sagen.
»Ach ja, warum nicht? Ich habe deinen Text gehört und kann jetzt schon sagen, dass du Talent hast. Mein Text war genauso aufschlussreich, eben nur in die andere Richtung.«
»Blödsinn.«
»Nein. Ich verschwende deine Zeit, die der anderen und in erster Linie die von diesem Blödmann! Das hat er doch klar zum Ausdruck gebracht. Er hasst es, wenn jemand ohne Talent seine Zeit verschwendet.«
»Lass dich von ihm nicht so verunsichern. Du solltest mehr scheiben als einen Text, um herauszufinden, ob du schreiben kannst. Am Ende des Kurses kannst du vielleicht darüber urteilen. Jetzt ist es noch viel zu früh.«
Das sehe ich anders, sage aber nichts mehr dazu, denn da ist etwas anderes, das mich plötzlich beschäftigt.
»Warum kümmert es dich überhaupt?«
AJ zuckt mit den Schultern. »Weil ich dich mag.«
Er mag mich? Er kennt mich doch gar nicht.
Mit einem »Warum?« schaue ich AJ wieder an. Es interessiert mich wirklich. Wahrscheinlich würde jeder anderen gerade das Herz aufgehen, aber ich finde es merkwürdig.
»Ich hab dich vermisst gestern Abend«, sagt er statt einer Antwort.
Ich versuche, in seinem durch die John-Lennon-Brille schlau wirkenden Blick zu lesen. Seine Augen sind dunkelbraun und von dichten Wimpern gerahmt. Viele Frauen würden töten für solche Wimpern. Von der Farbe und ihrem Rahmen abgesehen, entdecke ich darin nichts.
Er verarscht dich, flüstert die Vorsicht in mir.
»Du hattest gesagt, dass du kommst«, murmelt er.
»Ich war da. Ganz kurz nur. Ich musste wieder weg.«
»Schade. Es war echt gut. Schaffst du es heute vielleicht?«
»Ich habe den Workshop gerade geschmissen. Also habe ich auf den Partys nichts mehr verloren.«
»Du hast den Workshop nicht geschmissen.« Er macht einen letzten Schritt auf mich zu und steht damit gefühlt viel zu nahe bei mir. Sein Lächeln ändert sich und wirkt plötzlich nicht mehr mitleidig, sondern ein bisschen spöttisch. »Du ringst gerade mit dir, bist eigentlich schon auf dem Weg zurück.«
Als das Geräusch einer zufallenden Tür durch den Flur schallt, schauen wir den Flur entlang. Beim Anblick von Jordan schwindet der Mut, den ich gerade am Zipfel gegriffen hatte, wieder.
»Ist das hier draußen die Antiparty?«, fragt er und bleibt bei uns stehen. »Habt ihr gute Themen? Wenn ja, würden wir Loser da drinnen euch Gesellschaft leisten.«
»Ich finde es falsch, dass Layla hinschmeißt«, erklärt ihm AJ und geht wieder einen Schritt von mir weg. »So daneben ist ihr Text gar nicht. Ein bisschen positives Feedback …«
»Gib uns bitte mal zwei Minuten«, fällt ihm Jordan ins Wort, ohne sich um seine Kritik zu scheren.
AJ tauscht einen Blick mit mir, der mich scheinbar aufmuntern soll, und verschwindet. Mit Jordan allein fühle ich mich plötzlich wie vor einem Richter, der kurz davor ist, den Schuldspruch zu verkünden. Voller Unbehagen verschränke ich die Arme vor der Brust und muss mich geradezu zwingen, ihn anzuschauen. Sein Blick ist hart und kühl. Keine Spur des Bedauerns liegt darin.
»Willst du schreiben können oder nicht?«, fragt er.
Nachdenklich betrachte ich das heutige Motiv seines schwarzen T-Shirts: Ein roter Fuchs auf einem klapprig aussehenden Fahrrad, das ein bisschen zu klein für ihn ist. Man könnte fast meinen, dass Jordan Humor hat.
»Schaden kann das nicht … als Lektorin«, höre ich von ihm und überwinde mich, vom netten Fuchs zu seinem nicht so netten Gesicht zu sehen. Er klappt den Mund zu und schaut mich an, als müsste ich dazu irgendetwas sagen. Ich habe nichts zu sagen, und er redet weiter.
»Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Nicht jede grandiose Geschichte ist von Anfang an gut geschrieben oder druckfertig. Eigentlich wird sie erst durch die Arbeit des Lektorats …« Abermals zögert er und fährt dann fort. »… so was wie perfekt. Ich glaube nicht, dass es das perfekte Buch gibt oder dass irgendetwas wirklich perfekt sein kann.«
Ein Teil der Kälte in Jordans zweifarbigen Augen schmilzt. Es wäre übertrieben, seinen Blick als herzlich zu bezeichnen, aber immerhin starrt er mich nicht mehr an, als würde er mich verachten.
»Perfektion ist langweilig«, murmele ich. »Eine perfekte Story würde ich weder lesen noch herausgeben wollen.«
»Okay.« Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Ganz kurz nur ist es da; es verschwindet gleich wieder in der ernsten Linie seines Mundes. »Also gut, wenn du mir eine zweite Chance gibst, gebe ich dir auch eine.«
»Einverstanden.«
Er macht einen Schritt zurück, in Richtung des Raums. Ich folge ihm.
Kapitel 4
2. Oktober – abends
Noch als wir am Fluss ums Feuer sitzen, geht mir der Workshop nicht aus dem Kopf. Den Nachmittag haben wir mit Übungen verbracht, die an unsere Texte angeknüpft waren. Es ging um Freude und Vorfreude. Jordan hat uns Bilder in die Hand gedrückt, die entweder das eine oder das andere auslösen. Wir sollten uns in das jeweilige Gefühl hineinfühlen, um es mit wenigen Worten zu beschreiben. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es ist mir nicht leichtgefallen. Wie schon bei der Hausaufgabe konnte ich meine Gedanken bündeln, sie waren in meinem Kopf und meinem Herzen, haben mich lächeln lassen und innerlich erwärmt. Aber ich war nicht in der Lage, sie zu formulieren. Als wäre ich stumm. Emotional stumm. Immerhin hat sich Jordan mit seiner Kritik zurückgehalten.
Nervös denke ich an die neue Hausaufgabe, bei der es um eine andere Emotion geht, eine negative diesmal: die Enttäuschung. Ich befürchte, damit werde ich ähnliche Probleme haben.
Stellas Stimme holt mich aus meinen Gedanken. »Da ist er«, raunt sie und knufft mich in die Seite.
Elijah ist eingetroffen, reichlich spät. Stella hat die letzte Stunde damit verbracht, sich die Tragödie der Sinnlosigkeit auszumalen, die sich ohne Elijah hier am Flussufer abspielen würde. Die restliche Zeit hat sie sich gefragt, was er bloß Besseres vorhaben könnte.
Ich beobachte, wie Elijah zu drei Jungs aus Daphnes Gruppe geht und sie mit Handschlägen begrüßt. Dass er damit in der Nähe der drei Mädels steht, die ebenfalls bei Daphne sind, gefällt Stella nicht. Insbesondere nicht, als sie ihm neugierige Blicke zuwerfen.
Ich kann Stellas Verliebtheit und auch das Interesse der anderen nachvollziehen, denn Elijah ist praktisch schön wie ein griechischer Gott. Allerdings ist ihm das entweder nicht bewusst oder egal. Er ist in jedem Fall weit davon entfernt, sich auf sein Aussehen etwas einzubilden, und das macht ihn so sympathisch. Er bekommt nicht einmal mit, dass ihn so viele anschmachten.
»Ich muss da irgendwie hin«, murmelt Stella.
Wenn sie zu Elijah geht, bleibe ich, wo ich bin. Das nehme ich mir fest vor. Ich verdrücke mich auf keinen Fall wieder. Mir gefällt es am Feuer, bei den anderen. Es ist warm und gemütlich, und die flackernden Flammen hüllen den von uns belegten Teil des Parks in ein warmes Licht. Den Huron River, dessen Ufer nur zehn Meter entfernt ist, erreicht der Feuerschein aber nicht. Sein Wasser glitzert silbrig im Mondlicht.
Benedict, AJ und Kyle, der wie Stella und Elijah in Glorias Gruppe ist, haben Gitarren dabei. Sie wechseln sich mit dem Spielen ab, zupfen die Melodien älterer und neuerer Songs von den Saiten. AJ ist der zweite, der angeschmachtet wird. Anders als Elijah scheint er sich dessen bewusst zu sein. Säße er nicht zwischen den beiden Jungs, würden Tammy und Lucy an seinen Seiten kleben. Sie flirten mit ihm, indem sie ihn damit aufziehen, dass er bestimmte Songs nicht spielen kann, und AJ flirtet zurück, indem er ihnen zuerst zustimmt und ihnen dann das Gegenteil beweist.
»Er schaut gar nicht, ob ich da bin«, murrt Stella.
Ich sehe zu Elijah, der immer noch bei den Jungs aus Daphnes Gruppe steht, und versuche, Stella zu beruhigen. »Er ist doch eben erst gekommen und unterhält sich gerade.«
»Ich würde sofort nach ihm schauen.«
»Er ist nicht du. Wenn ihr gestern Abend lange geredet habt und heute im Workshop auch ein paar Mal, wird er …«
Sie unterbricht mich und schwärmt. »Ich hab dir noch nicht von seiner Geschichte erzählt. Er schreibt so klasse. Er träumt vom Leben in Italien, von einem Haus in den Weinbergen der Toskana. Stell dir vor, wir haben denselben Traum.«
Ich entsinne mich an Stellas Lebenstraum, den sie mir gestern Abend vorgelesen hat. Sie selbst muss ich offenbar auch daran erinnern.
»Du willst in Maine leben.«
»Ich hätte schwören können, dass es bei ihm Klick gemacht hat, nachdem ich vorgelesen hatte.«
»Zwischen Italien und der Ostküste liegen an die zehntausend Kilometer.«
Sie stöhnt, runzelt die Stirn und schüttelt den Kopf, als würde ich das Entscheidende an der Sache nicht kapieren. Tue ich sicher auch nicht.
»Die Toskana ist so etwas wie das europäische Neuengland«, erklärt sie mir. »Und in meiner Geschichte ging es auch um ein zurückgezogenes Leben inmitten von Weinbergen.«
»Auf einem anderen Kontinent.«
Stella schlägt mir auf den Arm. »Du bist so unromantisch«, ruft sie und lacht.
Ich muss auch lachen.
»Das glaube ich nicht«, kontert jemand in unsere Richtung. AJ. Er schaut zu uns herüber.
»Was glaubst du nicht?«, fragt ihn Stella.
»Dass Layla unromantisch ist.«
Wahrscheinlich enttäusche ich seine Erwartungen, als ich nichts sage und wieder wegsehe.
Benedict spielt die Melodie eines Songs, der vielen nicht gefällt. Ein paar Leute nörgeln, Tammy und Lucy bitten AJ um einen Song von Ed Sheeran.
Stella beugt sich zu mir. »AJ steht auf dich«, raunt sie mir ins Ohr. »Er ist übrigens Elijahs Mitbewohner. Elijah sagt, der Typ ist krass.«
Krass? Pff!
»Echt, was tut er denn Krasses?« Den belustigten Tonfall kann ich mir nicht verkneifen. »Züchtet er Klapperschlangen, macht er Base-Jumping, oder so?«
»Er ist einfach ein cooler Kerl, das ist mit krass gemeint.«
Genau das passt an der Sache nicht, warnt mich die Vernunft. Er ist cool. Und du bist langweilig.
Stella flüstert weiter auf mich ein: »Er hat deine Aufmerksamkeit gesucht. Merkst du nicht, dass er immer wieder herguckt?«
Ich merke es, und ich finde es merkwürdig. Was will er von mir? Warum will er was von mir?
»Echt jetzt, Layls! Wird Zeit, dass du die Tomaten von den Augen nimmst.«
Ich will die Tomaten kommentieren, da stimmt AJ einen neuen Song an, indem er kräftiger an den Saiten zupft. Die Melodie kommt mir bekannt vor. Es ist irgendein alter Song. Erst als AJ zu singen anfängt, weiß ich, welcher es ist und was mir damit bevorsteht. Während rund herum alle jubeln, weil endlich auch gesungen wird, möchte ich in entgegengesetzter Grasrichtung wachsen. Im Chorus hat dann auch der Letzte kapiert, dass der Song mir gilt, und alle singen mit:
»›Layla, you got me on my knees. Layla, I’m begging, darling please. Layla, darling, won’t you ease my worried mind?‹«
Eric Claptons Layla war in den siebziger Jahren so beliebt, wie es offenbar heute noch ist.
Stella neben mir lacht sich halb kaputt, schafft es dabei aber doch mitzusingen. Ganz und scheinbar ernsthaft bei der Sache, bringt AJ das Lied zu Ende. Dabei schaut er abwechselnd auf die Gitarrensaiten und zu mir. Am Schluss, als es Applaus gibt, lächelt er mich an.
»Hast du’s jetzt auch kapiert?« Stella legt den Arm um mich. Ihr Hin-und-weg-Sein von AJs Ständchen hält nicht lange an. Plötzlich wird sie nervös. »Wo ist Elijah hin?«
Ich schaue mich um, sehe ihn aber nirgends.
»Gerade war er doch noch da«, schimpft sie leise.
»Elijah ist mit Mason, Dennis und Cat weg«, informiert sie Bob, der gerade erst zum Feuer gekommen ist. »Die wollen irgendwo in der Stadt was essen.«
Damit verpufft Stellas gute Stimmung. Sie wird nörgelig und beginnt zu frieren. Keine zehn Minuten später sind wir auf dem Heimweg. Stella wollte mich zum Bleiben überreden, aber ich wollte sie nicht allein durch den Park und die Straßen von Ann Arbor ziehen lassen. Außerdem wird AJ längst von Tammy und Lucy in Beschlag genommen. Im Augenwinkel habe ich zwar gesehen, dass er immer wieder zu mir geschaut hat, aber ich will nicht bleiben. Mein sechster Sinn sagt mir, dass mit dem Typen etwas nicht stimmt. Mein sechster Sinn ist gut trainiert und hat mich bisher nie getrogen.
»Diese Cat ist doch in deiner Gruppe?«, fragt Stella, nachdem sie eine Weile vor sich hin gegrummelt hat.
»Ist sie, ja.«
»Sie hat diesen Roman selbst herausgegeben, diesen Porno, stimmt’s?«
Uff! »Wie kommst du darauf, dass es ein Porno ist?« Das ist das erste Mal, dass ich das höre.
»Weiß doch jeder, weil sie es überall herumposaunt. Platz eins bei Amazon für fünf Tage, bla bla!« Stella redet sich in Rage. »Irgendeine Fickgeschichte zwischen einem Mauerblümchen und Mister Million-Dollar-Sexgott-Dauerschwanzgesteuert, der sich einfach nicht gegen den Mauerblümchen-Charme wehren kann, obwohl er eigentlich lieber weiter durch die Betten der viel weniger komplizierten Barbies hüpfen würde.«
»Hast du das Buch gelesen?«
»Nä!« Das spuckt Stella förmlich aus. »So einen Dreck rühr ich nicht an.«
Es wird Zeit, sie zu bremsen.
»Also, mal angenommen, Cat hat einen Erotikroman geschrieben«, sage ich. »Das bedeutet doch nicht automatisch, dass sie sich an Elijah ranmacht.«
»Warum ist sie sonst mit den Jungs mit?«
»Weil sie Hunger hatte?«
Stella schnaubt. »Du bist nicht ernsthaft so naiv, oder?«