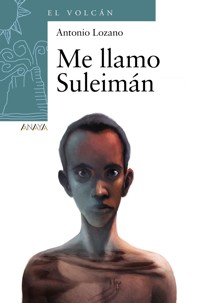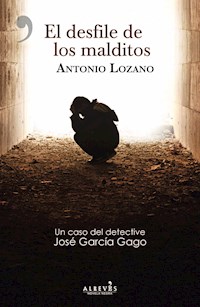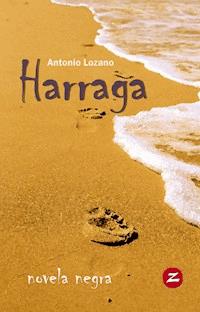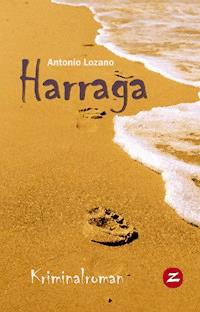
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Krimis u. Thriller
- Sprache: Deutsch
Khalid, ein junger Kellner aus der Medina von Tanger, träumt von einem besseren Leben in Europa. Über einen marokkanischen Landsmann kommt er nach Granada. Gefangen zwischen den Erwartungen seiner armen Familie und seinem neuen Leben im vermeintlichen Paradies, steht er bald in einer tödlichen Sackgasse... Flüchtlingsdrama an der Meerenge von Gibraltar: Korruption, Menschenhandel, Mord, Verzweiflung. Antonio Lozano schildert in diesem Roman hautnah eine menschliche Tragödie, wie sie sich täglich hundertfach an den Grenzen der "Festung Europa" abspielt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Lozano
Harraga
Im Netz der Menschenhändler · Kriminalroman
Über das Buch
Khalid, ein junger Kellner aus der Medina von Tanger, träumt von einem besseren Leben in Europa. Über einen marokkanischen Landsmann kommt er nach Granada. Gefangen zwischen den Erwartungen seiner armen Familie und seinem neuen Leben im vermeintlichen Paradies, steht er bald in einer tödlichen Sackgasse... Flüchtlingsdrama an der Meerenge von Gibraltar: Korruption, Menschenhandel, Mord, Verzweiflung. Antonio Lozano schildert in diesem Roman hautnah eine menschliche Tragödie, wie sie sich täglich hundertfach an den Grenzen der »Festung Europa« abspielt.
Der Autor
Antonio Lozano González (geb. 1956 in Tanger, Marokko) schreibt politische und Kriminalromane. Lehrer und Übersetzer für die französische Sprache, Kulturrat der Stadt Agüimes (Gran Canaria), Leiter internationaler Theaterfestivals. Sein Erstlingsroman Harraga wurde u.a. mit dem Premio Novelpol 2003 als bester Krimi in Spanien ausgezeichnet.
Die Meerenge von Gibraltar
1
Ich schließe die Augen. Von meiner Pritsche aus sehe ich nichts als die rissige Decke des Raumes, in den sie mich eingesperrt haben. Ich zähle die Tage, Wochen und Jahre nicht mehr, die ich schon hier drin bin. Ich unterscheide Tag und Nacht nicht mehr. Eine Glühbirne, die nur erlischt, wenn sie durchbrennt, und wieder aufleuchtet, wenn sie ersetzt wird, ist mein ein-ziges Licht. Die Sonne von Tanger – der Stadt, in der ich geboren wurde – hat hier keinen Zutritt.
Manchmal scheint es mir, als hätten sie mich aus der Wirklichkeit vertrieben, als befände ich mich in der Hölle. Aber nein, in die Hölle wirst du nicht von einem Aufseher hineingeprügelt. Daran erinnere ich mich. Ganz deutlich.
Alles andere: meine leuchtende Stadt, die engen Gassen meiner Kindheit, die Bucht von Tanger, so einladend wie die Arme einer Mutter; meine Eltern, meine Geschwister, mein Cousin, das kleine Haus in der Medina, die Armut, die ich jetzt sehnsüchtig vermisse; Jasminas Brüste, der Minztee, meine Haschischpfeife, Abderrahman, dessen Erinnerung mich so schwer drückt wie der Tod ... all dies muss ich zwischen den Rissen an der Zimmerdecke suchen. Ich habe sehr viel Zeit, den Erinnerungen nachzuspüren, um dort wiederzufinden, was mir diese Zelle geraubt hat.
Dauernd warte ich darauf, dass einer der Meinen, eines der Wesen, die ich im Leben liebte, aus den Rissen hervortritt und zu meiner Pritsche herabsteigt, sich zu mir setzt und mich anspricht. Ich erdichte dann lange Gespräche zwischen uns oder betrachte die Erscheinung, bis sie sich zwischen den Tränen auflöst, die meine Augen überfluten.
Seit langem unterscheide ich nicht mehr zwischen Träumen und Denken. Um zu spüren, dass ich noch lebe, muss ich meine Geschichte rekonstruieren, mich an jeden Schritt erinnern, der mich hierher geführt hat, muss wissen, welche Sünde, welche Hoffnung mich von meinem Weg abweichen ließ, um mich schließlich auf diese Pritsche zu verbannen und in einem Loch einzusperren, zu dem die Sonne von Tanger keinen Zutritt hat.
2
Ich kreuzte die Meerenge von Gibraltar wie ein Señor, würden die Spanier sagen: mit Anzug und Krawatte, Geld und Kreditkarten, das Visum gut sichtbar auf meinem Pass. In dieser Hinsicht konnte ich mich nicht beklagen. Ich kam nicht in einer Patera an, ich tat alles, wie es sich gehörte, und wurde respektiert. Ja, ein paar meiner Landsleute wurden beschimpft, gefilzt und schikaniert, aber ich ging vor ihnen durch und bekam fast nichts davon mit – nur ein dumpfes Raunen, das mein Glück nicht trüben konnte. Ich überquerte die Meerenge mit allem, was dazu gehört, in Einklang mit Recht und Gesetz.
Der Grenzpolizist in seiner Kabine überprüfte die Pässe von vorn bis hinten, von oben nach unten und noch einmal von vorn. Seine Augen wanderten zwischen dem Foto und dem Besitzer des Dokuments hin und her. Dann ließ er das Siegel des ›Willkommen in der zivilisierten Welt‹ sadistisch einige, ewigwährende Sekunden lang in der Luft schweben, bevor er den Stempel auf den angehaltenen Atem des Emigranten fallen ließ. Gleich hinter der Passkontrolle erwartete mich Hamid. Aufrecht stand er in der Tür, die Europa bedeutete.
»Grüß dich, Bruder!« Er umarmte mich. »Du wirst müde sein.«
»Egal. Ich will so schnell wie möglich weg von hier!«
»Ruhig, Khalid, es ist alles in Ordnung! Wir sind hier in einem freien Land. Hier werden die Rechte der Menschen respektiert, die einen gültigen Pass besitzen.«
»Nur für alle Fälle ...«
Ich hatte Hamid vor ungefähr zehn Jahren kennengelernt. Er war mit meinem Cousin ins Café Manila gekommen, an einem dieser endlosen Sommernachmittage in Tanger, die wir mit grünem Tee und Parchís totschlugen. Er war im Instituto Español zur Schule gegangen, bevor er ein Stipendium bekommen hatte, um in Granada Medizin zu studieren. Für uns alle, die wir dort um den rissigen Resopal-Tisch versammelt saßen, war er ein Held. Er erzählte uns von Spanien, vom Nachtleben und von den Frauen. Er erzählte uns vom Studium und von seinen Zukunftsplänen, dass er seine Ausbildung beenden und eine Spanierin heiraten würde:
»Frauen habe ich dort zuhauf! Wir Marokkaner stehen in dem Ruf, gute Liebhaber zu sein. Irgendwann wird meine Auserwählte dabei sein. Ich werde eine eigene Praxis haben, reich und glücklich sein.«
Ein Mann mit Zukunftsperspektive war für uns die Ausnahme. Die Gäste des Manila beneideten und bewunderten ihn zugleich, denn hier bildeten die schmuddeligen Parchís-Figürchen die einzigen Vehikel zu einem Sieg. Das Ächzen der Bäume, die vom Levante geschüttelt wurden, prägte den Rhythmus unseres Lebens, das in den Gassen zwischen der Medina und dem Stammcafé verstrich. Unsere weitesten Ausflüge führten uns zum Strand, dessen Sand sich in der Abendsonne erwärmte, oder zum Aussichtspunkt in den Bergen, wo uns die Wespen zusetzten, wenn wir unseren Tee tranken. Hamid erschien uns wie ein Auserwählter, weil er die Chance hatte, diesem Elend, in dem wir alle lebten, zu entkommen. Bei uns zu Hause drängten wir uns mit sieben Geschwistern und meinen Eltern in drei schäbige Räume, das Bad war auf dem Hof und die Küche so schmal wie unsere Leben. In der Küche knetete meine Mutter den Brotteig, kochte sie den Tee und die Harira-Suppe, die jeden Tag bei uns auf den Tisch kam – mit einer Regelmäßigkeit, die nur ab und zu von einer Handvoll Sardinen oder ein paar Hühnchen unterbrochen wurde, die Mutter dann stolz und gerecht unter den Kindern aufteilte. Den besten Happen hob sie stets für meinen Vater auf.
Dagegen stellten wir uns Hamids Wohnung so schön wie einen Palast vor. Er teilte sie sich mit wohlhabenden Studienkollegen. Jeder hatte sein eigenes Zimmer und konnte tun und lassen, was er wollte, Frauen gingen ständig ein und aus, es fehlte nie an Getränken oder Essen, man unterhielt sich über die Zukunft und den Beruf. Für mich, dessen einzige Beschäftigung darin bestand, ab und zu einen Kellner im Café Paris zu vertreten oder zur Verstärkung am Wochenende einzuspringen, war Hamids Leben ein Traum – und so wenig greifbar wie die Sandkörner, die der Levante in der Bucht umhertrieb.
Als wir das Manila an diesem Tag verließen, gingen wir wie immer den Boulevard zum Place de Faro hinunter. Hier proklamiert eine Inschrift die Städtepartnerschaft zwischen Tanger und der portugiesischen Stadt Faro. Nicht vorhandene, unfühlbare Bruderschaft – vielleicht nur erfunden, um die Träume derer zu nähren, die auf dem Geländer um diesen Platz herum sitzen und die Lichter betrachten, welche die Häuser von Tarifa, gegenüber an der spanischen Küste, an klaren Tagen provokant zur Schau stellen – Träume, die das Raunen des Meeres hin und her wiegt, das zwischen beiden Ufern einen unüberwindlichen Abgrund schafft.
Abends lud Hamid mich und meinen Cousin zu Fleischspießen und Kefta ins Dorado ein. Wir tranken Bier und gingen dann in seine Wohnung, wo eine Flasche Whisky das Feuer unserer Sehnsüchte entfachte. Die ganze Nacht lang schmiedeten wir Zukunftspläne und verstauten sie am nächsten Tag sämtlich wieder in der Schublade der ewigen Unmöglichkeiten, die jeder einzelne von uns in einem verlorenen Winkel seiner selbst aufbewahrte.
Hamid und ich, wir mochten uns von Anfang an. Hinter meiner Apathie vermutete er einen Träumer im Ruhezustand, und er war überzeugt, dass eines Tages in mir die Erkenntnis aufwachen würde, dass wir uns den Weg zum Glück im Leben nur selber bahnen können, wie der Entdecker, der sich mit der Machete durch den tropischen Urwald kämpft. Dann, meinte er, könne mich nichts mehr daran hindern, dorthin zu gelangen, wo auch immer ich hin wollte.
Seit dieser Nacht trafen wir uns häufiger. Hamids Leben und seine Persönlichkeit zogen uns magisch an. Schon seit unserer Kindheit hatten mein Cousin und ich ein sehr enges Verhältnis. Wir waren gleich alt, und unsere Mütter waren die beiden Schwestern, die sich in unserer großen Familie am engsten verbunden fühlten. Wir wohnten im selben Viertel; die Straßen der Medina waren unser Gebiet, das wir wie unsere Westentasche kannten. Zusammen erschlossen wir uns die Welt der Bordelle, des Haschischrauchens und des Alkohols. Die Freundschaft mit Hamid, den mein Cousin schon länger kannte, knüpfte ein neues Band zwischen uns.
3
Der Sommer ging zu Ende, und Hamid kehrte nach Granada zurück, wo er das zweite Studienjahr beginnen sollte. Ab und zu kam ein Brief von ihm, stets begleitet von einer Ansichtskarte, so als sollten wir uns damit das Paradies, das er uns beschrieb, in noch schöneren Farben ausmalen. Wenn ein Brief kam, gingen mein Cousin und ich zum Place de Faro und lasen dort die Zeilen, die Hamid uns schickte, immer und immer wieder. Wir blickten aufs Meer und warteten darauf, dass die Lichter von Tarifa angingen. Dabei stellten wir uns vor, dass es unser Freund sei, der in einem dieser Häuser nur für uns den Schalter betätigte ...
Derweil verlief unser Leben weiter von zu Hause zur Arbeit und von der Arbeit ins Manila. Der Herbst hatte Tangers Straßen von den Emigranten befreit, die ihre belgischen, französischen und holländischen Autokennzeichen in der ganzen Stadt zur Schau stellten. Ende November verstarb der älteste Kellner des Café Paris. Er hatte berühmte Künstler bedient: Leute, deren Porträts in den Schaufenstern der Buchläden, auf Kinoplakaten und in Zeitschriften aller Couleur zu sehen waren. Doch er hatte sich nie vom äußeren Schein blenden lassen. Angesichts unserer Sehnsucht für ein Tanger, das es nicht mehr gab, sagte er immer: ›Eine Stadt lebt durch ihre Bewohner; sie ist das, was die Menschen aus ihr machen, egal in welchem Moment. Die Ausländer hätten die Stadt zwar berühmt gemacht, aber sie waren doch nicht ihre einzigen Bewohner – sie allein hätten ja nicht einmal ein kleines Dorf zusammenbekommen. Sie waren lediglich der Schmuck einer Epoche. Doch die Straßen von Tanger, die belebten Cafés und Geschäfte, die gastfreundlichen Menschen bleiben immer dieselben. Vielleicht ist Tanger seine Geschichte damals über den Kopf gewachsen, das ja, aber es waren zweifellos auch schöne Jahre. Letztendlich hängt Tangers Wohl und Wehe nicht von den Ausländern ab. Wer seine Stadt wirklich liebt, darf sich nicht von ihr lossagen, nur weil sie aus der Mythologie der Europäer verschwunden ist.‹ Der wahre Tangerino, egal ob Moslem, Jude oder Christ, wird immer tief bewegt sein, wenn er mit dem Schiff aus Algeciras kommt und die Bucht sieht, die ihn zum Willkommensgruß in ihre Arme schließt, so wie die Silhouette der Stadt, die sich unveränderlich hinter dem Strand vom Hafen bis nach Malabata erstreckt.
Der Besitzer des Cafés bot mir die Stelle des alten Kellners an. Ich überlegte nicht lange und akzeptierte. Wie einer, der in seinem Leben einen Weg vorgezeichnet findet, zu dem er nichts zu sagen hat, einen Weg, der nicht der seine ist und der ihm nur eine Wahl lässt: ihm zu folgen.
Ich kam jeden Morgen um sieben zur Arbeit. Der Arbeitstag war lang und hart, ich war nie vor sechs Uhr fertig, aber der Umstand, mein eigenes Geld zu verdienen und zum Unterhalt der Familie beizutragen, gab mir mein Selbstvertrauen zurück und stimmte mich optimistischer. Sicher, Gehalt und Trinkgeld reichten gerade mal dazu, um mir meine Kleidung selbst zu kaufen, ab und zu ein Mädchen aus dem Viertel einzuladen und weiterhin mit meinem Cousin und den Freunden auszugehen. Ich schrieb mich für einen Spanisch-Kurs im Instituto Cervantes ein, um meine Kenntnisse in einer Sprache zu verbessern, die ich schon relativ fließend sprach. Ich gewöhnte mir an, regelmäßig Bücher aus der Institutsbibliothek auszuleihen, und entdeckte darüber die Freude am Lesen.
Angespornt durch die neue Situation – mein Cousin arbeitete schon seit einem Jahr als Portier in einem Hotel an der Avenue d‘Espagne – drangen wir in andere Stadtteile vor. Das war unsere einzige Möglichkeit, neue Welten zu entdecken. Wir liefen durch unbekannte Straßen und lernten in einer verspäteten, aber fruchtbaren Initiations-Reise die Bars und Bordelle der Stadt kennen. Die Nacht enthüllte uns ihre Geheimnisse, sie zeigte uns Elend und Vergnügen. Vor meinen siebenundzwanzig Jahren zogen zerlumpte Kinder vorbei, die in Mülltonnen wühlten, Bettler, die sich mit Kartons zudeckten, Prostituierte, die in schmuddelige Löcher verbannt waren; Polizisten, abgefüllt mit spendiertem Bier, Verrückte, die sich an ihren Tetra-Packs festhielten, um nicht aus der Welt zu fallen, arbeitslose Erleuchtete, die Verse gegen Wein eintauschten, Islamisten auf der Jagd nach fremder Verzweiflung. Wenn der Ruf der Muezzins durch die Nacht hallte, befreiten sich die Straßen vom Heer der Enterbten, der Entseelten, der Verzweifelten – die Menge verschwand, als hätte die Kanalisation sie aufgesaugt. Nun wurde die Stadt von den Gläubigen eingenommen, die zur Moschee gingen. Die ersten Bauern – alte Männer auf dem Weg zum Markt und zu den Straßenständen – zogen ihre Gemüsekarren die sieben Hügel hinauf und hinab, so als zögen sie ihr eigenes Leben.
Die Bücher und die Straße weckten eine neue Rastlosigkeit in mir, und bald wurde mir die eben erst eroberte Stadt zu klein. Die Parabolantennen, die innerhalb von ein paar Jahren sämtliche Dächer besetzt hatten, lieferten uns die dauernden und unumstößlichen Beweise einer besseren Welt, in der zu leben uns nicht vergönnt war. Arbeit im Überfluss, Geld für viel mehr als ein Paar billige Jeans und ein paar Liter Bier, im Neonlicht gleißende Nächte, liebeswillige Frauen, Autos für alle und amerikanische Hamburger, gigantische Einkaufszentren drangen in unsere Häuser ein, beschmutzten unser Elend, bezwangen unseren Widerstand.
In meiner Familie fingen sie an, vom Heiraten zu reden. Ich war der Älteste, war männlichen Geschlechts und hatte Arbeit. Jedes Mal, wenn meine Mutter sich mit ihren Freundinnen traf, hatten sie einen neuen Vorschlag: Nach einigen Monaten gab es keine Cousine, Nachbarin oder Bekannte mehr, die noch nicht auf der Liste der Kandidatinnen erschienen war. Jedes Nein deuteten sie als Affront, als Akt des Hochmuts, als Beweis meiner Launenhaftigkeit. ›Jasmina hat ihm den Kopf verdreht‹, sagten sie, oder ›Die Bücher machen ihn verrückt‹. Meine Mutter ließ Wehklagen auf Bittgebete folgen, und ich fühlte, dass ich mich dem eisernen Willen meiner Umgebung nicht mehr lange würde entziehen können; dass dieser Buße, die den Armen meines Volkes auferlegt war, nur diejenigen entkamen, die entweder ausreisen konnten oder die den Mut hatten, nach ihrer eigenen Fasson zu leben – aber mit der Verachtung derer, die sie für Verräter hielten, wie auch derjenigen, die nicht fähig waren, es ihnen gleichzutun.
Auf so unsicherem Terrain reifte in mir fast unmerklich die Idee heran, mich aus dieser Welt, die mir die Luft zum Atmen nahm, zu befreien. Meine Augen ruhten immer länger auf den Lichtern von Tarifa. Das Lesen füllte jetzt den größten Teil meiner freien Zeit aus und ersetzte allmählich auch die nächtlichen Streifzüge. Und trotzdem blieb das alles für mich so unerreichbar wie die goldenen Strände in den Reisekatalogen für einen Bettler aus der Medina.
Hamids Briefe wurden immer seltener. Als der Sommer kam, hatten wir schon monatelang nichts mehr von ihm gehört. Jeden Tag erwarteten wir seine Rückkehr, doch weder die Hitze noch der Levante brachten uns Nachricht. Mein Cousin fragte bei seiner Familie nach, doch auch die hatte seit dem Winter nichts von ihm gehört, zuletzt ein knappes ›Es geht mir gut. Ich habe viel Arbeit und muss diesen Sommer in Granada bleiben‹ an seine Mutter. Damit war unsere Verbindung zur Außenwelt abgerissen, die einzige Verbindung aus Fleisch und Blut zur Welt des Überflusses, der glücklichen Menschen, zu den Privilegierten dieser Erde.
Die Stadt füllte sich nach und nach wieder mit Menschen: Arbeiter, die mit vollbeladenen Autos aus Europa zurückkehrten, Sommerfrischler, die aus allen Teilen des Landes ans Mittelmeer strömten, geführte Touristengruppen und der eine oder andere Versprengte, der einem Mythos nachjagte, den er niemals finden würde. Das Café Paris war Tag und Nacht voll besetzt, die Arbeit war sehr anstrengend. Abends raffte ich mich gerade noch zu meinem Spanisch-Kurs auf, saß noch ein Weilchen im Manila und ging dann nach Hause, um zu schlafen und am nächsten Tag wieder Tee und Limonaden zu servieren.
Der Ramadan fiel dieses Jahr auf den Monat Juli. Die Gemüter waren erhitzt, und erst die Sirene, die die Erlaubnis zum Essen erteilte, gab der Stadt die Gelassenheit zurück, die sie seit Tagesanbruch vermissen ließ. Dann leerten sich die Straßen wie von Geisterhand, verspätete Autobusse rasten in höllischer Geschwindigkeit vorbei, deren Fahrer nur einen Gedanken hatten: sie möglichst bald an der Endstation loszuwerden. Während der Fastenzeit wurde ich für die Nachtschicht eingeteilt. Tagsüber blieb nur der älteste Kellner für den Fall, dass es einem Touristen einfiele, etwas zu verzehren, und um das Café für die Muslime offen zu halten, die den lieben langen Tag an einem leeren Tisch verbrachten – ohne zu trinken, zu essen oder zu rauchen. Sie lasen Zeitung, unterhielten sich und spielten Parchís. Wir löffelten unsere Harira in der Küche, und kaum dass wir fertig waren, füllten sich die Tische mit Männern, die – das Fasten aufgehoben – sich anschickten, hier bis zur letzten Mahlzeit am frühen Morgen auszuharren.
Der Ramadan machte einer bleiernen Augustsonne Platz. Bis zum Morgengrauen zogen jeden Tag lange Autoschlangen durch die Stadt, die mit lautem Hupen eine neue Hochzeit verkündeten: Die Emigranten nutzten ihren Sommeraufenthalt, um pflichtgetreu eine Ehe zu schließen. Dann rüsteten sie sich zur Rückkehr nach Europa mit dem guten Gefühl, unserer Tradition Genüge getan zu haben. Jeder neue Zug rief mir mein Dilemma ins Bewusstsein, entweder weiterhin von einer anderen Welt zu träumen oder dem Wunsch meiner Mutter nachzugeben, die mit jedem Mal eindringlicher wurde.
An einem Spätsommernachmittag – ich servierte gerade einen Tee auf der Terrasse, die nach dem Place de France hinaus liegt –, sagte ein Kollege, an einem der hinteren Tische habe jemand nach mir gefragt. Ich dachte, es wäre mein Cousin, der um diese Zeit schon Feierabend hatte. Im dunklen Halbschatten erkannte ich den Gast erst, als ich vor ihm stand. Doch je mehr ich mich ihm näherte, desto klarer nahm die Silhouette seine unverwechselbare Gestalt an: Hamid.
4
Ich schließe die Augen. Die Stimme von Um Kalsum hallt zeitlos durch das Manila. Ich lasse mich von ihr einhüllen wie einer, der sich an der Hand einer Frau zum Himmel führen lässt. Ich sehne mich nach dieser Stimme wie nach einem verlorenen Paradies, genauso wie nach dem Lärm im Café an den Fußballtagen oder nach dem Anblick von Said Auita, wie er bei der Ehrenrunde durch das Olympiastadion die Nationalflagge schwingt. Und nach dem Duft frischer Minze auf dem Markt, nach der Haschischpfeife am Aussichtspunkt, nach dem zu Bergen aufgetürmten Chebakia an den Straßenständen, nach der stehengebliebenen Zeit in dem kleinen Café von Hafa.
Jasmina war meine erste Liebe. Wir wohnten in derselben Straße und spielten schon als Kinder zusammen auf der Dachterrasse, während unsere Mütter zerpflückten, was sich in der vergangenen Woche im Viertel ereignet hatte: Der Jüngste der Bucharas hatte ein Visum bekommen, um zu seinem Bruder nach Lüttich zu reisen. Die Aicha von den Zohras hatte einen Bewerber, aber ihr Vater wollte sie nicht in die Hände eines einfachen Ladenbesitzers geben. Es ging das Gerücht, Fatma hätte einen Liebhaber, einen gutaussehenden jungen Mann, der ihr die Lebensfreude zurückgebracht und der sie vor der Verbitterung im Leben mit einem achtzigjährigen Ehemann bewahrt hätte.
Jasmina und ich, wir hatten eine glückliche Jugend. Ihre Brüste waren die ersten, die ich je berührte. Sie selbst nahm meine Hände und legte sie auf die gerade erst entfalteten Blüten ihres Körpers. Mein Herz galoppierte in meinem noch kindlichen Körper; das Blut in meinen Venen verwandelte sich in einen reißenden Strom, der jeden Moment über die Ufer zu treten drohte. Mit zitternden Fingern berührte ich ihre aufgerichteten Brustwarzen, doch ihre Gelassenheit, ihre geschlossenen Augen beruhigten mich wieder. Ich schloss die Augen auch, und die Welt um mich herum verschwand. Es gab nur noch sie und mich ... Nie wieder im Leben hat mich etwas so erschüttert. Jasmina war meine erste, vielleicht meine einzige Liebe.
In ihren vierzehn Jahren fand ein ganzes Universum Platz; ihr Weg in die Zukunft war klar vorgezeichnet. Ihr blondes Haar und die hellen Augen verrieten ihre berberische Herkunft, auf die sie wie alle in ihrer Familie sehr stolz war. Aus ihrem Mund hörte ich die ersten Worte in Tarifit, ihrer Muttersprache, die bei ihr daheim gesprochen wurde. Wenn wir zusammen auf dem Dach waren, erzählte sie mir Geschichten aus dem Rif-Gebirge, wo sie geboren war und wo sie gelebt hatte, bis ihre Familie vor vier Jahren nach Tanger kam. Ihr Großvater war Soldat unter Franco gewesen; nach dem Krieg wurde er nach Agüimes versetzt – ein kleines Städtchen auf den Kanarischen Inseln, in dem die Spanier eine Einheit Regulares stationiert hatten. Als die Kompanie die Inseln in den vierziger Jahren verließ, kehrte er zu seinem Kabylenstamm zurück, heiratete und hatte mehrere Kinder, darunter Jasminas Mutter. In ihren Träumen ging Jasmina durch die Straßen von Agüimes, so als würde sie diese Plätze kennen, die der Großvater ihr mit in der Ferne verlorenem Blick beschrieben hatte, wenn er sie im Arm hielt.
Sie wusste, dass sie die Beste sein musste, wenn sie weiter zur Schule gehen wollte, und dank ihrer Intelligenz schaffte sie das auch. Jasmina wollte unabhängig sein: keine leichte Aufgabe für eine mittellose Frau in meinem Land. Ihre exzellenten Noten und das Drängen der Lehrer bewogen die Eltern dazu, sie in der Schule zu halten, als andere Mädchen ihres Alters längst im Haushalt helfen mussten und sich auf die Ehe vorbereiteten. Heute glaube ich, dass auch ich in gewisser Weise ein Teil dieser Schule war, die das Leben in diesen Jahren für sie bildete. Alles, was sie tat, richtete sie auf ein Ziel aus: eines Tages wegzufliegen. Denn dann, sagte sie oft zu mir, begänne ihr wahres Leben, das ihr – und nur ihr allein gehöre.
Jasmina träumte von weiten Reisen, neuen Horizonten und schönen Männern, die ihr zu Füßen lagen. Ihr Großvater hatte die schlimmsten Erinnerungen an seinen Aufenthalt in Spanien während des langen Bürgerkrieges übergangen. Sie war seine Lieblingsenkelin, und jeden Tag verbrachten sie viele Stunden miteinander – lange Stunden in einem Spiel von Fragen und Antworten. Als er starb, schloss sich für Jasmina das Buch, mit dem sie jeden Tag aufs Neue ihre Illusionen und ihre Pläne für die Zukunft nährte, der sie jede Nacht, wenn die anderen schliefen, einen Schritt näher kam.
Jasminas Gesicht war der Mittelpunkt meiner Nächte, die Laken waren ihre Haut und das Kissen ihr Körper, den meine Hände streichelten, bis ich endlich einschlief. Irgendwie konnten wir es einrichten, jeden Tag für ein paar Minuten zusammen zu sein, und die Tage, an denen ihre Mutter zu uns zu Besuch kam, waren wie Festtage, die wir ungeduldig erwarteten. Allerdings waren es jetzt nicht mehr die Kinderspiele auf dem Flachdach, die uns interessierten. Wir zogen uns in eine kleine Kammer zurück, die es dort gab, küssten und streichelten uns, tauschten zärtliche Worte und unerfüllbare Versprechen aus.
Eines Nachmittags hörten wir nicht die Schritte von Jasminas Mutter, die kam, um sie zu holen und nach Hause zu gehen. In der Welt, in der wir in diesen Augenblicken des Glücks lebten, nahmen wir nichts anderes wahr als unseren Atem und unser Flüstern. Als ihre Mutter die Tür öffnete, fand sie einen einzigen verschlungenen Körper, über den die ganze Welt zusammenbrach. Noch heute blenden mich Tränen ohnmächtiger Wut und Trauer, wenn ich an den Schrei denke, der wie ein scharfes Messer zwischen uns fuhr, und an die Hand, die Jasmina aus meinen Armen riss. Ich habe sie nie wiedergesehen. Sie sperrten sie in ihr Zimmer ein, das sie erst verlassen durfte, als sie mit einem Cousin ihres Vaters verheiratet wurde, der sie schon als kleines Mädchen auf seinen Knien geschaukelt hatte und der ein fahrender Händler im Rif-Gebirge war. Meine Jasmina, meine süße, strahlende Jasmina! Sie haben die Quelle, in der wir jeden Tag badeten, für immer ausgetrocknet und sie unter den vier Wänden einer Zelle in Al Hoceima begraben.
5
Ich war unsagbar erleichtert, als Hamids Auto die letzten Häuser von Algeciras hinter sich ließ. Es war meine erste Reise nach Spanien, und obwohl alles in bester Ordnung war, fürchtete ich noch immer, mein Traum könnte im letzten Moment zerplatzen. Hamid schlug mir aufmunternd aufs Knie:
»Komm schon, Khalid, wir haben‘s geschafft! Schluss mit Harira und Tee! Du bist in der Welt des Überflusses angekommen, in der Freiheit, im wirklichen Leben! Schau dich um: Diese leuchtende Straße ohne ein Schlagloch führt dich direkt ins Glück. Wenn du Geld in der Tasche hast, dann hast du hier einfach alles. Und ich versichere dir: Du wirst so viel Geld haben, um dir jeden Wunsch erfüllen zu können. Schluss mit den Schichten von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, in denen du Müßiggänger bedienen musst, deren Horizont nicht über den Kaffeehaustisch hinausreicht, an dem sie ihr halbes Leben verbringen. Das Glück ist nicht mit den Mittelmäßigen. Schau dir nur deine eigene Familie an: Was für ein Leben führen deine Eltern? Was für ein Leben erwartet deine Geschwister?«
Seine Argumente beruhigten mich. Es waren dieselben, die er mir an jenem Abend vorgetragen hatte, als er überraschend im Café Paris aufkreuzte. Damals, als ich mich ihm näherte und er mir durch Handzeichen zu verstehen gab, ich solle meine Überraschung verbergen. Er bestellte einen Minztee, und wir verabredeten uns für zehn Uhr im Dorado. Die Wiedersehensfreude und sein geheimnisvolles Benehmen stürzten mich in eine ungewohnte Aufregung. Ich ahnte, dass etwas Bedeutsames geschehen würde. Ich ging nach Hause, duschte, zog frische Sachen an und überraschte meine Geschwister und meine Mutter mit einer ausnehmend guten Laune, die sie von mir nicht kannten. Um viertel vor zehn wartete ich schon auf der Terrasse des Dorado. Der Levante, der die Stadt schon seit Tagen verrückt machte, war einer Meeresbrise gewichen, die die Nacht mit mediterraner Luft erfüllte. Als Hamid mir die Hand entgegenstreckte, wusste ich durch seine bedeutungsvolle Geste, dass er mir Wichtiges zu sagen hatte.
Die Geschichte mit dem Studium in Granada stimmte gar nicht. Es gab wohl ein Stipendium und ein erstes Trimester an der medizinischen Fakultät mit unregelmäßigem Besuch der Vorlesungen und wenig Lust, dafür zu lernen. Hamid teilte sich eine kleine Wohnung mit anderen marokkanischen Stipendiaten und zwei Jurastudenten aus Äquatorialguinea. Kaum dass sie aus der Uni kamen, rauchten sie ritualartig Joints bis in die Nacht. Ihre tägliche Diät bestand aus Nudeln oder Reis mit Tomatensoße, mal mit Spiegelei, mal mit einer Dose Thunfisch als einziger Beilage. Nur an den Tagen, an denen Hamid sein Stipendium kassierte, das ihm wie Sand durch die Finger rann, gab es Brötchen und Bier in irgendeiner Bar.
»Das mit dem luxuriösen Zimmer und den Mädchen habe ich nicht nur erfunden, um meine Familie und meine Freunde zu täuschen, sondern auch mich selbst. Ich habe es bis nach Europa geschafft; ich habe in null Komma nichts das erreicht, wovon Millionen Menschen unseres Kontinents ein Leben lang träumen. Wir sind in Afrika geboren, Khalid, das ist unser Drama. Hier leben wir, um zu überleben; wir kämpfen, um nicht zu verhungern; wir träumen, um nicht vor Verzweiflung zu sterben. Wir sind nichts wert, nicht einmal denen, die uns regieren. Hier, in diesen Ländern, sind wir unserem Schicksal überlassen, verloren im Elend, nackt der Ungerechtigkeit und der Laune jedes Idioten ausgeliefert, den seine Uniform zu einem kleinen König macht: ob Polizist, Pförtner im Rathaus, Zöllner oder Regierungsbeamter. Im Ausland sind wir bestenfalls billige Arbeitskräfte, ein notwendiges Übel, das die Arbeit erledigt, die die Europäer nicht machen wollen, ein Heer von Unerwünschten, das ihnen den Boden putzt, den Müll abholt, die Kloaken desinfiziert, die Schuhe putzt, die Felder bestellt. Auf der Straße beäugen sie uns misstrauisch: Wir sind verdächtig und gefürchtet – wir, die wir eingeschüchtert und verängstigt unter ihnen leben, weil dauernd eine Anschuldigung über uns schwebt, weil es immer einen Finger gibt, der bereit ist, uns zu beschuldigen, weil uns immer ein Strick um den Hals liegt.«
Wir hatten unsere erste Flasche Gris de Boulaouane geleert. Zur zweiten bestellten wir noch einmal Kefta mit scharfen Oliven dazu. Der Wein begann zu wirken und stimmte mich positiv auf das Gespräch ein. So hatte Hamid noch nie mit mir gesprochen. Unsere Plaudereien waren bisher nie übers Fantasieren hinausgekommen; das hier war etwas ganz anderes. Hamid hatte sich verändert, und er hatte mich für sein Geständnis ausgewählt. Ich war stolz, dankbar und äußerst interessiert.
»Ohne Frage, ich hatte meine Chance, aber die Sache ist: Ich will überhaupt kein Arzt werden. Wahrscheinlich habe ich das ausgesucht, weil Arzt sein heißt – wo auch immer, und hier noch viel mehr –, dass man den Sprung vom Nichts zum Alles schafft. Bei uns gibt es keinen Mittelweg: Entweder du bist einer der Glücklosen und verbringst dein Leben zwischen Tee und Haschischpfeife, oder du gehörst zu denen, die sich alles erlauben können und die sich auf unserem Elend betten. Außerdem, es gab dort keinen, der richtig studierte. Ich habe doch selbst den ganzen Tag am Joint geklebt, umgeben von den anderen, die ebenso dazu verurteilt waren, ihr Stipendium zu verplempern, um nach ein paar Jahren – wahrscheinlich den besten ihres Lebens – zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Meine Familie glaubt immer noch, ich sei der fleißige Student, der sie aus dem Elend herausziehen wird. Sie bewundern mich, sie vergöttern mich, sie setzen alle ihre Hoffnungen in mich. Ich habe nur zwei Prüfungen abgelegt: eine Katastrophe! Die Stimmung in der Wohnung wurde mir unerträglich, die Mitbewohner führten mir jeden Tag aufs Neue vor, wie ich nicht leben wollte. Das waren zerstörte Kreaturen, die sich an eine Planke klammerten, die sie niemals vor dem Ertrinken retten würde. So wie sie wollte ich nicht enden und die Chance verpassen, die die Vorsehung mir geschenkt hatte. In dem Sommer, als wir uns im Manila kennenlernten, hatte ich das Medizinstudium längst aufgegeben, mein Stipendium war dabei, sich in Luft aufzulösen, die Kohle wurde knapp und damit das einzige Mittel, das ich hatte, um in Spanien zu leben. Eins war klar: ich musste mich wieder an der Uni einschreiben, um meine Aufenthaltserlaubnis nicht zu verlieren; ich musste irgendwie zu Geld kommen.«
Hamid leerte sein Weinglas in einem langen Zug. Für einige Augenblicke verlor sich sein Blick durch das Glas, an dem die letzten Tropfen herunterliefen. Er meinte immer, dass auch im irdischen Leben nur wenige es schaffen könnten und dass er auf jeden Fall einer dieser Wenigen sein wollte. Er hatte viel darüber nachgedacht: In diesem Dschungel war kein Platz für Skrupel. Es hatte eine Zeit gegeben, in der er zu den Guten gehören wollte, bis er erkannt habe, dass die Welt derer, die sich lediglich mit ihrem Elend abfanden, voll von guten Menschen war; dass die Gesetze gemacht waren, damit die Armen arm blieben und die Reichen sich darüber hinwegsetzen konnten; dass die Religion die Zuflucht der Glücklosen und die Normen das Gefängnis der Ehrbaren waren; dass Gott seine guten Absichten aufgegeben und entschieden hatte, dass jeder selbst zusehen müsse, wie er zurechtkam.
»Ich kannte die Drogenszene zu gut, um keinen Profit daraus zu schlagen. Das ganze Haschisch, das ich in Granada rauchte, musste ich ja irgendwo kaufen. Ich wusste immer wo, und Käufer gab es mehr als genug auf meiner Liste, die ich nach und nach anlegte. In Tanger genauso: wir hatten genügend Kleindealer im Freundeskreis, und ich konnte alles, was ich wollte, zu guten Preisen besorgen. Da war zwar das Risiko beim Zoll, aber das Elend schreckte mich hundertmal mehr. Mir war klar, dass ich gar kein Studium zu Ende bringen würde und dass mein Leben wieder im Nichts versinken würde, wenn ich mir keinen Weg suchte, der zu mir passte. Nach dem zweiten Trimester kehrte ich heimlich nach Tanger zurück. Ich beschloss, es mit Haschisch-Öl zu versuchen, das heißt: weniger Volumen und mehr Geld. Ich füllte zwei Kondome, die sich so weit dehnten, bis jedes das Stipendium eines ganzen Jahres enthielt. Ich versiegelte sie mit Silikon und klebte mir je eins mit Leukoplast an die Oberschenkel. Du hättest sie sehen sollen: Sie sahen aus wie zwei riesige Negerschwänze. Auf dem Schiff blieb ich die ganze Zeit sitzen, weil ich Schiss hatte, dass sie platzen könnten und das Zeug mir zwischen den Beinen zerrinnen würde. Als wir im Hafen anlegten, stieg ich so breitbeinig die Treppe hinunter, als hätten sie mich gerade in den Arsch gefickt. Frag mich nicht, wie ich durch den Zoll gekommen bin. Ich weiß nur noch, dass ich in eine Hafenkneipe ging, auf dem Klo die Kondome abnahm und sie in der Hand hielt, während ich mir fast die Gedärme rausschiss.«
An diesem Punkt der Unterhaltung löste sich der tiefe Eindruck, den Hamids Erzählung auf mich gemacht hatte, und die Spannung, die mich ergriffen hatte, entlud sich in lautem Lachen, das uns bei der Vorstellung von Hamids jämmerlicher Erscheinung auf dem Klo überfiel – dasselbe Lachen, das er damals auf seiner Busreise von Algeciras nach Granada hatte unterdrücken müssen. Wir bestellten die dritte Flasche Gris