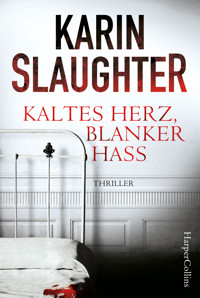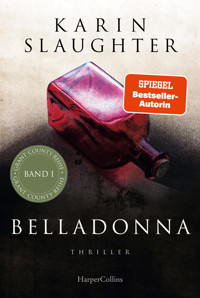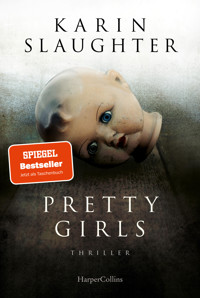12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georgia-Serie
- Sprache: Deutsch
„Du weißt, warum wir hier sind. Gib es uns, und wir lassen sie gehen.“
Kein Polizeitraining ist effektiver als purer Instinkt – als Faith Mitchell, Agentin beim Georgia Bureau of Investigation, eines Tages ihre Mutter nicht mehr erreichen kann, fährt sie sofort nach Hause. Dort findet sie eine weit offene Haustür, einen Blutfleck über der Klinke, eine Leiche im Wäscheraum und ihre kleine Tochter in den Schuppen gesperrt vor – und zwei bewaffnete Männer im Schlafzimmer. Um ihre Mutter wiederzufinden, braucht sie Will Trents und Sara Lintons Hilfe, doch die Ereignisse überschlagen sich …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
Vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter ist Faith Mitchell wieder zurück bei der Arbeit, denn glücklicherweise kümmert sich ihre Mutter Evelyn um die kleine Emma. Doch eines Morgens hört Faith nichts von den beiden, und zu Hause erwartet sie ein Albtraum: Bewaffnete Männer sind in ihr Haus eingebrochen. Faith gelingt es zwar knapp, die Eindringlinge auszuschalten – von ihrer Mutter jedoch fehlt jede Spur. Da sie gleichzeitig Tochter der Vermissten, Zeugin und potenzielle Täterin ist, darf Faith in dem Fall nicht selbst ermitteln, und so bittet sie verzweifelt Will Trent um Hilfe. Wonach haben die Mörder gesucht? Und wo ist ihre Mutter?
Zur Autorin:
Karin Slaughter ist eine der weltweit berühmtesten Autorinnen und Schöpferin von über 20 New York Times-Bestseller-Romanen. Dazu zählen »Cop Town«, der für den Edgar Allan Poe Award nominiert war, sowie die Thriller »Die gute Tochter« und »Pretty Girls«. Ihre Bücher erscheinen in 120 Ländern und haben sich über 40 Millionen Mal verkauft. Ihr internationaler Bestseller »Ein Teil von ihr« ist 2022 als Serie mit Toni Collette auf Platz 1 bei Netflix eingestiegen. Eine Adaption ihrer Bestseller-Serie um den Ermittler Will Trent läuft derzeit erfolgreich auf Disney+, weitere filmische Projekte werden entwickelt. Slaughter setzt sich als Gründerin der Non-Profit-Organisation »Save the Libraries« für den Erhalt und die Förderung von Bibliotheken ein. Die Autorin stammt aus Georgia und lebt in Atlanta. Mehr Informationen zur Autorin gibt es unter www.karinslaughter.com
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Fallen bei Delacorte Press, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.
© 2011 by Karin Slaughter
Ungekürzte Ausgabe im HarperCollins Taschenbuch
by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2013 für die deutschsprachige Ausgabe by Blanvalet Verlag München, in der Verlagsgruppe Randomhouse GmbH
Die Rechte an der Nutzung der deutschen Übersetzung von Klaus Berr liegen beim Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Covergestaltung von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung unter Verwendung von Midjourney
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749907908
www.harpercollins.de
Widmung
Für alle Bibliothekare und Bibliothekarinnen dieser Welt im Namen all der Kinder, denen sie geholfen haben, Schriftsteller zu werden.
SAMSTAG
1. KAPITEL
Faith Mitchell kippte den Inhalt ihrer Handtasche auf den Beifahrersitz ihres Mini und suchte in dem Durcheinander nach etwas Essbarem. Bis auf einen pelzigen Streifen Kaugummi und eine Erdnuss zweifelhafter Herkunft gab es nichts auch nur entfernt Genießbares. Sie dachte an die Schachtel mit Energieriegeln in ihrem Küchenschrank, und ihr Magen machte ein Geräusch wie eine verrostete Türangel.
Das Computerseminar, das sie an diesem Vormittag besucht hatte, hätte eigentlich nur drei Stunden dauern sollen, aber daraus waren wegen des Idioten in der ersten Reihe, der andauernd sinnlose Fragen stellte, viereinhalb geworden. Das Georgia Bureau of Investigation, GBI, trainierte seine Agenten häufiger als jede andere Strafverfolgungsbehörde in der Region. In regelmäßigen Abständen wurden ihnen Statistiken und Daten über kriminelle Aktivitäten in die Köpfe gehämmert. Sie mussten sich auskennen mit neuester Technologie; zweimal im Jahr mussten sie eine Schießprüfung ablegen; sie führten gestellte Razzien und Schusswechsel-Simulationen durch, die so intensiv waren, dass Faith auch Wochen danach noch nicht mitten in der Nacht auf die Toilette gehen konnte, ohne in den Türöffnungen nach Schatten zu suchen. Normalerweise wusste sie die Gründlichkeit der Agency durchaus zu schätzen. Heute aber konnte sie an nichts anderes denken als an ihr vier Monate altes Baby und an das Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hatte, spätestens mittags zurück zu sein.
Die Uhr am Armaturenbrett zeigte zehn nach eins, als sie den Motor anließ. Leise fluchend fuhr sie vom Parkplatz vor der Zentrale an der Panthersville Road. Sie benutzte Bluetooth, um die Nummer ihrer Mutter zu wählen. Aus den Autolautsprechern drang nur statisches Rauschen. Faith legte auf und wählte noch einmal. Diesmal bekam sie ein Besetztzeichen.
Faith trommelte mit den Fingern aufs Lenkrad und lauschte dem Blöken. Die Voicemail ihrer Mutter. Jeder hatte Voicemail. Faith konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal ein Besetztzeichen gehört hatte. Sie hatte das Geräusch schon fast vergessen. Wahrscheinlich gab es bei der Telefongesellschaft irgendeinen Kabelsalat. Sie legte auf und versuchte es noch ein drittes Mal.
Immer noch besetzt.
Faith lenkte einhändig und kontrollierte auf ihrem BlackBerry, ob ihre Mutter ihr eine E-Mail geschickt hatte. Bis zu ihrer Pensionierung war Evelyn Mitchell knapp vier Jahrzehnte lang Polizistin gewesen. Über die Polizeieinheiten Atlantas konnte man viel sagen, aber man konnte nicht behaupten, dass sie nicht auf der Höhe der Zeit wären. Evelyn hatte schon ein Handy gehabt, als sie noch eher aussahen wie Handtaschen, die man sich über die Schulter hängte. Sie konnte noch vor ihrer Tochter Mails schreiben. Und seit fast zwölf Jahren hatte sie ein BlackBerry.
Aber heute hatte sie ihr keine Nachricht geschickt.
Faith kontrollierte die Voicemail ihres normalen Handys. Sie hatte eine Nachricht ihres Zahnarztes abgespeichert, der sie daran erinnerte, einen Termin für eine Zahnreinigung zu vereinbaren, aber neue Mails gab es keine. Sie wählte die Nummer des Festnetzanschlusses bei sich zu Hause, weil sie dachte, dass ihre Mutter vielleicht zu ihr gegangen war, um etwas für das Baby zu holen. Faith wohnte nur ein paar Häuser von Evelyn entfernt. Vielleicht hatte sie keine Windeln für Emma mehr. Vielleicht hatte sie noch ein Fläschchen gebraucht. Faith hörte den Apparat bei sich zu Hause klingeln und dann ihre eigene Stimme, die den Anrufer bat, eine Nachricht zu hinterlassen.
Sie legte auf. Ohne nachzudenken, schaute sie auf den Rücksitz. Emmas leerer Kindersitz war da. Sie konnte das rosafarbene Futter sehen, das über die Plastikschale hinausragte.
»Idiotin«, fluchte Faith leise. Sie wählte die Handynummer ihrer Mutter. Mit angehaltenem Atem wartete sie drei Klingelzeichen ab. Evelyns Voicemail sprang an.
Faith musste sich räuspern, bevor sie etwas sagen konnte. Sie merkte, dass ihre Stimme zitterte. »Mom, ich bin auf dem Heimweg. Schätze, du bist mit Em spazieren …« Faith schaute zum Himmel, als sie auf die Interstate fuhr. Sie war etwa zwanzig Minuten vor Atlanta und sah flaumige, weiße Wolken, die sich wie Schals um die dünnen Hälse der Wolkenkratzer legten. »Ruf mich einfach an«, sagte Faith mit einem unguten Gefühl.
Lebensmittelladen. Tankstelle. Drogerie. Ihre Mutter hatte den gleichen Kindersitz wie der in Faith’ Mini. Wahrscheinlich war sie unterwegs, um Besorgungen zu machen. Faith hatte sich über eine Stunde verspätet. Mit Sicherheit hatte Evelyn das Baby genommen und … Faith eine Nachricht hinterlassen, dass sie unterwegs sei. Die Frau hatte den Großteil ihres Erwachsenenlebens Dienstbereitschaft gehabt. Sie ging nicht einmal auf die Toilette, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Faith und ihr älterer Bruder Zeke hatten sich als Kinder darüber lustig gemacht. Sie wussten immer, wo ihre Mutter war, auch wenn sie es gar nicht wissen wollten. Vor allem, wenn sie es nicht wollten.
Faith starrte das Telefon in ihrer Hand an, als könnte es ihr sagen, was los war. Sie war sich bewusst, dass sie sich wahrscheinlich wegen nichts und wieder nichts aufregte. Das Festnetz konnte ausgefallen sein. Ihre Mutter würde das nur merken, wenn sie zu telefonieren versuchte. Ihr Handy konnte ausgeschaltet oder im Ladegerät oder beides sein. Ihr BlackBerry konnte in ihrem Auto oder in ihrer Handtasche oder irgendwo sein, wo sie das charakteristische Vibrieren nicht hörte. Faith schaute zwischen Straße und ihrem BlackBerry hin und her, während sie eine E-Mail an ihre Mutter tippte. Beim Tippen sprach sie die Wörter laut mit: »Unterwegs. Sorry-für-die-Verspätung. Ruf-mich-an.«
Sie schickte die Mail ab und warf dann das Telefon auf den Beifahrersitz zu den verstreuten Dingen aus ihrer Handtasche. Nach kurzem Zögern steckte sie sich den Kaugummi in den Mund. Sie kaute beim Fahren und ignorierte die Flusen aus der Handtasche, die an ihrer Zunge klebten. Sie schaltete das Radio ein und gleich wieder aus. Je näher sie der Stadt kam, umso dünner wurde der Verkehr. Die Wolken trieben auseinander und schickten helle Sonnenstrahlen auf die Erde. Der Innenraum des Autos wurde zu einem Backofen.
Zehn Minuten später waren ihre Nerven noch immer aufs Äußerste gespannt, und sie schwitzte von der Hitze im Auto. Sie öffnete das Sonnendach einen Spalt, um ein bisschen frische Luft hereinzulassen. Das Ganze war vermutlich ein simpler Fall von Trennungsangst. Seit gut zwei Monaten arbeitete sie wieder, doch noch jeden Morgen hatte sie, wenn sie Emma bei ihrer Mutter ablieferte, fast so etwas wie einen Anfall. Ihre Sicht verschwamm. Das Herz hämmerte in ihrer Brust. Ihr Kopf summte, als wären ihr eine Million Bienen in die Ohren geflogen. In der Arbeit war sie noch gereizter als sonst, vor allem bei ihrem Partner Will Trent, der entweder die erforderliche Geduld ihr gegenüber aufbrachte oder sich ein glaubhaftes Alibi zurechtbastelte für den Augenblick, da ihm endlich der Geduldsfaden riss und er sie erwürgte.
Faith konnte sich nicht erinnern, ob sie bei Jeremy, ihrem Sohn, der inzwischen bereits auf dem College war, dieselbe Angst gespürt hatte. Faith war achtzehn Jahre alt gewesen, als sie in die Polizeiakademie kam. Jeremy war damals drei Jahre alt. Sie klammerte sich an die Idee, zur Polizei zu gehen, als wäre sie der einzige Lebensretter auf der Titanic. Dank gedankenloser zwei Minuten in der hinteren Reihe eines Kinos und einer Fehlentscheidung, die ein Leben atemberaubend schlechten Geschmacks bei Männern vorausahnen ließ, war Faith ohne die ansonsten üblichen Zwischenstopps aus der Pubertät in die Mutterschaft gesprungen. Mit achtzehn Jahren hatte sie sich an den Gedanken geklammert, ab jetzt ein regelmäßiges Gehalt zu verdienen, damit sie aus dem Haus ihrer Eltern ausziehen und Jeremy so erziehen konnte, wie sie wollte. Jeden Tag zur Arbeit zu gehen, war ein Schritt in die Unabhängigkeit gewesen. Ihn in Tagespflege geben zu müssen, war ihr damals als geringer Preis erschienen.
Jetzt, da Faith vierunddreißig Jahre alt war, eine Hypothek und einen Autokredit abbezahlen und noch mal ein Baby aufziehen musste, wünschte sie sich nichts mehr, als wieder in das Haus ihrer Mutter zu ziehen, damit Evelyn sich um alles kümmern konnte. Sie wollte den Kühlschrank öffnen und nach Essen sehen, das sie nicht kaufen musste. Sie wollte im Sommer die Klimaanlage aufdrehen, ohne sich über die Rechnung Sorgen machen zu müssen. Sie wollte bis Mittag schlafen und dann den ganzen Tag fernsehen. Und verdammt, wenn sie schon dabei war, könnte sie auch ihren Vater wiederauferstehen lassen, der vor elf Jahren gestorben war, damit er ihr zum Frühstück Pfannkuchen backen und ihr sagen konnte, wie hübsch sie war.
Alles Hirngespinste. Evelyn schien recht glücklich damit zu sein, das Kindermädchen zu spielen, aber Faith gab sich nicht der Illusion hin, dass ihr Leben einfacher werden würde. Ihre eigene Rente war noch fast zwanzig Jahre entfernt. Den Mini hatte sie noch drei Jahre lang abzubezahlen, und bis dahin wäre die Garantie längst abgelaufen. Emma würde für mindestens die nächsten sechzehn Jahre Essen und Kleidung erwarten, wenn nicht sogar länger. Und es war nicht mehr so wie damals, als Jeremy noch ein Baby war und Faith ihm nicht zusammenpassende Socken und Secondhandkleidung von Garagenverkäufen anziehen konnte. Bei den Babys heute musste alles perfekt passen. Sie brauchten BPA-freie Fläschchen und garantiert organische Apfelsauce von gütigen Amish-Farmern. Falls Jeremy es in das Architektur-Programm an der Georgia Tech schaffte, musste Faith sich auf sechs weitere Jahre Bücherkaufen und Wäschewaschen einstellen. Und am beunruhigendsten war, dass ihr Sohn eine ernsthafte Freundin gefunden hatte. Eine ältere Freundin mit ausladenden Hüften und einer tickenden biologischen Uhr. Faith könnte Großmutter sein, bevor sie fünfunddreißig Jahre alt wurde.
Eine lästige Hitze breitete sich in ihrem Körper aus, als sie versuchte, diesen letzten Gedanken aus ihrem Kopf zu verdrängen. Beim Fahren kramte sie noch einmal im Inhalt ihrer Handtasche. Der Kaugummi hatte keine große Wirkung gezeigt. Ihr Magen knurrte noch immer. Sie beugte sich vor und tastete im Handschuhfach herum. Nichts. Sie könnte an einer der Imbissbuden anhalten und sich wenigstens eine Cola besorgen, aber sie trug noch ihre Dienstkleidung – eine hellblaue Khakihose und eine blaue Bluse mit der leuchtend gelben Beschriftung GBI auf dem Rücken. Und das war nicht unbedingt ein Viertel der Stadt, wo man sich als Angehöriger der Strafverfolgungsbehörden zu erkennen gab. Die Leute liefen gern vor einem davon, und dann musste man ihnen nachjagen, was nicht unbedingt dazu führte, dass man zu einer vernünftigen Zeit zu Hause war. Außerdem sagte ihr irgendetwas, sie solle zu ihrer Mutter fahren, ja, drängte sie förmlich dazu.
Faith griff noch einmal zum Handy und wählte Evelyns Nummern. Festnetz, Handy, sogar ihr BlackBerry, das sie eigentlich nur für E-Mails verwendete. Von allen dreien kam die gleiche negative Reaktion. Faith spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog, während ihr die schlimmsten Szenarios durch den Kopf gingen. Als Polizistin auf Streife war sie oft zu Vorfällen gerufen worden, bei denen die Nachbarn durch ein weinendes Kind auf ein ernsthaftes Problem aufmerksam geworden waren. Mütter waren in der Badewanne ausgerutscht. Väter hatten sich durch Unachtsamkeit selbst verletzt oder einen Herzstillstand erlitten. Die Babys hatten einfach nur dagelegen und hilflos geweint, bis jemand auf den Gedanken kam, dass etwas nicht stimmen könnte. Es gab nichts Herzzerreißenderes als ein weinendes Baby, das sich nicht trösten ließ. Faith ärgerte sich über sich selbst, weil sie diese schrecklichen Bilder überhaupt zuließ. Schon immer war sie eine Meisterin darin gewesen, dauernd das Schlimmste anzunehmen, auch bereits bevor sie Polizistin wurde. Evelyn ging es wahrscheinlich gut. Emmas Zeit für den Mittagsschlaf war etwa halb zwei Uhr. Wahrscheinlich hatte ihre Mutter das Telefon ausgesteckt, damit das Klingeln nicht das Baby weckte. Vielleicht hatte sie einen Nachbarn getroffen, als sie in den Briefkasten schaute, oder sie war nebenan, um der alten Mrs. Levy den Müll hinauszutragen.
Dennoch rutschten Faith’ Hände auf dem Lenkrad ab, als sie auf den Boulevard fuhr. Sie schwitzte trotz des milden Märzwetters. Hier ging es nicht nur um das Baby oder ihre Mutter oder um Jeremys so skrupellos fruchtbare Freundin. Vor weniger als einem Jahr hatte man bei Faith Diabetes diagnostiziert. Sie war äußerst gewissenhaft, wenn es darum ging, den Blutzucker zu messen, das Richtige zu essen und immer einen Snack bei der Hand zu haben. Wahrscheinlich erklärte das, warum ihre Gedanken so aus dem Ruder gelaufen waren. Sie brauchte einfach etwas zu essen. Vorzugsweise gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Kind.
Faith kramte noch einmal im Handschuhfach, um ganz sicherzugehen, dass es wirklich leer war. Dunkel erinnerte sie sich daran, dass sie Will gestern ihren letzten Energieriegel gegeben hatte, während sie vor dem Gerichtsgebäude warteten. Es hieß, entweder das oder mit ansehen zu müssen, wie er sich einen klebrigen Donut aus dem Verkaufsautomaten einverleibte. Er hatte sich über den Geschmack beschwert, aber trotzdem den ganzen Riegel gegessen. Und jetzt bezahlte sie dafür.
Sie übersah eine gelbe Ampel und fuhr, so schnell sie sich traute, eine nur mäßig belebte Wohnstraße hinunter. Die Straße verengte sich an der Ponce de Leon. Faith kam an einigen Fast-Food-Restaurants und einem Bioladen vorbei. Sie drückte noch ein wenig mehr aufs Gaspedal, schlitterte durch die Kurven und Abzweigungen am Rand des Piedmont Park. Der Blitz einer Überwachungskamera zuckte im Rückspiegel auf, als sie erneut bei einer gelben Ampel durchfuhr. Wegen eines unachtsamen Fußgängers musste sie scharf abbremsen. Noch zwei Lebensmittelläden huschten vorbei, dann kam die letzte Ampel, die zum Glück Grün zeigte.
Evelyn wohnte noch immer in dem Haus, in dem Faith und ihr älterer Bruder aufgewachsen waren. Das einstöckige Ranchhaus lag in einer Gegend Atlantas mit dem Namen Sherwood Forest, eingebettet zwischen Ansley Park, einem der reichsten Viertel der Stadt, und der Interstate 85, die, abhängig von der herrschenden Windrichtung, beständigen Verkehrslärm bot. Heute blies der Wind genau richtig, und als Faith das Fenster öffnete, um mehr frische Luft ins Auto zu lassen, hörte sie das vertraute Dröhnen, das fast jeden Tag ihrer Kindheit charakterisiert hatte.
Als lebenslange Einwohnerin von Sherwood Forest hatte Faith einen tiefsitzenden Hass gegen die Männer, die das Viertel geplant hatten. Die Wohnsiedlung war nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, und die Backsteinhäuser wurden an zurückkehrende Soldaten verkauft, die die billigen Veteranenkredite nutzten. Die Straßenplaner hatten sich das Sherwood-Konzept unverfroren zu eigen gemacht. Nachdem Faith links in die Lionel eingebogen war, kreuzte sie die Friar Tuck, bog rechts in die Robin Hood Road ein, fuhr über die Gabelung an der Lady Marian Lane und kontrollierte die Einfahrt ihres eigenen Hauses an der Ecke Doncaster und Barnesdale, bevor sie schließlich das Haus ihrer Mutter am Little John Trail erreichte.
Evelyns beiger Chevy Malibu stand mit dem Heck nach hinten im Carport. Wenigstens das war normal. Faith hatte noch nie gesehen, dass ihre Mutter anders auf einen Parkplatz fuhr. Diese Angewohnheit stammte noch aus ihren Tagen in Uniform. Man sorgte immer dafür, dass man sofort abfahrbereit war, wenn ein Anruf kam.
Faith hatte nicht die Zeit, über die Gewohnheiten ihrer Mutter nachzudenken. Sie rollte in die Einfahrt und parkte ihren Mini Schnauze an Schnauze mit dem Malibu. Ihre Beine schmerzten, als sie ausstieg; in den letzten zwanzig Minuten war jeder Muskel ihres Körpers angespannt gewesen. Aus dem Haus hörte sie laute Musik. Heavy Metal, nicht die gewohnten Beatles ihrer Mutter. Auf dem Weg zur Küchentür legte Faith die Hand auf die Motorhaube des Malibu. Der Motor war kalt. Vielleicht war Evelyn unter der Dusche gewesen, als Faith anrief. Vielleicht hatte sie E-Mail und Handy nicht kontrolliert. Vielleicht hatte sie sich geschnitten. Auf der Tür war ein blutiger Handabdruck.
Faith stutzte und schaute noch einmal genauer hin.
Der blutige Abdruck stammte von einer linken Hand und befand sich einen knappen halben Meter über dem Türknauf. Die Tür war zugezogen worden, war jedoch nicht ins Schloss gefallen. Ein Streifen Sonnenlicht fiel auf den Türpfosten, wahrscheinlich vom Fenster über dem Spülbecken.
Faith konnte nicht begreifen, was sie da sah. Sie hielt ihre eigene Hand über den Abdruck wie ein Kind, das seine Finger auf die ihrer Mutter legt. Evelyns Hand war kleiner. Schlanke Finger. Die Spitze ihres Ringfingers hatte die Tür nicht berührt. Wo der Abdruck hätte sein müssen, klebte ein Blutklumpen.
Unvermittelt brach die Musik ab. Durch die Stille hörte Faith ein vertrautes gurgelndes Geräusch, das einen Schrei ankündigte. Das Geräusch hallte durch den Carport, sodass Faith im ersten Augenblick dachte, er käme aus ihrem eigenen Mund. Dann ertönte er noch einmal, und Faith drehte sich um, weil sie wusste, dass er von Emma kam.
Fast jedes andere Haus in Sherwood Forest war abgerissen oder umgebaut worden, nur das Haus der Mitchells sah noch so aus, wie man es damals gebaut hatte. Der Grundriss war einfach: drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer und eine Küche mit einer Tür, die in den offenen Carport führte. An die andere Carport-Seite hatte Bill Mitchell, Faith’ Vater, einen soliden Werkzeugschuppen angebaut – ihr Vater hatte nie etwas halbherzig gemacht –, mit einer Metalltür, die sich verriegeln ließ, und Sicherheitsglas in dem einzigen Fenster. Faith war zehn Jahre alt gewesen, als sie erkannte, dass der Anbau für etwas so Einfaches wie einen Werkzeugschuppen viel zu stabil war. Mit dem Zartgefühl, das nur ein älterer Bruder aufbringen kann, hatte Zeke ihr den wahren Zweck des Schuppens verraten: »Dort bewahrt Mom ihre Waffe auf, du blöde Kuh.«
Faith lief an dem Auto vorbei und wollte die Schuppentür öffnen – verschlossen. Sie schaute durchs Fenster. Die Metalldrähte in dem Sicherheitsglas bildeten vor ihren Augen ein Spinnennetz. Sie sah den Arbeitstisch und darunter die ordentlich aufgestapelten Säcke mit Erde. Werkzeuge hingen an ihren Haken. Die Geräte zur Rasenbearbeitung standen sauber aufgereiht nebeneinander. Ein schwarzer Metallsafe mit Zahlenschloss war unter dem Tisch mit Bolzen am Boden befestigt. Die Tür stand offen. Evelyns Revolver, ein Smith & Wesson mit dem Kirschholzgriff, fehlte, ebenso die Schachtel mit Munition, die normalerweise danebenstand.
Wieder war das gurgelnde Geräusch zu hören, diesmal lauter. Einige Decken auf dem Boden pulsierten wie ein Herzschlag. Evelyn benutzte sie, um bei unerwarteten Frostperioden die Pflanzen abzudecken. Normalerweise lagen sie zusammengefaltet auf dem obersten Regalbrett, jetzt aber waren sie in die Ecke hinter dem Safe gestopft. Faith sah ein Stückchen Pink aus den grauen Decken herausragen, dann die Rundung einer Plastikkopfstütze, die nur zu Emmas Autositz gehören konnte. Die Decken bewegten sich wieder. Ein winziger Fuß wurde herausgestreckt; eine weiche, gelbe Baumwollsocke mit weißem Spitzenbesatz am Knöchel. Dann stieß eine kleine Faust durch die Decken. Und plötzlich sah sie Emmas Gesicht.
Emma lächelte Faith an, ihre Oberlippe formte ein weiches Dreieck. Wieder gurgelte sie, doch diesmal vor Freude.
»O Gott.« Faith zog vergeblich an der verschlossenen Tür. Ihre Hand zitterte, als sie die Oberkante des Türstocks abtastete und nach dem Schlüssel suchte. Staub rieselte herunter. Die scharfe Spitze eines Splitters stach ihr in den Finger. Faith schaute wieder durchs Fenster. Emma klatschte in die Hände, der Anblick ihrer Mutter tröstete sie, obwohl Faith einer ausgewachsenen Panik so nahe war wie noch nie in ihrem Leben. In der Hütte war es heiß. Emma könnte sich überhitzen. Sie könnte dehydrieren. Sie könnte sterben.
Voller Angst kniete Faith sich hin, weil sie dachte, dass der Schlüssel vielleicht heruntergefallen, möglicherweise unter die Tür gerutscht war. Faith sah, dass der Boden von Emmas Sitz verbogen war, weil er so straff zwischen Wand und Safe klemmte. Versteckt unter Decken. Blockiert vom Safe.
Geschützt vom Safe.
Faith hielt inne. Ihre Lunge verkrampfte sich. Sie biss die Zähne zusammen. Langsam setzte sie sich auf. Auf dem Betonboden vor ihr entdeckte sie Blut. Ihr Blick folgte der Spur bis zur Küchentür. Dem blutigen Handabdruck.
Emma war im Schuppen eingeschlossen. Evelyns Waffe war verschwunden. Eine Blutspur führte zum Haus.
Faith stand auf und schaute zur unverschlossenen Küchentür. Außer ihrem schweren Atem war nichts zu hören.
Wer hatte die Musik ausgeschaltet?
Faith lief zu ihrem Auto zurück. Sie zog ihre Glock unter dem Fahrersitz hervor, kontrollierte das Magazin und klemmte sich das Halfter an den Gürtel. Ihr Handy lag noch auf dem Vordersitz. Faith schnappte es sich, bevor sie den Kofferraum öffnete. Sie war Detective des Morddezernats von Atlanta gewesen, bevor sie Special Agent beim Staat wurde. Sie wählte die geheime Notfallnummer aus dem Gedächtnis. Sie ließ der Telefonistin keine Zeit zum Sprechen und ratterte die Nummer ihrer alten Marke, ihre Einheit und die Adresse ihrer Mutter herunter.
Dann hielt sie kurz inne, bevor sie sagte: »Code dreißig.« Die Wörter blieben ihr beinahe im Hals stecken. Den Code hatte sie noch nie in ihrem Leben benutzt. Er bedeutete, dass ein Beamter Notfallhilfe brauchte. Er bedeutete, dass ein Kollege in Gefahr, möglicherweise schon tot war. »Mein Kind ist im Außenschuppen eingeschlossen. Auf dem Beton ist eine Blutspur und ein blutiger Handabdruck auf der Küchentür. Ich glaube, meine Mutter ist im Haus. Ich habe Musik gehört, aber sie wurde ausgeschaltet. Sie ist eine pensionierte Kollegin. Ich glaube, sie ist …« Ihr wurde die Kehle eng, als würde eine Faust sie abdrücken. »Hilfe. Bitte. Schicken Sie Hilfe.«
»Bestätige Code dreißig«, erwiderte die Telefonistin knapp und scharf. »Bleiben Sie draußen und warten Sie auf Verstärkung. Gehen Sie nicht – ich wiederhole –, gehen Sie nicht ins Haus.«
»Verstanden.« Faith schaltete ab und warf das Handy auf den Rücksitz. Sie drehte den Schlüssel in dem Schloss, das ihre Schrotflinte auf dem Boden des Kofferraums fixierte.
Das GBI gab an jeden seiner Agenten mindestens zwei Waffen aus. Die Glock, Modell 23, war eine Halbautomatik Kaliber 40 mit dreizehn Schuss im Magazin und einem in der Kammer. Die Remington 870 hatte vier Kartuschen mit Doppelnull-Postenschrot im Lauf. Faith’ Flinte hatte sechs zusätzliche Patronen in einem seitlich vor dem Schaft befestigten Halter. Jede Kartusche enthielt acht Kugeln. Jede Kugel hatte in etwa die Größe einer 38er-Pistolenkugel.
Bei jeder Betätigung des Abzugs verschoss die Glock eine Kugel. Jedes Abfeuern der Remington verschoss acht Kugeln. Die GBI-Vorschriften verlangten, dass jeder Agent seine Glock mit einer Patrone in der Kammer geladen hatte, sodass ihm insgesamt vierzehn Schuss zur Verfügung standen. An dieser Waffe gab es keinen konventionellen äußeren Sicherungshebel. Die Agenten waren nach dem Gesetz berechtigt, tödliche Gewalt anzuwenden, wenn sie ihr eigenes Leben oder das anderer Personen bedroht sahen. Man drückte nur einfach den Abzug ganz zurück, wenn man schießen wollte, und man schoss nur, wenn man töten wollte.
Die Schrotflinte war eine andere Geschichte mit demselben Resultat. Der Sicherungshebel befand sich am hinteren Teil des Abzugsbügels, ein Querschrauben-Schieberegler, für dessen Betätigung man geschmeidige Muskeln brauchte. Man trug sie nicht mit einer Patrone in der Kammer. Man wollte, dass jeder in der Umgebung das Ratschen hörte, mit der die Patrone schussbereit einrastete.
Während sie die Sicherung löste, schaute sie sich zum Haus um. Der Vorhang am vorderen Fenster bewegte sich. Ein Schatten lief den Korridor hinunter.
Faith lud die Flinte, während sie auf den Carport zuging. Die Bewegung erzeugte genau dieses befriedigende Geräusch. In einer einzigen, flüssigen Bewegung drückte sie sich den Schaft gegen die Schulter und richtete den Lauf aus. Sie trat die Tür ein und schrie, die Waffe schussbereit: »Polizei!«
Das Wort dröhnte durchs Haus wie ein Donner. Es kam aus einem dunklen Ort tief in Faith’ Eingeweiden, den sie meistens ignorierte, aus Angst, etwas einzuschalten, was nicht wieder abgeschaltet werden konnte.
»Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!«
Niemand kam heraus. Irgendwo im hinteren Teil des Hauses hörte sie ein Geräusch. Sie betrat die Küche. Blut auf der Anrichte. Ein Brotmesser. Noch mehr Blut auf dem Boden. Schubladen und Schränke waren alle weit geöffnet. Der Festnetzapparat hing an der Wand wie eine verdrehte Henkerschlinge.
Evelyns BlackBerry und ihr Handy lagen zertreten auf dem Boden. Faith hielt die Flinte gerade an der Schulter, den Zeigefinger dicht neben dem Abzug, damit sie keinen Fehler machte. Sie hätte an ihre Mutter und an Emma denken sollen, aber ihr ging immer wieder nur ein einziger Satz durch den Kopf: Personen und Türen. Wenn man ein Haus durchsuchte, waren das die größten Bedrohungen der eigenen Sicherheit. Man musste wissen, wo die Personen waren – ob es die Guten oder die Bösen waren –, und man musste wissen, was einen an jeder Tür erwartete.
Faith drehte sich zur Seite und richtete die Flinte in die Wäschekammer. Sie sah einen Mann mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Schwarze Haare. Haut wie gelbes Wachs. Er hatte die Arme um den Körper geschlungen wie ein Kind bei einem Spiel. Keine Waffe an ihm oder in seiner Reichweite. Sein Hinterkopf war ein blutiger Brei. Gehirnmasse sprenkelte die Waschmaschine. Sie konnte das Loch in der Wand sehen, wo die Kugel eingedrungen war, nachdem sie aus dem Schädel ausgetreten war.
Faith drehte sich wieder zur Küche. Von dort gab es einen Durchgang zum Esszimmer. Sie kauerte sich hin und schwang die Waffe in diese Richtung.
Leer.
Sie machte sich den Grundriss des Hauses bewusst. Links das Wohnzimmer. Rechts eine große, offene Diele. Direkt vor ihr der Flur. Badezimmer am Ende. Rechts davon zwei Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer links – das ihrer Mutter. In ihm gab es ein winziges Bad und eine Tür auf die Terrasse. Evelyns Schlafzimmertür war die einzige geschlossene im Gang. Faith ging auf die geschlossene Tür zu, blieb dann aber stehen.
Personen und Türen.
Im Geist sah sie den Satz wie in Stein gemeißelt: Bewege dich nicht auf eine vor dir liegende Bedrohung zu, bevor du sichergestellt hast, dass hinter dir alles sicher ist.
Geduckt ging sie nach links und betrat das Wohnzimmer. Sie schaute an den Wänden entlang, kontrollierte die Glasschiebetür, die auf die Terrasse führte. Das Glas war zerbrochen. Die Vorhänge bewegten sich im Wind. Das Zimmer war verwüstet worden. Da hatte irgendjemand irgendetwas gesucht. Schubladen waren herausgerissen. Kissen aufgeschlitzt. Von ihrer Position aus konnte Faith hinter die Couch blicken und auch erkennen, dass im Ohrensessel niemand saß. Immer wieder schaute sie zwischen dem Zimmer und dem Gang hin und her, bis sie sicher war, dass sie weitergehen konnte.
Die erste Tür war die zu ihrem alten Zimmer. Auch hier hatte jemand gesucht. Die Schubladen in Faith’ altem Schreibtisch standen heraus wie Zungen. Die Matratze war aufgeschlitzt. Emmas Kinderbettchen war zertrümmert, die Bettdecke zerrissen. Das Mobile, das jeden Tag ihres Lebens über ihr gehangen hatte, war in den Teppich getreten wie Dreck. Faith unterdrückte die brennende Wut, die in ihrer Brust aufstieg, und zwang sich zum Weitergehen.
Schnell schaute sie in den Schränken und unter dem Bett nach. Dasselbe machte sie in Zekes Zimmer, das ihre Mutter zum Büro umgebaut hatte. Auf dem Boden lagen Papiere verstreut. Die Schreibtischschubladen hatte man an die Wand geschmettert. Sie schaute ins Bad. Der Duschvorhang war zurückgezogen. Der Wäscheschrank stand offen. Handtücher und Laken hingen heraus.
Faith stand links neben dem Schlafzimmer ihrer Mutter, als sie die erste Sirene hörte. Zwar noch entfernt, aber deutlich. Sie sollte auf die Beamten, auf Verstärkung warten.
Faith trat die Tür ein und blickte, leicht geduckt, hinein. Am Fuß des Betts waren zwei Männer. Einer kniete. Er war Hispano und trug nur eine Jeans. Die Haut auf seiner Brust war aufgeplatzt, als hätte man ihn mit Stacheldraht gepeitscht. Schweiß glänzte auf seinem Oberkörper. Schwarze und rote Verfärbungen sprenkelten seine Rippen. Überall auf Armen und Torso hatte er Tätowierungen, die größte davon auf seiner Brust: ein grüner und roter Texasstern mit einer sich darum windenden Klapperschlange. Er war Mitglied der Los Texicanos, einer mexikanischen Gang, die seit zwanzig Jahren den Drogenhandel in Atlanta kontrollierte.
Der zweite Mann war Asiate. Keine Tattoos. Ein leuchtend rotes Hawaiihemd und beige Chinos. Er stand vor dem Texicano und hielt dem Mann eine Waffe an die Stirn. Ein fünfschüssiger Revolver Smith & Wesson mit Kirschholzgriff. Der Revolver ihrer Mutter.
Faith richtete die Flinte auf die Brust des Asiaten. Das kalte, harte Metall fühlte sich an wie eine Verlängerung ihres Körpers. Adrenalin ließ ihr Herz rasen. Jeder Muskel ihres Körpers wollte abdrücken.
Ihre Stimme klang scharf. »Wo ist meine Mutter?«
Er sprach mit näselndem Südstaatenakzent. »Wenn du auf mich schießt, triffst du ihn auch.«
Er hatte recht. Faith stand im Flur, deutlich weniger als zwei Meter entfernt. Die Männer waren zu dicht beieinander. Sogar ein Kopfschuss barg das Risiko, dass eine Kugel danebenging, die Geisel traf und wahrscheinlich tötete. Dennoch ließ sie die Waffe nicht sinken und behielt den Finger am Abzug.
»Sag mir, wo sie ist.«
Er drückte die Mündung fester an die Stirn des Mannes.
»Waffe weg.«
Die Sirenen wurden lauter. Sie kamen aus Zone fünf, der Peachtree-Seite des Viertels. Faith sagte: »Hörst du das?« Sie stellte sich den Weg die Nottingham herunter vor und rechnete sich aus, dass ihre Kollegen in weniger als einer Minute hier waren. »Sag mir, wo meine Mutter ist, oder ich schwöre, ich töte dich, bevor sie an der Tür sind.«
Er grinste und umfasste den Revolver fester. »Du weißt, weswegen wir hier sind. Gib es uns, und wir lassen sie gehen.« Faith wusste nicht, was er meinte. Ihre Mutter war eine dreiundsechzig Jahre alte Witwe. Das Wertvollste im Haus war der Boden, auf dem sie standen.
Er verstand ihr Schweigen als Unschlüssigkeit. »Willst du wirklich deine Mutter wegen Chico hier verlieren?«
Faith tat so, als würde sie ihn verstehen. »Ist es wirklich so einfach? Eines gegen das andere?«
Er zuckte die Achseln. »Der einzige Weg, damit wir beide hier rauskommen.«
»Blödsinn.«
»Kein Blödsinn. Ein fairer Tausch.« Die Sirenen wurden lauter. Auf der Straße quietschten Reifen. »Na komm, du Schlampe. Was ist? Kommen wir ins Geschäft?«
Er log. Er hatte bereits einen Mann getötet und bedrohte einen anderen. Sobald er merkte, dass Faith bluffte, würde es für sie nur eines geben: eine Kugel in die Brust.
»Okay«, sagte sie, fasste die Flinte mit der linken Hand und warf sie vor sich auf den Boden.
Der Waffenausbilder am Schießstand hatte eine Stoppuhr, die Zehntelsekunden maß, und deshalb wusste Faith, dass ihre rechte Hand genau acht Zehntelsekunden brauchte, um die Glock aus ihrem Gürtelhalfter zu ziehen. Während der Asiate von der Flinte abgelenkt war, die ihm vor die Füße fiel, tat sie genau das, sie zog die Glock, legte den Finger um den Abzug und schoss dem Mann in den Kopf.
Seine Arme schnellten in die Höhe. Die Waffe fiel klappernd zu Boden. Er war tot, bevor er auf den Boden knallte.
Die Haustür splitterte. Faith drehte sich zur Diele um, als ein SWAT-Team in voller Kampfausrüstung ins Haus drängte. Und dann drehte sie sich wieder zum Schlafzimmer um und sah, dass der Mexikaner verschwunden war.
Die Terrassentür stand offen. Faith rannte nach draußen, als der Mexikaner eben über den Maschendrahtzaun sprang, die S&W in seiner Hand. Mrs. Johnsons Enkelinnen spielten im hinteren Garten. Sie schrien, als sie den bewaffneten Mann auf sich zurennen sahen. Er war sieben Meter entfernt. Fünf. Er richtete die Waffe auf die Kinder und feuerte einen Schuss über ihre Köpfe hinweg. Backsteinbrocken rieselten zu Boden. Sie waren zu verängstigt, um zu schreien, sich zu bewegen und in Sicherheit zu bringen. Faith blieb am Zaun stehen, hob ihre Glock und drückte ab.
Der Mann machte einen Satz, wie von einer Schnur in die Höhe gerissen. Mindestens eine Sekunde blieb er noch auf den Beinen, dann gaben seine Knie nach, und er fiel rücklings auf die Erde. Faith schwang sich über den Zaun und rannte auf ihn zu. Sie rammte ihm den Absatz ins Handgelenk, bis er die Waffe ihrer Mutter losließ. Die Mädchen fingen wieder an zu schreien. Mrs. Johnson kam aus dem Haus und nahm sie unter ihre Fittiche wie eine Entenmutter. Während sie die Tür zuzog, warf sie Faith noch einen Blick zu. Sie war schockiert, entsetzt. Als Zeke und Faith noch klein waren, hatte sie sie oft mit dem Gartenschlauch nass gespritzt. Damals fühlten sie sich hier sicher.
Faith steckte die Glock in das Halfter und Evelyns Revolver hinten in den Hosenbund. Sie packte den Mexikaner bei den Schultern. »Wo ist meine Mutter?«, blaffte sie. »Was habt ihr mit ihr gemacht?«
Er öffnete den Mund, unter den Silberkappen seiner Schneidezähne quoll Blut heraus. Das Arschloch grinste.
»Wo ist sie?« Faith drückte ihre Hand auf seine zerschossene Brust, spürte, wie sich die gebrochenen Rippen unter ihren Fingern bewegten. Er schrie vor Schmerz auf, und sie drückte noch fester, sodass die Knochen aneinanderrieben.
»Wo ist sie?«
»Agent!« Ein junger Beamter stützte sich mit einer Hand ab und schwang sich über den Zaun. Die Waffe zu Boden gerichtet, kam er auf sie zu. »Entfernen Sie sich von dem Gefangenen.«
Faith beugte sich noch näher zu dem Mexikaner vor. Sie spürte die Hitze, die seine Haut abstrahlte. »Sag mir, wo sie ist.«
Sein Kehlkopf bewegte sich. Er spürte den Schmerz nicht mehr. Seine Pupillen waren riesig. Die Lider flatterten. Seine Mundwinkel zuckten.
»Sag mir, wo sie ist.« Mit jedem Wort klang ihre Stimme verzweifelter. »O Gott, sag mir einfach – bitte –, sag mir, wo sie ist.« Sein Atem rasselte, als wären die Lungenflügel zusammengeklebt. Seine Lippen bewegten sich. Er flüsterte etwas, das sie nicht verstand.
»Was?« Faith brachte ihr Ohr so dicht an seine Lippen, dass sie seinen Speichel spürte. »Sag’s mir«, flüsterte sie. »Bitte sag’s mir.«
»Almeja.«
»Was?«, wiederholte Faith. »Was hast du gesagt?« Sein Mund klappte auf. Anstelle von Worten quoll Blut heraus.
»Was hast du gesagt?«, schrie sie. »Sag mir, was du gesagt hast!«
»Agent!«, brüllte der Beamte noch einmal.
»Nein!« Sie presste ihre Handflächen auf die Brust des Mexikaners, um sein Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Faith ballte die Faust, sie wollte ihn unbedingt ins Leben zurückholen. »Sag’s mir!«, schrie sie. »Sag’s mir einfach.«
»Agent!« Sie spürte Hände um ihre Taille. Der Beamte hob sie in die Höhe.
»Loslassen!« Faith stieß ihren Ellbogen so heftig nach hinten, dass er sie fallen ließ wie einen Stein. Sie krabbelte noch einmal auf den Zeugen zu. Die Geisel. Den Mörder. Die einzige Person, die ihr jetzt noch sagen konnte, was mit ihrer Mutter geschehen war.
Sie nahm den Kopf des Mexikaners zwischen beide Hände und starrte in sein lebloses Gesicht. »Bitte sag’s mir«, flehte sie, obwohl sie wusste, dass es zu spät war. »Bitte.«
»Faith?« Detective Leo Donnelly, ihr alter Partner im Atlanta Police Department, stand auf der anderen Seite des Zauns. Er war außer Atem. Seine Hände umklammerten den Maschendrahtzaun. Der Wind riss das Sakko seines billigen, braunen Anzugs auseinander. »Emma geht es gut. Ein Schlosser ist schon unterwegs.« Seine Stimme klang träge und langsam, wie Sirup, der durch ein Sieb tropft. »Jetzt komm, Mädchen. Emma braucht ihre Mutter.«
Faith schaute an ihm vorbei. Überall waren Polizisten. Das Dunkelblau ihrer Uniformen verschwamm, während sie das Haus, den Garten durchsuchten. Durch die Fenster verfolgte sie die Bewegungen des SWAT-Teams von Zimmer zu Zimmer, hörte ihre Rufe »sauber«, wenn sie nichts fanden. Das Geheul vieler Sirenen schwängerte die Luft. Streifenwagen. Krankenwagen. Ein Feuerwehr-Einsatzwagen.
Der Notruf war in der Welt. Code 30. Beamter braucht Notfallunterstützung.
Drei Männer erschossen. Ihr Baby in einem Schuppen eingesperrt. Ihre Mutter verschwunden.
Faith sank in die Hocke, stützte den Kopf in die zitternden Hände und zwang sich, nicht zu weinen.
2. KAPITEL
»Also, er erzählt mir, er hätte bei seinem Auto einen Ölwechsel gemacht, und weil es heiß war in der Werkstatt, hat er seine Hose ausgezogen …«
»Aha«, meinte Sara Linton und versuchte, Interesse zu heucheln, während sie in ihrem Salat stocherte.
»Und ich sagte: ›Hör mal, Kumpel, ich bin Arzt und nicht deshalb hier, um zu urteilen. Du kannst mir ruhig ehrlich sagen, was …‹«
Sara sah die Bewegungen von Dale Dugans Lippen, doch zum Glück verschmolz seine Stimme mit dem mittäglichen Lärm der Pizzeria. Die leise Musik. Das Lachen der Menschen. Teller, die in der Küche herumgeschoben wurden. Seine Geschichte war nicht besonders fesselnd, nicht einmal neu. Sara war Kinderärztin in der Notaufnahme von Atlantas Grady Hospital. Davor hatte sie zwölf Jahre lang eine eigene Praxis gehabt und in der Zeit nebenbei auch als Coroner für eine kleine, aber aktive College-Stadt gearbeitet. Es gab so gut wie nichts, weder Geräte, Werkzeuge, Haushaltsprodukte oder Glasfiguren, die sie nicht irgendwann einmal in einer Öffnung eines menschlichen Körpers gefunden hatte.
Dennoch fuhr Dale fort: »Dann kommt die Schwester mit den Röntgenaufnahmen rein.«
»Aha«, sagte sie und gab sich Mühe, neugierig zu klingen. Dale lächelte sie an. Zwischen seinen Schneidezähnen klemmte Käse. Sara maßte sich kein Urteil an. Dale Dugan war ein netter Mann. Er war nicht gerade der Attraktivste, aber er sah ganz okay aus, mit Gesichtszügen, die viele Frauen attraktiv fanden, nachdem sie erfahren hatten, dass er Medizin studiert hatte. Sara ließ sich nicht so leicht mitreißen. Außerdem war sie am Verhungern, da die Freundin, die ihr dieses lächerliche Blind Date verschafft hatte, meinte, sie solle eher Salat als Pizza bestellen, weil das besser aussehe.
»Also halte ich die Aufnahme in die Höhe, und was sehe ich …?«
Steckschlüssel, dachte sie, bevor er endlich zur Pointe kam.
»Einen Steckschlüssel! Kannst du dir das vorstellen?«
»Nein!« Sie zwang sich zu einem Lachen, das klang wie die Töne aus einer Aufziehpuppe.
»Und er behauptete weiterhin, er sei ausgerutscht.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Ein ziemlicher Sturz.«
»Ja, nicht?« Er lächelte sie noch einmal an, bevor er herzhaft in seine Pizza biss.
Sara kaute Salat. Die Digitaluhr über Dales Kopf zeigte 2:12 und ein paar Sekunden. Die roten LED-Ziffern waren eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass sie jetzt eigentlich zu Hause das Basketball-Spiel anschauen und den Berg Wäsche auf ihrem Sofa zusammenlegen könnte. Sara hatte mit sich selbst gewettet, nicht auf die Uhr zu schauen, um zu sehen, wie lange sie es aushielt, bevor ihre Selbstbeherrschung sich verflüchtigte und sie den tickenden Sekundenzeiger anstarrte. Drei Minuten und zweiundzwanzig Sekunden waren ihr Rekord. Sie nahm sich noch eine Gabel Salat und schwor sich, ihn einzustellen.
»Also«, sagte Dale, »du warst auf der Emory.« Sie nickte. »Und du warst an der Duke?«
Wie vorauszusehen, setzte er nun zu einer langatmigen Beschreibung seiner akademischen Errungenschaften an, wozu auch Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und programmatische Reden bei verschiedenen Konferenzen gehörten. Wieder heuchelte Sara Aufmerksamkeit, zwang sich, nicht auf die Uhr zu schauen, und kaute den Salat so langsam wie eine Kuh auf der Weide, sodass Dale sich nicht gezwungen fühlte, ihr eine Frage zu stellen.
Das war nicht Saras erstes Blind Date, und leider war es auch nicht ihr unterhaltsamstes. Das Problem hatte schon in den ersten sechs Minuten angefangen, wie Sara an der Uhr abgelesen hatte. Die Präliminarien waren bereits abgehandelt, bevor ihr Essen serviert wurde. Dale war geschieden, hatte keine Kinder, verstand sich noch gut mit seiner Ex-Frau und spielte in seiner Freizeit im Krankenhaus Spontan-Basketball. Sara stammte aus einer Kleinstadt in South Georgia. Sie hatte zwei Windhunde und eine Katze, die allerdings lieber bei ihren Eltern wohnte. Vor viereinhalb Jahren war ihr Ehemann getötet worden.
Normalerweise war diese letzte Information ein Gesprächskiller, aber Dale hatte es überspielt wie eine unbedeutende Nebensächlichkeit. Zuerst hatte Sara es ihm positiv angerechnet, dass er nicht nach Details fragte, dann hatte sie vermutet, dass er zu egozentrisch war, um Fragen zu stellen, und schließlich hatte sie sich vorgeworfen, dass sie zu hart über den Mann urteile.
»Was hat dein Mann gemacht?«
Die Frage überrumpelte sie. Sie hatte den Mund voller Salat, kaute, schluckte und antwortete ihm dann: »Er war Polizist. Der Polizeichef des Bezirks.«
»Das ist ungewöhnlich.« Anscheinend schaute sie verständnislos, denn er erklärte: »Ich meine, ungewöhnlich, weil er kein Arzt ist. Kein Arzt war. Also kein Akademiker.«
»Akademiker?« Sie hörte den Vorwurf in ihrer Stimme, konnte aber nichts dagegen tun. »Mein Vater ist Installateur. Meine Schwester und ich haben für ihn gearbeitet, einige Jahre …«
»Mann, Mann.« Er hob kapitulierend die Hände. »Das kam wohl falsch heraus. Ich meine, es hat schon etwas Edles, mit den eigenen Händen zu arbeiten, nicht?«
Sara wusste ja nicht, welche Art von Arzt Dr. Dale war, aber sie neigte dazu, ihre Hände bei ihrer Arbeit zu benutzen.
Er schien sich seines Fauxpas gar nicht bewusst zu sein, denn seine Stimme bekam nun etwas Feierliches: »Ich habe viel Respekt vor Polizisten. Und Leuten im aktiven Dienst. Soldaten, meine ich.« Er wischte sich mit seiner Serviette nervös den Mund ab. »Gefährliche Arbeit. Ist er im Dienst gestorben?«
Sie nickte und schaute schnell auf die Uhr. Drei Minuten und sechzehn Sekunden. Ihren Rekord hatte sie knapp verfehlt.
Er zog sein Handy aus der Tasche und sah aufs Display.
»Entschuldigung, aber ich habe Bereitschaft. Ich wollte nur eben nachsehen, ob ich hier ein Signal habe.«
Wenigstens hatte er nicht so getan, als wäre sein Handy stumm geschaltet, allerdings war Sara ziemlich sicher, dass das noch kam. »Tut mir leid, dass ich so abweisend bin. Es ist ein schwieriges Thema.«
»Dein Verlust tut mir sehr leid.« Seine Stimme hatte die professionelle Färbung, die Sara aus der Notaufnahme kannte. »Das war sicher schwer für dich.«
Sara biss sich auf die Zungenspitze. Eine höfliche Reaktion fiel ihr einfach nicht ein, und als sie endlich daran dachte, das Thema zu wechseln und übers Wetter zu sprechen, war so viel Zeit vergangen, dass die Situation noch peinlicher würde. Schließlich sagte sie: »Na ja, wie auch immer. Warum reden wir nicht …«
»Entschuldigung«, unterbrach er sie, »muss mal kurz auf die Toilette.«
Er stand so schnell auf, dass sein Stuhl beinahe umgekippt wäre. Sara sah ihn nach hinten hasten. Vielleicht bildete sie sich das nur ein, aber sie dachte, vor dem Notausgang hätte er kurz gezögert.
»Idiot.« Sie warf ihre Gabel auf den Salatteller.
Wieder schaute sie auf die Uhr. Es war Viertel nach zwei. Falls Dale je wieder von der Toilette zurückkam, konnte sie diese Geschichte um halb drei hinter sich haben. Sara war zu Fuß von ihrer Wohnung hierhergekommen, es würde also nicht dieses ausgedehnte, furchtbare Schweigen geben, wenn Dale sie nach Hause fuhr. Die Rechnung hatten sie bereits bezahlt, als sie an der Kasse ihr Essen bestellten. Für den Rückweg brauchte sie fünfzehn Minuten, sodass sie noch Zeit hatte, ihr Kleid aus- und eine Jogginghose anzuziehen, bevor das Basketballspiel anfing. Sara merkte, dass ihr Magen knurrte. Vielleicht sollte sie nur so tun, als würde sie gehen, und dann zurückkommen und eine Pizza bestellen.
Auf der Uhr verging noch eine Minute. Sara schaute auf den Parkplatz hinaus. Dales Auto stand noch dort, da sie davon ausging, dass der grüne Lexus mit dem Nummernschild DRDALE ihm gehörte. Sie wusste nicht, ob sie enttäuscht oder erleichtert war.
Noch einmal dreißig Sekunden verstrichen auf der Uhr. Der Gang zu den Toiletten blieb noch einmal dreiundzwanzig Sekunden leer. Eine ältere Frau mit einer Gehhilfe ging mühsam dort entlang. Hinter ihr war niemand.
Sara stützte den Kopf auf die Hand. Dale war kein schlechter Mann. Er war solide, einigermaßen gesund, in fester, gut bezahlter Stellung, hatte noch fast alle Haare und wirkte, bis auf den Käse zwischen den Zähnen, gut gepflegt. Doch das alles war nicht genug. Allmählich dachte Sara, dass sie das Problem war, denn sobald sie ihre gute Meinung von jemandem verloren hatte, war sie für immer verschwunden. Die Richtung eines Dampfers zu ändern, war einfacher, als Saras Denken zu ändern.
Sie sollte sich bei der Sache einfach mehr Mühe geben. Sie war keine fünfundzwanzig mehr, die Vierziger saßen ihr im Nacken. Bei einer Größe von über eins achtzig war ihre Auswahl von vornherein beschränkt. Ihre kastanienbraunen Haare und die helle Haut war nicht jedermanns Geschmack. Ihre Arbeitstage waren lang. Als Köchin war sie eine absolute Niete. Offensichtlich hatte sie ihre Fähigkeit zu jeglichem Small Talk verloren, und allein schon die Erwähnung ihres toten Mannes konnte sie zur Furie werden lassen.
Vielleicht waren ihre Ansprüche einfach zu hoch. Ihre Ehe war nicht perfekt gewesen, aber verdammt gut. Sie hatte ihren Mann mehr geliebt als das Leben selbst. Ihn zu verlieren, das hatte sie beinahe umgebracht. Aber Jeffrey war nun schon fast fünf Jahre nicht mehr da, und um ehrlich zu sein, Sara fühlte sich einsam. Sie vermisste die Gesellschaft eines Mannes. Sie vermisste die Art, wie das männliche Gehirn funktionierte, und die erstaunlich lieben Dinge, die ein Mann sagen und tun konnte. Sie vermisste die raue Männerhaut. Sie vermisste auch die anderen Sachen. Leider hatte sie, als ein Mann sie das letzte Mal dazu gebracht hatte, die Augen zu verdrehen, gegen die Langeweile angekämpft und sich nicht in Ekstase gewunden.
Sara musste sich eingestehen, dass sie beim Flirten extrem, schrecklich, grässlich schlecht war. Viel Zeit zum Üben hatte sie ja nicht gehabt. Von der Pubertät an war Sara seriell monogam gewesen. Ihr erster Freund war eine Highschool-Liebe gewesen, die bis zum College gehalten hatte, dann war sie während des Medizinstudiums die ganze Zeit mit einem Kommilitonen gegangen, und schließlich hatte sie Jeffrey kennengelernt und nie mehr einen Gedanken an einen anderen Mann verschwendet. Bis auf eine katastrophale Nacht vor drei Jahren hatte es seitdem keinen Mann mehr gegeben. Sie kannte nur einen Mann, der auch nur entfernt einen Funken in ihr entfachen konnte, aber der war verheiratet. Schlimmer noch, er war ein verheirateter Polizist.
Und am schlimmsten, er stand gerade mal drei Meter von ihr entfernt an der Kasse.
Will Trent trug schwarze Shorts und ein langärmeliges, schwarzes T-Shirt, das seine breiten Schultern sehr vorteilhaft zur Geltung brachte. Seine sandblonden Haare waren länger als noch vor ein paar Monaten, als Sara ihn das letzte Mal gesehen hatte. Er hatte einen Fall bearbeitet, der einen ihrer alten Patienten in der Kinderklinik zu Hause betraf. Sie hatte ihre Nase so tief in Wills Angelegenheiten gesteckt, dass er keine andere Chance gehabt hatte, als sich von ihr bei den Ermittlungen helfen zu lassen. Sie hatten, so fühlte es sich zumindest an, ein wenig miteinander geflirtet, doch nach Abschluss des Falls war er nach Hause zu seiner Frau zurückgekehrt.
Will war extrem aufmerksam. Sicher hatte er Sara beim Hereinkommen am Tisch sitzen sehen. Dennoch drehte er ihr den Rücken zu und starrte ein Flugblatt auf der Anschlagtafel an der Wand an. Sie brauchte die Uhr nicht, um die Sekunden zu zählen, während sie darauf wartete, dass er sie bemerkte.
Er wandte seine Aufmerksamkeit einem anderen Flugblatt zu.
Sara zog den Clip heraus, der ihre Haare zusammenhielt, und ließ ihre Locken über die Schultern fallen. Sie stand auf und ging zu ihm.
Es gab einige Dinge, die sie über Will Trent wusste. Er war groß, mindestens eins neunzig, hatte den schlanken Körper eines Läufers und die schönsten Beine, die sie bei einem Mann je gesehen hatte. Seine Mutter war ums Leben gekommen, als er weniger als ein Jahr alt gewesen war. Er war in einem Kinderheim aufgewachsen und nie adoptiert worden. Er war Special Agent beim GBI und einer der intelligentesten Männer, die sie kannte, und er war so legasthenisch, dass er, soweit sie das beurteilen konnte, nicht besser lesen konnte als ein Zweitklässler.
Sie stand Schulter an Schulter mit ihm und starrte das Flugblatt an, das seine Aufmerksamkeit fesselte. »Sieht interessant aus.«
Seine Überraschung, sie zu sehen, war sehr schlecht gespielt. »Dr. Linton. Ich wollte eben …« Er riss eine Telefonnummer von dem Flugblatt. »Ich überlege schon länger, mir ein Motorrad zuzulegen.«
Sie schaute sich das Flugblatt an, das unter einer Werbung für neue Mitglieder die detaillierte Zeichnung einer Harley Davidson zeigte. »Ich glaube nicht, dass Lesben auf schweren Maschinen das Richtige für Sie sind.«
Sein Lächeln war schief. Er hatte sein ganzes Leben damit zugebracht, seine Behinderung zu verbergen, und obwohl Sara es herausgefunden hatte, gab er noch immer nicht gern zu, dass er ein Problem hatte. »Ist doch eine tolle Möglichkeit, Frauen kennenzulernen.«
»Wollen Sie Frauen kennenlernen?«
Sara dachte an eine weitere von Wills Eigenheiten, nämlich sein unheimliches Talent dafür, den Mund zu halten, wenn er nicht wusste, was er sagen sollte. Daraus resultierten dann die verlegenen Augenblicke, die Saras Dates ausgesprochen unterhaltsam erscheinen ließen.
Zum Glück war Wills Pizza fertig. Sara trat einen Schritt zurück, während er die Schachtel von der tätowierten und vielfach gepiercten Kellnerin entgegennahm. Die junge Frau warf Will einen Blick zu, den man nur anerkennend nennen konnte. Er schien das überhaupt nicht zu bemerken, während er nachschaute, ob sie seine Bestellung auch korrekt ausgeführt hatten.
»Also.« Mit dem Daumen drehte er den Ehering an seinem Finger. »Schätze, ich sollte los.«
»Okay.«
Er rührte sich nicht. Sara ebenfalls nicht. Draußen fing ein Hund an zu bellen, das schrille Kläffen drang durch die offenen Fenster. Sara wusste, dass für die Kunden, die mit ihren Haustieren zum Restaurant kamen, neben der Vordertür ein Pfosten zum Anbinden und eine Schüssel mit Wasser standen. Sie wusste außerdem, dass Wills Frau einen kleinen Hund namens Betty hatte und dass dessen Pflege und Fütterung vorwiegend ihm überlassen war.
Das Kläffen wurde intensiver. Will machte noch immer keine Anstalten zu gehen.
Sie sagte: »Das klingt aber sehr nach Chihuahua.«
Er horchte konzentriert und nickte dann. »Ich glaube, Sie könnten recht haben.«
»Da bin ich wieder.« Dale war zurück von der Toilette.
»Hör zu, ich habe einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen …« Er schaute zu Will hoch. »Hi.«
Sara stellte die beiden einander vor. »Dale Dugan, das ist Will Trent.«
Will nickte knapp. Dale tat dasselbe.
Der Hund bellte weiter, ein durchdringendes, panisches Jaulen. An Wills Gesichtsausdruck sah Sara, dass er lieber sterben würde, als zuzugeben, dass der Hund zu ihm gehörte.
Sie zeigte ein wenig Mitleid mit ihrem Blind Date. »Dale, ich weiß, dass du ins Krankenhaus musst. Vielen Dank für das Mittagessen.«
»War mir ein Vergnügen.« Er beugte sich zu ihr und küsste sie direkt auf die Lippen. »Ich ruf dich an.«
»Toll«, murmelte sie und musste sich beherrschen, um sich nicht die Lippen abzuwischen. Sara sah die beiden Männer noch ein knappes Nicken austauschen, bei dem sie sich vorkam wie der einzige Hydrant im Hundepark.
Bettys Kläffen wurde noch lauter, als Dale über den Parkplatz ging. Will murmelte etwas in sich hinein, bevor er die Tür aufstieß. Mit einer Hand band er die Leine los und hob den Hund hoch, während er auf der anderen die Pizza balancierte. Das Kläffen hörte sofort auf. Betty drückte ihren Kopf an seine Brust. Ihre Zunge hing heraus.
Sara strich dem Hund über den Kopf. Auf ihrem schmalen Rücken hatte sie frische Wundnähte. »Was ist passiert?«
Wills Lippen waren noch immer zusammengepresst. »Sie hat sich mit einem Jack Russell angelegt.«
»Wirklich?« Diese Art von Verletzungen konnte unmöglich von einem anderen Hund stammen, außer der Jack Russell hatte Scheren anstelle von Pfoten.
Er deutete mit dem Kinn auf Betty. »Ich sollte sie nach Hause bringen.«
Sara war noch nie in Wills Haus gewesen, aber sie wusste, wo er wohnte. »Müssen Sie nicht nach rechts?« Sie differenzierte: »In diese Richtung.«
Will antwortete nicht. Er schien sich zu überlegen, ob er sie anlügen und damit durchkommen könnte.
Sie ließ nicht locker. »Wohnen Sie nicht an der Linwood?«
»Sie müssen in die andere Richtung.«
»Ich kann durch den Park abkürzen.« Sie setzte sich in Bewegung, sodass ihm keine andere Wahl mehr blieb. Schweigend gingen sie die Ponce de Leon hinunter. Der Verkehr war so laut, dass er ihre Sprachlosigkeit problemlos übertönte, aber nicht einmal die Auspuffgase der Autos konnten überdecken, wie strahlend schön dieser Frühlingstag war. Pärchen gingen Hand in Hand die Straße entlang. Mütter schoben Kinderwagen. Jogger sprinteten über die vierspurige Straße. Die Bewölkung des frühen Morgens war nach Osten abgezogen, jetzt zeigte sich ein jeansblauer Himmel. Eine leichte Brise wehte. Sara verschränkte die Hände hinter dem Rücken und schaute den aufgeplatzten Bürgersteig entlang. Baumwurzeln durchbrachen den Beton wie knotige, alte Zehen.
Sie sah Will an. Die Sonne ließ den Schweiß auf seiner Stirn funkeln. Auf seinem Gesicht waren zwei Narben, von denen Sara keine Ahnung hatte, woher sie stammten. Irgendwann war seine Oberlippe aufgerissen und schlecht zusammengenäht worden, sodass sein Mund jetzt etwas ordinär aussah. Die andere Narbe lief am linken Unterkiefer entlang und verschwand in seinem Kragen. Als sie ihn kennengelernt hatte, hatte sie die Narben seinem jugendlichen Ungestüm zugeschrieben, doch da sie nun seine Geschichte kannte und wusste, dass er in staatlicher Obhut aufgewachsen war, nahm sie an, dass hinter den Verletzungen eine dunklere Geschichte steckte.
Will drehte sich ihr zu, und sie wandte den Blick ab. Er sagte: »Dale scheint ja ein recht netter Kerl zu sein.«
»Ja, ist er.«
»Arzt, nehme ich an.«
»Genau.«
»Sah aus wie ein guter Küsser.« Sie lächelte.
Will drückte Betty ein wenig fester an sich, um sie besser im Griff zu haben. »Schätze, Sie gehen mit ihm.«
»Das war heute unser erstes Date.«
»Sie wirkten aber vertrauter.«
Sara blieb stehen. »Wie geht’s Ihrer Frau, Will?«
Er antwortete nicht sofort. Sein Blick war über ihre Schulter in die Ferne gerichtet. »Ich habe sie seit vier Monaten nicht gesehen.«
Irgendwie fühlte Sara sich im Stich gelassen. Seine Frau war verschwunden, und Will hatte sie nicht angerufen. »Sind Sie getrennt?«
Er trat einen Schritt beiseite, sodass ein Jogger vorbeilaufen konnte. »Nein.«
»Wird sie vermisst?«
»Nicht direkt.«
Ein MARTA-Bus hielt am Bordstein, sein Motor füllte die Luft mit einem anhaltenden Grummeln. Sara hatte Angie Trent vor knapp einem Jahr kennengelernt. Ihr mediterranes Aussehen und die kurvenreiche Figur waren genau das, woran Mütter dachten, wenn sie ihre Söhne vor Flittchen warnten.
Der Bus fuhr wieder an. Sara fragte: »Wo ist sie?«
Will atmete lang aus. »Sie verlässt mich sehr oft. Genau das tut sie. Sie geht einfach weg, und dann kommt sie zurück. Und dann bleibt sie eine Weile, und dann verschwindet sie wieder.«
»Wohin geht sie?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Sie haben sie nie gefragt?«
»Nein.«
Sara tat erst gar nicht so, als würde sie verstehen. »Warum nicht?«
Er schaute auf die Straße, den vorbeiziehenden Verkehr.
»Das ist kompliziert.«
Sie legte ihm die Hand auf den Arm. »Erklären Sie es mir.« Als er sie anschaute, sah er absolut lächerlich aus mit dem winzigen Hund in der einen Hand und der Pizzaschachtel in der anderen.
Sara trat näher an ihn heran. Sie spürte die harten Muskeln unter seinem T-Shirt, die Hitze seiner Haut. Im strahlenden Sonnenlicht wirkten seine Augen unwirklich blau. Er hatte zarte Wimpern, blond und weich. An seinem Unterkiefer war eine stoppelige Stelle, die er beim Rasieren übersehen hatte. Sara war ein paar Zentimeter kleiner als er. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihm direkt in die Augen sehen zu können.
Sie sagte: »Reden Sie mit mir.«
Er schwieg, und sein Blick wanderte über ihr Gesicht, blieb kurz an den Lippen hängen, bevor er ihr wieder in die Augen schaute.
Schließlich sagte er: »Es gefällt mir, wenn Sie Ihre Haare offen tragen.«
Ein schwarzer SUV, der mitten auf der Straße hart bremste, nahm Sara die Möglichkeit zu einer Reaktion. Knapp zwanzig Meter weiter vorn kam er zum Stehen und stieß dann wieder zurück. Die Reifen quietschten über den Asphalt. Gummigestank füllte die Luft. Das Fenster wurde heruntergelassen.
Wills Chefin Amanda Wagner schrie: »Einsteigen!«
Sie waren beide zu verblüfft, um sich zu rühren. Autos hupten. Fäuste wurden geschwenkt. Sara kam sich vor wie mitten in einem Actionfilm.
»Können Sie …«, setzte Will an, aber Sara nahm ihm Betty und die Pizzaschachtel bereits ab. Aus einer Socke zog er seinen Hausschlüssel. »Man muss sie im Gästezimmer einsperren, damit sie nicht …«
»Will!« Amandas Ton ließ keinen Zweifel offen.
Sara nahm den Schlüssel. Das Metall war noch warm von seinem Körper. »Gehen Sie.«
Das musste man Will nicht zweimal sagen. Er sprang ins Auto, und sein Fuß schleifte noch über den Asphalt, als Amanda schon wieder losfuhr. Wieder wurde gehupt. Eine viertürige Limousine brach bei der Vollbremsung mit dem Heck aus. Sara erkannte auf dem Rücksitz einen Teenager. Das Mädchen presste die Hände ans Fenster. Der Mund stand vor Schreck offen. Von hinten kam mit hohem Tempo ein weiteres Auto, konnte aber im letzten Augenblick noch ausweichen. Sara schaute dem jungen Mädchen direkt in die Augen, doch dann richtete die Limousine sich wieder aus und fuhr davon.
Betty zitterte, und Sara ging es nicht viel besser. Sie versuchte, den Hund zu beruhigen, während sie zu Wills Straße lief. Sie drückte ihn fest an sich und presste die Lippen auf seinen Kopf. Sara wusste nicht so recht, was es noch schlimmer machte – daran zu denken, was zwischen Will und ihr hätte passieren können, oder die Tatsache, dass Amanda Wagner beinahe einen schlimmen Unfall verursacht hatte.
Sie würde die Nachrichten einschalten müssen, um herauszufinden, was passiert war. Denn wohin Will auch fuhr, die Übertragungswagen würden ebenfalls dort sein. Amanda war Deputy Director des GBI. Sie fuhr nicht nur aus einer Laune heraus herum und suchte nach ihren Agenten. Sara stellte sich vor, dass Faith, Wills Partnerin, in diesem Augenblick ebenfalls wie eine Verrückte zu einem Tatort raste.
Sie hatte vergessen, Will nach seiner Hausnummer zu fragen, aber zum Glück standen alle Angaben auf Bettys Anhänger. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn Wills schwarzer Porsche, der in einer Einfahrt fast am Ende der Straße stand, war unübersehbar. Das Auto war ein älteres Modell, das komplett restauriert worden war. Anscheinend hatte Will es heute gewaschen. Die Reifen glänzten, und im Lack der langen Schnauze konnte sie ihr Spiegelbild sehen, als sie daran vorbeiging.
Will wohnte in einem Bungalow aus rotem Backstein. Die Haustür war schwarz lackiert. Die Holzverzierungen waren buttergelb. Der Rasen war gut gepflegt, die Kanten waren sauber abgestochen, Sträucher und Hecken penibel gestutzt. Ein farbenfrohes Blumenbeet fasste den Mimosenbaum im vorderen Garten ein. Sara fragte sich, ob Angie Trent einen grünen Daumen hatte. Stiefmütterchen waren widerstandsfähige Pflanzen, aber sie mussten regelmäßig gegossen werden. So, wie es klang, war Mrs. Trent nicht der Typ, sich mit so etwas lange aufzuhalten. Sara wusste nicht recht, was sie davon halten sollte oder ob sie es überhaupt verstand. Dennoch hörte sie die Stimme ihrer Mutter in ihrem Hinterkopf nörgeln: Auch eine abwesende Ehefrau ist immer noch eine Ehefrau.
Betty fing an, sich zu winden, als Sara den Gartenpfad hochging. Sie fasste das Hündchen fester. Genau das brauchte sie jetzt, um ihren Tag noch schlimmer zu machen – den Hund zu verlieren, der der Frau des Mannes gehörte, den sie eben noch auf der Straße hatte küssen wollen.
Mit einem Kopfschütteln stieg Sara die Stufen zur Veranda hinauf. Sie hatte kein Recht, so über Will zu denken. Sie sollte froh sein, dass Amanda Wagner sie unterbrochen hatte. Am Anfang ihrer Ehe hatte Jeffrey Sara betrogen. Es hätte sie beinahe auseinandergerissen, und sie hatten jahrelang hart arbeiten müssen, um ihre Beziehung wieder zu kitten. Will hatte seine Entscheidung getroffen, zum Guten oder zum Schlechten. Und es war auch nicht nur eine vorübergehende Romanze. Er war mit Angie aufgewachsen. Sie hatten sich im Kinderheim kennengelernt, als sie beide noch sehr jung waren, und hatten eine fast fünfundzwanzigjährige gemeinsame Geschichte. Sara gehörte nicht zwischen die beiden. Sie wollte nicht einer anderen Frau denselben Schmerz zufügen, den sie gespürt hatte, gleichgültig, wie trostlos ihre sonstigen Möglichkeiten waren.