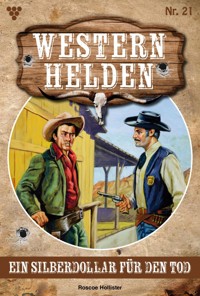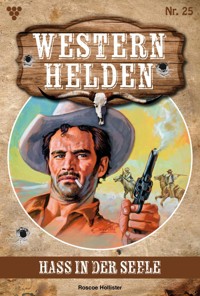
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Western Helden – Die neue Reihe für echte Western-Fans! Harte Männer, wilde Landschaften und erbarmungslose Duelle – hier entscheidet Mut über Leben und Tod. Ob Revolverhelden, Gesetzlose oder einsame Reiter auf der Suche nach Gerechtigkeit – jede Geschichte steckt voller Spannung, Abenteuer und wilder Freiheit. Erlebe die ungeschönte Wahrheit über den Wilden Westen Es würde der letzte Whiskey seines Lebens sein. Aber das ahnte William Hatfield nicht, als er das leere Glas auf die wurmstichige Theke des schäbigen Saloons im texanischen Tuscola knallte. Dort, wohin er sich verkrochen hatte. Mit dem Handrücken wischte er sich über die dünnen Lippen. »Noch einen, Joe«, raunte er dem Bartender mit einer seltsam hohen Stimme zu, die so gar nicht zu seinem Äußeren passte. William Hatfield war ein schwerer, übergewichtiger Mann mit kurzem, borstigen und kupferrotem Haar. Die wässrig grauen Augen, die zwischen feisten Wangen eingebettet waren, erinnerten an nasses Blech. Beim Sprechen schwabbelte das Doppelkinn wie Pudding. Der mächtige Nacken glänzte rosa. Doch trotz dieser unvorteilhaften, äußerlichen Attribute war William Hatfield alles andere als ein Kerl, den man herumschubsen konnte. Ganz im Gegenteil umgab ihn geradezu eine düstere, unheilvolle Aura. Schon als dickliches Kind war er raffiniert und bösartig gewesen, hatte Tiere und Gleichaltrige mit üblen Scherzen gequält und schikaniert, um nachher die Schuld anderen zuzuschieben. Schon früh war sein Weg als Verbrecher vorgezeichnet gewesen. Er wurde mit vierundvierzig Jahren in mehreren Bundesstaaten wegen Raubmordes und Pferdediebstählen gesucht. Das alles wusste auch der mittelgroße, schlanke Fremde, der durch die Schwingtür des Lonesome Saloons trat und auf die Theke zusteuerte. Die Sporen klirrten auf den Bodenbrettern. Der breitkrempige Stetson ließ das scharfgeschnittene Gesicht im Schatten verschwinden. Sein vormals weißes Reiterhemd war schmutzig, zeugte von einem langen Ritt unter glühender Texassonne. Die staubige Hose aus schwarzem Denim bedeckte die Schäfte der schweren Reitstiefel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Helden – 25 –Hass in der Seele
Roscoe Hollister
Es würde der letzte Whiskey seines Lebens sein. Aber das ahnte William Hatfield nicht, als er das leere Glas auf die wurmstichige Theke des schäbigen Saloons im texanischen Tuscola knallte. Dort, wohin er sich verkrochen hatte. Mit dem Handrücken wischte er sich über die dünnen Lippen. »Noch einen, Joe«, raunte er dem Bartender mit einer seltsam hohen Stimme zu, die so gar nicht zu seinem Äußeren passte. William Hatfield war ein schwerer, übergewichtiger Mann mit kurzem, borstigen und kupferrotem Haar. Die wässrig grauen Augen, die zwischen feisten Wangen eingebettet waren, erinnerten an nasses Blech. Beim Sprechen schwabbelte das Doppelkinn wie Pudding. Der mächtige Nacken glänzte rosa. Doch trotz dieser unvorteilhaften, äußerlichen Attribute war William Hatfield alles andere als ein Kerl, den man herumschubsen konnte. Ganz im Gegenteil umgab ihn geradezu eine düstere, unheilvolle Aura. Schon als dickliches Kind war er raffiniert und bösartig gewesen, hatte Tiere und Gleichaltrige mit üblen Scherzen gequält und schikaniert, um nachher die Schuld anderen zuzuschieben. Schon früh war sein Weg als Verbrecher vorgezeichnet gewesen. Er wurde mit vierundvierzig Jahren in mehreren Bundesstaaten wegen Raubmordes und Pferdediebstählen gesucht.
Das alles wusste auch der mittelgroße, schlanke Fremde, der durch die Schwingtür des Lonesome Saloons trat und auf die Theke zusteuerte. Die Sporen klirrten auf den Bodenbrettern. Der breitkrempige Stetson ließ das scharfgeschnittene Gesicht im Schatten verschwinden. Sein vormals weißes Reiterhemd war schmutzig, zeugte von einem langen Ritt unter glühender Texassonne. Die staubige Hose aus schwarzem Denim bedeckte die Schäfte der schweren Reitstiefel. In einem eingefettetem, gekreuzten Holster trug er tief an den Schenkeln zwei .45 Remington Government-Revolver, deren Walnussgriffschalen vom häufigen Gebrauch abgewetzt waren. Das zeichnete ihn als Revolvermann aus, deshalb blickte auch William Hatfield von seinem neu gefüllten Whiskeyglas zu dem Fremden auf.
Um diese Zeit war der Saloon nur mit einem Dutzend Gästen besetzt. Alles hart aussehende Kerle mit rauem Lachen, gelben Zähnen und Narben in den verwitterten Gesichtern. Bei den meisten von ihnen handelte es sich um Banditen, die es genauso wie Hatfield in die Einsamkeit und Sicherheit dieses verruchten Kaffs im Nirgendwo getrieben hatte. Den Animierdamen war es egal. In guter Geschäftsmanier wickelten sie die Männer sofort um ihre Finger, sobald sie an einem der Tische saßen, um zu reden, zu trinken oder zu pokern.
Eines der hübschen Mädchen kam auch auf den Fremden zu, der sie jedoch mit einer unwilligen Geste stoppte. Dann stand er an der Bar, nur zwei Yards von Hatfield entfernt.
Joe, der Barkeeper kam vom anderen Ende der Theke heran, doch auch ihn schickte der Fremde fort. Dann schob er sich den Stetson in den Nacken und blickte den dicken Mann neben sich unentwegt an. In seinen dunklen, stechenden Augen glitzerte eine unbändige Härte, die tief in seinem Charakter zu wurzeln schien. Die hageren Wangen in dem knochigen Gesicht waren mit Stoppeln übersät. Die Spitzen des sichelförmigen Schnauzbarts, genauso pechschwarz wie sein Haupthaar, hingen weit über die dünnen Lippen herab und zitterten, als er sprach.
»Bist du William Bill Hatfield?« Seine raue Stimme klirrte wie Eis.
Der dicke Mann, der seinen Blick nicht von dem Fremden gelassen hatte, seit dieser unvermittelt hier aufgetaucht war, verzog das feiste Gesicht. »Wer will das wissen?« Die Frage war mehr ein Japsen.
Sein Gegenüber strich sich mit den Fingern durch den sichelförmigen Bart. Gewiss, seine Statur war nicht gerade furchteinflößend. Es gab größere und schwerere Männer, dennoch ging von ihm die Gefährlichkeit einer Klapperschlange aus.
»Ich bin Kopfgeldjäger Jack Stapp Dunlay«, erwiderte dieser ruhig, während er aus seiner Gesäßtasche einen Steckbrief herauszog, auf dem das Konterfei des Dicken prangte und ihn auf den Tresen legte. »Die Bundesbehörden haben auf dich eine Belohnung von fünfhundert Dollar ausgesetzt. Tot oder lebendig.«
Hatfield wurde blass. Dicke Schweißtropfen bildeten sich auf seiner Stirn, die jedoch kein Anzeichen von Angst waren, sondern von Überraschung, dass er hier in Tuscola aufgespürt worden war.
Als er sich einen Yard vom Tresen wegbewegte, um seine Bewegungsfreiheit zu vergrößern, hielten die Gäste und die Huren die Luft an. Keineswegs wollte sich der dicke Mann freiwillig in die Hände des Menschenjägers begeben. Die Spannung im Raum knisterte.
»Leg deine Waffe auf die Theke! Das ist das Beste für alle. Tust du das nicht und forderst mich heraus, wirst du sterben!« Noch immer war Dunlays Stimme gefasst. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, verbreiterte auch er seinen Stand, um das Gewicht zu verlagern. Die Hände schwebten über den Kolben der großkalibrigen Revolver.
»Du marschierst hier einfach herein und drohst mir?« Nun war Hatfield nicht mehr so gelassen wie noch kurz zuvor. Er blinzelte den Schweiß weg, der in seine schmalen Augen lief. »Glaubst du wirklich, dass du damit ungeschoren davon kommst?«
»Ich sage es dir nur noch einmal, William Hatfield: Leg deine verdammte Bleispritze auf den Tresen!«
Der Dicke schluckte gereizt. Das Zucken um seine Mundwinkel verriet seine Absicht, als er gleich darauf seinen Colt aus dem Holster zog.
Für einen so gewichtigen Mann, wie ihn, war er verdammt schnell. Aber nicht schnell genug für Jack Stapp Dunlay, der ihn um Sekundenbruchteile schlug.
Mit einer jahrelang geübten fließenden Bewegung zog der Kopfgeldjäger beide Revolver gleichzeitig aus dem Holster. Die Mündungsflammen, die aus den Läufen zuckten und das ohrenbetäubende Krachen waren eins. Das heiße Blei hämmerte nur einen halben Fingerbreit voneinander entfernt in Hatfields linke Brustseite, schüttelte ihn kurz durch, als stünde er unter Strom, und stieß ihn dann nach hinten. Als er auf dem Boden aufschlug, war er bereits tot.
Mit einem Handsalto ließ J.S., wie Freunde ihn nannten, seine Waffen zurück in das gekreuzte Holster gleiten. Durch den beißenden Pulverdampf hindurch wandte er sich an die Anwesenden. »Ihr alle habt gesehen, dass es ein fairer Kampf war.« Mehr sagte er nicht.
Die Gäste und Freudenmädchen, beeindruckt von den Schießkünsten des Fremden, nickten stumm. Nur einer, ein Riese mit zerschlagener Nase, sagte: »Der Bastard hat zuerst nach seiner Bleispritze gegriffen. Das können wir alle bestätigen, Mister. Aber nun machen Sie, dass Sie von hier fortkommen, denn der Dicke war einer von uns. Oder wollen Sie noch weiteren Verdruss?«
Der Kopfgeldjäger war von den Worten des Riesen völlig unbeeindruckt, blickte vielmehr jeden einzelnen Gast der Reihe nach an.
»Ich bin nur gekommen, um William Hatfield zu holen. Nun schmort er genau da, wo er auch hingehört«, entgegnete er eisig. »Und jetzt werde ich seinen Leichnam mitnehmen und niemand wird mich daran hindern!«
Tatsächlich dachte auch keiner im Traum daran.
*
Von Tuscola aus ritt Jack Stapp Dunlay mit einem zweiten Pferd, auf dessen Sattel Hatfields Leiche gebunden war, nach Abilene. Der Gaul hatte unter dem massigen Gewicht des Toten arg zu leiden. Mehrmals musste J.S. eine Pause einlegen.
Das texanische Abilene, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Rinderstadt in Kansas, war ein aufstrebender Ort, der sein Bestehen hauptsächlich der Texas and Pacific Railroad zu verdanken hatte. Rancher und Landspekulanten hatten die Eisenbahngesellschaft dazu bewegt, die Gleise durch ihr Land zu verlegen, das sie nur allzu gern und bereitwillig zur Verfügung stellten. So wuchs die Stadt stetig, obwohl die Region noch vor wenigen Jahren von Indianern besiedelt gewesen ist. Doch die Apachen waren vertrieben oder in neu geschaffene Reservate gesteckt worden. Nun war Abilene der Sitz der Verwaltung des Taylor County.
Dunlay lieferte die Leiche William Hatfields im Sheriffs Office ab. Der Sternträger war der oberste Verwaltungsbeamte des Countys und übte neben der Polizeigewalt auch noch andere Aufgaben aus. So war er zuständig für Steuereinnahmen, Volkszählungen, Bodenrecht und gleichzeitig auch das zivil- und strafrechtliche Vollstreckungsorgan des Gerichts.
Wenig später kassierte J.S. in der Bank die Kopfprämie. Allerdings war seine Arbeit noch nicht getan. Er suchte noch einen weiteren Mörder, der sich in Fort Worth versteckt hielt. Erst wenn er Ben Johnson geholt und ebenfalls tot oder lebendig abgeliefert hatte, konnte er wieder auf seine Ranch in der Nähe von Waco zurückreiten. Zurück zu seiner Frau Ireen und seiner fünfjährigen Tochter Eliza, die sehnsüchtig auf ihn warteten.
*
Der Hass brannte sich so tief in die Seelen der sechs Brüder, dass es fast körperlich wehtat. Dabei waren die Männer, die um den offenen Sarg in der Schreinerei von Abilene standen, alles andere als zartbesaitet. Bud, Chuck, Scott, Ralph, Jeremiah und Rufus Hatfield waren allesamt hart gesottene Revolvermänner, die ihre schnellen Hände an jeden vermieteten, der sie bezahlen konnte. Ganz gleich, ob es üble oder ehrenhafte Auftraggeber waren. Zumeist gehörten diese ohnehin zu der letztgenannten Sorte. Nun aber ging es nicht um irgendeinen Revolverlohn, sondern um ihre eigene Sippe. Um ihren Vater. Um ihren toten Vater.
Trotz der Tatsache, dass im Tod sein Körper eingefallen war und er bleich und starr wie ein Zedernbrett da lag, passte der aufgebahrte William Hatfield selbst jetzt kaum in die grobgezimmerte Lattenkiste aus Kiefernholz.
Der kleine, schmierige Bestatter hielt sich im Hintergrund. Seine Aufgabe war erst erledigt, wenn er den Raubmörder unter die Erde gebracht hatte. Doch zuvor waren Hatfields Söhne vom Sheriff darüber informiert worden, dass ihr Vater in Abilene bei einem Duell mit dem berüchtigten Kopfgeldjäger Jack Stapp Dunlay erschossen wurde. Diese nahmen nun, nachdem sie eiligst hergekommen waren, Abschied von ihrem Erzeuger.
Bud, der Jüngste der Brüder, ähnelte mit der untersetzten, rundlichen Figur und dem roten Borstenhaar äußerlich am ehesten seinem Dad. Selbst die grauen Augen in dem rosigen, feisten Gesicht mit der riesigen Nase und dem schmalen Mund hatten dieselbe Farbe.
Chuck war glatzköpfig, groß und hager wie ein Pinienzweig. Seine Augen funkelten wie gewaschener Kies, die Wangen waren stoppelbärtig, das Kinn kantig.
Rufus und Jeremiah könnten aufgrund ihrer großen, bulligen Statur mit den breiten Schultern und dem blonden Haar, das sie schulterlang trugen, fast Zwillinge sein, waren aber zwei Jahr auseinander. Ihre platt geschlagenen Nasen und die Blumenkohlohren zeigten, dass sie wilde Kerle waren, die keinem Faustkampf aus dem Wege gingen. Ihre schwarzen Augen strömten eine wilde Bösartigkeit aus, die jeden schaudern ließ, der in sie hineinblickte.
Scott war stattlich, wenn auch knorrig und lächelte nie. In seinem wettergegerbten schmalen Gesicht, das mit tiefen Falten zerfurcht war, dominierten durchdringende grüne Augen über der scharfen Nase und dem breiten Mund.
Ralph, der Älteste von ihnen, war sehnig und muskulös und wies unzählige Narben im Gesicht auf, die von den Krallen eines Pumas stammten. Sein schwarzes Haar war gescheitelt und halblang. Er sah aus wie ein Mexikaner, wären da nicht die hellblauen Augen, die diesen Eindruck Lüge straften.
Was die Brüder jedoch trotz der äußerlichen Unterschiede gemeinsam hatten, waren ihre rohen, aufbrausenden und egoistischen Charakterzüge, die sie unzweifelhaft von William Hatfield geerbt hatten. Maria Santoz, ihre Mutter, war eine stille, zurückhaltende und gutmütige Frau gewesen. Sie stammte aus El Bonito im Norden Mexikos, an der Grenze zu Texas, die der Rio Grande in einem weiten Bogen bildete. Maria war gerade mal dreißig, als sie bei der Geburt ihres letzten Sohns Bud, an einer Infektion starb. Seitdem hatte William Hatfield seine Söhne allein und mit harten Bandagen aufgezogen. Dazu gehörten von Kindesbeinen an Schläge, die sie misstrauisch gegenüber Autoritäten machten, gegen die sie sich immer wieder auflehnten. Deshalb galt für sie das Gesetz nicht mehr als das Papier, auf dem es stand. Das war auch der Grund, weshalb alle sechs Hatfield-Söhne noch unverheiratet waren. Ein gewaltloser Umgang mit Frauen lag ihnen genauso wenig wie ihrem Dad, der ihrer Mutter zu Lebzeiten immer wieder gezeigt hatte, wer das Sagen hatte.
Rufus spuckte neben der Totenkiste auf den Boden. Jeremiah tat es ihm gleich. In den Blicken der Hatfields war nicht die geringste Spur von Trauer, sondern nur unbändiger Hass, der wie Feuer in ihren Herzen flammte. Sicher, ihr Alter war ein übler Zeitgenosse, ein Mörder, Dieb und Vergewaltiger gewesen. Aber dennoch ihr Vater. Schließlich war Blut dicker als alles andere.
Mit versteinerten Mienen starrten sie auf die beiden, vom Bestatter nur notdürftig zugenähten Einschusslöchern in der Brust ihres Erzeugers. Es waren große Löcher, die von großen Kalibern stammten.
»Bevor dich die Würmer in der Erde fressen, werden wir die Leiche dieses verfluchten Menschenjägers neben dir in die Grube legen, Dad!«
Ralph, der Älteste sprach für alle. Seine Stimme war rau wie ein Reibeisen.
»Aber zuvor werden wir uns an all denen rächen, die Jack Stapp Dunlay wichtig sind! Das schwören wir dir bei unserem Blut!«
*
Wie Baumwollflocken trieben ein paar einsame Wolken am gleißenden Himmel dahin, zeichneten vereinzelt Schatteninseln auf das Antlitz des unermesslich weiten Landes. Die einzige Bewegung schien das träge Dahingleiten eines einsamen Bussards zu sein, der zwischen den zerklüfteten Felsen des Bergkammes, den Wacholderbüschen und den Stauden von Squaw-Kraut nach Beute Ausschau hielt.
Genau dort, wo der Höhenzug schroff und völlig unvermittelt abbrach, öffnete sich ein Talbecken. Auf dessen Grund lag eine Ranch, die trotz der Trockenheit freundlich und friedlich aussah. Das kleine Ranchhaus mit dem Hof, dem Corral, in dem mehrere Pferde standen und dem offenen Schuppen mit den untergestellten Werkzeugen, war von verwelktem Weideland umgeben.
Unverkennbar trug der kleine Küchengarten hinter dem Haus die Handschrift einer Frau. Allerdings war der Pegel des Wassers, das in einem Stauweiher gesammelt wurde, um den Garten zu bewässern, besorgniserregend niedrig. Das lebensspendende Nass stammte von einem nahen, immer mehr versiegenden Fluss. Wenn nicht bald Regen einsetzte, würde er vollends austrocknen und die Beete in einem jämmerlichen Zustand zurücklassen. Genauso wie die gesamte Natur, die er mit frischem Wasser versorgte, samt Mensch und Tier.
Eine Frau stand in diesem Küchengarten, pflückte mit geschickten Händen das Gemüse, das von der Sonne noch nicht ganz verdorrt war. Sie war außerordentlich hübsch, mit einer blonden Haarmähne, die weit über die Schultern fiel. Ihr gebräuntes Gesicht war edel geschnitten, mit blassblauen, forsch leuchtenden Augen, hohen Wangenknochen, gerader Nase und vollen Lippen, so rot wie mexikanisches Chili. Trotz ihrer schlanken Figur war sie an den richtigen Stellen üppig gebaut. Ihr helles Baumwollhemd und die blauen Hosen, die sie trug, waren von der anstrengenden Arbeit staubig und verschmutzt.
Neben ihr stand ein niedliches Mädchen, das einen geflochtenen Korb in den kleinen Händen hielt, in dem es das noch essbare Grünzeug sammelte. Es war das genaue Abbild der Mutter, freilich nur ein Kind von etwa fünf Jahren, aber dennoch mit demselben bezaubernden Gesichtszügen gesegnet. Allerdings trug das Mädchen das blonde Haar in einem langen geflochtenen Zopf, der weit über das luftige Sommerkleidchen fiel.
Ireen Dunlay war es gewohnt, die meiste Zeit des Jahres mit ihrer Tochter Eliza allein auf der Ranch zu sein. Denn ihr Mann Jack verdiente sein Brot mit der Kopfgeldjagd, die ihn quer durch den Westen der Vereinigten Staaten trieb. Eine gefährliche Arbeit, die einem rechtschaffenen Mann alles abverlangte. Sobald er mit seinem Pferd in der Weite der Great Plains, an deren südlichen Rand sie lebten, verschwunden war, um hinter Mördern, Pferdedieben, Vergewaltigern und Bankräubern herzujagen, brach sie in Tränen aus. Freilich nie vor ihm, um sein Gewissen nicht bei seiner wochenlangen Abwesenheit von Heim und Familie zu belasten.
Ireen weinte jedoch nicht nur aus der immer währenden Furcht, ihn das letzte Mal lebend gesehen zu haben, sondern vor allem aus Sehnsucht nach seiner Stärke, seiner Wärme aber auch seiner Härte gegenüber diesem Land.
Dennoch war die kleine Familie auf das Kopfgeld angewiesen, um überleben und die kleine Ranch bewirtschaften zu können.
Wie alle Frauen im Westen war Ireen so aufgezogen worden, dass es ihre Aufgabe war, ein Heim zu erhalten und ein Kind gut zu erziehen, um diesem einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Und natürlich ihrem Ehemann in allen Höhen und Tiefen eine gute Partnerin zu sein. Für eine Frau war es in dieser Zeit existenziell wichtig, ein Heim zu haben, weil sie irgendwohin gehören musste, selbst wenn ein Mann ziellos umherstreifen und auch unter freiem Himmel nächtigen konnte.
Trotzdem sehnte sich Ireen danach, dass Jack für immer auf der Ranch blieb. Denn es gab Dinge, die nur ein Vater einem Kind beibringen konnte. Gerade ein Vater mit so viel Lebenserfahrung. Außerdem brauchte die Ranch seine Stärke und Kraft für Reparaturen, die Ireen körperlich nicht leisten konnte. Langsam ging auch der ehemals große Vorrat an Feuerholz zur Neige. Holz, das sie zum Kochen benötigte. Es wurde wirklich Zeit, dass J.S. zurückkam.
Bei diesen trüben Gedanken traten unwillkürlich Tränen der Sehnsucht in Ireens Augen, die sie schnell mit dem Handrücken wegwischte. Doch ihre Tochter hatte sie schon gesehen. »Warum bist du traurig, Mami?« Elizas Stimme war so hell und klar wie Glockenklang aus dem Himmel.
Ireen kamen erneut die Tränen, dieses Mal versteckte sie sie nicht. Sie legte das kleine Messer auf den Boden, mit dem sie gerade ein paar Feldtomaten abgeschnitten hatte, die noch nicht ganz vertrocknet waren. Dann nahm sie ihre schutzbedürftige Tochter in die Arme und drückte sie sanft an sich. Als sie den Herzschlag der Kleinen an ihrer eigenen Brust spürte, schluchzte sie laut auf.
»Es ist nichts, Honey. Ich vermisse nur Daddy so sehr.«
»Ich auch. Jeden Tag aufs Neue …«
Weiter kam Eliza nicht, denn aus der Ferne klang trommelnder Hufschlag auf, der ihr die Worte von den Lippen riss.
Ireen ließ das Mädchen los und schirmte die Augen mit der Hand vor der gleißenden Sonne ab. Von Norden her näherte sich ein Reiter, dessen Pferd eine lange Staubfahne hinter sich herzog.
Ohne zu überlegen drehte sich die Frau um und zog Eliza hastig an der Hand mit ins Haus.
»Du bleibst hier drin, egal was geschieht«, ermahnte sie ihre Tochter mit erhobenem Finger.
»Aber Mami …«