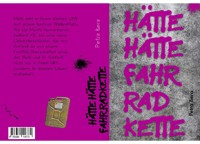
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Melli lebt in ihrem kleinen LKW auf einem Berliner Wagenplatz. Als sie sich in Moritz verliebt, beginnt für sie eine neue Liebe. Gleichzeitig wird sie in einen Konflikt mit hineingerissen, der sich auf ihr ganzes Umfeld ausweitet und ihr gesamtes Leben aushebelt. "Ich glaube, für die sind wir Dreck", sagt sie über die Typen, die ihr das Leben vermiesen, über die sie aber anfänglich nicht viel weiß. In einem Kreuzberger Hofdurchgang geschieht etwas, dass ihre Vermutung untermauert. Neben ihren Erlebnissen nimmt Melli uns auch mit in ihre Musik- und Bücherwelt und teilt mit uns die politischen und sozialen Themen, die sie umtreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Petra Bera
Hätte hätte Fahrradkette
Roman
Inhalt
Cover
Titelblatt
Prolog
1. Verknallt
2. Sehnsüchtig
3. Besorgt
4. Enttäuscht
5. Brutal
6. Erleichtert
7. Eifersüchtig
8. Verwirrt
9. Nachdenklich
10. Spontan
11. Betreten
12. Flüchtend
13. Nicht erleichtert
14. Gewalttätig
15. Gefrustet
16. Gefrustet
17. Genervt
18. Egoistisch
19. Jung und verrückt
20. Gedankenvoll
21. Relaxt
22. Wieder besorgt
23. Überfallen
24. Runterkommend
25. Beschwert
26. Gezielt
27. Unsicher
28. Total empört
29. Am Rotieren
30. Im Stress
31. Eingesperrt
32. Verzweifelt
33. Neugierig
34. Einsam
35. Freudig
36. Eifersüchtig
37. Kampfbereit
38. Urlaubsreif
39. Gestresst
40. Verpeilt
41. Erfolgreich
42. Verspätet
43. Betreten
44. Zu ehrlich
45. Zerrissen
46. Bescheuert
47. Wie erstarrt
48. Fokussiert
49. Im Geiste bei den Frauen
50. Abgenervt
51. Unruhig
52. An den Job gekommen
53. Gut aufgehoben
54. Entspannt
55. Frierend
56. Voll
57. Verärgert
58. Entnebelt
59. Wie immer schwer am Nachdenken
60. Perspektiven suchend
61. Entspannt
62. Pläne ändernd
63. Gemocht
64. Im Countdown-Modus
65. Besorgt
66. Ungeduldig
67. Wieder aufbrechend
68. Nervös
69. Planend
70. In ruhige Fahrwasser lenkend
71. In Urlaubslaune
72. Pläne schmiedend
73. Sortierend
74. Wellenförmig
Epilog
Danksagung
Urheberrechte
Hätte hätte Fahrradkette
Cover
Titelblatt
Prolog
Danksagung
Urheberrechte
Hätte hätte Fahrradkette
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
Back Cover
Prolog
Ich bin allein. Marleen ist weg. Wie soll ich das aushalten? Aber das Schreiben ist mein Lebenselixier. Und schließlich die Phantasie und die Realität, mit der ich und jede und jeder und wir alle zurechtkommen müssen. Das Leben ist voller Abwägungen. Jede Entscheidung bedingt eine neue. Manche sind fatal und wenn dir etwas Schlimmes passiert ist, kommst du nicht umhin, über eine vorherige nachzudenken. Aber es hilft ja nichts. Du hast nur eine Realität und weißt nur, wie diese verlaufen ist und nicht, was passiert wäre, hättest du dich für eine andere Variante entschieden.
Das Leben ist nicht gerecht, viele soziale, hilfsbereite Menschen sind arm, viele skrupellose, egoistische Menschen reich, kaum jemand übernimmt wirklich Verantwortung für den Wahnsinn. Viele wissen, dass das alles verrückt ist, nicht vertretbar. Kaum jemand bringt die Kraft auf, gegen die Verhältnisse etwas zu tun. Nur ein kleiner Prozentsatz lässt es überhaupt an sich heran.
Ich will hier nicht herumjammern, ich hatte eigentlich einen sehr guten Start, aber ich habe es versemmelt.
Ich blicke auf eine Zeit zurück, die so rasant und lebendig war.
Mir ist das gar nicht bewusst gewesen und ich wusste gar nicht zu schätzen, wie gut es mir zeitweise ging, fern von Problemen, wie sie jetzt da sind oder wie andere sie haben. Aber es aufzuschreiben ist das Tollste, was ich mir gerade vorstellen kann. Ich bin ganz bei mir.
1.
Verknallt
Ich hatte ein Buch beendet, das spannend und lustig war, aber unbefriedigend endete. Die ganze Zeit war klar, irgendwann würden sie miteinander schlafen. Und dann hört das Buch auf. Es ist sicher, es wird passieren, aber das steht nicht in diesem Buch. Das musste die Fantasie alleine erledigen. Ich wollte es lieber lesen!
Es war schon spät, ich wollte dennoch ein neues Buch anfangen. Es kam nur eines mit Liebe in Frage. Leider war kein solches in meinem Regal vertreten. Also machte ich stattdessen noch ein Kreuzworträtsel.
Ich lese sehr gerne. Oft ist mein Leben aber zu rasant, da geht abends nur noch Licht aus und einschlafen.
Am nächsten Morgen stand ich um halb neun auf, heizte ein, kochte Kaffee und las die Zeitung, die mir mein Mitbewohner Alex erst kurz zuvor durch die Katzenklappe reingelegt hatte. Er holte sie morgens aus dem Briefkasten, der vorne am Eingangstor hing, las sie beim Frühstück und ging dann arbeiten. Davon profitierte ich, denn bevor er ging, bekam ich meine Zeitung fast ans Bett.
Meine Katze hieß TheCat und hatte breite graue und schwarze Streifen auf dem Rücken. Das Muster auf ihrer Stirn sah aus wie ein großes M wie Melli oder auch Melanie, mein Name.
Ich bewohnte einen kleinen LKW. Ein untermotorisierter Sechstonner (er fuhr nur ca. 80 km/h) mit einem Koffer, in dem Zwei-Meter-Menschen den Kopf einziehen mussten und sich mein Schlafzimmer, die Küche, Wohn- und Esszimmer und das Klo in einem Raum befanden. Nicht nur ich lebte so: Um mich herum standen weitere LKWs, Bauwagen, Zirkuswagen und andere mobile Wohnstätten. Wir waren eine Wagenburg, in der nicht nur Menschen verschiedenen Alters, auch Kinder, mit Hunden und Katzen zusammenlebten, sondern es gab auch Kultur: Einmal die Woche wurde gekocht. Manchmal kamen über hundert Leute zu unserer Vokü (Volxküche), um warm und günstig zu essen, zu trinken und sich in angenehmem Ambiente zu unterhalten. Viele Leute, die dort hinkamen, wohnten in besetzten oder ehemals besetzten Häusern oder Wohngemeinschaften, viele waren politisch aktiv oder interessiert. Der Versuch, die allgemeine Bevölkerung, Leute, die nicht so in diesen Zusammenhängen unterwegs waren, ins Boot zu holen, gelang oft nicht. Im Winter fand es etwas familiärer in einem großen Zirkuswagen, in dem wir auch Plenum machten und der Gemeinschaftswagen hieß, statt. Es gab auch Feste, Konzerte, Infoveranstaltungen, tendenziell alles eher im Sommer. Dann war es schön und grün, bunt und lustig. Natürlich gab es auch Stress untereinander, wie überall, wo Leute zusammenleben, wo Entscheidungen gemeinschaftlich gefällt werden, das Konsensprinzip gilt oder auch wie überall anders, wo es offenere Hierarchien gibt. Sie existieren ja leider überall, auch dort, wo sie eigentlich vermieden werden.
Es gab viele Wagenburgen in Berlin, anderen Städten und Ländern. Meistens waren sie besetzt worden. Oft wurden sie geräumt. Manchmal gab es Einigungen mit dem Staat oder Privateigentümer*innen in Form von Pachtverträgen. Viele waren aber auch einfach geduldet und mussten befürchten, geräumt zu werden. Auch gab es hin und wieder Demos gegen Räumungen, für Legalisierungen, für mehr Möglichkeiten alternativen Lebens.
Was ein Plenum ist? Ein Meeting, Treffen, eine Versammlung, um das gemeinsame Zusammenleben zu organisieren, Entscheidungen zu treffen: Wollen wir besetzt bleiben oder lassen wir uns auf Verhandlungen ein? Kann er oder sie einziehen? Welche Konflikte gibt es? Wollen wir den Küchenwagen renovieren? Die Themen waren endlos. Ich war eine Verfechterin von regelmäßigen Treffen, damit die Punkte sich nicht so ansammelten, dass es jedes Mal eine ewige Veranstaltung wurde, die alle furchtbar fanden. Damit war ich aber auf dem Platz in einer Minderheit, daher gab es nur hin und wieder Plena, die oft stressig verliefen und daher alle grauenhaft fanden. Aus meiner Sicht eben, weil zu viel in kleinen Gruppen oder einzeln und zu wenig gemeinsam besprochen wurde.
Kennst du das, wenn deine ganze Perspektive sich krass verändert, weil du ein bestimmtes Buch liest oder gelesen hast? Ähnlich geht es manchmal auch mit Filmen: Ich sehe einen Film und will gar nicht mehr in meine eigene Welt zurück, wünsche mir, ich würde in der Zeit weiterleben, in der der Film spielt.
Mein ganzer Tag stand unter dem Omen des ausgelesenen Buches.
Ich erledigte Überweisungen, besorgte ein paar Dinge, ging in die Bibliothek, führte ein Anwaltsgespräch und verbrachte einige Stunden zu Hause, in denen ich aufräumte und putzte.
Es war ein Freitag, da war ein kleiner Club geöffnet, den ich gerne mochte. Er bestand nur aus einem Raum mit Tresen und Sitznischen und einer Tanzfläche, die durch kleine Details und coole Beleuchtung herausstach. In einer Ecke hing ein Drachen, der aus Altmetall zusammengeschweißt worden war. Er wurde lila angeleuchtet. Es gab auch eine Discokugel, sie hatte aber unregelmäßige Spiegelscherben, sodass auch die Lichtpunkte unterschiedlich waren, die durch den Raum liefen. Ab und zu ging ein Stroboskop an, zwischendurch auch etwas Nebel, was ich eher eklig fand. Außerdem hingen unterschiedliche Plakate für Demos, Konzerte und andere Veranstaltungen überall verteilt. Sie klebten auch übereinander, sodass oft noch der Rand vom vorigen herauslugte. Der Laden wurde im Kollektiv betrieben, das hieß, zehn bis fünfzehn Personen organisierten und entschieden alles gemeinsam und die Preise dienten den Selbstkosten, waren also recht günstig.
Ich tanzte und schaute mir Männer an. Ich sah natürlich auch Frauen und es waren wunderschöne dabei, aber mein Hauptaugenmerk lag auf Männern.
Ich dachte aber an einen, der weit weg war.
Es war nicht mein Plan mich zu verlieben, weil ich das nur anstrengend fand und ich froh über meine Unabhängigkeit war.
Trotzdem übte das Buch einen starken Einfluss auf mich aus. Hätten sie doch bloß miteinander geschlafen …
Ich tanzte und tanzte. Hiphop lief.
Ich schaute oft nach unten beim Tanzen, manchmal machte ich auch die Augen zu. Wollte für mich sein.
Ich öffnete die Augen und sah geradewegs in ein Gesicht, das mich anvisierte und sofort einen Helikopterrotor in meinem Bauch starten ließ. Meine Güte, es war nur ein Gesicht, zugegeben recht hübsch: Ein schmales Gesicht und irgendwie verschmitzt. Seine Haare waren kurz, schwarz und struppelig. Seine Statur war schmal, aber nicht dürr, irgendwie lässig. Er schaute mich an, zuerst Stirnrunzeln und dann ein strahlendes Lächeln.
Ich schaute schnell weg und tanzte weiter.
War nicht mehr entspannt.
Fühlte mich angestiert.
Ich ging zu meinem Drink, lehnte mich an die Wand und schaute auf die Tanzfläche.
Er war weg.
Was nun kam, ist ungefähr der Klassiker. Mal tanzen, mal stehen, glotzen.
Er tauchte wieder auf, tanzte, stand herum, glotzte, Blicke begegneten sich.
Irgendwann bin ich gegangen, weil ich dachte, da ist kein Anfang und ich kann nicht die ganze Nacht so weiter zappeln.
Jeder Schritt arbeitete in mir. Ja, Berlin ist ein Dorf, aber dann auch wieder nicht. Einige Leute traf oder sah ich häufig: Auf Demos und Kundgebungen, öffentlichen Plena oder Konzerten. Aber ich kannte auch die gegensätzliche Erfahrung: Ich hoffte, einen bestimmten Typ zu treffen, und bewegte mich sogar in dessen näherem Umfeld und er lief mir Ewigkeiten nicht über den Weg.
Auf halbem Wege bin ich wieder zurückgerannt und er war weg. Da bin ich dann auch wieder abgezischt. Hab mich geärgert. Ich Idiotin!
Vielleicht gut so, dachte ich und ärgerte mich noch mehr.
Als der Club das nächste Mal geöffnet war, hatte ich den ganzen Tag gearbeitet und war total kaputt. Meine Arbeit bestand daraus, mit einem Kleintransporter alles mögliche Zeug von A nach B zu befördern, eine Art Shuttle-Service für Gegenstände.
Wir machten das zu dritt: Karl, Gerdi und ich.
Karl koordinierte mehr, Gerdi und ich fuhren mehr.
Karl wohnte in einer Hausgemeinschaft in Kreuzberg. Das Haus war in den Achtzigern besetzt und auch legalisiert worden. Er war älter als Gerdi und ich, Anfang Dreißig, ich war erst zweiundzwanzig, Gerdi etwas älter, aber das wirkte nicht so.
Karl hatte einen Iro, der oft die Farbe wechselte und das einzige darstellte, was auf Eitelkeit oder Selbstdarstellung hindeutete. Ansonsten war er praktisch veranlagt, auf das Wesentliche fokussiert und gut im Organisieren und Papierkram machen. Auch in seinem Hausprojekt verhielt er sich verantwortungsbewusst und übernahm häufig wichtige Aufgaben.
Gerdi war mehr so die Partynudel und derjenige, mit dem ich auch privat mehr unternahm.
Wir hatten für einen Musikanlagenverleih, von dem wir häufig Aufträge bekamen, ein Schulkonzert versorgt, danach Aktenkartons transportiert und einen Schrank geschleppt. Touren zu zweit mochte ich, sie waren finanziell nicht so ergiebig, aber besonders mit Gerdi hatte ich immer viel Spaß. Obwohl er ein Tattoo mit einer kleine Träne unter dem linken Auge hatte, lachte er viel und sagte witzige Sachen. Zudem fand er mich urkomisch. Und so war ich zwar körperlich hinüber, aber mein Geist schaffte es, den Körper zum Club zu bewegen. Es waren vier Tage vergangen. Ich schleppte mich dahin und blieb zwei Stunden.
Kein Rudi, wie ich ihn inzwischen so für mich nannte, in Anlehnung an das Wort „Ruin“. Verstehst du nicht? Ist so in meinem Kopf entstanden.
Dann vergingen einige Tage, in denen ich versuchte mich damit abzufinden, dass dieser Fremde einfach ein Fremder blieb.
Als ich dann wieder in diesen Club ging, mit Karen und Betty, beides Mitbewohnerinnen und Freundinnen von mir, traf ich ihn gleich am Eingang.
„Hallo!“, sagte er und ich auch.
„Ich dachte du kommst NIE wieder“, meinte er.
„Dachte ich auch“, antwortete ich und wollte damit sagen, dass ich dasselbe von ihm dachte. Ich kam nicht dazu, das Missverständnis aufzuklären.
„Wohnst du weit von hier?“, fragte er.
„Kreuzberg und du?“
„Prenzlberg!“
Es ist immer cool zu wissen, in welchem Bezirk eine Person wohnt, die ich gerne treffen wollte. Ist aber bescheuert: Berliner Bezirke sind größer als viele Kleinstädte.
Aber auch eine komische Art mich anzusprechen, dachte ich bei mir. Wohnst du weit von hier. Aber ich muss zugeben, ich hätte gar nichts herausgebracht und das, obwohl ich seit Tagen an nichts anderes dachte als an diese Begegnung. Was ich dann aber sagen konnte, darüber hatte ich nicht nachgedacht.
„Soll ich dich jetzt auf einen Drink einladen?“, wollte er wissen.
„Na, erst mal können wir ja unser Freigetränk zusammen trinken“, antwortete ich, denn das war im Eintrittsgeld inbegriffen.
So gingen wir zur Bar. Ich nahm ein Diesel, ein Bier-Kola-Gemisch.
Ich fand mich selbst nicht sehr schön, fand aber, dass sich in diesem Schummerlicht mein Äußeres sehen lassen konnte, weil mir meine Statur besser gefiel als meine Gesichtszüge. Mein Vater, mit dem ich mich früher oft zankte, hatte mich in schwierigen Momenten schon als Indianderin, Zigeunerin, Hexe und Hippie betitelt, und obwohl das nicht viel mit Gesichtszügen zu tun hatte und er mich damit beleidigen wollte, passten meine hohen Wangenknochen, gebräunte Haut, lange dunkle Haare und eine etwas markante Nase zu den Bildern, die Menschen mit diesen Begriffen vielleicht verbanden.
Zu meinem Gesprächspartner hätte mein Vater wahrscheinlich Rocker, Penner oder Halbstarker gesagt.
Ich erfuhr seinen Namen: Moritz.
Moritz war charmant und wirkte intelligent.
Er hatte grüne Augen, die von langen dunklen Wimpern umrahmt waren, und ich schmolz innerlich dahin.
Wir unterhielten uns eine ganze Weile über Bücher und ein bisschen über den letzten Castortransport im Wendland. Es sollte mal wieder Atomschrott transportiert und dann gelagert werden und dementsprechend waren Protestaktionen dagegen geplant. Viele Menschen fuhren bei solchen Gelegenheiten mit Bussen, Bahnen oder Privatfahrzeugen aus Berlin, Hamburg, von überall her, dorthin und unterstützten damit die Atomkraftgegner*innen vor Ort. Moritz hatte an den letzten Aktivitäten teilgenommen.
Der elfte September war Thema. Die Bilder des Flugzeuges, das ins World Trade Center gerast war, erfüllten noch die Leinwände, da es noch nicht lange her war. Ich hatte keinen Fernseher, aber das Thema beherrschte alle Medien. Wir sprachen auch davon, waren besorgt, dass dies nun viele schlimme Entscheidungen legitimieren könnte und Rassismus und Ressentiments neue Türen öffnete.
Dann blödelten wir herum. Moritz lachte ein bisschen wie Kermit, das fand ich witzig.
„Ich will schon seit Ewigkeiten mal in ein Irish Pub“, sagte Moritz irgendwann. “Hast du Bock?“, fragte er mich.
Er sagte, ihm fiele jetzt auch kein konkretes ein. Ich sah die Dinger dauernd irgendwo, merkte mir aber nie die Straßen. Das hatte ich oft, dass ich bestimmte Läden suchte. Ich kannte ihr Aussehen von außen, hatte aber nicht genau im Kopf, ob sie nun in der und der Straße oder in der Parallelstraße, auf diesem Teilstück oder auf jenem waren. Das nervte mich manchmal enorm.
„Klar, warum nicht, frische Luft ist gut“, sagte ich geistreich, wir waren ja nun bestimmt schon mehr als eine Dreiviertelstunde in dem Laden.
Ich meldete mich bei Betty und Karen ab. Betty tanzte, das war immer sehr schön anzuschauen. Sie hatte irgendwie einen coolen Stil und ihre dunkelblonde Lockenmähne wehte durch die Gegend. Karen stand an der Tanzfläche an die Wand gelehnt und süffelte an einem Drink. Sie hatte wasserstoffblonde kurze Haare und war immer eher praktisch gekleidet, während Betty sich auch gerne etwas schicker machte bzw. im Rock oder Kleid herumlief oder eine Bluse trug. Blusen waren nicht so meins, aber auf Röcke hatte ich auch manchmal Lust. Während Betty eher groß war, war Karen etwas kleiner als ich, und wenn wir nebeneinander liefen und ich in der Mitte, müssen wir wie die Orgelpfeifen ausgesehen haben.
Ich hatte an dem Abend eine enge schwarze Jeans, schwarze Boots und ein hellblaues T-Shirt ohne Ärmel an, das ich mochte, weil es die kleinen Hügel auf meinen Oberarmen betonte, die ich an mir ganz gut leiden konnte und auch bei anderen Frauen extrem attraktiv fand.
Zum Abschied biss mir Betty ins Ohr und grinste breit. „Schönen Abend noch“, rief sie gegen die Musik an. Während Karen auf Frauen stand, hatte Betty sich schon in beiden Richtungen umgeschaut und es kam vor, dass sie ein Ziel ihrer Begierde von nächtlichen Streifzügen mit nach Hause nahm. Eigentlich hoffte sie aber auf den großen Knall.
Ich wühlte meine Jacke und meinen Pulli aus einem Klamottenstapel hervor, eine Garderobe gab es hier nicht, alle stapelten ihre Jacken auf Heizkörpern oder auf den Bänken in den Sitznischen, und ging in Richtung Ausgang.
Auch Moritz war zu seinen Leuten gegangen. Sie saßen in einer Sitzecke zusammen, musterten mich neugierig, als ich mich ihnen näherte, und sagten freundlich hallo. Was er zu ihnen sagte, konnte ich nicht hören, einer nickte und sie lächelten einander an.
Er schnappte sich eine ausgefranste Lederjacke und wir verließen den Laden. Wir latschten ewig durch Friedrichshain. Keines der Irish Pubs war da, wo ich es erwartet hatte, aber es war egal, Hauptsache, wir waren zusammen. Irgendwann beschlossen wir in einen Späti zu gehen, ein kleiner Laden, in dem es neben Tabakwaren und Getränken auch Tampons, Dosensuppen und viele andere Dinge zu fast jeder Tageszeit zu kaufen gab. Dort erwarben wir aber auch kein irisches, sondern ein spanisches Bier. Ich bin eigentlich gar nicht so die Biertrinkerin, ist mir irgendwie zu bitter, in dem Moment hätte mir aber wahrscheinlich alles geschmeckt, meine Sinne waren auf Genießen eingestellt.
Mit dem Bier saßen wir dann auf einer Bank herum. Es war schon eine kühle Jahreszeit und trotz meiner Glückshormone fing ich irgendwann an zu klappern und verkündete:
„Entweder du rubbelst ein bisschen meinen Rücken, oder ich muss mich jetzt definitiv bewegen, um nicht festzufrieren.“
Etwa vier Sekunden lang schaute er mich einfach an. Er sah nicht wirklich verblüfft aus, vielleicht war er es aber.
Dann rutschte er ganz dicht an mich heran und nahm mich in den Arm. Das fühlte sich gut an! Und er roch gut!
„Geht das auch?“, fragte er mich.
„Auf jeden Fall“, war meine Antwort.
„Fährst du auch manchmal weg mit deinem LKW?“, erkundigte er sich.
„Wenn ich Zeit habe schon!“
„Nimmst du mich mal mit?“
Ich lachte.
„Einen wildfremden Kerl?“
Er lachte.
„Wo willst du denn hin?“, wollte ich wissen.
„Egal!“
Ich lachte wieder.
„Zur Zeit komme ich hier nicht so gut weg“, ergänzte ich das Geplänkel mit etwas ernst Gemeintem.
Ich erzählte ihm von meinem Anwaltstermin. Ein Jahr zuvor war ein Prozess gegen mich eingestellt worden. Ich hatte „Deutschland muss sterben, damit wir leben können“, ein Punklied von Slime, auf einer Demo gespielt, aus dem Lautsprecherwagen, das galt als Volksverhetzung und sie stürmten das Fahrzeug und beschlagnahmten meine Kassetten (ja, Kassetten!). Es war aber nicht das erste Mal, dass das passierte, eine andere Frau saß sogar in U-Haft deswegen. Darum ging es. Ich wollte sie wiederhaben, ließ es dann aber schleifen.
Und dann latschte ein Typ vorbei, blieb stehen und sagte: „Ey, Moritz!“
Er hatte einen Parka an, längere Haare und seine Haut war irgendwie ungesund.
Er sagte noch mehr, ich erinnere mich an den Satz: „Kai ist doch gar nicht mehr da!“, der in Moritz` Gehirnwindungen einen krassen Donner ausgelöst zu haben schien, denn von dem Moment an hatte er schlagartig andere Laune.
Er verabschiedete sich nach kurzer Zeit von dem Typen, stand auf und fragte mich: „Kommst du mit?“
Das tat ich, und wir latschten in die Richtung, aus der der Typ gekommen war.
Moritz schaute ernst und verschlossen drein und meinte nach ein paar Metern:
„Jetzt habe ich mich gerade amüsiert wie lange nicht mehr, und nun kommt so eine Botschaft!“
Ich dachte, er fängt jetzt an, mir irgendetwas zu erklären, aber er sagte erst mal nichts mehr. Natürlich fragte ich mich auch, was er damit meinte. Ob er normalerweise eher ein Deprityp war. Das konnte ich mir aber nicht vorstellen. Ich wollte mich gerade trauen, irgendwas zu sagen, denn es war klar, dass wir uns jetzt mal verabschieden mussten, wenn wir nicht ein gemeinsames Ziel vereinbarten, dann sagte er ganz unverblümt:
„Tut mir leid, dass jetzt so ein bisschen die Stimmung gekippt ist, ich will das eigentlich gar nicht. Würdest du mit zu mir kommen oder mich zu dir mitnehmen?“
Ich grinste verlegen und nickte nur.
„Na, und was von beiden?“, hakte er nach. Das fiel mir schon schwer zu entscheiden. Ich war neugierig auf sein Zuhause, fand aber auch die Vorstellung toll, ihn bei mir zu haben.
„Ist es schön bei dir?“ fragte ich schließlich.
„Hmhm, wir wohnen zu fünft und sind immer ganz lieb zueinander!“, witzelte er.
So fuhren wir gemeinsam auf meinem Fahrrad, er war auf dem Hinweg in einem Auto mitgefahren, zu ihm.
Er machte sich auf meinem Gepäckträger darüber lustig, dass ich ihn chauffierte. Wir wechselten auch die Rollen, aber hinten drauf tat mir so der Po weh, dass ich mich lieber abstrampelte, als das auszuhalten. Es dauerte lange, wir schoben zwischendurch mal und hielten auch noch einmal bei einem Spätkauf an. Trotz dieser romantischen Situation war er ernster, als er es gewesen war, bevor wir diesen Typen getroffen hatten.
Die Wohnung wirkte bunt und einladend. In der geräumigen Küche stand ein großer runder Tisch, auf dem ein Aschenbecher stand und einiger Krimskram herumlag.
Das Haus war ein 4-stöckiger Altbau, saniert, aber nicht auf chic gemacht.
Die WG befand sich im ersten Stock.
Aus einem Zimmer drang noch Musik. Chemical Brothers vielleicht oder Prodigy, also elektronische Musik.
Moritz kochte Tee und zeigte mir sein Zimmer und das Klo.
Ich bin keine Spießerin, aber hatte schon darüber nachgedacht, ob er ein gemütliches, halbwegs aufgeräumtes Zimmer hatte. Mit so Bruchbuden, Matratze auf dem Boden und alles liegt drum herum, komm ich nicht gut zu Rande.
Aber er hatte ein süßes kleines Zimmer mit Hochbett, Schreibtisch, Sitzecke, Fernseher, Schrank und Spiegel.
Ich hoffte auch, er war nicht so ein TV-Dauerglotzer, das fand ich langweilig.
Den Tee tranken wir in der Küche. Es war keine unangenehme oder angespannte Stimmung, aber Moritz war deutlich nicht mehr so ausgelassen und ich dann auch nicht.
Als eine kleine Redepause entstand, sagte ich: „Jetzt kommt schon wieder ein Entweder-oder.“
„Na, ich hoffe, dass du bei mir bleibst heute Nacht!“, erwiderte er.
„Obwohl ich gleich einräumen muss, dass ich keine Kondome im Haus habe, aber ich persönlich finde das nicht so schlimm“, setzte er hinzu.
Ich grinste verschwiegen und schaute Richtung Fußboden. Moritz bückte sich vor, um meinen Blick einzufangen. Dann sagte ich: „Ich auch nicht.“ Ich hatte auch keine mit.
Es sollte sich recht schnell bewahrheiten, dass das irgendwie doch ein bisschen schlimm war.
Moritz ließ nur die Unterhose an und ich noch ein Hemdchen. Wir hatten uns noch nicht einmal ein Küsschen gegeben, als wir nacheinander auf das Hochbett kraxelten und uns unter die Bettdecke kuschelten. Dann lagen wir da also, streichelten uns, lächelten uns an, fingen an uns zu küssen und so weiter, atmeten schneller und zogen uns gegenseitig aus. Dann war es soweit. Wir wollten, dass er in mich eindrang, durften aber nicht.
Irgendwann raffte sich Moritz auf, zog sich eine schlabberige Hose über, in der der Hügel vorne natürlich auch nicht verschwand, und ging hinaus.
Kurz darauf kam er grinsend mit einem kleinen Pappkarton wieder.
Alles war toll mit Moritz, wild, zärtlich, super erotisch und für beide mit Höhepunkten. Moritz hatte auch noch eine Zauberhand, die irgendwo zwischen unsere Leiber passte. Nach Stunden tat mir schon die Möse weh.
Ein total schönes Aha-Erlebnis war der Sex mit diesem quasi Unbekannten.
Moritz schlief vor mir ein, so konnte ich ihn noch verwundert mustern.
„Wo kommst du her, du Wahnsinn im schönen Männerkörper?“, fragte ich ihn leise.
Ich erwachte, als er aufstand und sich etwas überzog. Ich spürte kurz seinen Blick, dann ging er hinaus.
Nun wieder mit ihm am Küchentisch zu sitzen, hatte ich eigentlich keine Lust, und so hoffte ich, dass er noch einmal zurück ins Bett kam. Ich hörte die klassischen Küchenklimpergeräusche und fing an, darüber nachzudenken, in welcher Position ich daliegen wollte, wenn er zurückkam. Das fand ich dann total bescheuert von mir. Als ich mich gerade aufsetzte, kam Moritz mit zwei Bechern Milchkaffee herein.
„Ich hoffe, du trinkst den Kaffee weiß!“, meinte er und schaute mich fragend an. Ich nickte und lächelte ihn verliebt an.
„Zucker?“, fragte er weiter. Ich schüttelte den Kopf.
Hinter Moritz her kam ein Hund gewackelt.
„Das ist Hanna, ist ganz lieb“, stellte er mir vor.
„Hallo Hanna!“, meinte ich und Hanna wedelte einmal fast unmerklich mit dem Schwanz hin und wieder her.
Sie war beige, nicht gerade klein, fellig und schien eher eine Ruhige zu sein.
Moritz machte Musik an, Chambawamba, jonglierte geübt die Kaffeebecher auf das Bett, zog sich wieder aus, sprang auf die Matratze, gab mir einen dicken Kuss ohne Zunge und sagte: „Guten Morgen!“
Es war etwa halb zwei.
Wir redeten, kuschelten, vögelten, was zwei eben so tun, die sich frisch gefunden haben, und es wurde wieder dunkel draußen.
Ich war ganz froh, dass Moritz keine Kippen rauchte. Er fragte mich irgendwann:
„Magst du eine Tüte mit mir rauchen?“
Das taten wir dann, leckeres Gras, und danach kuschelten wir und lachten über jeden Scheiß.
Es war wirklich alles der Hammer.
So gegen zehn rafften wir uns auf, zogen uns an und gingen in die Küche.
Dort saßen zwei Frauen am Tisch, grüßten freundlich, musterten mich kurz aufmerksam und quatschten dann weiter.
Eine davon hatte lange, dunkelrote Dreadlocks zu einem Riesendutt verdreht. Die andere hatte dunkelblonde Haare, eine Art Pagenkopf und süße Sommersprossen, kleine dunkle Punkte im ganzen Gesicht verteilt. Ihr Gespräch ging um Leute, die ich nicht kannte. Aber auch um studieren und politisch aktiv sein und um Geld verdienen und von den Eltern unterstützt werden.
Moritz quatschte mit und irgendwann ging das Gespräch in eine Richtung, wo ich dann auch mitredete.
Nebenbei kochte Moritz Spaghetti, briet Zwiebeln und anderes Gemüse an und schob mir irgendwas zum Schnibbeln hin.
Ich hatte den Eindruck, dass die da ohne Filme zusammenwohnten, und fühlte mich dort auf Anhieb wohl. Es war zwar nur ein Witz gewesen, was Moritz nachts über seine WG gesagt hatte, aber es stimmte.
Nach dem Essen gingen wir mit Hanna raus. Ihr „Herrchen“ war verreist und so kümmerten sich alle gemeinsam um sie.
Ich war nach dem Essen nicht mehr ganz so bekifft, nahm aber alles um mich herum in einer Art Schleier war, die Optik war nett.
Ich blieb noch eine Nacht bei Moritz mit der Ansage, dass ich am nächsten Tag nach dem Kaffee gehen würde.
„Meine Katze verhungert sonst“, erläuterte ich.
„Die soll sich eine Maus fangen“, erwiderte Moritz. Das stimmte auch insofern, dass die Katzenklappe offen war und die Katze so die Wahl hatte, doch war sie natürlich regelmäßige Fütterung gewohnt und war nun sicher schon beleidigt.
Wir schleppten uns seine Glotze aufs Hochbett, schauten einen Film bis eine Sexszene kam, dann schauten wir nicht mehr hin. Die Kondome von Moritz' Mitbewohner gingen schon zur Neige und wir hatten wieder nicht daran gedacht.
„Wir Idioten!“, erläuterte Moritz. So wund, wie ich mich schon anfühlte, war das dann irgendwann auch ganz beruhigend.
Am nächsten Morgen war ich diejenige, die in die Küche Kaffee kochen ging. Bei mir dauerte es allerdings um einiges länger.
Zum Glück kam zwischendurch ein Typ rein.
Er sagte: „Hi, (Pause) Gerry“,und ich dann: „Hi, Melli.“
Ich dachte etwas verlegen, dass von ihm vielleicht die Kondome kamen. Er half mir, die Kaffeedose zu finden, was super war, da es ein Riesensammelsurium an Teesorten, Gewürzen und anderen Dingen in Dosen gab.
Moritz wollte sich noch einen weiteren Kaffee mit mir erbetteln, aber mir fiel der Abschied so schwer, dass ich ihn hinter mich bringen wollte.
Vielleicht wäre Moritz sogar mitgekommen, wenn ich ihn gefragt hätte. Aber er fragte nicht und ich auch nicht. Das lag vielleicht daran, dass ich mal Luft holen musste und davon ausging, dass wir uns zeitnah wiedersehen würden.
Also ging ich, ausgestattet mit einer Telefonnummer und jeder Menge Liebe.
2.
Sehnsüchtig
In den Tagen danach sahen wir uns gar nicht. Ich war beschäftigt mit meinen täglichen Notwendigkeiten, hatte einige teilweise nette Begegnungen mit anderen Leuten, dachte ständig an Moritz und machte aber keinen Schritt, außer zweimal zu versuchen, bei ihm anzurufen, ohne irgendwen an den Apparat zu bekommen. Ich hatte ein Handy und Moritz nur einen Festnetzanschluss in seiner WG.
Am Sonntag drauf war ich auf der traditionellen Silvio-Meier-Demo. Der Namensgeber dieser Demonstration war im November 1992 von Nazis ermordet worden. Heute ist im Norden des Berliner Bezirks Friedrichshain eine Straße nach ihm benannt. Sie liegt an dem U-Bahnhof, in dem es geschah.
Es waren bestimmt 2000 Leute auf der Demo. Als ich von der Seite auf die Demo zukam, konnte ich weder den Anfang, noch das Ende sehen.
Auch dort wurde wegen eines Slime-Songs der Lautsprecherwagen gestürmt und die CDs beschlagnahmt. Langsam wurde es langweilig. Es gab Rumgeschubse. Aus dem Augenwinkel sah ich einen der Typen, die mit Moritz in den Club gekommen waren. Er hatte ein Kappy auf, aber seine markanten Gesichtszüge machten ihn auch von Weitem erkennbar. Auch ein Hübscher, dachte ich bei mir, aber vor allem suchte ich die Gegend um ihn herum ab, ob Moritz mit ihm zusammen dort war, doch der Typ hatte ein Fahrrad dabei und stand etwas abseits vom größten Trubel. Mich stresste der ganze Mist, und zugegebenermaßen hatte ich ein bisschen gehofft, Moritz dort zu treffen. Ich wusste ja, dass auch er politisch interessiert und auch aktiv war. Ich beteiligte mich nicht am Versuch, den Lauti, wie der Lautsprecherwagen bei uns hieß, zu verteidigen. Das schien mir anhand der hohen Polizeipräsenz auch sinnlos. Sie waren schnell wieder draußen mit den CDs, beschützten noch die Kolleg*innen, die die Personalien der Insass*innen aufnahmen, und dann war der Stress vorbei. Nur die Musik war futsch und die Stimmung angespannt. Ich ging, bevor die Demo für beendet erklärt wurde. Da ich zu Fuß unterwegs war und keine Lust hatte, die Öffentlichen zu nehmen, lief ich von Friedrichshain nach Kreuzberg und rief währenddessen bei Moritz an. Es war der dritte Versuch.
Schon nach dem zweiten Klingeln war Gerry dran.
„Ah Melli, nein, der ist nicht da, aber hier hängt ein Zettel, da steht drauf: Wenn Melli anruft 1000 Küsse. Und diesmal bitte die korrekte Nummer!“
Es kribbelte wie wild in meiner Magengrube und ich fragte: „Ist er länger weg?“
Er hatte also eine falsche Nummer notiert .
„Weiß nicht genau, der ist zu einem Freund gefahren, nach Hamburg, kommt bestimmt bald wieder!“, beschwichtigte er mich. Wahrscheinlich konnte er sich denken, wie es mir erging. Dass da was Heftiges zwischen uns los war, hatten sicher alle in seiner WG mitgeschnitten. Ich gab Gerry die korrekte Nummer durch.
In der darauffolgenden Woche arbeitete ich viel.
Auto fahren war in meiner Situation die Hölle. Anstatt Ablenkung zu haben, war ich vom Verkehr abgelenkt. Und grübelte und grübelte und litt, verzehrte mich sozusagen nach Moritz.
Zu Hause träumte ich davon, dass er plötzlich vor der Tür stand, und schalt mich dafür. Er kannte ja meinen Wagen nicht, da ihm aber mein Wagenplatz ein Begriff war, hätte er sich sicher durchfragen können. Der Platz war einfach begehbar zu der Zeit. Später, als ich schon nicht mehr dort wohnte, entschieden die Bewohner*innen, ein abschließbares Tor einzubauen, da sich Situationen häuften, in denen Neugierige auf dem Platz herumliefen, ein bisschen wie im Zoo, jedenfalls empfand ich das so. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass das immerhin oft die aufgeschlossenen Tourist*innen waren, die sich alternative Lebensformen immerhin ansehen wollten. Trotzdem war es auch irgendwie so, als wenn ich zu Leuten in die Wohnung latschen und durch ihr Wohnzimmer schleichen würde. Unser Wohnraum war ja nun mal draußen.
Und schließlich waren wir ja auch sehr angreifbar und es gab Leute, die etwas gegen uns hatten.
Mein Handy war der Horror, wenn es klingelte, war es nicht Moritz, und wenn es nicht klingelte, war es immer so nah bei mir, dass ich schnell rangehen konnte, als würde er nur zweimal klingeln lassen und ich musste schnell genug sein. Klingelte es, erschrak ich regelmäßig.
Und dann rief er endlich an.
Er machte einen ganz normalen Eindruck. Er war mir ja keine Rechenschaft schuldig und trotzdem irritierte es mich, dass ich nach so qualvollen Tagen plötzlich so ein normales Telefongespräch mit ihm führte.
Er sagte, dass er dauernd an mich dachte, dass er in Hamburg sei und am nächsten oder darauffolgenden Tag wieder da sein wollte, ob er mich dann besuchen könnte.
„Ruf mich einfach an, wenn du kommen willst!“, sagte ich, ärgerte mich dann aber gleich wieder darüber, weil ich mich damit in eine passive Situation gebracht hatte, in der ich wieder nur abwarten konnte.
Immer dieses quadratische Denken!
Am Tag danach frühstückte ich mit Betty, sie wohnte gleich neben mir in einem Bauwagen. Wir quatschten ewig, dann musste sie los. Ich beschloss einen Haustag einzulegen. Ich hackte Holz und stapelte es neben und hinter meinem Ofen und befüllte meinen Wassertank. Er umfasste 80 Liter und konnte wie ein Benzin- oder Dieseltank von außen befüllt werden, mit Hilfe eines Schlauchs, den ich in meinem Kellerkasten aufbewahrte und den ich dann an einen Außenhahn anschloss. Ich reinigte die Katzenbehältnisse und ging einkaufen.
Danach ging ich in ein Internet-Cafe und checkte meine EMails.
Es war nun abends und ich legte mich mit einem Buch ins Bett: Sharon und meine Schwiegermutter von Suad Amiry. Gerdi hatte es mir geschenkt, weil er wusste, dass ich Bücher zum Frühstück aß. Es war das Tagebuch einer Frau, die im palästinensischen Kriegsgebiet lebte.
Am Tag darauf arbeitete ich wieder, war aber schon zu Hause, als gegen vier Uhr das Telefon klingelte und Moritz anrief, dass er zu Hause sei und um sieben vorbeikommen könnte.
Ich war so aufgeregt!
Was sollte ich anziehen? Musste ich noch irgendwas einkaufen?
Ich räumte auf und putzte bis zehn vor sieben. Dann kochte ich Tee. Angezogen hatte ich einen gemütlichen schwarzen Schlauchminirock mit grauen Leggins, meine Kuschelhausschuhsocken und ein langärmeliges rosa T-Shirt mit weitem Ausschnitt. Der Spiegel warf mir zwar zweifelnde Blicke zu, aber zum Glück hatte ich keine Zeit darüber nachzudenken.
Meine Haare waren lang und dunkel. Einige Strähnen waren verfilzt, denn sie wurden von bunten Perlen zusammengehalten. Die musste ich immer über dem Kopf zusammenbinden, wenn ich mich bürstete, was ich immer erst tat, wenn der Rest sich auch komplett zu liieren drohte.
Moritz hatte leichte Augenringe, sah aber immer noch so cool aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
Er erzählte mir von seinem Problemfreund und von Hamburg. Er hatte bei einem Kumpel übernachtet und nach Kai gesucht, um ihm den „Kopf zu waschen“ und das Geld wieder einzutreiben, das er ihm geliehen hatte. Er hatte ihn nicht gefunden und irgendwann vermutet, dass er gar nicht in Hamburg war.
„Na ja, Hamburg ist nicht gerade klein!“, warf ich ein. Aber er erwiderte, dass er schon ein paar Stellen kannte, wo er annahm, ihn zu treffen oder Leute zu finden, die ihn gesehen hätten.
Er sagte: „Ich finde es ungerecht, dass auf so etwas saugutes gleich so eine Scheiße folgen muss, was meine ganze Glückseligkeit so kaputtmacht. Jetzt bin ich endlich bei dir und müsste total happy sein, bin aber gleichzeitig frustriert und hab das Bedürfnis, mich elendig zu besaufen oder zu bekiffen!“
„Na, dann betrinken wir uns eben zusammen!“, beschwichtigte ich ihn. Wir gingen Rum und Club Cola kaufen und mischten uns zwei Cuba Libre (oder sagen wir lieber Rum-Cola, das passt mir besser in den Kram als das Getränk der Exil-Kubaner*innen), dann noch zwei. Ich wunderte mich, wie wenig er vertrug.
Nach dem dritten Drink hatte Moritz glasige Augen und lallte.
Er merkte das und forderte mich auf ihn zu unterhalten.
Unter dieser Voraussetzung kann ich nicht reden!“, verkündete ich und machte Musik an, Cypress Hill. Das Geräusch einer Wasserpfeife erfüllte den Raum, dann ein paar elektronische Beats und die quäkig klingende Stimme des Sängers, der das Kiffen hochpreiste.
„Ich möchte dich ausziehen!“, teilte ich ihm mutig mit. Er schenkte mir wieder sein bezauberndes Lächeln. Ich zog erst ihn aus, dann mich. Wir kuschelten uns unter die Decke und schliefen ein.
Irgendwann gen Hell-werden wachte ich von tatschenden Händen auf.
Der Klassiker, dachte ich bei mir: Ist der Kerl nachts zu breit, will er morgens umso mehr!
Aber es war wieder sehr schön und zärtlich, selbst seine Alkfahne roch nicht unangenehm.
Hinterher redeten wir über das Thema Orgasmus und er fragte mich, was mir besonders gefiel. Ich antwortete, dass es mich am meisten anmachte, wenn er gleichzeitig in mir drin war und mich mit dem Finger befriedigte.
„Das ist manchmal gar nicht so leicht!“, sagte er lächelnd.
Wir redeten auch über echtes und unechtes Gestöhne. Ich war manchmal ganz schön laut.
„Ich fahr da ganz schön drauf ab!“, sagte Moritz und lachte schnaufend. Dann fragte er mich, was es denn mit dem unechten Stöhnen von Frauen auf sich habe.
„Warum tun die das denn?“, wollte er wissen.
„Hm, vielleicht, weil sie wissen, dass das die andere Person erregt, damit die es dann schön findet oder … schneller fertig wird“, setzte ich lachend hinzu.
„Hoffentlich trifft das nicht auf dich zu, ich bilde mir eigentlich ein, dass deine Erregung echt ist.“
Das konnte ich bestätigen. Wäre ich nicht so bei der Sache, hätte ich wahrscheinlich Schiss, dass mir jemand zuhörte, was in meinem LKW durch die dünnen Wände nicht gerade unwahrscheinlich war.
Wir frühstückten im Bett. Danach liehen wir uns bei Alex, dem Mitbewohner, der mir immer die Zeitung aus dem Briefkasten holte, eine Badehose und gingen in ein Schwimmbad.
Von Kater keine Spur.
Im Schwimmbad lachten wir viel.
Danach musste er los. Er hatte einen Job in einer Kneipe. Hauptsächlich machte er dort Tresenschichten, ab und zu Einkäufe.
Als ich ihn das nächste Mal traf, war seine Lippe aufgeplatzt.
Wir waren in dem Club verabredet, in dem alles begonnen hatte.
Meine Frage, woher die Verletzung kam, beantwortete er nur mit dem Satz: „Für Schulden, die gar nicht meine sind.“
Seine Lust, mit mir darüber zu reden, war anscheinend nicht sehr groß. Er fragte mich, wie es mir ginge, lenkte die Aufmerksamkeit auf mich, und ich ließ mich erst mal darauf ein.
Wir quatschten, tanzten, trafen beide Bekannte und unterhielten uns zusammen oder getrennt. Irgendwann kamen wir darauf zu sprechen, dass ich eine Schablone zu Hause hatte, die ich gemacht hatte, um damit sprühen zu gehen, sie aber noch nie benutzt hatte.
„Was steht drauf?“, wollte Moritz wissen. Ich grinste und antwortete: „Bush is a terrorist!“
„Hast du auch eine Sprühdose?“
„Jaaa …!“
„Na, dann los!“, rief er.
Das mit Bush war mein voller Ernst: Für mich gab es schon damals zwei Arten von Verbrecher*innen: welche mit Lizenz und welche ohne. Mächtige Politiker*innen, aber auch Wirtschaftsgrößen gehen über Leichen, für Geld und Macht. Die Liste ist lang: Firmen wie Siemens, Nestlé und eben solche Leute wie Bush nehmen es in Kauf, dass Menschen leiden und sterben. Es werden Kriege angezettelt, es wird Menschen das Grundsätzlichste wie sauberes Wasser vorenthalten, das ist Mord. Wie sagte Brecht so schön: Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Auszublenden, wie andere Menschen auf der Welt litten und dass das was mit uns zu tun hatte… .
Zudem fand ich es ärgerlich, dass es komplett normal war, dass wir uns auf der Straße jeden Tag hässliche Werbeplakate mit bescheuerten Produkten anschauen mussten.
Ich wollte dem eine für mich wichtige Botschaft entgegensetzen, die zum Nachdenken bringen könnte.
Also fuhren wir zu mir, diesmal hatte er auch sein Fahrrad dabei, um die Schablone und die Dose zu holen. Als wir zu Hause waren, entschieden wir, vorher noch eine Tüte zu rauchen, waren aber überzeugt, wir würden hinterher gleich losgehen. Dann quatschten wir erst mal und merkten plötzlich, dass es schon fast hell war, tja, Unternehmung geplatzt oder erst mal verschoben, wie wir es nannten.
3.
Besorgt
Am nächsten Tag erkundigte ich mich noch einmal nach der Platzwunde. Moritz erzählte mir, dass Kai ein guter Freund von ihm war, dem er Geld geliehen hatte, mit dem der wiederum Schulden bezahlen wollte. Anstatt das aber zu tun, war er anscheinend einfach abgehauen und der Typ, dem Kai Geld schuldete, wollte das jetzt von Moritz haben.
„Was, warum sollst du was bezahlen, was jemand anders ihm schuldet?“, fragte ich entrüstet.
„Weil ich ihm nicht sage, wo Kai ist!“
„Aber du weißt doch gar nicht, wo er ist!“
„Was spielt das für eine Rolle?“, fragte Moritz resigniert.
Nicht meine Welt, dachte ich bei mir und fragte mich heimlich, in was für Kreisen Kai und Moritz verkehrten und ob er irgendeinen Teil der Geschichte verschwieg.
„Weiß der Typ, wo du wohnst?“, fragte ich weiter und hatte damit den Kern des Problems getroffen.
„Ich glaube schon!“, war die Antwort.
Den restlichen Tag dachte ich darüber nach, wie bescheuert die Welt doch war. Kai schuldete Moritz Geld, und der bezog noch Prügel dafür, dass Kai noch jemandem Geld schuldete. Was für ein Arschloch. Was war mit dem? Schließlich nannte Moritz Kai seinen Freund. Er musste doch wissen, was das für ein Typ war. Warum ließ er Moritz hängen?
Der wiederum sagte, dass er das alles selber nicht wisse.
Abends besuchte ich Moritz in der Kneipe, in der er arbeitete. Es war kurz vor Weihnachten und auf dem Tresen stand ein Totenkopf mit einer Weihnachtsmannmütze, dessen Augen grün leuchteten.
Moritz spielte Hardcore. Er unterhielt sich mit einem Typen am Tresen. Es war voll, sodass er mich gar nicht wahrnahm beim Hereinkommen. So sah ich ihm zu, wie er zu einer Frau hinüberging, die etwas bestellen wollte, ihr sein Ohr hinhielt, nickte und anfing, die entsprechenden Getränke vorzubereiten.
Als er aufschaute und mich wahrnahm …. wieder dieses abgefahrene Kribbeln ….
Die Kneipe gefiel mir ganz gut. Zwar war sie nicht in einem besetzten oder ehemals besetzten Haus und auch nicht kollektiv organisiert, wie der Wagenplatz oder der Klub und die Kneipen, in die ich eher ging, und so war ich auch das Preisniveau nicht gewöhnt, musste aber eh nichts bezahlen.
Die Einrichtung, die Leute und die Musik gefielen mir aber. Ich blieb etwa drei Stunden, gerne wäre ich mit Moritz zusammen abgehauen, konnte mir aber nicht vorstellen zu warten, bis er zumachte. Das sagte ich ihm, und er fragte mich, ob er nach seiner Schicht noch zu mir kommen könnte.
„Oder findest du das blöd, wenn ich nur zum Pennen aufkreuze?“, hakte er nach.
„Nein, ich freue mich jetzt schon darauf, davon aufzuwachen, dass du auftauchst!“
Darauf folgte ein heißer Kuss, der mich wünschen ließ, dies sei schon der Moment, von dem ich gerade gesprochen hatte. Und ich kann auch nicht leugnen, dass mir bewusst war, dass da einige Ladys am Tresen hingen, die so wirkten, als wenn sie gerne an meiner Stelle gewesen wären, und sich das echt gut anfühlte. Dieses Lächeln, diese Augen … Garantiert gab es Frauen, bestimmt auch Männer, die auf ihn standen. Er sah mega aus, verschmitzt und ein bisschen verwegen.
Bestimmt hatte Moritz einen inneren Kampf mit sich ausgefochten, ob er zu mir kommen konnte oder nicht, da ja zu jeder Tages- und Nachtzeit dieser Typ bei ihm auftauchen konnte, aber daran dachte ich in dem Augenblick gar nicht.
Der Typ kam aber nicht in der Nacht, sondern einen Tag danach. Moritz hatte bei mir übernachtet, ich musste aber morgens zur Arbeit. Wir tranken noch einen Kaffee zusammen. Moritz war so unfit, dass er sich noch einmal in mein Bett legte, als ich ging. Gemein! Später rief er mich dann von zu Hause an und erzählte mir, was passiert war.
Sein Mitbewohner Dennis, der mit Hanna, hatte die Tür geöffnet, ohne durch den Spion zu gucken. Er hatte auf einen Freund gewartet und nicht damit gerechnet, dass es jemand anders sein könnte. Mich wunderte das etwas, weil ich davon ausgegangen war, dass Moritz' Mitwohnis im Bilde und dementsprechend vorsichtig waren, aber es war wohl genau die Uhrzeit gewesen, zu der der Freund kommen wollte.
Der Typ hatte Dennis sofort ins Gesicht geschlagen. Das musste ein echtes Tier sein, der war reingekommen, hatte sich von drei weiteren Leuten, die ihn angeschrien hatten, nicht einschüchtern lassen. Erst als Hanna auf ihn zugerannt war und Gerry mit einer Art Schlagstock angelaufen kam, hatte er den Rückzug angetreten.
Nun waren alle etwas fertig. Abends war ein Treffen angesetzt, um gemeinsam zu essen und darüber zu reden, was jetzt zu tun war.
Abends waren wir zu sechst: Carola und Beate, die beiden Frauen in der WG, Dennis und seine Freundin Frauke, Moritz und ich. Gerry war nicht da.
Dennis stand am Herd, als ich in die Küche kam. Seine Dreadlocks gingen ihm bis zum Hintern. Er hatte ein fettes Veilchen.
Dennis und Frauke hatten das Essen zubereitet. Es gab Reis mit einer Soße aus Kokosmilch und Gemüse.
Frauke hatte längere dunkle Haare und trug einen Pony. Die Klamotten, die sie trug, hatten immer milde Farben: Minzgrün, flieder, blass bordeaux und sahen selbstgenäht aus. Die meisten Leute, mit denen ich zu tun hatte, neigten eher zum Einheitslook, dunkle, praktische Klamotten: Springerstiefel oder Doc Martens, Arbeitshosen, Bomberjacken, Kapuzenpullis.
Nachdem Beate uns erklärte, wie der Typ ausgesehen hatte, wollte Beate wissen, ob Moritz denn wüsste, wer der Typ sein könnte. Moritz verneinte das, räumte jedoch ein, dass er wusste, wem Kai das Geld schuldete. Und wo der wohnte, wusste er ungefähr. Dass dieser Gläubiger nicht der Angreifer gewesen war, wussten wir, weil die Beschreibung, die Beate abgegeben hatte, laut Moritz, nicht zu ihm passte.
„Ich kenne seinen Namen und weiß, in welcher Straße er wohnt.“, erläuterte er.
Eine Überlegung war, ihm das Geld einfach zu geben, damit er Ruhe gab.
„Um wie viel Geld geht es hier überhaupt?“, erkundigte sich Dennis.
„Na ja, Kai hat sich von mir 600 Euro geliehen, ich denke, soviel schuldet er dem.“
„So ein Arsch!“, rief Dennis.
„Was ist bloß los mit Kai!“, erboste sich Carola.
„Lass uns lieber gucken, was jetzt zu tun ist“, brachte uns Beate wieder auf sinnvollere Pfade zurück.
„Wir müssen Moritz schützen.“, sagte sie, und setzte hinzu: „Hoffentlich hat der Typ nicht noch irgendwo eine Kampfgarde im Hintergund.“
Wie richtig dieser Gedanke war, erfuhren wir recht bald.
Die WG kannte Kai ja auch etwas, er war schließlich mit Moritz von früher befreundet. Er zog wohl öfter eine Nase, dass wussten alle, aber warum er plötzlich in solch eine Stresssituation geraten war, war nicht so klar.
Moritz erklärte auch noch mal, wie die Situation entstanden war:
„Erinnerst du dich, Gerry, als ich mein Auto verkauft hatte, tauchte doch Kai bei mir auf? Er wusste ja, dass ich gerade Bargeld am Start hatte.“
Moritz hatte nachgefragt, wofür Kai so dringend Geld gebraucht hatte, der war aber voll gestresst gewesen und hatte ihm versprochen, dass er es ihm später erklären würde. Dann hatte er Kai nie wieder gesehen.
„Komisch, aber wenn Kai Leuten Geld schuldete und du es ihm gegeben hast, warum ist er denn jetzt weg?“, wunderte Carola sich mit gerunzelter Stirn.
„Vielleicht schuldet er mehreren Leuten was oder das Geld hat nicht gereicht“, mutmaßte Beate.
„Dann wissen wir doch nicht, um wie viel Geld es geht!“, stellte Frauke fest.
„Oder er hat ihnen das Geld gar nicht gegeben“, äußerte sich Moritz.
„Aber was hat er bloß angestellt?“, fragte Beate in den Raum hinein.
„Und was hat er mit meinem Geld gemacht?“, ärgerte sich Moritz.
4.
Enttäuscht
Es war Weihnachten und ich fuhr zu meinen Eltern. Sie wohnten nicht weit weg von Berlin und ich konnte meinen LKW bei ihnen auf den Hof stellen. Wie jedes Jahr hatten wir verabredet, dass wir Erwachsenen einander nichts schenkten, nur mein Neffe sollte beschenkt werden. Wie immer bekamen alle etwas von allen, außer dass Dirk, der Mann meiner Schwester, es wie jedes Jahr ihr überließ, die Geschenke heranzuholen.
Weihnachten verlief soweit okay, solange mein Daddy und ich nicht über Politik sprachen, was wir uns abgewöhnt hatten, weil wir keine Power mehr hatten uns ständig zu zanken, verstanden wir uns ganz gut.
Wir machten Spaziergänge, quatschten über alles Mögliche. Ich hatte vor allem Klamotten bekommen. Es war immer gutes Zeug, was meine Eltern aussuchten, damit ich es warm und gemütlich hatte. Meine Schwester versorgte mich immer mit neuem Lesestoff. Dieses Jahr war es Wassermusik von T.C. Boyle, das ich in wenigen Tagen durchlas. Jahre später fraß ich nacheinander alle seine Bücher.
Ich half zwar etwas in der Küche in den Tagen, wurde aber insgesamt schon eher bewirtet von meiner Mama, wie alle, in alter Tradition, und heizte meinen Ofen nur abends an, um es vorm Zubettgehen etwas warm zu haben. Da mein Wassertank leider einfror bzw. meine Leitungen, weil es direkt in der „heiligen Nacht“ schweinekalt war, trug mein Vater am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages einen Heizlüfter in meinen Wagen und stellte den auf volle Pulle. Am Nachmittag des Siebenundzwanzigsten fuhr ich wieder und holte mir für meine zusätzlich eingebaute Gasheizung eine Flaschenfüllung, damit es nachts nicht mehr so auskühlte.
Meine Gedanken waren permanent bei Moritz. Er war nicht in Bielefeld, wo seine Familie lebte, wollte auch nicht mit zu meiner. Er sagte, Weihnachten interessierte ihn eh nicht, aber räumte trotzdem ein, dass er schon oft in der Zeit nach Bielefeld gefahren war. Auch alte Freunde, die nicht mehr dort lebten, kamen dann häufig zusammen, wozu auch Kai gehörte. Er kam aus derselben Gegend wie Moritz und sie waren auch schon zusammen dorthin gefahren, aber dass Moritz Kai dort antraf, hatte er sich wohl keine Hoffnung gemacht. Erst viel später erfuhr ich, dass auch Paul, der Typ, dem Kai anscheinend das Geld schuldete, aus Bielefeld kam.
Auch Moritz' Pläne, über Silvester dorthin zu fahren, verwarf er wieder. Vielleicht hatte er auch mittlerweile Angst, Kai zu finden und der Realität ins Gesicht zu schauen.
Dieses Verknalltsein ist doch ein hammerhartes Ding. Wenn ich verknallt bin, bin ich für alles andere völlig blockiert. Meine Antennen haben dann Scheuklappen, empfangen nur noch einen Sender. Alles andere wird zum müßigen Beiwerk, das ich über mich ergehen lassen muss, bis ich mich wieder meiner Liebe hingeben kann. Ich muss mich dann richtig zwingen, mich auch auf andere Dinge zu konzentrieren bzw. Spaß an ihnen zu haben. Mein Lotterleben war vorbei. Ich war zwar frei wie ein Vogel, aber nur wie einer, der in einen Käfig fliegt und dann da hocken bleibt, obwohl das Türchen offen ist.
Aber Beziehungen entwickeln sich ja und irgendwann ist die Sicht auch wieder freigelegt auf andere Dinge, Leute, Wichtigkeiten.
Ich hatte eigentlich Lust, mal was Produktives mit Moritz zu machen, aber er war beschäftigt, lustlos und permanent besorgt wegen dieses Typen, der erst mal nicht mehr aufgetaucht war.
Eines Abends bei mir sagte Moritz, dass er vorerst nicht mehr bei mir schlafen wollte, weil er dann permanent in Sorge war, was zu Hause abging. Seine Mitwohnis fanden es eigentlich okay, wenn er bei mir schlief, denn dann war er wenigstens aus der Gefahrenzone.
Ich räumte ein, dass der Typ ja auch auftauchen könnte, wenn Moritz am Arbeiten oder sonst wo war, aber gegen ein inneres Gefühl konnte ich nicht anreden, und schließlich fing ich an zu heulen. Mir war schon klar, dass das nicht so schlimm war, schließlich konnte ich ja bei ihm sein, aber diese ganze Sache kotzte mich langsam echt an.
Na ja, dann Tröstung, Blödgelaber und irgendwann die unausgesprochene Frage, ob er mit mir oder alleine wieder ging. Die Frage blieb unausgesprochen und ich ließ ihn gehen und war sehr traurig.
Drei Tage später flog bei der WG ein Stein ins Küchenfenster. Niemand verletzt, nur Scheibe im Arsch und Problematik wieder in Erinnerung gerufen. Wieder treffen, reden, aber passiv bleiben.
Inzwischen bekam Moritz eine Postkarte von Kai. Sie war in Berlin abgestempelt und komplett nichtssagend, was den Inhalt anging. Ein mattes Sorry, Alter stand allerdings da, wo "liebe Grüße" oder so hätte stehen können. Moritz zerriss die Karte mit wutverzerrtem Gesicht.
Ich zog mich in meine Bücherwelt zurück. Gerade las ich ein Buch über ein sechsjähriges Mädchen. Es hatte einen Dreijährigen gefesselt und angezündet, das Buch war von ihrer Lehrerin und Therapeutin geschrieben worden. Es kam mir vor, als sei der Mensch nur eine Ansammlung von Erlebnissen, gekoppelt mit solchen Sachen wie Adrenalin, Cholesterin, also Hormonen und so Zeugs. Ich wollte den Kopf in den Sand stecken und nichts mehr wissen von dieser Scheißwelt, diesen vielen Arschlöchern, die anderen das Leben schwer machten. Wenn alle Leute friedlich und gut drauf wären, wenn es nicht immer um Besitz und Macht ginge, gäbe es keinen Kapitalismus, keine Ungerechtigkeiten, keine Abschiebungen, Folterungen, keine Kriege, kein Leid. Warum war die Welt voll von Idiot*innen, die alles kaputt machten?
Ich verkroch mich mit ernster Literatur und düsterer Musik, Joy division, The Cure, Sisters of Mercy und Christian Death, und in mir war es auch finster. Ich haderte mit mir, weil ich politisch kaum etwas auf die Reihe bekam und zu viel an Moritz dachte.





























