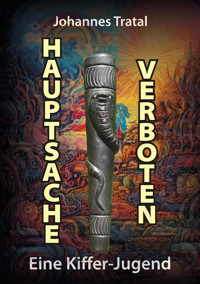
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Hauptsache verboten" erzählt den Werdegang eines Babyboomers aus gutem Hause, vor dem Hintergrund der ausschweifenden Achtzigerjahre. Seine Karriere beginnt früh, mit einem Rausschmiss aus dem Kindergarten, und steigert sich mit den Jahren in eine handfeste kriminelle Laufbahn. Das Buch bietet interessante Einblicke in die damalige "Szene" und deren Gewohnheiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Johannes Tratal
Hauptsache verboten
Eine Kiffer-Jugend
© 2025 Johannes Tratal
Lektorat: Leandra Pesavento
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Softcover
978-3-384-55690-5copy
Hardcover
978-3-384-55691-2copy
E-Book
978-3-384-55692-9
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Im Alter zwischen dreizehn und dreiundzwanzig war ich ständig bekifft. Was so nicht ganz stimmt, denn manchmal war kein Dope verfügbar, oder kein Geld um welches zu kaufen. Angeblich ist THC noch für mehrere Wochen im Blut nachweisbar, also trifft es, zumindest chemisch betrachtet, dann doch wieder zu.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
null – zwei
zwei – sieben
sieben – neun
Gymnasium
White Kids on Dope
Rauchkultur, Beschaffung, und Sonntagsfahrten
Schlechter Umgang
Interrail
Ibiza
Umzug
A'Dam
5 Terre 1
A'dam 2
Women
5 Terre 2
Trequanda
Marc
Holz und Sex
Notre Dame
Im Tal des Mondes
ABRUZZEN
London
Möbel und Überschätzung
Hauptsache verboten
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
null – zwei
Möbel und Überschätzung
Hauptsache verboten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
null – zwei
Mein Leben begann Mitte der sechziger Jahre in einer süddeutschen Stadt.
An meine Kindheit erinnere ich mich gerne zurück. Wie an einen einzigen, niemals endenden Tag auf dem Abenteuerspielplatz.
Aber wer kann schon genau sagen was echte Erinnerungen, und was nur Erzählungen, Fotos oder Wunschvorstellungen sind, die sich uns als eigene Erinnerung einbrennen?
Meine Eltern waren beide Universitätsabbrecher. Mein Vater weil er Geld verdienen wollte, meine Mutter weil sie Kinder bekam.
Ende der dreißiger Jahre geboren, hatten beide noch den Krieg erlebt, also Flucht, Not, Krankheit und Verluste. Später standen sie dann eher auf antiautoritäre Erziehung, die in gebildeten Familien gerade sehr beliebt war.
Unser Bücherregal war voll mit entsprechenden Bänden. Den Satz "Ihr durftet doch immer machen was ihr wollt", hörte ich oft, obwohl er natürlich nur zum Teil zutraf. Meine hübsche, und sensible Mutter war der Typ „bloß kein schiefer Haussegen, koste es was es wolle“, womit sie ziemlich genau die Familienpolitik ihrer eigenen Mutter übernahm. Jedenfalls war sie eine liebe und fragile Person die gerne auch mal alleine war. Vor allem wenn der „Der Kommissar“, und später „Tatort" liefen, wollte sie keinesfalls gestört werden.
Mein Vater mit seiner Panzerglas-Hornbrille (wegen einer heftigen und langwierigen Kinderkrankheit war er extrem kurzsichtig) und langem Ledermantel oder Trenchcoat, war nicht viel zu Hause. Eigentlich sahen wir ihn meist nur abends (wir aßen immer erst um zwanzig Uhr), an Sonntagen, Weihnachten, Ostern, und bei den eher seltenen Familienurlauben. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, fanden meine jüngere Schwester Wadi und ich ihn einfach nur toll. Effektiv war er auch ein witziger, unkonventioneller und recht abenteuerlustiger Typ, der uns mit seinen schnellen Autos durch die Gegend fuhr. In engen Kurven kugelten wir dann wild kreischend durch den Wagen. Das nannten wir "Achterbahn".
Bei unseren sonntäglichen Spaziergängen packte er gerne die weidenden Kühe an den Hörnern, wobei meine Mutter immer eine Mordsangst bekam.
Die ersten zwei Lebensjahre verbrachte ich, und das sind definitiv keine eigenen Erinnerungen, in einem Zweifamilienhaus am grünen Rand einer fünfzehn Kilometer entfernt gelegenen Kleinstadt, deren einziges bemerkenswertes Merkmal der angeblich besonders schlechte Fahrstil ihrer Bewohner war. Da war ich noch allein, meine Schwester wurde erst gut zwei Jahre später geboren.
Im Sommer wurde für mich ein "Laufstall" auf dem Rasen platziert, mein erstes kleines Gefängnis. Manchmal kamen Rehe aus dem Wald, um mich zu begutachten.
Meine Ausbruchsversuche waren berüchtigt, und ich war ein unermüdlicher Schreihals der die Nerven meiner Eltern auf das Äusserste strapazierte. Noch dazu wurde ich mit einer Art Riesenbeule am Kopf geboren, deren Natur sich jeglicher damaligen ärztlichen Kenntnis entzog, dann aber zum Glück irgendwann von selbst verschwand. Meine Eltern dachten eine Zeit lang sie hätten ein Monster gezeugt.
zwei – sieben
Unser zweites Zuhause war eine Wohnung in einem ruhigen, spiessigen Viertel (zu Beginn der Sechziger war so ziemlich alles in Deutschland spiessig), ein halbes Dutzend Strassenbahnhaltestellen östlich vom Stadtzentrum. Einfamilienhäuser mit Garten, ein paar grössere Mietshäuser, alles schön geordnet. Zum einkaufen gab es einen Gottlieb und einen kleinen Edeka. Letzterer kam bei meiner Mutter schnell auf die schwarze Liste, denn die Kassiererin begrüsste uns immer mit dem Satz "Da kommt ja das Äffle, der kriegt jetzt eine Banane". Das bezog sich auf meine angeblich krummen Beine, sollte aber wohl einfach nur meine Mutter zur Weissglut bringen.
Der mit Abstand aufregendste Ort unserer Kinderwelt war aber die freiheitsverheischende Endhaltestelle der Strassenbahn. Mit Kiosk! Hier legten wir Pfennigmünzen auf die Gleise und platzten fast vor Aufregung wenn die Strassenbahn laut rumpelnd und gefährlich nah von uns über die Münzen fuhr und sie plattwalzte. Man konnte damals noch relativ ungefährdet auf der Strasse spielen. Ich erinnere mich auch an viele ernst und verbittert aussehende Männer in mittlerem Alter, mit tristen, grauen Mänteln, die nicht viel für spielende Kinder übrighatten, und uns oft rüde zurechtwiesen. Fehlende Gliedmassen waren bei ihnen nicht selten. Das waren sicher nicht alle ehemalige Nazis, aber die meisten wahrscheinlich schon. Aber davon wussten wir damals noch nichts. Typisch für die Zeit waren auch die vielen Schilder auf denen „Spielen verboten“ und "Eltern haften für ihre Kinder" geschrieben stand. In unserer kleinen Straße lernte ich rennen, Fahrrad fahren, mir die Knie aufschürfen, und, dass auch kleine Taschenmesser böse schneiden können. Also die notwendigen Grunderfahrungen eines kleinen Lausbuben.
Unser Haus hatte zwei geräumige Wohnungen, die jeweils eine ganze Etage einnahmen. Wir bewohnten das Hochparterre. Im Tiefparterre und im Dachgeschoss gab es Studentenzimmer. Über uns wohnte eine Familie mit drei Kindern, der Vater war ein Chemieprofessor und schon etwas älter. Der größere, und mit mir gleichaltrige, der beiden Söhne, Friedrich, wurde sofort mein bester Freund und sollte es lange Jahre bleiben. Unvergesslich die Szene als sein jüngerer Bruder Heinz an einem Balkonpfeiler hochkletterte und von oben seinem kahlen Professorenvater zurief „Papi ich spuck‘ Dir auf die Glatze“.
Gegenüber wohnte eine Arztfamilie mit deren Sohn ich ebenfalls befreundet war, eigentlich aber nur weil unsere Mütter sich frequentierten. Der Arme musste in der warmen Jahreszeit mit von seiner Mutter selbstgestrickten kurzen Hosen mit Träger rumlaufen. Die Dinger sahen absolut furchtbar aus und er tat uns echt leid. Jeden Sonntagmorgens holten meine Schwester und ich an einem nahen Kiosk bei den Bahngleisen die „WamS“ für meinen Vater, und durften uns vom Restgeld „Prickel Pit“ kaufen, welches damals fünf Pfennige kostete.
Im Sommer gingen wir oft ins Freibad, wo ich bei Bedarf eine Art Hundeschlittengeschirr verpasst bekam, welches an einen Baum geknotet wurde, damit meine Mutter ungestört schwimmen konnte. Das klingt grausam, war aber die einzige Möglichkeit für meine arme Mutter mal kurz auszuspannen.
Friedrich und ich waren zwei süße kleine blonde Jungs deren Interessen aber schon bald in eine Richtung schweifen sollten, die nicht unbedingt normal für unsere Alter war. Wer weiss warum, aber wir waren von Beginn an eigentlich nur an verbotenen und gefährlichen Dingen interessiert. Vielleicht lag es ja an der antiautoritären Erziehung?
Der erste besorgniserregende Vorfall war, dass Friedrich und ich aus dem Kindergarten verwiesen wurden. Meine Mutter behauptete später, in ganz Deutschland sei so etwas noch nie vorgekommen (was uns natürlich ganz besonders stolz machte). Friedrich und ich hatten ein liebevoll von den evangelischen Schwestern angelegtes Blumenbeet komplett verwüstet, und sie dann bei der unausweichlichen Standpauke auch noch höhnisch ausgelacht. Sie versuchten daraufhin uns zu erklärten, dass Blumen doch auch eine Seele hätten, und das fanden wir natürlich höchst fragwürdig, und kommentierten dies laut Schwestern mit "einem dreckigem Lachen". Mein Vater, der ganz schön überzeugend auftreten konnte, hatte die Sache dann noch irgendwie hingebogen, jedenfalls erinnere ich mich nicht daran je einen anderen Kindergarten besucht zu haben.
Mit fünfeinhalb wurde ich eingeschult. Die Grundschule lag etwa einen Kilometer entfernt, und wir gingen natürlich bei jedem Wetter zu Fuss. Es handelte sich um einen großen, düsteren Bau aus der Kaiserzeit, mit breiten, steinernen Treppen, und Türen die so schwer waren, dass wir Knirpse sie kaum aufbekamen. Zum Glück hatten wir einen ziemlich aussergewöhnlichen Klassenlehrer, der extrem behaart war, ausser auf dem Kopf. Er warf gerne mal einen riesigen Schlüsselbund nach den Schülern, um deren Konzentration wiederzuerwecken. Oder aber er sprang mit Riesenanlauf und ohne Vorwarnung auf das Pult unaufmerksamer Schüler, wo er dann wie ein Affe vor einem saß und wild guckte. Es wirkte, und wir mochten ihn. Einige Jahre später haben wir ihn sogar einmal zuhause besucht.
In gewissen Abständen kamen die Eltern meines Vaters zu Besuch,stets per Zug. Sie wohnten gut fünfhundert Kilometer von uns entfernt, im Geburtsort meines Vaters am Niederrhein. Oma war eine kleine Frau, deren wohlriechende Hände so ziemlich alles konnten. Ihr selbstgemachter Eierlikör, und die Plätzchen die an Weihnachten in rauhen Mengen per Paket eintrudelten waren legendär. Den Krieg hatten sie, wie so viele, "auf dem Land" überstanden. Ein Säckchen mit Linsen wurde eisern rationiert und gehütet, geschlafen wurde auf dem Tisch. Mein Grossvater war derzeit an der russischen Front. Er kehrte zum Glück nach einem Jahr Kriegsgefangenenlager körperlich unversehrt nach hause. Sein russischer Passierschein ist noch vorhanden, so auch die rührenden Postkarten (max. 25 Wörter) an seine Frau, in denen er sich für die Zigaretten bedankt. Erzählt hat er nie etwas davon.
Bei uns schlief er in einem "Fremdenzimmer" weil die Wohnung nicht gross genug für alle war. Das Zimmer lag etwa fünfzehn Gehminuten entfernt, im ersten Stock über einer Metzgerei. Opa war immer perfekt gekleidet. Anzug, Weste, Schlips, und Hut auf dem kahlen Kopf. Im Sommer eine elegante, weisse Schiebermütze mit Luftlöchern. Er rauchte gerne und ausgiebig "Lord Extra", wirkte stets entspannt, und ging um sein Leben gerne spazieren, mit Spazierstock natürlich. Einen Wagen besass er nicht, kam aber früh, und durch genau so ein Gefährt, ums Leben. Da war er etwa siebzig.
In Omas kleiner, aber gemütlicher Wohnung roch es nach Kohl und Ordnung. Obwohl es schon länger Fernseher gab, verfolgte mein Grossvater seine Fussballspiele ausschliesslich am Radio, immer alleine und hoch konzentriert, mit dem Ohr nah am Lautsprecher, als ob noch Krieg wäre.
Meine Schwester und ich machten oft Ausflüge mit den beiden, und erhielten das komplette Verwöhnungsprogramm. Oma steckte uns bei allen Gelegenheiten heimlich Süssigkeiten und Geld zu, was meine Mutter extrem ärgerte wenn sie es herausbekam.
Bei unseren eher seltenen Gegenbesuchen ins Flachland, spazierte ich stundenlang mit Opa durch die Stadt die so anders war als unsere. Grau, russig, und irgendwie altmodisch. Er nahm mich in seine Stammkneipen mit, trank Kölsch, stellte mich seinen Kneipenbekanntschaften vor, und brachte mir alte Wirtshauslieder bei. Jedes Jahr im September, so um meinen Geburtstag herum, besuchten wir die beiden dann in einer für mehrere Wochen angemietete, und von meinem Vater bezahlte Ferienwohnung am Thuner See. Das war so als ob eines unserer Kinderbücher Wirklichkeit geworden wäre.
Wir spielten im Heu mit den jungen Kätzchen, fütterten die Möwen auf den Fähren, und assen Rüblitorte am Seeufer, oder Omas selbstgemachtes, göttliches Mandelbrot.
Die Mutter meiner Mutter kam in etwas grösseren Abständen. Sie war eine immer noch vorzeigbare Dame die stark sächselte, und für alles eine Lösung parat hatte. Sie kam aus einer gutsituierten Arztfamilie, hatte Abitur, und einen Führerschein. Den Krieg hatte sie mit ihren Kindern vergleichsweise bequem in einer Marmeladenfabrik in einem Mittelgebirge überstanden. Der Eiskaffee den sie uns im Sommer auf der Terrasse unter der alten Trauerweide servierte schmeckte wunderbar. Ihre eigene Mutter war im Rollstuhl sitzend bei Düsseldorf von einer S-Bahn überfahren worden, und sie musste uns Kindern diese gruselige Geschichte immer wieder erzählen. Als ich einmal vor unserem Haus in ein vorbeifahrendes Mofa lief, und mir eine lange Schnittwunde am Knie holte (man konnte den schneeweissen Knorpel sehen), klebte sie einfach ein riesiges Pflaster drauf, nach einer Woche war alles zugewachsen. Ihr Mann, ein verbitterter Tyrann, blieb lieber zuhause. Er wollte mit meinen Eltern nichts zu tun haben was diesen mehr als recht war. Das Problem war, dass mein Vater erstens katholisch war und zweitens nicht den "richtigen" Studiengang gewählt hatte. Und somit nicht ihrer Tochter wert war. Bei einem der selteneren Besuche bei ihnen, die beiden wohnten im achten Stock eines Hochhauses bei Krefeld, zeigte er mir seine Schrapnellwunden, die er täglich einsalbte, und die ich sehr beeindruckend, aber auch ziemlich eklig fand. Mein Oma musste uns immer wieder ihre "Dauerwurst", eine Art Salami, zeigen, die in einem Kabuff beim Eingang hing und köstliche Gerüche verströmte. Sie brachte uns meistens ins Wellenbad oder in den Zoo. Es waren herrliche Nachmittage.
Unsere Freizeit verbrachten wir, wie gesagt, zum grössten Teil auf der Straße, praktisch unbeaufsichtigt. Wir waren also so etwas wie wohlbehütete Wirtschaftswunder-Strassenkinder.
Sonntags drangen Friedrich und ich in ein weitläufiges Areal mit Baumaterial („Eintritt verboten, Eltern haften für ihre Kinder“) ein, wo wir Kacheln oder grosse Eisenkrampen klauten. Oder wir setzten Kreissägen in Gang, und liessen sie dann einfach weiterlaufen. Oder wir zerstörten was uns gerade so in die Finger kam. Einen ausgeprägten Sinn für das Eigentum anderer hatten wir jedenfalls nicht. Wir klauten auch gerne Süßigkeiten im örtlichen „Gottlieb“. Klein wie wir waren rechnete einfach niemand damit. Als es dann doch einmal schief ging kamen wir mit einem blauen Auge davon, da die Filialleiterin die Mutter eines Klassenkameraden war.
Ein anderes Mal fischte man Friedrich und mich vom Dach unseres Hauses runter, immerhin vier Stockwerke hoch. Wir waren durch eine Dachluke im obersten Stock rausgeklettert und irgendein Nachbar hatte das wohl beobachtet. Das Geschrei war riesig und es folgte verschärfter Hausarrest.
Im Fernsehen liefen zu der Zeit täglich Kriegsszenen aus Vietnam, schwarzweiss natürlich. Sie machten uns Angst, obwohl wir nicht wirklich verstanden was sich da abspielte.
sieben – neun
Als ich sieben Jahre alt war zogen wir an den Rand eines grösseren Dorfes. Vier Kilometer südlich vom Stadtzentrum entfernt, Busverbindung bis Mitternacht. Ein glücklicher Zufall war, dass auch Friedrich mit seiner Familie kurz vor uns in dasselbe Dorf gezogen war. Seine Eltern hatten sich dort einen schmucken Bungalow mit Garten, Schwimmbad und echtem Indianertipi gebaut. Ihre Bäder hatten sogar Bidets, was ziemlich ungewöhnlich war. Wir dachten anfangs sie dienten der Fusswäsche. Unser ebenfalls ansehnliches Einfamilienhaus war gemietet, und stand am Hang auf der gegenüberliegenden Talseite, mit herrlichem Blick auf das Rheintal.
Die Vermieter des Hauses, eine Grossfamilie, hatten kurz vor unserem Einzug eine schlimme Tragödie durchlebt. Fast die ganze Familie war durch eine Pilzvergiftung umgekommen. Obwohl allesamt Pilzexperten seit Generationen, hatte sich ein Knollenblätterpilz in den Korb verirrt. Nur die Grossmutter überlebte. Seitdem habe ich nie mehr selbstgepflückte Pilze gegessen. Die ganze Gegend war noch ziemlich ländlich geprägt und die tief süddeutsch sprechenden Ureinwohner beäugten uns Zuzügler natürlich mit einem gewissen Misstrauen. Die meisten Häuser, so auch unseres, hatten Gärten ohne Umzäunung und wir kürzten immer über die Grundstücke der umliegenden Häuser ab. Das hatte viel böses Geschrei, und ab und zu auch mal einen Tritt in den Hintern von den Nachbarn zur Folge. Vor den vielen Hunden (damals vorwiegend deutsche Schäferhunde, Schnauzer und Spitze) musste man sich in acht nehmen, denn sie bissen wirklich zu. Die Dorfschule war ein dünnwandiger Nachkriegsbau mit Turnhalle, direkt an der Bus-Endhaltestelle. In den Pausen gab es "Schoki" und "Rosinenschnecken" zu kaufen. Auch hier war man Dörfler, oder Zugezogener, die Vermischungsquote ausserhalb der Schule war recht gering. Ich erinnere mich nur ein einziges Mal bei einem Mitschüler, sein Spitzname war „Äffle“, zuhause gewesen zu sein. Seine Mutter war extrem neugierig, als ob ich von einem anderen Planeten käme.
Mein prägendes Erlebnis was Religion betrifft war ein "Halbfeiertag" an dem man sich entscheiden sollte, ob man am Gottesdienst (der erste und letzte meines Lebens) teilhaben, oder im Mathematikunterricht bleiben wollte. Religion war schlimm, aber Mathe war schlimmer, also fand ich mich bald darauf in der muffigen Dorfkirche wieder. Irgendwann fingen plötzlich alle an zu singen und ich wunderte mich woher sie alle wussten welches Lied gesungen werden musste. Es war mir sehr peinlich und ich bewegte halt so gut es ging den Mund zur Musik. Erst nach dem Gottesdienst erfuhr ich, dass es eine Anzeige an der Wand gab die das jeweils zu singende Lied zeigte. Der feste Grundstein für meine Abneigung gegenüber Religionen und ihren Vertretern war damit gelegt.
Eine Ausnahme bildete die evangelische Dorfgemeinde. Der dortige Pfarrer war verheiratet, hatte eine Familie (und somit auch Sex), also ganz normale freundliche Menschen. Man wurde auch nicht weiter missionarisch belästigt, und es gab keinen Zwang zum Gottesdienst. Ich habe bei den "Evangelen" an vielen Hüttenaufenthalten und Ausflügen teilgenommen, obwohl ich ja katholisch getauft war. Bereut habe ich das Ganze nur einmal als plötzlich alle katholischen Klassenkameraden am Tag nach ihrer Kommunion mit neuen Armbanduhren und Bargeld auftauchten.
In unserer Klasse gab es einen Sizilianer, ein braunhäutiger, dünner, und schüchterner Junge namens Giovanni, der auf Grund seiner geringen Deutschkenntnisse nur schlecht mitkam. Italien war damals noch weit weg und richtig exotisch, vor allem alles was nicht der Gardasee oder Rimini war. Meine Mutter überhäufte uns mit Ratschlägen und Vorsichtsmassnahmen als wir einmal ins nördliche Kampanien reisten. Eiswürfel wurden aus dem Glas gefischt und in Blumenkübeln entsorgt, Salat wurde auf dem Teller belassen, und auf das Obst hatte ganz sicher beim pflücken jemand draufgepinkelt.
Jedenfalls tat mir Giovanni leid und ich bot ihm an bei den Hausaufgaben zu helfen. Seine Familie wohnte in einer kleinen Barackensiedlung am Rande eines Bauhofs. Giovanni empfing mich an der Tür und ich trat in einen penibel aufgeräumten Wohnraum mit Küchenzeile, Esstisch und zwei Sesseln. Giovannis Mutter sprach kein Wort deutsch und redete unentwegt lebhaft auf italienisch (oder sizilianisch?) auf mich ein. Ich bekam Süssigkeiten und Orangenlimonade, dann lernten wir zusammen. Ich war selbst kein guter Schüler aber für Giovanni reichte es. Ich ging noch etwa vier bis fünf mal hin, dann nicht mehr.
Ganz am Ende unserer Strasse, wo diese in Weinberge und Felder überging, begann ein Schleichweg durch dichten Wald der zu einer stillgelegten Ziegelei führte. Die riesige halbverfallene Halle lag mitten in einem weitläufigen, komplett verwilderten Areal (Die "Wildnis") mit einem Tümpel. Für Friedrich und mich, seinen kleinem Bruder und anderen Kindern aus meiner Strasse war diese für einige Jahre der schönste Spielplatz den man sich vorstellen konnte. Wir legten Brände (was einmal fast in eine Katastrophe ausartete), fällten grosse Bäume mit Axt und Säge, und wuchteten alte Loren wieder auf ihre Schienen, um sie dann den Hang hochzuziehen und in ihnen hinunterzusausen. Unseren Hunger stillten wir mit wildem Rhabarber und Brombeeren.
Wir klauten auch wieder in den kleinen Geschäften des neuen Dorfs. Die erste Frage wenn wir reinkamen war immer "wem ghörsch' du?". Dann musste man seinen Namen nennen und sagen, wo man wohnte und was die Eltern machten. Und dann klauten wir. Vornehmlich Süßigkeiten und alle möglichen brennbaren Flüssigkeiten mit denen wir pyrotechnische Experimente am Ufer eines kleinen Baches veranstalteten. Wir wurden nie erwischt, denn hier konnte sich niemand vorstellen, dass es so junge Diebe geben könnte.
Aussen an Geschäften hingen oft Kaugummiautomaten die von uns mit französischen Centimes-Münzen überlistet wurden die genauso gross wie Fünfzig-Pfennigmünzen waren, aber weniger wert waren.
Dann die ersten Zigaretten. Zigarettenautomaten waren noch mechanisch, und hatten diese Schubladen aus poliertem Metall. Die konnte man aber ein ganz kleines Stück aufziehen, dann die Packung mit einer Rasierklinge aufschlitzen, und zwei oder drei Zigaretten mit einer Pinzette rausziehen.
Meine Eltern machten gerne mal eine Party bei denen viel getrunken wurde. Sie hatten ein paar interessante Bekannte, unter denen auch Musiker waren die bei uns spielten. Es wurde immer sehr spät und dementsprechend lange schliefen sie am nächsten Morgen. Der Flur stand dann voller leerer Flaschen und es roch nach kaltem Rauch und schalem Wein. Ich konnte es am nächsten Morgen kaum erwarten das Wohnzimmer nach liegengelassenen Zigaretten, aus der Tasche gerutschtem Geld, und anderen Dingen abzusuchen. Die Zigaretten rauchten wir hinter der Garage eines Nachbarn. Den meisten von uns wurde zwar erstmal schlecht, aber es drehte sich halt alles so herrlich im Kopf. Das war der "Nikotinflash" auch wenn wir diesen Ausdruck natürlich erst viel später verwenden sollten.
Ein weiterer beliebter, und potentiell tödlicher Zeitvertreib, bestand darin ein schmales und steiles Strässchen mit dem Fahrrad, wenn Schnee lag, mit selbstgebauten Schlitten, hinunterzurasen. Am unteren Ende querte die Dorfstrasse, die wir ungebremst, ohne zu schauen, und mit voller Geschwindigkeit überquerten. Es ist seltsamerweise nie etwas passiert.
In dieser Zeit karrte meine Mutter Wadi und mich unermüdlich durch die Gegend. Schwimmen, reiten, Judo, Skifahren, Kochkurs und so weiter. Was halt damals so in modernen Familien üblich war. Der Judotrainer kam aus Rumänien und hatte bei Olympia mitgemacht. Er hatte einen dunklen Teint, sah gut aus und vernaschte die Mammis reihenweise. Ich schaffte es bis zum grünen Gürtel.
In unserer Familie wurde viel gelesen. Die Bücher meines Vaters füllten bereits alle Wohnzimmerwände, ausserdem hatten meine Eltern Dutzende von Zeitschriften abonniert. Spiegel, Stern, Pardon, Schöner Wohnen, Brigitte, Essen&Trinken, Autozeitungen und so weiter. Auch wir Kinder hatten beide schon eine ansehnliche Menge an Büchern in Regal. Mein absolutes Lieblingsbuch war "Die Grüne Wolke". Ich habe es mindestens fünfmal gelesen, und später dann meiner Tochter vorgelesen.
Unsere Hauptfeinde waren die ortsansässigen Mofarocker. Sie nannten sich "Eagles" und kamen alle seit Generationen aus dem Dorf. Sie hatten einschlägige Erfahrung von den vielen Dorffesten, die naturgemäss in Alkohol-, und Kotzexzessen, sowie, unkoordinierten Schlägereien endeten. Für uns waren sie einfach nur primitiv, ausserdem hatten die meisten gruselige Frisuren. Ihr Anführer hiess "Wuschel". Er hatte ganz feines, blondes Kraushaar, wie ein Pudel, welches er wahrscheinlich auch furchtbar fand. Die Größeren hatten auch schon sexuelle Erfahrung (wenn man wixen dazuzählt). Wer es sich leisten konnte trug eine schwarze Kunstlederjacke. Ansonsten standen sie auf saufen und frisierte Mofas oder Mopeds, meistens mit Fuchsschwanz verziert und mit Tussi auf dem Sozius. Einer von ihnen war wegen einer Meningitis geistig zurückgeblieben, und sozusagen der Hofnarr der Bande. Er wurde manchmal ziemlich grob verarscht. Der Arme, musste zum Beispiel immer seinen Mini-Pimmel herzeigen, was dann lautes Gröhlen der anderen provozierte. Körperlich waren uns die meisten von ihnen überlegen, wir hatten uns sowieso noch nie richtig geprügelt. Man musste also aufpassen nicht alleine und im falschen Moment an ihrem Treffpunkt, einem Spielplatz direkt vor Friedrichs’s Haus, aufzutauchen. Das Mindeste was man dann erwarten konnte war Anmache und Rempelei. Diese Treffen verliefen fast immer gleich. Man lief vorbei, bemüht die Idioten zu übersehen, dann wurde man angesprochen, meist mit: „Guck nicht so blöd“. Dann hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder man antwortete, dass man doch gar nicht blöd schaue, das war dann Aufmüpfigkeit. Oder man sagte gar nichts und das provozierte sie sogar noch mehr, weil respektlos. Richtig „aufs Maul“ gab es damals aber eher selten, es war mehr ein rumschubsen, aber trotzdem nervlich aufreibend weil man ja nie wusste was noch kommen könnte. Wenn wir mal einen von ihnen alleine erwischten bekam er natürlich auch eine Abreibung, im schlimmsten Fall wurde er mit Brennesseln ausgepeitscht oder in eine Dornenhecke geworfen, was dann natürlich Racheaktionen der Gegenseite mit sich führte. Friedrich hatte es auch mal erwischt und er wurde an einen herrenlosen, vergammelten Lieferwagen gefesselt und ebenfalls mit Brennesseln traktiert.
Friedrich und ich waren "beste Freunde", wenn auch grundverschieden. Wir waren ziemlich genau gleichstark und beim periodisch notwendigen Kräftemessen gab es meistens ein unentschieden. Friedrich war zwei Zentimeter grösser als ich und rastete meist irgendwann berserkerartig aus. Er war dann schwer zu stoppen in seiner Raserei, ich konnte dafür immer schon sehr sehr gut Arme verbiegen, was alles wieder ausglich. Wenn ich mal einen seiner Arme in der Mache hatte siegte Schmerz über Wut. Trotzdem wollte natürlich keiner von uns verlieren und es gab tagelange Schmollphasen nach so einem Kampf. Damals war (unter Freunden) nur ringen angesagt, niemals wurde geboxt oder getreten. Meistens ging es so aus, dass einer von beiden im "Schwitzkasten" endete und irgendwann (ungern) aufgab.
Zu den anderen, eher normaleren Beschäftigungen, zählte das Forellen angeln im Dorfbach. Wir hatten eine Treibjagdtechnik entwickelt und waren sehr erfolgreich. Es war einfach. An einer geeigneten Stelle positionierte sich einer von uns mit einem Käscher, während die anderen die Forellen von oben mit Stöcken aufscheuchten und in den Käscher getrieben. Die Forellen wurden meistens vor Ort geräuchert und verspeist.
In Friedrich's Bungalow, der eigentlich keiner war, weil zweistöckig, verbrachten wir damals die meiste Zeit, vor allem wenn wir wetterbedingt nicht durch die Gegend ziehen konnten. Es gab dort viel Platz und sogar einen "Spielflur". Eines der beliebtesten Spiele war es ausgeschlossen zu werden. Man musste dann versuchen irgendwie wieder in das Haus hineinzukommen, während das Haus von innen verteidigt wurde. Wir spielten das endlos, bis irgendwann Friedrichs grosse Schwester eingriff. Manchmal durften wir auch glotzen. Es gab zwei grosse kackebraune Stoffsessel mit hoher Lehne, um die stest sofort Streit ausbrach. Wer verlor musste auf dem Boden sitzen. Meine erste "Fernbedienung" lernte ich hier kennen. Sie hatte allerdings noch ein Kabel und nur einen einzigen Knopf, mit dem man mit einem lauten Klack zwischen den damals drei verfügbaren Programmen wechseln konnte.
Wir hörten aber auch viel Musik auf den damals üblichen portablen Plastikplattenspielern, oder Kassettenrecordern, anfangs meist Abba und Beatles. Ich hatte aber auch einige Hörspielplatten zum Beispiel Winnetou, Im Land der Skipetaren oder Der Schatz im Silbersee. Absoluter Favorit war aber Die Sklavenkarawane. Dort wurden Negersklaven unter gruseligstem Geschrei den Krokodilen zum Frass vorgeworfen. Wir hörten uns die schlimmsten Stellen immer wieder an. Eine andere Gruseltaktik war es, ein Zimmer komplett zu verdunkeln und die Musik von "Spiel mir das Lied vom Tod" voll aufzudrehen. Die jüngeren und die Mädels bekamen manchmal richtig Angst und flüchteten aus dem Zimmer.
Bei schönem Wetter streunten wir durch die nahen Wälder und Weinberge. Nicht weit entfernt übten französische Soldaten die sich Löcher in die Erde gebuddelt hatten, Krieg übten, und mit Platzpatronen rumschossen. Mit etwas Glück fand man auch blaue Plastikübungshandgranaten die nicht hochgegangen waren. Wir nahmen sie mit und liessen sie dann anderswo explodieren.
Ich litt damals, und später auch noch, unter schlimmen Nebenhöhlen- entzündungen. Medizinisch war da nicht viel bekannt, jedenfalls nicht unserem schon etwas älterem HNO-Arzt. Meine Mutter schleifte mich also in gewissen Abständen dorthin und ich bekam dicke, zirka zwanzig Zentimeter lange (nicht übertrieben) Hohlnadeln in die Nebenhöhlen gestochen. So richtig durch irgendwelche Knochen hindurch wobei es fürchterlich knirschte. Dann wurden Schläuche angeschlossen und eine Spüllösung durchgepresst. Zu allem Übel musste ich auch immer wieder den Rotz ausschneuzen was höllisch wehtat. Es war wie eine Folter und hatte noch dazu keinerlei Wirkung.
Irgendwann schickte man mich deswegen auch zur Kur auf eine friesische Insel, wegen dem Reizklima und der guten Seeluft. Das Heim war so ein Riesengebäude mit Schlafsälen und vielen anderen Kindern. Ich erinnere mich an Schillerlocken, Kutterfahrten mit anschliessendem Krabbenessen, und an metergrosse Quallen die am Strand rumlagen und die wir mit Stöcken piesackten. Zu meiner grossen Freude war gleichzeitig eine Gruppe schwererziehbarer Jungs aus Berlin in dem Heim. Ich war begeistert, denn das waren im Vergleich zu mir richtige kleine Gangster. Ich war beeindruckt von ihren Erzählungen, stromerte mit ihnen unerlaubt über die Insel, und rauchte ihre Zigaretten. Ich lernte viel, die Nasenhöhlen wurden aber nicht besser.
Gymnasium





























