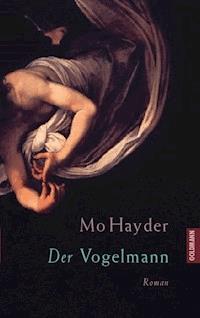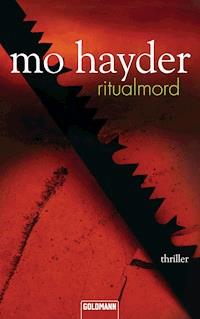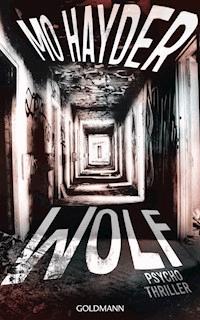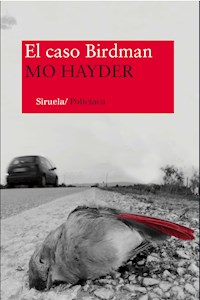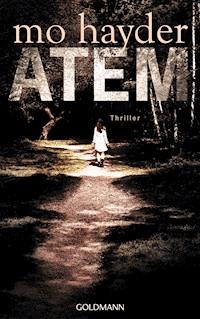Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Skin« bei Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers London.
Copyright © der Originalausgabe by Mo Hayder 2009 Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.ISBN : 978-3-641-02980-7V003
www.goldmann-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Danksagung
Copyright
1
Die menschliche Haut ist ein Organ, das größte des Körpers, und besteht aus der Dermis, der Epidermis und einer subkutanen Fettschicht. Wenn man sie in einem Stück abziehen und ausbreiten wollte, würde sie eine Fläche von knapp zwei Quadratmetern bedecken. Und sie ist schwer: Bei all dem Protein und dem damit verbundenen Fett hat sie ein enormes Gewicht. Die Haut eines gesunden erwachsenen Mannes wiegt zwischen zehn und fünfzehn Kilo, je nach seiner Größe. Genauso viel wie ein kleines Kind.
Die Haut einer Frau dagegen wiegt etwas weniger. Auch ihre Fläche ist kleiner.
Die meisten Männer mittleren Alters, selbst diejenigen, die allein in einer entlegenen Gegend von Somerset leben, würden niemals darüber nachdenken, wie eine Frau ohne ihre Haut aussähe. Sie würden auch keinen Grund haben, sich zu fragen, wie ihre Haut aussähe, wenn man sie ausgespannt auf eine Werkbank nagelte.
Aber natürlich sind die meisten Männer nicht wie dieser Mann.
Dieser Mann ist völlig anders.
2
Tief in den regennassen Mendip Hills in Somerset liegen acht überflutete Kalksteinbrüche. Sie wurden schon vor langer Zeit stillgelegt; ihre Eigentümer haben sie durchnummeriert, von eins bis acht, und sie liegen in einem hufeisenförmigen Halbkreis beieinander. Nummer acht, am südöstlichen Ende, grenzt beinahe unmittelbar an das, was in der Umgebung als Elf’s Grotto bezeichnet wird: die Elfengrotte, ein System aus tropfenden Höhlen und Gängen, die tief in die Erde hinunterreichen. Den regionalen Mythen zufolge führen geheime Ausgänge aus diesem Höhlensystem in die alten römischen Bleibergwerke, und in alten Zeiten haben die Elfen in Elf’s Grotto die Tunnel als Fluchtwege benutzt. Manche sagen, wegen all der Sprengungen im zwanzigsten Jahrhundert münden diese Tunnel jetzt direkt in die gefluteten Steinbrüche.
Sergeant »Flea« Marley, die Leiterin der Unterwasser-Sucheinheit der Avon and Somerset Police ließ sich kurz nach vier an einem klaren Mainachmittag in den Steinbruch Nummer acht gleiten. Sie dachte nicht an geheime Eingänge. Sie suchte nicht nach Löchern in der Wand. Sie dachte an eine Frau, die seit drei Tagen vermisst war. Die Frau hieß Lucy Mahoney, und die Profis an Land glaubten, ihre Leiche könnte hier unten sein, irgendwo unter dieser weiten Wasserfläche, eingerollt in den Tang auf einem dieser Simse.
Flea tauchte zehn Meter hinunter und bewegte den Unterkiefer hin und her, um den Druck in ihren Ohren auszugleichen. In dieser Tiefe war das Wasser von einem gespenstischen, fast graugrünen Blau, und nur ein zarter Hauch von milchigem Kalksteinstaub schwebte da, wo ihre Flossen ihn aufgewirbelt hatten. Perfekt. Normalerweise herrschte in dem Wasser, in dem sie tauchte, null Sichtweite – als würde sie durch eine Suppe schwimmen, sodass sie ganz auf ihren Tastsinn angewiesen war -, aber hier unten konnte sie mindestens drei Meter weit sehen. Sie entfernte sich von der Einstiegsstelle und hangelte sich an der Kalksteinwand entlang, bis der Zug der Sicherungsleine konstant war. Sie erkannte jedes Detail, jede sich wiegende Wasserpflanze, jeden Steinblock auf dem Grund. Jede Stelle, an der eine Leiche hätte landen können.
»Sarge?« Police Corporal Wellard, ihr Leinenführer, sprach in sein Funkmikrofon, und seine Stimme ertönte in ihrem Ohr, als stünde er neben ihr. »Sehen Sie was?«
»Ja«, murmelte sie. »Ich sehe die Zukunft.«
»Hä?«
»Ich kann in die Zukunft sehen, Wellard. Ich sehe, wie ich in einer Stunde völlig durchgefroren hier auftauche. Und ich sehe die Enttäuschung in allen Gesichtern, weil ich mit leeren Händen komme.«
»Wieso?« »Keine Ahnung. Ich glaube nur nicht, dass sie hier unten ist. Fühlt sich nicht so an. Seit wann wird sie vermisst?«
»Seit zweieinhalb Tagen.«
»Und ihr Wagen. Wo war der geparkt?«
»’ne halbe Meile weit von hier. Auf der B 3135.«
»Hielt man sie für depressiv?«
»Ihr Exmann wurde im Zusammenhang mit der Vermisstenmeldung befragt. Er sagt ganz entschieden, sie war es nicht.«
»Und sonst keine Verbindung mit dem Steinbruch? Nichts, was ihr gehört? Sie war nicht schon öfter hier oder so was?«
»Nein.«
Flea paddelte mit den Flossen ein Stück weiter, und die Nabelschnur – die Luft- und Sprechfunkleitung, die sie mit der Oberfläche verband – wehte sanft hinter ihr her. Steinbruch Nummer acht war ein berüchtigter Ort für Selbstmörder. Vielleicht hatte der polizeiliche Fahndungsberater, Stuart Pearce, die Ansicht der Familie über Lucy Mahoney nicht geteilt. Vielleicht hatte er deshalb diese spezielle Nadel in die Landkarte gestochen und sie zu dieser Suchaktion eingeteilt. Entweder das – oder er klammerte sich an einen Strohhalm. Sie war Stuart Pearce schon begegnet. Vermutlich war Letzteres der Fall.
»Konnte sie schwimmen, Wellard? Ich hab vergessen, danach zu fagen.«
»Ja. Sie war eine gute Schwimmerin.«
»Dann muss sie sich mit einem Gewicht belastet haben, wenn sie Selbstmord begangen hat. Mit einem Rucksack oder so was. Das bedeutet, sie muss sich nah am Rand befinden. Lassen Sie uns die Suche im Pendelmuster durchführen, bis auf zehn Meter hinaus.«
»Äh, Sarge, da gibt’s ein Problem. Bei zehn Metern kommen Sie tiefer als fünfzig Meter.«
Wellard besaß einen Plan des Steinbruchs. Flea hatte ihn oben studiert. Als die Steinbruchfirma fingerförmige Löcher gebohrt hatte, um den Sprengstoff hineinzuschieben, hatten sie zehn Meter lange Bohrer benutzt, und folglich war das Gestein – bevor sie die Pumpen abschalten und das Wasser in den Steinbruch strömen ließen – in zehn Meter dicken Scheiben abgesprengt worden. An einem Ende betrug die Wassertiefe zwanzig bis dreißig Meter, am anderen war es tiefer; da ging es mehr als fünfzig Meter hinunter. Die Vorschrift der Gesundheits- und Sicherheitsabteilung war eindeutig: Kein Polizeitaucher hatte die Genehmigung, tiefer als fünfzig Meter zu tauchen. Niemals.
»Sarge? Haben Sie gehört? Am Ende des Suchbogens wären Sie fünfzig Meter tief. Vielleicht tiefer.«
Sie räusperte sich. »Haben Sie das ganze Bananenbrot aufgegessen?«
»Hä?«
An diesem Morgen vor Dienstantritt hatte sie Bananenbrot für das ganze Team gebacken. So etwas tat sie normalerweise nicht. Sie war die zweitjüngste nach Wellard und der Boss, aber sie bemutterte niemanden. Und sie hatte es nicht getan, weil sie gern backte. Sie hatten in letzter Zeit schlimme Zeiten durchgemacht: Einer von ihnen hatte aus psychischen Gründen Sonderurlaub, und nach dem, was er zu Anfang der Woche hatte durchmachen müssen, würde er wahrscheinlich nicht zurückkehren. Dazu kamen ihre miesen Launen; in den letzten zwei Jahren war es ein Albtraum gewesen, mit ihr zu arbeiten. Ab und zu musste sie ihnen etwas zurückgeben.
»Haben wir, ja. Aber Sarge, da sind ein paar Senken, die weit über fünfzig Meter tief sind.«
»Auf wessen Seite stehen Sie, Wellard? Auf unserer oder auf der des Sicherheitsbeauftragten?«
Schweigen. Besser gesagt, Wellards lautloses Murren. Wenn es darum ging, sich wie ein altes Weib aufzuführen, steckte er mühelos das ganze Team in die Tasche. »Okay. Aber wenn Sie es wirklich machen wollen, werde ich den Lautsprecher leiser stellen. Der ganze Steinbruch kann Sie hören, und wir haben heute eine Zuschauergalerie.«
»Wieso?«
»Da ist eine Verkehrsstreife vorbeigekommen, um zu gucken, und die stehen jetzt da oben auf den Zementstaubdünen. Ich glaube, sie trinken Kaffee.«
»Ich nehme an, dieser bescheuerte Fahndungsberater ist nicht dabei, oder?«
»Noch nicht.«
»Wie schön.« Jetzt wurde sie sarkastisch. »Es wird nur manchmal als höflich empfunden, wenn der Fahndungsberater seinen Arsch ebenfalls aus dem Bett bewegt, wenn er ein Team rausjagt wie in diesem Fall.«
Sie wurde langsamer. Im dunkler werdenden Wasser vor ihr spannte sich ein Netz über ihren Weg. Dahinter lag der Abschnitt, wo der Grund auf über fünfzig Meter abfiel. Das Wasser dort wirkte dunkler und blauer. Kälter. Der Bereich war so unsicher, dass die Firma dort ein Netz gespannt hatte, um die Hobbytaucher, die hier manchmal ihre Übungen absolvierten, zurückzuhalten. Sie griff in das Netz, schaltete die Tauchlampe ein und richtete den Lichtstrahl auf den Boden des Steinbruchs, der dort steil abfiel.
Sie war Pearce erst einmal begegnet, aber das hatte genügt. Sie würde sich von ihm nicht einschüchtern lassen. Selbst wenn es bedeutete, gegen alle Berufsregeln zu verstoßen – sie würde den Teufel tun und die Suche hier abbrechen. Rechts neben sich entdeckte sie ein in Beton eingelassenes Schild. Die Worte waren grün von Algen: Gefahr: Tiefe über 50 Meter. Stichprobenkontrollen der Tauchcomputer in diesem Bereich. Tauchen Sie nicht jenseits Ihrer Fähigkeiten.
Eine gute Stelle, um den Tauchcomputer aufzuhängen, dachte sie. Nimm das Gerät vom Handgelenk, häng es an einen der Nägel, und auf dem Rückweg kannst du es wieder abholen. Niemand würde nachher bei einer Kontrolle merken, dass du tiefer als fünfzig Meter getaucht bist. Die Computereinheit oben registrierte kein Tauchprotokoll. Solche Tricks hatte ihr Dad angewandt, als er noch lebte. Er war ein Extremsporttaucher gewesen, und er hatte alles getan, um die Grenzen immer weiter zu verschieben und so tief zu tauchen, wie er wollte.
Mit ihrem Tauchermesser schnitt sie ein Loch in das Netz. Dann nahm sie vorsichtig den Tauchcomputer ab und hängte ihn an das Schild. Mit eingeschalteter Lampe glitt sie durch die Öffnung und folgte dem Lichtstrahl hinunter in die Dunkelheit.
Der Steuerstrich ihres Kompasses lag hart auf Nordwest, als sie anfing abwärtszuschwimmen, tiefer und immer tiefer; sie folgte der Felsformation und blieb ungefähr zwei Meter darüber. Wellard rollte die Führungsleine hinter ihr ab. Der Plan hatte gestimmt: Es war tief hier. Sie glitt langsam nach unten, ließ sich vom Lichtstrahl leiten und rechnete im Kopf. Ohne Computer würde sie Grundzeit und Dekompressionspausen selbst kalkulieren müssen.
Im Dunkeln rechts von ihr bewegte sich etwas. Sie riss die Lampe herum und spähte in den Lichtstrahl; sie pendelte aus und schwebte horizontal im Wasser. In Steinbruch Nummer acht lebten keine Fische. Er war vor Jahren geflutet worden, und das Unternehmen hatte niemals welche eingesetzt. Bäche waren auch nicht in der Nähe, also würde es nicht mal Krebse geben. Außerdem – was sich da bewegt hatte, war kein Fisch. Es war zu groß gewesen.
Ihr Herz schlug tief in der Brust. Sie atmete gleichmäßig – zu tief, und sie würde aufsteigen, zu flach, und sie würde Auftrieb verlieren. Hier unten sollte und konnte sich nichts bewegen, denn es gab auch keine Strömung. Alles sollte still sein. Langsam schwamm sie auf die Stelle zu, wo sie die Bewegung bemerkt hatte.
»Sarge?« Wellard hatte oben sofort gemerkt, dass sie den Kurs gewechselt hatte. »Alles okay?«
»Ja, ja. Geben Sie mir noch ein Bar.«
Wenn sie tiefer ging, war es Wellards Aufgabe an der Steuereinheit, den Druck der Luft zu erhöhen, die durch die Nabelschnur zu ihr herunterkam. Sie drehte sich um und leuchtete mit der Lampe hinter sich, um zu sehen, wie weit sie sich von dem Netz entfernt hatte. Wahrscheinlich war sie ungefähr siebenundvierzig Meter tief und ging langsam tiefer. Noch drei Meter, und sie hätte die vorgeschriebene Tauchgrenze erreicht. »Ja – auf sechzehn.«
»Sechzehn Bar? Das bringt Sie auf …«
»Ich weiß, wohin es mich bringt. Lassen Sie das meine Sorge sein.«
Sie schwamm weiter und streckte jetzt die Hände vor sich aus, weil sie nicht sicher war, was sie erwartete. Achtundvierzig Meter. Neunundvierzig. Jetzt war sie da, wo sie die Bewegung gesehen hatte.
»Sarge? Wissen Sie, wie tief Sie sind?«
»Halten Sie«, flüsterte sie. »Halten Sie mich stabil.«
Sie richtete die Lampe nach oben und schaute in die Höhe. Es war eine ungemütliche Haltung, denn die Maske wollte sich heben, sodass Wasser eindringen konnte. Sie drückte sie mit den Fingerspitzen ans Gesicht und spähte in den silbrig sprudelnden Strom der Luftblasen, die in einer langen Kolonne zielstrebig über ihr hochstiegen – zur Oberfläche, die jetzt so weit entfernt war, dass man sie nicht mehr erkennen konnte. Da befand sich etwas in dieser funkelnden Säule. Flea war sicher. Etwas Dunkles schwamm da oben. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Waren das nackte Fußsohlen?
»Sarge, das reicht. Sie sind über fünfzig. Können Sie mich hören?«
»Hey, Wellard«, flüsterte sie. Die Luftblasen waren verschwunden, hatten sich aufgelöst in frostige Zacken aus Licht. Plötzlich sah alles wieder so aus, wie es sein sollte. Das Wasser war leer. »Ist hier noch jemand drin?«
»Noch jemand?«
»Ja«, fauchte sie; es sollte nicht klingen, als hätte sie Angst. Hoffentlich waren die Lautsprecher leise gestellt. Nicht jeder am Ufer brauchte ihre Stimme zu hören. »Schwimmt außer mir noch jemand hier herum? Das müssten Sie doch mitbekommen haben.«
Pause. Ein kurzes Zögern. Dann seine Stimme, ein wachsamer Unterton. »Boss? Sie wissen, dass Sie weit drüber sind, oder? Vielleicht wird’s Zeit, den zweiten Mann runterzuschicken.«
N2-Narkose, meinte er. In dieser Tiefe war es leicht, von der desorientierenden, giftigen Wirkung überwältigt zu werden, die Stickstoff unter hohen Druckverhältnissen haben konnte. Sie dachte und reagierte, als hätte sie einen Nachmittag im Pub verbracht. Eine Halluzination wie diese vorhin war das klassische Merkmal einer N2-Narkose. Sie starrte den Luftblasen nach. Da war etwas Dunkles gewesen, so groß wie eine große Schildkröte. Aber ohne Panzer. Es war glatt und haarlos gewesen, agil und kräftig. Mit den Füßen eines Menschen.
»Ich habe keine Narkose, Wellard, ich schwör’s Ihnen. Sagen Sie mir nur, dass hier unten nicht noch jemand herumschwimmt. Das ist alles.«
»Da ist sonst niemand, okay? Und der Rettungstaucher bereitet sich jetzt vor.«
»Nein.« Ihre Nabelschnur war hinter ihr an einem Grat oder einem Stein hängen geblieben. Gereizt hob sie die Schultern, wedelte mit der rechten Hand und spürte, wie das Kabel sich wieder löste und freikam. »Nicht nötig, dass jemand herunterkommt. Ich bin hier fast fertig.«
Wellard hatte natürlich recht. Wenn es sich um eine Narkose handelte, dann sollte sie herauskommen. Aber sie brauchte noch eine Minute, um sich zu vergewissern, dass sie alles abgesucht hatte. Also neigte sie sich nach unten, und es fühlte sich gut an, wie der Druck auf der Maske nachließ. Sie leuchtete nach vorn. Dort, ungefähr zehn Meter weiter, war die Wand des Steinbruchs zu Ende; sie hatte den Grund erreicht. Weiter ging es nicht, und es gab keinen Zweifel: Lucy Mahoney war nicht hier. Gut. Sie hatte recht gehabt. Es würde Spass machen aufzusteigen und Pearce mitzuteilen, dass er sich geirrt habe.
Die Gummidichtung ihrer Maske sog sich an ihrem Gesicht fest – und blockierte.
Sie griff nach der Maske. Versuchte, Atem zu holen. Aber da kam nichts; die Dichtung saugte sich noch fester, und sie verspürte einen vertrauten Druck unter dem Brustbein. Sie kannte das Gefühl vom Training her. Die Luft kam nicht durch. Sie fummelte über ihrem rechten Ohr an der Maske. Das war sicher kein Problem; das Team da oben pumpte die Luft zu ihr herunter, und der Vorrat konnte nicht zu Ende sein. Aber manchmal verhakte sich die Nabelschnur mit dem Druckhebel an der Maske und sperrte die Zufuhr ab. Das war leicht zu beheben. Wenn man Ruhe behielt. Ruhe.
Ihr Herz klopfte, als sie den Hebel fand. Sie drückte ihn herunter und versuchte noch einmal zu atmen. Ihre Rippen spannten sich. Nichts kam. Sofort stellte sie den Hebel hoch.
Nichts.
Herunter. Nichts.
»Sarge?« Wellard klang panisch. »Was ist los? Was läuft da unten?«
Aber sie hatte keine Luft zum Antworten. Die Arme schmerzten. In ihrem Kopf dröhnte es, und es fühlte sich an, als wäre er auf die zweifache Größe angeschwollen. Als stünde jemand auf ihrer Brust. Sie riss den Kopf in den Nacken. Ihr Mund stand weit offen. Sie tastete nach dem Schalterblock an ihrer Weste, um auf die Notfallflasche umzuschalten.
»Sarge? Ich habe sämtliche Ventile offen, aber irgendwoher dringt Luft ein. Haben Sie Druck?«
Sie wusste, was da oben jetzt vorging. Der Standby-Taucher würde sich hektisch in den Anzug zwängen; vor lauter Panik würden seine Finger sich in den Gurten der Maske verheddern, und er würde alles vergessen, was er gelernt hatte. Seine Knie würden zittern. Er würde nicht rechtzeitig kommen. Sie hatte nur noch Sekunden, keine Minuten mehr.
Mit einer gefühllosen Hand schlug sie an ihre Weste. Fand den Schalterblock nicht. Ihr Kopf schwoll immer weiter, immer härter an. Es kribbelte in ihren Gliedern.
»Ich muss Sie rausziehen, Sarge. Das muss ich einfach.«
Sie hörte nicht mehr zu. Die Zeit lief immer langsamer, und Wellard, der verzweifelt die Führungsleine einholte und sie herauszog, war in einer anderen Welt. Auf einem anderen Planeten. Sie wusste, dass ihr erschlaffter Körper sich ruckartig rückwärts durch das Wasser bewegte. Sie spürte, dass die Lampe aus ihren Fingern glitt, sie fühlte, wie sie träge an ihr Bein stieß, bevor sie versank. Sie versuchte nicht, sie festzuhalten.
In der Dunkelheit zehn Meter vor ihr war etwas aufgetaucht, das aussah wie eine weiße Qualle. Nicht das, was sie kurz vorher halluziniert hatte, sondern etwas anderes, das sich blähte, sich in gespenstischen Spiralbewegungen hob und senkte wie eine Wolke aus Haaren. Es schien da zu schweben, von unsichtbaren Strömungen hin und her geschoben, als wäre es irgendwohin unterwegs gewesen – vielleicht zum Grund – und hätte jetzt innegehalten, um sie zu beobachten. Als interessierte es sich für das, was hier passierte. Für ihren Kampf.
Die Oberseite dieses Dings hob sich, streckte sich, verlängerte sich zu langen, rankenähnlichen Haaren, und jetzt wusste sie, was sie sah.
Mum.
Mum, die seit zwei Jahren tot war. Das lange blonde Haar, das sie immer im Nacken zu einem Knoten gebunden hatte, hob sich und wallte in der Dunkelheit, wehte um ihr Gesicht.
»Wach auf, Flea. Gib Acht auf dich.«
Flea antwortete nicht. Sie konnte es nicht. In der realen Welt hatte ihr Körper sich auf die Seite gelegt und zuckte wie ein Fisch mit geplatzter Schwimmblase.
»Gib Acht auf dich.«
Mum drehte sich. Mit den Bewegungen ihrer kleinen weißen Hände steuerte sie ihren Körper so, dass sie Flea ins Gesicht sehen konnte. Ihr Haar umwehte sie, und ihre schlanken weißen Beine schwebten hinter ihr wie ein Schleier. Ihr liebes, fahles Gesicht war jetzt ganz nah, und sie legte Flea die Hände auf die Schultern. »Hör zu.« Ihr Ton war scharf. »Wach auf! Sofort. Gib Acht auf dich.«
Sie schüttelte Flea, und als diese nicht reagierte, umfasste sie ihre Hand, führte sie zu dem Schalterblock und legte den Schalter um, der die Sauerstoffversorgung auf die Tauchflasche umstellte.
Luft flutete in die Maske. Ihre Lunge blähte sich mit einem Schlag und riss ihr den Kopf in den Nacken. Licht blendete ihre Augen. Sie atmete noch einmal ein, schleuderte die Arme zur Seite und hustete. Die Luft war trocken in ihrer verdorrten Lunge. Beim nächsten panischen Atemzug spürte sie, wie ihr Herz wieder schlug, wie das Blut in ihren Schläfen hämmerte. Noch einmal einatmen. Sie ruderte blindlings mit den Armen, und die Anzeigen ihrer Ausrüstung und der Lungenautomat bewegten sich wie Tentakel um sie herum, als sie sich im Wasser aufrichtete. Wellard hatte sie in seiner Panik auf dem Grund entlanggeschleift. Schlick war aufgewirbelt und wallte um sie herum wie Rauch. Schlaff hing sie im milchigen Wasser und ließ sich an der holprigen Wand entlangziehen.
Mum?
Aber das Wasser rauschte an ihr vorbei, und sie hörte nur Wellards panische Stimme aus dem Kopfhörer. »Sind Sie da, Sarge? Um Gottes willen, antworten Sie doch!«
»Alles okay.« Sie hustete. »Sie können jetzt aufhören, mich zu ziehen.«
Jäh lockerte sich die Leine, und Flea bewegte sich nicht weiter. Sie schwebte mit dem Gesicht nach unten im Wasser, ihre Hand lag immer noch auf dem Notschalter. Sie starrte auf die Stelle, wo sie ihre Mutter gesehen hatte. Das Wasser war leer. Noch eine Halluzination.
3
Die Major Crime Investigation Unit – MCIU, das Dezernat für Schwerverbrechen der Polizei von Bristol – hatte es mit einem der berüchtigtsten Fälle seiner Geschichte zu tun. Bis vor wenigen Tagen war Misty Kitson eine B-Prominente gewesen, landesweit nur dafür bekannt, dass sie eine weitere Fußballergattin war, die sich genug Kokain in die Nase gezogen hatte, um sie von innen heraus zu zerstören und die Scheidewand zu zerfressen. Monatelang hatte die Presse sich darum gerissen, Bilder von ihrer Nase zu bekommen. Jetzt riss sie sich darum herauszufinden, was passiert war, als sie aus einer Rehaklinik am anderen Ende von Somerset hinausspaziert und nie wieder gesehen worden war.
Die Polizei hatte das Land rings um die Klinik nach ihr abgesucht und in einem Radius von zwei Meilen jedes Haus auf den Kopf gestellt, jeden Wald durchkämmt, in jeden Viehstall geschaut. Es war beispiellos – die größte Geländefahndung, die die Polizei jemals unternommen hatte, und das Ergebnis gleich null. Keine Leiche. Kein Hinweis. Misty Kitson hatte sich in Luft aufgelöst.
Die Öffentlichkeit war fasziniert von diesem Rätsel und der Einheit, die hier ermittelte. Sie betrachtete das Dezernat für Schwerverbrechen als Eliteteam: eine Gruppe von engagierten und erfahrenen Männern, die ihre ganze Energie auf den Fall verwandten. Sie stellte sich vor, wie diese Männer in ihren Köpfen, ja in ihrem ganzen Leben nur noch Platz für diesen Fall hatten, wie sie sich ausschließlich ihm widmeten. Im Großen und Ganzen stimmte das auch: Die Polizisten, die den Fall bearbeiteten, waren wild entschlossen, Misty zu finden.
Das heißt, alle bis auf einen.
Nur ein Mann hatte Mühe, sich auf Misty zu konzentrieren. Ein Mann stellte fest, dass sein Kopf, was immer er eigentlich tun und wie viel Zeit er auch darauf verwenden sollte, Misty Kitson zu suchen, sich immer nur in eine Richtung bewegte, nämlich rückwärts. Zurück zu einem anderen Fall, an dem er in der Woche zuvor gearbeitet hatte. Zu einem Fall, den er zu den Akten hätte legen und hinter sich hätte lassen sollen.
Dieser Mann war Detective Inspector Jack Caffery.
DI Caffery war neu bei der MCIU, aber er hatte fast zwanzig Jahre Erfahrung, hauptsächlich bei der Mordkommission der Metropolitan Police London, und nie ein Problem damit, einen Fall loszulassen.
Aber er hatte auch noch nie einen Fall bearbeiten müssen, der ihm Angst einjagte.
Nicht wie es Operation Norwegen getan hatte.
Um halb neun am Morgen nach Fleas Unfall in Steinbruch Nummer acht saß Caffery am anderen Ende der Stadt in seinem verdunkelten Büro im Gebäude des MCIU in Kingswood. Er hatte die Jalousien heruntergelassen und die Tür geschlossen und sah sich eine DVD an.
Sie zeigte zwei Männer in einem unbeleuchteten Zimmer in einem verwahrlosten, leer stehenden Mietshaus. Der eine Mann war neunundzwanzig, trug eine lederne S&M-Haube mit Reißverschlüssen und war nackt bis zur Taille. Er bereitete ein paar Werkzeuge vor und hielt sie ins Bild. Der andere war neunzehn ebenfalls nackt bis zur Taille, aber nicht freiwillig. Er war bewusstlos und unter Drogen und lag angeschnallt auf einer Werkbank. Er rührte sich nicht, bis der Vermummte eine Bügelsäge an seinen Hals legte. Dann bewegte er sich doch, und zwar heftig.
Dieses Video war überall bei der Polizei berüchtigt. Die Presse wusste, dass es existierte, und hätte alles darum gegeben, um wenigstens Teile davon zu sehen. Es zeigte den Tod und die Beinaheenthauptung eines Jungen namens Jonah Dundas. Caffery war nur wenige Minuten zu spät in diesen Raum eingedrungen, um ihn noch zu retten. Die meisten Kollegen, die bei der Operation Norwegen dabei gewesen waren, bestanden darauf, dass der Ton abgestellt wurde, wenn sie sich das Video ansehen mussten. Nicht Caffery. Für ihn gehörte es einfach nur zur Suche nach Antworten.
Er ließ es bis zu der Stelle laufen, wo er hereingestürmt und der Vermummte geflüchtet war. Dann ging er zurück zum Anfang, zu dem Teil, der ihn interessierte: zu den ersten fünf Minuten, die Dundas allein und festgeschnallt in dem Raum verbracht hatte, bevor der Vermummte mit der Enthauptung begann. Caffery drückte sich die Kopfhörer an die Ohren, rutschte auf seinem Stuhl nach vorn und beugte sich zum Monitor.
Der Name »Operation Norwegen« war beliebig gewählt. Der Fall hatte nichts mit Norwegen zu tun, aber alles mit Afrika. Der Mann mit der Sadomaso-Haube – der »Onkel«, wie sie ihn nannten – hatte ein Projekt in der afrikanischen Community von Bristol betrieben. Habgier, Sadismus und Zufall hatten dazu geführt, dass er sich einen uralten Glauben der Community zunutze machen konnte, der vage als »Muti« oder afrikanische schwarze Magie bezeichnet wurde: den Glauben, dass manche Teile des menschlichen Körpers zur Behandlung von medizinischen oder spirituellen Problemen benutzt werden könnten. In den letzten zehn Jahren hatte es in ganz Europa nur acht ähnliche Fälle gegeben, und für die britische Polizei war es Neuland gewesen. Aber sie hatten immerhin erfahren, dass ein menschlicher Kopf, der Kopf eines jungen Mannes – besonders wenn er dem Opfer bei lebendigem Leib abgetrennt worden war -, in manchen Kreisen Unsummen von Geld einbrachte. Das war Dundas’ Pech gewesen.
Die Operation Norwegen war geplatzt, bevor der Kopf verkauft werden konnte, und die Polizei hatte zwei Personen verhaftet: den Vermummten – einen Einheimischen – und einen illegal eingewanderten Afrikaner, der ihn in diesen Gebräuchen unterwiesen und ihm geholfen hatte, Kunden für seine Ware zu gewinnen. Der Afrikaner befand sich immer noch in Haft und versuchte, die Polizei davon zu überzeugen, dass sein Name Johnny Brown sei und er einen britischen Pass besitze. Bei der Durchsuchung hatten sie festgestellt, dass er einen Schlüsselanhänger mit der tansanischen Nationalflagge bei sich trug und sein T-Shirt in Tansania hergestellt war, und jetzt kämmte die MCIU Akten aus Daressalam nach Hinweisen auf ihn durch.
»Was ist denn das?« Superintendent Rolf Powers, der Chef der MCIU, öffnete um zehn nach neun die Tür. »Kein Licht? Ist ja wie im Zimmer meines halbwüchsigen Sohnes.« Er schaltete die Leuchtstoffröhren ein. »Wo waren Sie? Ich habe soeben eine ganze Pressekonferenz über den Fall Kitson ohne Sie abhalten müssen.«
Caffery stoppte die DVD und drehte den Monitor so, dass der Superintendent ihn sehen konnte. »Schauen Sie sich das an.«
Powers tat es und runzelte die Stirn. »Das ist die Operation Norwegen. Damit sind wir fertig. Die Unterlagen dürften Ende des Monats bei der Staatsanwaltschaft sein.«
»Sehen Sie mal.« Caffery tippte auf den Bildschirm. »Es ist wichtig.«
Powers, ein großer, breitschultriger und gut gekleideter Mann, schloss die Tür und kam herein. Sicher war er früher sportlich gewesen, aber seine Lebensweise hatte ihren Tribut gefordert. Er legte die Mappe, die er in der Hand hielt, auf den Schreibtisch und zog sich einen Stuhl heran.
Auf dem Standbild, das Dundas auf dem Tisch zeigte, sah man noch eine Gestalt, die neben seinem Kopf stand und der Kamera den Rücken zuwandte. Sie war vorgebeugt und konzentrierte sich auf irgendeine Tätigkeit. Als sie Dundas’ Kopf nach den Festnahmen in die Rechtsmedizin gebracht hatten, war festgestellt worden, dass ihm Haarbüschel fehlten, – und zwar an der Stelle, auf die sich die Gestalt auf dem Videobild konzentrierte.
Powers schüttelte den Kopf. »Das ist der Tansanier. Johnny Brown, oder wie immer er auch heißt. Den wir eingesperrt haben.«
»Das ist er nicht. Er lügt.«
»Jack, der kleine Scheißer hat es schon tausendmal zugegeben. Ganz klar: Er habe Dundas die Haare abgeschnitten, um sich daraus ein Voodoo-Armband zu machen. Wenn er es nicht ist, wer, zum Teufel soll es dann sein? Die Unterstützungseinheit hat alles durchkämmt. Die Bude war leer. Da war niemand. Und da war kein Ausgang.«
Caffery starrte die Gestalt auf dem Monitor an. Von allen, die sich das Video angeschaut hatten, war niemandem das Offensichtliche aufgefallen: Diese Gestalt sah nicht völlig menschlich aus. »Nein«, sagte er, »das ist er nicht. Die Jungs im Zellentrakt haben ihn für mich gemessen: Er ist eins sechzig groß. Klein, aber nicht so klein. Die Kamera stand exakt einen Meter fünfzig hoch und zwei Meter vom Tisch entfernt. Ich habe mir die Pläne der Spurensicherung angesehen. Johnny Brown müsste bis hierher reichen.« Er deutete auf eine Stelle auf dem Monitor. »Er ist mehr als einen Kopf größer. Und schauen Sie sich die Schultern an. Mit denen stimmt auch was nicht, und zwar ernsthaft.«
»Sie haben ihn verkleidet – das hat er zugegeben – und ihn dann losgeschickt, damit er Leuten so viel Angst einjagte, dass sie ihren Voodoo-Quatsch kauften. Ziemlich primitives Zeug, was die da glauben – aber selbstverständlich würde ich mich so nie darüber äußern.«
Caffery starrte ihn mit versteinerter Miene an. »Wie kann man jemanden ›verkleiden‹, damit er so aussieht? Schauen Sie doch hin.«
»Prothesen. Beleuchtung.«
»Da waren keine Prothesen, als wir die Bude durchsucht haben. Und Brown hatte Dundas’ Haare nicht bei sich, als er festgenommen wurde, oder?«
»Er sagt, er habe sie weggeworfen. Sie können mich für begriffsstutzig halten, für einen Hinterwäldler oder wie immer ihr uns bei der Londoner Met sonst nennt, aber wenn einer so ein Geständnis ablegt, finden wir hier draußen in der Provinz es einfacher, ihm schlichtweg zu glauben. Nein.« Seine Stimme bekam plötzlich einen geschäftsmäßigen Ton. »Nein, Jack. Lassen Sie uns so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Operation Norwegen ist erledigt, okay?« Er stand auf und schob die Mappe, die er mitgebracht hatte, zu Caffery hinüber. »Damit sollen wir unsere Zeit jetzt verbringen, sagt der Chef. Und das ist der Fall, für den ich ab jetzt meine Betablocker nehme. Machen Sie auf.«
Caffery gehorchte. Die Mappe enthielt sechs Zwanzig-malfünfundziebzig-Hochglanzfotos. Fotos von Kleidungsstücken, die neben einem Maßband ausgebreitet waren. Frauensachen. Ein Kleid. Ein Paar hochhackige Sandalen. Eine violette Samtjacke. Ein silbernes Handy. »Misty Kitson?«
»Natürlich. Das sind Reproduktionen der Sachen, die sie anhatte. Wir haben sie an alle Abteilungen verschickt. Jede Person in jedem Büro dieser Polizei wird heute Abend einen Satz dieser Bilder am Arbeitsplatz hängen haben. Selbst wer keine Zeitungen liest und niemals fernsieht, wird von ihr wissen.« Powers ging zu der Landkarte an der Wand, schob die Hände in die Taschen und studierte sie. »Ich kapier’s nicht. Wirklich nicht. Ein Zwei-Meilen-Radius, die größte Aktion, die ich bei der Polizei je erlebt habe, jeder Zollbreit abgesucht – und wir haben nichts gefunden. Nicht die Bohne. Herrgott, Sie hören mir überhaupt nicht zu, was?«
Caffery saß vorgebeugt da und starrte auf das Obduktionsfoto an der Wand, auf Dundas’ Haare, von denen ganze Büschel fehlten.
Powers nahm ein Foto von Mistys Kleidern und pinnte es demonstrativ über das Bild des toten Dundas. »Jack, da draußen warten drei Detective Sergeants und vier Constables darauf, dass Sie ihnen sagen, was sie tun sollen. Denn sie wollen sie finden.«
Caffery öffnete seine Schublade und nahm die Fotos von einer anderen, zwei Nächte zuvor vorgenommenen, Obduktion heraus. Er hatte sie gestern Abend über die Centrex-Guardian-Datenbank bekommen, und sie enthielten alles, was er brauchte. Er stand auf und hängte eins über das Foto von Mistys Kleidung.
»Ben Jakes. Zwanzig Jahre alt. Student an der Bristol University. Kriegt sein Examen nicht gebacken, seine Freundin verlässt ihn, und das Ende ist ein Taschenmesser und ein Kasten Alkopops. Unten in der Gegend von Elf’s Grotto. Ist hübsch da. Man kann die Lichter von Bristol sehen. Sehr beliebt bei Selbstmördern.«
»Was hat das mit all dem zu tun?«
»Sein Telefon war verschwunden. Ist immer noch nicht aufgetaucht. Er war ausgeplündert worden. Sein Mitbewohner sagt, er hatte Geld dabei, mindestens einen Zwanziger, plus Kreditkarten, nie benutzt. Sogar Sandwiches im Rucksack. Die waren auch weg. Ach, und er war nackt.«
»Er hat sich ausgezogen, um sich umzubringen? Was war los? Vollmond?«
»Nein. Der Dieb hat auch die Kleider mitgenommen. Zu Anfang ging der ermittelnde Kollege von einem Mordfall aus. War der District Police eine Nummer zu groß und kam deshalb sogar bei uns auf die Watchlist, bis der Obduktionsbefund ergab, dass es sich um einen Suizid handelte. Die Kleider wurden ihm vierundzwanzig Stunden nach seinem Tod abgenommen, sagt der Obduzent. Als weiteres Indiz zu dem Befund kommen die Depressionen. Niemand bezweifelt, dass es Selbstmord war; sogar seine Eltern sagen, sie hätten halb damit gerechnet. Aber ich möchte, dass Sie sich das hier ansehen.«
Powers nahm die Brille ab und spähte blinzelnd auf das Foto.
»Sehen Sie? Sein Haar?«
»Abgeschnitten.«
»Abrasiert. Erinnert Sie das an irgendwas?«
Powers runzelte die Stirn. Er nahm das Foto von der Wand und drehte es um. Die Rückseite trug den Stempel der audiovisuellen Einheit in Portishead. »Wo, sagen Sie, ist das passiert?«
»In Steinbruch Nummer acht. Unten bei Elf’s Grotto.«
»Und das Haar ist ein wichtiger Faktor? Weil mit Dundas das Gleiche passiert ist?«
»Es war derselbe Täter. Die Merkmale sind fast identisch.«
»Und?«
Caffery lächelte grimmig. »Weil der Rechtsmediziner ein Rechtsmediziner ist, äußert er sich wie immer vage, was den Todeszeitpunkt betrifft. Aber er sagt immerhin, dass derjenige, der seine Kleider geklaut hat, es mindestens sechs Stunden nach Eintritt des Todes getan hat. Die Leichenflecken beweisen es. Und der Mitbewohner sagt, Jakes hat das Zimmer gegen sechs Uhr morgens verlassen. Wie er zum Steinbruch gekommen ist, wissen wir nicht, aber es dauert mindestens eine Stunde, wenn nicht mehr, vorausgesetzt, dass er unterwegs nicht irgendwo haltmacht. Damit wäre es sieben Uhr, und folglich kann der Dieb auf keinen Fall vor dreizehn Uhr vorbeigekommen sein. Unterdessen war Brown um vierzehn Uhr in diesem Loch hier.« Er stieß mit dem Finger an den Bildschirm. »Ich hab den Scheißkerl mit eigenen Augen gesehen. Können Sie sich wirklich vorstellen, dass er zum Steinbruch rausgondelt, Jakes die Haare abrasiert und innerhalb von einer Stunde wieder am anderen Ende von Bristol ist?«
»Ich nehme an, der Arzt hat seine Vermutungen über den zeitlichen Ablauf sozusagen inoffiziell geäußert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so was in seinen Bericht schreibt. Sie legen sich beim Todeszeitpunkt niemals fest.«
»Da haben Sie recht. Aber ich brauche seine Vermutungen gar nicht. Vodafone hat Jakes’ Telefonunterlagen rausgerückt. Daraus geht hervor, dass um zwanzig Uhr am Abend dieses Tages mit seinem Handy telefoniert wurde. Und da war Brown schon seit fünf Stunden in Haft.«
Powers schob den Finger zwischen die Lamellen der Jalousie und schaute hinaus. Ein oder zwei Reporter standen draußen auf Dauerposten, seit der Fall Kitson an die MCIU gegangen war. Er starrte sie eine Zeit lang an. Dann ließ er die Jalousie wieder fallen und bedachte seinen DI mit einem langen Blick. »Mein Gott«, sagte er. »Was wollen Sie von mir?«
»Eine Woche. Eine Woche hierfür. Geben Sie mir zwei Mann und eine Woche Urlaub vom Fall Kitson. Ich will wissen, wie Brown es geschafft hat, Jakes die Haare abzuschneiden, wenn er zur selben Zeit zwanzig Meilen weit weg war. Ich will wissen, wofür er dieses Haararmband haben wollte. Und …«
»Und?«
4
Caffery verließ das MCIU-Gebäude um halb elf. Er nahm den Hinterausgang und lief außen herum, weg von den Kitson-Reportern und geradewegs zu dem überdachten Parkplatz. Hier war es geschützt, aber er ging trotzdem schnell, mit gesenktem Kopf und hochgeschlagenem Kragen. Er stieg nicht in seinen Dienstwagen, einen zivilen Mondeo, sondern blieb davor stehen, ließ den Blick über den Parkplatz wandern und vergewisserte sich, dass die Schatten hinter den anderen Autos still und flach dalagen. Nach einer Weile bückte er sich und spähte unter den Wagen. Dann richtete er sich wieder auf, öffnete die Autotür, stieg ein und verriegelte die Türen von innen.
Wie immer sie es geschafft, was immer sie für Tricks angewandt hatten, die Akteure der Operation Norwegen hatten den Leuten weismachen können, sie sähen etwas, das sie sich nicht erklären konnten. Etwas, das sie nervös machte. Einige der ersten Zeugen wussten keinen Namen dafür; konnten nur beschreiben, was sie schemenhaft gesehen hatten: etwas Menschenähnliches, aber zu klein und verkümmert für einen richtigen Menschen. Dann gab es Zeugen, die einen Namen dafür hatten: einen Namen, der aus den dunkelsten Gegenden des schwarzen Kontinents stammte. Ein Zuluwort, das Caffery Superintendent Powers gegenüber nicht laut aussprach, weil sich dabei seine Nackenhaare sträubten.
Tokoloshe.
Vier schlichte Silben, aber sie hatten eine machtvolle Bedeutung für diejenigen, die daran glaubten. Sie beschrieben etwas Entstelltes, Zerbrochenes. Sie beschrieben den gesamten afrikanischen Aberglauben in einem einzelnen Wesen – von der Größe eines großen Pavians, mit dem Körper eines Affen und dem Gesicht eines Menschen. Der Hausgeist einer Hexe, eine Kreatur aus dem Herzen des Velds. Sie lauerte im Schatten. Beobachtete, ohne mit der Wimper zu zucken.
Caffery konnte die schattenhafte Gestalt auf dem Video nicht mit Johnny Brown in Einklang bringen, aber die Alternative war natürlich ziemlich irrwitzig: eine Theorie, die er niemals aussprechen würde. Trotzdem – wenn er an das dachte, was er da jagte, fiel ihm immer nur dieses gespenstische Zuluwort ein: Tokoloshe.
Er beugte sich vor, klappte das Handschuhfach auf und warf einen Blick auf den Inhalt. Alle Polizisten im Außendienst führten die gleiche Standardausrüstung mit sich: Pfefferspray, Handschellen und den ASP, einen Schlagstock aus Metall, der Knochen zertrümmern konnte. Während der Operation-Norwegen-Verhaftungen zu Anfang der Woche hatte er selbst einen Schlag mit dem ASP abbekommen. Es hatte höllisch wehgetan, aber als Verteidigungswaffe war der ASP eine Lachnummer, wenn die Halbwelttypen da draußen mit Mach-11-MPs und Magnum-Pistolen herumliefen. Obenauf lag jetzt ein brauner Aktenumschlag in seinem Handschuhfach und darunter, in Öltuch eingewickelt, eine Pistole.
Fünf Jahre zuvor, noch in London, hatte ein etwas seltsamer Kollege, der an der Operation Trident beteiligt gewesen war, ihn mit einem Typen zusammengebracht, der sein Leben lang in Tulse Hill gewohnt hatte, aber unerklärlicherweise sprach, als wäre er in South Central L. A. geboren, und weil er seine coole Sonnenbrille nie abnahm, wusste man nie, was er dachte. Als Caffery bei ihm aufgekreuzt war, hatte er ihn in seine Küche geführt und ihm zwei Pistolen gezeigt, die er in einem Schuhkarton unter dem Plastiksack in seinem Pedalmülleimer aufbewahrte: eine Glock 17 und eine.45er AMT Hardballer aus Edelstahl, die so sehr glänzte, dass sich einem der Gedanke aufdrängte, sie als Schmuck zu tragen. Der Händler war fassungslos, als Caffery sich nicht auf die Hardballer stürzte, denn er persönlich war der Meinung, sie sei allererste Sahne und werde nicht lange rumliegen, weil der Nächstbeste, der hier durch die Tür käme, sie sich schnappen werde, wenn Caffery so dämlich sei, sie nicht zu nehmen. Am Ende hatte Caffery die schicke Waffe tatsächlich genommen – nicht weil sie ihm gefiel, sondern weil die Glock sich von der Standardpolizeiwaffe nicht unterschied, und auch wenn er nicht vorhatte, sich damit erwischen zu lassen, musste man mit allem rechnen. Eine Polizeiwaffe würde auf die falschen Leute hindeuten. Da war es besser, wenn sie ihn mit einer Waffe von der Straße schnappten, auch wenn sie ein peinlicher Klunker war.
Normalerweise verwahrte er die Hardballer unter dem Müllsack im Kücheneimer, denn wenn ihm an dem Dealer in Tulse Hill etwas imponiert hatte, dann war es die Auswahl dieses Verstecks. Er würde den Teufel tun und das verdammte Ding je benutzen, aber darum ging es auch gar nicht. Es ging darum, dass er – wie in dieser Woche – gelegentlich das Gefühl der Sicherheit brauchte, die es ihm gab. Einfach zu wissen, dass es da war.
Er klappte das Handschuhfach zu und schaute aus dem Fenster auf die Mauern, betrachtete noch einmal die Schatten und konzentrierte sich auf die in Hüfthöhe. Er hatte Powers nicht die ganze Geschichte erzählt, ihm nicht gesagt, dass er sich seit der Operation Norwegen ständig beobachtet fühlte. Wenn es nicht verrückt klänge, würde er sagen, der Tokoloshe verfolge ihn. Der Tokoloshe? In den Straßen von Bristol?
Es hatte in diesem Wagen angefangen. Vor mehr als einer Woche hatte er einmal spätnachts in einer verlassenen Gasse im Zentrum von Bristol geparkt, und da war jemand oder etwas auf den Wagen gesprungen und auf der Motorhaube gelandet. Es war so schnell wieder weg gewesen, dass er nicht hatte erkennen können, was es war, aber was er gesehen hatte, war klein gewesen, dicht am Boden, als es davonwieselte. So hatte es angefangen. Inzwischen war ihm, als sähe er das verdammte Ding überall. Im Schatten unter den Autos. Sogar im Spiegel, wenn er sich morgens rasierte.
Er schaute wieder auf die Uhr. Zehn Uhr fünfunddreißig. Nur ein Opfer hatte die Operation Norwegen überlebt. Am Tag der Festnahme hatte er eine wirre Aussage zu Protokoll gegeben, aber jetzt lag er im Southmead Hospital und kämpfte um sein Leben. Die Ärzte ließen niemanden in seine Nähe, vor allem nicht die Polizei, die ihn mit ihren Fragen überforderte.
Und was jetzt, du Arsch?, dachte Caffery.
5
Jeden Monat entdeckte die Unterwasser-Sucheinheit ein paar verweste Leichen. Eine verweste Leiche ist giftig. Eine Biogefährdung. Die Flüssigkeiten, die sie produziert, wenn der Unterleib platzt, können etliche durch Blut übertragene Krankheitskeime enthalten, und wenn die Leiche von Ratten angefressen wurde, bestehen noch weitere Gefahren, etwa die einer Infektion mit Leptospirose, der Weilschen Krankheit. Wenn die Leiche bewegt wird, kommt es vor, dass sie »seufzt«, als wäre sie wieder lebendig: Luft entweicht aus der Lunge, und sie kann Tuberkulosekeime enthalten. Die meisten britischen Polizeibehörden schreiben vor, dass der Umgang mit stark verwesten Leichen von Teams mit Atemschutzgeräten übernommen werden musste. Kurz gesagt, von den Tauchern. Auch wenn die Leiche auf trockenem Boden liegt.
Nach einer solchen Leichenbergung hielten Fleas Leute sich in ihrem Hauptquartier streng an die vorschriftsmäßige Reinigungsprozedur, und meist gelang es ihnen, dafür zu sorgen, dass es in ihren Räumen ganz annehmbar roch. Aber als sie an diesem Morgen um zehn in ihrem Büro saß und die Berichtsformulare ausfüllte, fiel ihr auf, dass etwas nicht stimmte. Sie schnupperte. Nicht schön. Sie steckte die Formulare in den Umschlag, stand auf und ging in den Korridor. Schnupperte noch einmal.
Nach dem Unfall mit der Atemluftleitung am Tag zuvor hatten die Sanitäter sie gleich untersucht, aber sie wollte sich nicht von ihnen mitnehmen lassen. Es ging ihr gut. Sie war gesund und kräftig. Um dies zu beweisen, hatte sie sich auf den Ponton fallen lassen und zwanzig Liegestütze gemacht. Nichts und niemand hatte sie dazu bewegen können, sich für den Rest des Tages in die Klinik zu begeben, und das war auch gut so, denn keine zwei Stunden später war das Team schon wieder hinausgerufen worden, um den zwei Zentner schweren Leichnam eines sechsundfünfzigjährigen Mannes abzuholen, der auf seiner Toilette in einem Mietshäuserblock in Redlands gestorben war. Da hatte er acht Tage gesessen, mit der Pyjamahose an den Fußknöcheln. Toiletten waren am schlimmsten, weil man sich dort meist nicht bewegen konnte. Drei Stunden hatten sie gebraucht, um ihn herauszuholen. Als sie wieder in die Basis zurückkehrten, hatten sie ihre Chemieschutzanzüge dekontaminiert, das heißt sie auf dem Boden ausgebreitet und mit langstieligen Bürsten abgeschrubbt, gespült und desinfiziert; sie hatten die Fünf-Phasen-Filter in den Atemmasken gewechselt und schließlich alles mit einer antibakteriellen Lösung eingesprüht. Streng nach Vorschrift.
Aber der Geruch des Mannes war noch da.
Flea ging in die Spindräume, wo das gesamte Team sich umzog. Sie war nicht entzückt darüber, dass sie alle von der Narkose am Tag zuvor wussten. Bis jetzt hatte noch niemand sie deshalb aufgezogen, aber das konnte noch kommen. »Was riecht hier so, Leute?«
»Ihr Bananenbrot?«
»Sehr komisch. Wir haben alles dekontaminiert. Es dürfte hier nicht so riechen.«
Wellard zuckte die Achseln. Die anderen schüttelten die Köpfe.
»Okay. Dann los.« Sie machte eine scheuchende Handbewegung. »Alle. Macht’s noch mal. Mit Janitol.«
Niemand rührte sich. Alle starrten sie nur an.
»Was ist los?«
»Wir haben’s schon gemacht. Noch mal. Als Sie im Büro waren. Zweimal sogar.«
»Zweimal? Woher kommt dann dieser verdammte Geruch?«
»Von Ihrem Bananenbrot?«
Sie ging in die Dekontaminationskammer, wo die Anzüge zum Trocknen hingen – gespenstisch, wie eine Reihe von Leuten, die nebeneinanderstanden – und schnupperte. Sie ging zurück in den Korridor und schnupperte wieder. Der Geruch war unverkennbar. Sie lief zu der Mülltonne, mit der sie die verseuchten Anzüge vom Einsatzort weggeschafft hatten, steckte den Kopf hinein und holte tief Luft. Wellard erschien neben ihr; er begleitete sie und sah zu, wie sie in den Tonnen nach den Plastiksäcken stöberte, in denen sie die gebrauchten Stiefelsocken und Handschuhe verstaut hatten.
»Das ist es nicht.« Er verschränkte die Arme. »Ich hab’s schon kontrolliert. Die Reinigung hat sie abgeholt.«
Sie richtete sich auf. »Ich kapituliere. Woher kommt es?«
»Keine Ahnung.«
Seufzend nahm sie eine grüne Schürze vom Haken und band sie sich um. »Und ich hatte vorgehabt, joggen zu gehen.«
»Sie sollten nicht joggen gehen. Nicht nach der Sache gestern.«
»Na, ich gehe ja auch nicht, oder? Ich habe gesagt, ich hatte es vor.« Sie zog die Nitrilhandschuhe an, pumpte Luft in die Sprühdose. »Stattdessen werde ich diese Anzüge reinigen. Noch einmal. Ich mache Ihre Arbeit.«
»Uuuh. Zickig?«
»Nicht zickig, Wellard. Hormonal gesteuert. Ich bin eine Frau. Ich habe Eierstöcke. Mein Benehmen ist hormonal gesteuert.« Sie ging zum Lagerraum und holte ein paar Sachen heraus. Einen Druckluftzylinder, einen Schlauch. »Kommen Sie her.«
Er sah den Luftschlauch an. »Du lieber Himmel, Boss. Ich hab’s nicht so gemeint.«
»Geben Sie mir Ihre Hand.«
»Machen Sie es wenigstens kurz.«
»Stecken Sie den« – sie klatschte ihm den Schlauch auf die flache Hand – »auf das Ventil. So ist es richtig. Braver Junge. Und während ich jetzt noch einmal alles dekontaminiere, gehen Sie durch das Gebäude und riechen an den Abflüssen. Wenn irgendwas stinkt, spülen Sie es mit Wasser durch. Wenn etwas verstopft ist, nehmen Sie das da.«
»Druckluft? Für die Abflüsse? Sarge, wir haben hier irgendwo einen Hausmeister, da bin ich ganz sicher. Das ist ein netter Mann. Der hat sicher Spiralen für so was. Die sind besser als Druckluft.«
»Wellard?«
»Ja?«
»Machen Sie es einfach, ja?«
Die Arctic-Monkeys-CD lag im Player. Flea schaltete ihn ein, drehte die Lautstärke hoch und stürzte sich in die Arbeit. Sie schrubbte und sprühte, spülte Wasser in den Abfluss. Die Nabelschnur, die gestern gerissen war, steckte in einem gelben Nylonbeutel, der an der Wand lehnte und darauf wartete, dass das Labor der Sicherheitsabteilung ihn abholte. Das konnte Monate dauern. Das Labor würde die Leitung einer Reihe von Tests unterziehen, um herauszufinden, was da schiefgegangen war und wie sie es geschafft hatte, einfach so ein Loch in beide Kabel zu scheuern. Für einen Augenblick blieb sie davor stehen.
Es war unerklärlich. Sie hatte immer gedacht, diese Schläuche seien so ziemlich bombensicher, und fühlte sich unbehaglich und ziemlich dämlich, weil sie ihre Ausrüstung nicht kontrolliert hatte. Es war so knapp gewesen. Langsam kam es ihr so vor, als hätte sie eine Pechsträhne. Da war die Sache von gestern und die vom Dienstag, wo sie mit den Leuten von der MCIU in eine höllische Festnahmeaktion, die Operation Norwegen betreffend, geraten war, die das Teammitglied, das sich jetzt im Sonderurlaub befand, beinahe nicht überstanden hätte. Gar nicht zu reden von dem Tag davor, als sie wieder einmal gezwungen gewesen war, Thom zu decken, der eines Nachts sturzbetrunken zurückgekommen war – am Steuer ihres Wagens und verfolgt von einem Streifenwagen. Weil sie immer wieder auf ihren Bruder hereinfiel, hatte sie ihn gerettet; sie hatte dem pedantischen Streifenpolizisten geschworen, sie habe den Wagen gefahren, und sogar einen Alkoholtest gemacht. Thom war zum hundertsten Mal um Haaresbreite davongekommen. Sie fragte sich, ob er jemals würde auf eigenen Füßen stehen können. Und wie lange würde sie es noch schaffen, ihn durchzuziehen?
Sie kramte die weißen Gummistiefel hervor, die das Team bei Leichenbergungen trug, und krempelte sie von innen nach außen, um nachzusehen, ob vielleicht Körperflüssigkeiten in das saugfähige Innere gesickert waren. Als sie beim letzten Paar angekommen war, erschien Wellard in der Tür. Sie wischte sich über die Stirn und ließ die Stiefel resigniert fallen.
»Ich gebe auf. Ich habe alles versucht. Als Nächstes muss ich alle Ihre Ausrüstungstaschen durchsuchen und mir eklige Männerunterwäsche ansehen. Socken und solches Zeug. Was haben Sie zu berichten, Mr. Rohrfrei?«
»Die Abflüsse sind tadellos sauber. Hat aber auch keinen Sinn, sich jetzt weiter den Kopf darüber zu zerbrechen.«
»Hä?«
»Das Telefon hat wie blöd geklingelt. Sie hatten die Musik zu laut.«
»Wer hat angerufen?«
»Ihr freundlicher Fahndungsberater Pearce. Hat wieder eine Leiche. Noch mehr Überstunden.«
»Ach ja?«
6
Steinbruch Nummer acht lag verlassen da. Caffery stand neben seinem Wagen und betrachtete die Wattewolken und den blauen Himmel im Spiegel des stillen, kalten Wassers. Am oberen Ende des Steinbruchs, an dem flachen Rand, den das Wasser noch nicht erreicht hatte, lagen zwei alte Kabinenkreuzer auf der Seite, miteinander verbunden durch eine rostige Ankerkette. Am anderen Ende lagerten riesige graue Quaderblöcke, die man zurückgelassen hatte, in braunen Wasserpfützen. Sommerflieder wuchs auf den Hängen des Abraums zu allen Seiten.
Caffery schloss den Wagen ab, rückte sein Jackett zurecht, ging zum Rand des Steinbruchs und schaute ins Wasser, das klar und dämmrig blau war. Embryonische Pflanzen hingen wie ein gelblicher Dunst am Gestein unter Wasser, und in etwa fünf Metern Tiefe erkannte er verschwommene, groteske Umrisse; vielleicht war es ein Felsblock oder eine versunkene Pumpe, vielleicht auch die zerklüftete Wand des Steinbruchs.
Die Afrikaner glaubten, der Tokoloshe sei ein Flussbewohner. Sie glaubten, er halte sich dort am Ufer auf, baue Nester in den Binsen und könne stundenlang unter Wasser bleiben. Was immer die Zeugen in Bristol gesehen hatten, in einem stimmten sie alle überein: Es war aus dem Wasser gekommen, aus dem Fluss, aus einem See, einmal sogar aus dem Floating Harbour in Bristol. Sie beteuerten, es sei einfach »aufgetaucht«, als hätte es sich eine Weile unter Wasser aufgehalten, habe dort träge auf dem Grund gelegen und sich im Schlick gewälzt wie ein zufriedenes Krokodil. Und es habe kein Atemgerät getragen; da waren die Zeugen sich einig: Das teuflische Gesicht war nackt gewesen. Wie um alles in der Welt hatte die Bande es zuwege gebracht, diesen Eindruck langen Tauchens zu erwecken?
Caffery richtete sich auf und ließ einen Blick hinüber zu den Zementstaubhalden wandern. Die Sonne war hinter einer Wolke verschwunden, und eine Zeit lang schien es, als hinge etwas Schweres über dem Wasser – als wäre die Luft selbst dunkler geworden. Ben Jakes hatte sich dort auf einer der Halden umgebracht. Im Gebüsch baumelte noch ein Stück vom polizeilichen Absperrband, und daneben lag ein welker Blumenstrauß in Zellophan, den seine Studienkollegen dort abgelegt hatten. In den letzten vier Jahren hatte es hier zehn weitere Suizidfälle gegeben. So war das mit Selbstmorden: Sie breiteten sich aus wie ein Virus. Jemand springt von einer Brücke, und kurze Zeit später ist es die »Selbstmörderbrücke«, und Leute, die bis dahin nie von ihr gehört hatten, fahren die ganze Nacht hindurch mit dem Auto, nur um auch dort herunterspringen zu können. So war es auch mit diesem Steinbruch, nur dass sich hier niemand hinunterstürzte. Sie saßen am Rand mit ihren Tabletten und ihren Rasierklingen, und wahrscheinlich schauten sie zu den Sternen empor.
Jakes’ Telefon war immer noch nicht aufgetaucht, aber dasselbe Team, das auch am Fall Kitson arbeitete, hatte das Signalraster analysiert und ermittelt, dass die beiden Anrufe nach seinem Tod irgendwo hier in der Nähe getätigt worden waren. Die gewählte Nummer war eine, die Jakes noch nie benutzt hatte. Caffery hatte sie vom Büro aus angerufen und festgestellt, dass der Anschluss nicht mehr existierte. Es war ein Wegwerfhandy gewesen, ein »Pay As You Go«-Telefon, und Caffery ging davon aus, dass es schon irgendwo in einem Müllschlucker gelandet war.
Er hob einen Stock auf, ging um den Rand des Steinbruchs herum und schlug dabei immer wieder auf das Gestrüpp; man hatte das ganze Gelände abgesucht, nachdem Jakes’ Leiche gefunden worden war, aber Caffery wollte sichergehen, dass man nichts übersehen hatte – kein Versteck, keinen Hinweis darauf, dass sich noch jemand hier aufgehalten und vielleicht aus dem Gebüsch Jakes’ Sterben beobachtet hatte. Er suchte noch einmal jeden Zentimeter ab, stocherte im Unterholz herum, und nach einer Stunde fand er einen Motorroller, der auf der Seite im Gebüsch lag.
Jemand hatte sich bemüht, ihn zu verstecken; Caffery musste sich bücken und Zweige zerbrechen, um an ihn heranzukommen. Er zog ihn ans Licht, stellte ihn aufrecht hin und schüttelte ihn kurz. Er wies eine Steuerplakette auf, und im Tank schwappte Benzin. Jakes hatte keinen Roller besessen, das wusste Caffery genau. Er nahm einen Stift aus der Tasche und drückte den Bremssattel zurück. An den Bremsscheiben befand sich kein Rost: Das Ding war in den letzten vierundzwanzig Stunden gefahren worden. Er legte es wieder auf den Boden, klopfte sich den Schmutz von den Händen und wollte gerade wieder zu seinem Wagen zurückgehen, als er noch etwas entdeckte.
Etwa drei Schritte weiter rechts von ihm hatte sich etwas Blauweißes an den Wurzeln eines Sommerfliederbuschs verheddert. Es war ein Stück Absperrband. Er ging hin und zog daran, und dann sah er ein Stück blaues Butyl, das am Boden lag. Es war ein Stückchen Schlauch, vielleicht fünfundzwanzig Zentimeter lang. Er hob es auf und betrachtete es. Im Abstand von sieben Zentimetern waren Buchstaben hineingestanzt: USU – Underwater Search Unit. Er kannte die Unterwasser-Sucheinheit und ihren Sergeant Flea Marley. Sie war Leiterin des Unterstützungsteams gewesen, als er die Razzia bei der Operation Norwegen durchgeführt hatte. Als Caffery hierher ins West Country gezogen war, hatte er einen Entschluss gefasst: Er hatte in London das eine oder andere Leben zerstört, und er würde es nicht noch einmal tun. Es würde in seinem Leben keine Frauen mehr geben. Nicht ohne dass er vorher ernsthaft darüber nachdachte. Aber er hatte sich nicht vorgenommen nicht mehr hinzuschauen, wenn jemand hübsch war.
Er zog sein Telefon heraus und rief in Kingswood an. DC Turnbull, einer der Männer, die Powers ihm zugeteilt hatte, meldete sich. »Ich wollte Sie gerade anrufen«, sagte der Constable eifrig. »Hab zwei Neuigkeiten für Sie. Zunächst mal: der Tansanier in der U-Haft, der uns dauernd erzählt, er heißt Johnny Brown. Wir haben einen Namen. Clement Chipeta. Interpol hatte ihn in Daressalam im Visier, bis er vor ungefähr einem Jahr von ihrem Radarschirm verschwand. Muss da ziemlichen Ärger gehabt haben, nicht bloß mit der Polizei, sondern auch mit der Bande, für die er arbeitete.«
»In welcher Branche?«
»Illegale Dealerei. Sie haben Zutaten für die traditionelle Medizin verkauft, die hauptsächlich von gefährdeten Arten stammten, aber teilweise auch von Menschen. Deshalb hatten die Muppets von der Operation Norwegen wahrscheinlich auch Verwendung für ihn, als er hier aufkreuzte.«
»Haben Sie die Kollegen im Zellentrakt informiert?«
»Natürlich.«
»Okay.« Er wandte sich vom Steinbruch ab und steckte einen Finger ins Ohr, damit er bei der miserablen Verbindung besser hören konnte. »Passen Sie auf, Turnbull, Sie müssen dreierlei für mich tun. Machen Sie eine Computeranfrage zu folgendem Kennzeichen, ja?«
Er nannte ihm die Nummer des Motorrollers und hörte, wie Turnbull sie in den Computer eintippte.
»Und wenn Sie das erledigt haben, gehen Sie online, und finden Sie was für mich raus. Schon mal was von Freediving gehört?«
»Freitauchen? Sorry, Boss, ich bin aus Birmingham. Wir machen nichts mit Meer und Wasser und Flüssen. Wir lieben unseren Beton.«
»Googeln Sie, wenn wir hier fertig sind. Ich will wissen, wie lange jemand den Atem anhalten, wie lange man unter Wasser bleiben kann.«
»Freediving …« Er konnte fast hören, wie Turnbull die Stirn runzelte. Der Computer piepste. »Ihre Anfrage. Der Roller ist als gestohlen gemeldet.«
»Wann?«
»Letztes Wochenende. Aus einer Einfahrt drüben in Bradley Stoke. Mehr hab ich nicht.«
»Okay. Sie können ihnen sagen, dass ich ihn gefunden habe. Und dann sprechen Sie mit jemandem von der Unterstützungseinheit. Stellen Sie fest, was das Unterwasser-Suchteam in Steinbruch Nummer acht gemacht hat, in der Gegend von Elf’s Grotto.«
Schweigen.
»Sind Sie noch da, Turnbull? Rufen Sie da jemanden an.«
»Das brauch ich nicht, Boss. Ich kann Ihnen sagen, was das Suchteam da gemacht hat. Sie haben eine Vermisste gesucht. Gestern.«
»Und, haben sie sie gefunden?«
7
Lucy Mahoney wurde seit drei Tagen vermisst. Nach dem Zustand ihrer Leiche zu urteilen, war sie davon die meiste Zeit tot gewesen. Wanderer hatten sie gefunden, draußen im Hügelland der Mendips, an der Böschung der Strawberry Line, einer stillgelegten Eisenbahnstrecke, die in viktorianischer Zeit für den Transport der Erdbeeren von den Feldern bei Cheddar benutzt worden war. Die Landschaft dort war hübsch; auf den Leinsaatfeldern blühte schon der Mohn, und darüber hing der Pollendunst. Aber an der Leiche war nichts Hübsches: Schon aus hundert Metern Entfernung sah man die Wolke von Fliegen, die darüber schwebte, und den dunklen Haufen aus Kleidern und Haut.
Sie lag auf dem Rücken, gekleidet in einen auffallenden gestreiften Pullover, einen Rock und geblümte, von Laub bedeckte Doc Martens, und sie war bereits so weit verwest, dass ein paar Knochen durch die verfärbte Haut ragten. Flea leitete das Team beim Bergen der Toten. Sie wedelten die Fliegen weg, zogen vorsichtig an der Leiche, um sie aus den klebrigen Flüssigkeiten am Boden zu lösen, rollten sie in ein Leintuch und hoben sie in einen weißen Leichensack – mit dem Gesicht nach oben, weil sie es im Leichenschauhaus nicht ausstehen konnten, wenn die Toten bäuchlings eingeliefert wurden. Lucy Mahoney war eine kräftige Frau gewesen, und selbst im Zustand der Verwesung war es anstrengend, sie hochzuheben. Die Leute in den Schutzanzügen schwitzten; Flea sah, wie das Wasser in Strömen über Wellards Gesicht lief.
Flea hatte Belobigungen für ihre Arbeit erhalten. Zweimal schon. Dabei war sie erst neunundzwanzig. Sie hatte große Angst, sie könne sie nur bekommen haben, weil sie eine Frau war, und sie sei auch nur deshalb Sergeant und Leiterin ihrer Einheit geworden. Und wegen dieser Angst neigte sie zum Überkompensieren ihrer zierlichen Gestalt. Sie quälte sich bis zur völligen Erschöpfung durch irrsinnige Trainingsprogramme, lief zehn Meilen am Tag oder stemmte bis tief in die Nacht hinein Gewichte – schwere Gewichte, wenig Wiederholungen -, und das Tag für Tag. Unter Wasser waren alle gleich. An Land musste sie zweimal so hart arbeiten, um mitzuhalten.
Sie versiegelten den Leichnam in einem gelben Biogefahrensack – Größe XL, weil Leichen manchmal auf den doppelten Umfang anschwollen – und schleppten ihn eine Viertelmeile weit bis zum Treffpunkt; unterwegs hielten sie immer wieder an, um sich auszuruhen und die Seiten zu wechseln. Ab und zu hielt sie Ausschau nach Teleobjektiven außerhalb der Absperrung: Vielleicht warteten Reporter auf die Gelegenheit, sie und die Jungs zu fotografieren, von Kopf bis Fuß mit Körperflüssigkeiten beschmiert.
Der Parkplatz stand voller Autos. Der Krankenwagen des Coroners war da – zwei Männer in grauen Anzügen mit schwarzen Krawatten standen daneben und rauchten -, und die Leiterin der kriminaltechnischen Abteilung, eine Frau in Jeans und einem roten Kanada-Sweatshirt, saß in der offenen Tür ihres Wagens und trank eine Tasse Tee. Flea half mit, die Trage in den Wagen der Rechtsmedizin zu schieben, warf ihr Atemgerät in eine kleine Rädertonne und ließ sich neben dem Mercedes Sprinter ihrer Einheit von Wellard mit Bleichlösung abspritzen, und erst dann fiel ihr noch jemand auf.