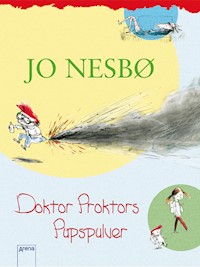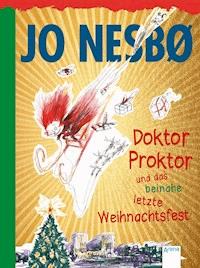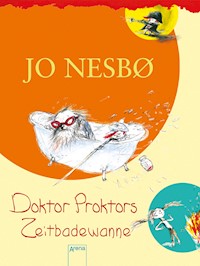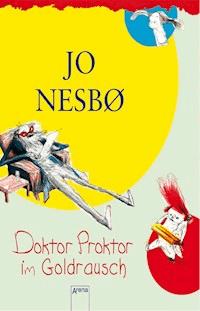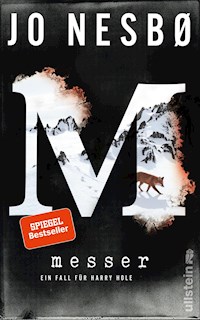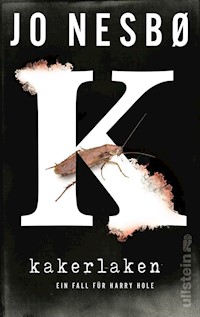9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Roger Brown genießt als Headhunter in Wirtschaftskreisen einen exzellenten Ruf. Was niemand weiß: Er raubt seine Klienten aus, bringt sie um ihre Kunstwerke. Auf einer Vernissage lernt Brown den Holländer Clas Greve kennen. Greve scheint ihm die perfekte Besetzung als Geschäftsführer eines GPSUnternehmens. Die Männer kommen ins Geschäft, und so erfährt Brown, dass Greve einen lange verloren geglaubten Rubens besitzt. Am nächsten Tag stiehlt Brown das wertvolle Gemälde. Doch Greve erweist sich als hartnäckiger Gegner. Eine gnadenlose Verfolgungsjagd beginnt. Entdecken Sie auch MESSER, den neuen großen Kriminalroman um Kommissar Harry Hole!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Jo Nesbø
Headhunter
Thriller
Aus dem Norwegischen
von Günther Frauenlob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internetwww.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder
Übertragung können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage August2010
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin2010
© Jo Nesbø2008
Satz: LVD GmbH, Berlin
ISBN978-3-548-92017-7
Prolog
Eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen ist ganz einfache Physik. Alles ist dem Zufall überlassen, doch sämtliche Zufälle lassen sich in der Gleichung »Kraft mal Zeit = Masse mal Geschwindigkeitsänderung« in einen logischen Zusammenhang bringen. Setzt man die Zufälle in diese Gleichung ein, bekommt man eine ebenso einfache wie gnadenlose Geschichte. Eine Geschichte, die einem vielleicht erklärt, was geschieht, wenn ein voll beladener Lastzug mit25Tonnen Gewicht und einer Geschwindigkeit von80km/h mit einemPkwmit1800kg Gewicht und gleicher Geschwindigkeit zusammenstößt. Ausgehend von Zufällen wie Treffpunkt, Beschaffenheit der Karosserie oder der Position der Körper zueinander gibt es unzählige Varianten. Doch etwas haben all diese Varianten gemeinsam: Es sind Tragödien. Und derPkwhat definitiv ein Problem.
Es ist merkwürdig still, ich höre den Wind in den Bäumen und das Rauschen des Flusses. Mein Arm ist gelähmt, und ich hänge irgendwie kopfüber eingeklemmt zwischen Fleisch und Stahl. Vom Türholm über mir tropfen Blut und Benzin. Auf dem karierten Autodach unter mir liegen eine Nagelschere, ein abgerissener Arm, zwei tote Menschen und ein offenes Beautycase. Die Welt kennt keine Schönheit, nur Beauty. Die weiße Prinzessin existiert nicht mehr, ich bin ein Mörder, und in diesem Auto atmet niemand mehr. Auch ich nicht, deshalb werde ich bald sterben. Die Augen schließen und aufgeben. Aufgeben ist ein gutes Gefühl. Ich bin das Warten leid. Und deshalb eilt es, diese Geschichte zu erzählen, diese Variante von der Position zweier Körper zueinander.
Teil I
Erstes Gespräch
Kapitel 1
Der Bewerber
Der Bewerber war nervös.
Er trug eine Rüstung von Herrenausstatter Gunnar Øye: einen grauen Ermenegildo-Zegna-Anzug, ein handgenähtes Hemd von Borelli und einen burgunderroten Schlips mit Samenzellenmuster, vermutlich Cerruti1881. Bei den Schuhen war ich mir jedoch ganz sicher, das waren handgenähte Ferragamo. So ein Paar hatte ich selbst einmal besessen.
Die Unterlagen vor mir besagten, dass der Bewerber ein Top-Examen der Norwegischen Handelshochschule in Bergen vorzuweisen hatte, eine Amtszeit als Parlamentsabgeordneter der Bürgerlichen Partei und eine vierjährige Erfolgsstory als Leiter eines mittelgroßen norwegischen Industrieunternehmens.
Trotzdem war Jeremias Lander nervös. Auf seiner Oberlippe glänzte der Schweiß.
Er griff nach dem Wasser, das meine Sekretärin ihm hingestellt hatte.
»Ich möchte …«, begann ich und lächelte. Nicht das offene, bedingungslose Lächeln, mit dem man einen Fremden ins Haus bittet, in die Wärme. Nicht dasunseriöse, sondern das höfliche, unverbindliche Lächeln, das laut Fachliteratur die Kompetenz des Gesprächsleiters zum Ausdruck bringt und seine Objektivität und analytischen Fähigkeiten betont. Das fehlende gefühlsmäßige Engagement des Fragenden lässt den Bewerber auf dessen Integrität vertrauen, wodurch er – auch wieder laut Fachliteratur – nüchterner und objektiver Auskunft gibt. Man vermittelt ihm damit das Gefühl, dass man jegliche Schauspielerei und Übertreibung durchschaut und dass jedes Taktieren bestraft wird. Aber ich lächle nicht so, weil es die Fachliteratur so empfiehlt. Dieser Berg mehr oder weniger qualifizierter Bullshit ist mir egal, ich halte mich bloß an das neunstufige Befragungsmodell von Inbaud, Reid und Buckley. Und ich lächle so, weil ich sobin:professionell, analytisch und ohne gefühlsmäßiges Engagement. Ich bin Headhunter. Das ist nicht sonderlich schwer. Aber ich bin der beste von allen.
»Ich möchte«, wiederholte ich, »… dass Sie mir als Nächstes von Ihrem Leben außerhalb der Arbeit erzählen.«
»Gibt es so etwas?« Sein Lachen lag anderthalb Töne höher, als es sollte. Wenn man einen derart trockenen Witz in einem Bewerbungsgespräch macht, sollte man es vermeiden, selbst zu lachen, dabei sein Gegenüber anzustarren und auf eine Reaktion zu hoffen.
»Das hoffe ich doch«, sagte ich, woraufhin sein Lachen in ein Räuspern überging. »Ich glaube, die Leitung des Unternehmens legt Wert darauf, dass der neue Geschäftsführer ein ausgeglichenes Leben führt. Sie suchen jemanden, der ein paar Jahre bleibt, einen Langstreckenläufer, der sich seine Zeit einzuteilen weiß. Nicht jemanden, der nach vier Jahren ausgebrannt ist.«
Jeremias Lander nickte und trank noch einen Schluck Wasser.
Er war etwa14Zentimeter größer als ich und drei Jahre älter. Also38. Etwas zu jung für den Job. Und das wusste er, nur deshalb hatte er sich die Haare an den Schläfen unauffällig grau getönt. Ich sah so etwas nicht zum ersten Mal. Hatte schon Bewerber erlebt, die derart unter schwitzenden Händen litten, dass sie sich ein bisschen Kalk in die rechte Jackentasche gestreut hatten und mir den trockensten, weißesten Händedruck aller Zeiten boten. Landers Hals gab einen unfreiwilligen Gluckslaut von sich. Ich notierte auf meinem Fragebogen:MOTIVIERT, LÖSUNGSORIENTIERT.
»Sie wohnen also hier in Oslo?«, fragte ich.
Er nickte. »Skøyen.«
»Und Sie sind verheiratet mit …« Ich blätterte durch die Unterlagen und setzte die irritierte Miene auf, die den Bewerbern signalisiert, dass sie jetzt die Initiative übernehmen sollen.
»Camilla. Wir sind seit zehn Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Sie gehen zur Schule.«
»Und wie würden Sie Ihre Ehe charakterisieren?«, fragte ich, ohne aufzublicken. Ich gab ihm zwei lange Sekunden Zeit, und als ich bemerkte, dass er sich noch nicht gesammelt hatte und mir die Antwort schuldig bleiben würde, fuhr ich fort: »Glauben Sie, dass Sie noch immer zusammen sind, wenn Sie die nächsten sechs Jahre zwei Drittel ihres wachen Lebens mit der Arbeit verbringen?«
Ich blickte auf. Sein Gesicht strahlte die erwartete Verwirrung aus. Ich war mit voller Absicht inkonsequent gewesen. Ausgeglichenes Leben. Totaler Anspruch. Das passte nicht zusammen. Es vergingen vier Sekunden, bis er antwortete. Mindestens eine Sekunde zu viel.
»Das hoffe ich doch.«
Sicheres, routiniertes Lächeln. Aber nicht routiniert genug. Nicht für mich. Er hatte meine eigenen Worte verwendet, und ich hätte ihm das als Pluspunkt angerechnet, wäre die Ironie beabsichtigt gewesen. In diesem Fall handelte es sich aber nur um das unbewusste Nachäffen einer Person, die er als überlegen einstufte.SCHLECHTES SELBSTBILD, notierte ich. Und er »hoffte« – das hieß, er war sich nicht sicher, skizzierte keine Visionen, blickte in keine Kristallkugel und schien sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass eine der Mindestanforderungen an eine Führungsperson darin bestand, jederzeit den Eindruck hellseherischer Fähigkeiten vermitteln zu können.
KEIN IMPROVISATIONSTALENT. KEIN CHAOSPILOT.
»Arbeitet sie?«
»Ja, in einer Anwaltskanzlei im Zentrum.«
»Jeden Tag, von neun bis vier?«
»Ja.«
»Und wer bleibt zu Hause, wenn eines der Kinder krank ist?«
»Sie. Aber das passiert zum Glück höchst selten, Niclas und Anders sind …«
»Sie haben also keine Haushaltshilfe oder sonst irgendjemanden, der Ihnen tagsüber zur Hand geht?«
Er zögerte, wie es Bewerber tun, wenn sie unsicher sind, welche Antwort die richtige ist. Trotzdem lügen sie enttäuschend selten. Jeremias Lander schüttelte den Kopf.
»Sie sehen so aus, als würden Sie etwas für Ihre Fitness tun?«
»Ja, ich treibe regelmäßig Sport.«
Dieses Mal kein Zögern. Jeder weiß, dass Firmen keine Manager wollen, die bei den ersten Schwierigkeiten einen Herzinfarkt bekommen.
»Jogging und Langlauf vielleicht?«
»Ja, die ganze Familie ist gern auf dem Land. Und wir haben eine Hütte im Norefjell.«
»Ah ja, dann haben Sie sicher auch einen Hund.«
Er schüttelte den Kopf.
»Nicht? Sind Sie allergisch?«
Energisches Kopfschütteln. Ich notierte mir:EVENTUELL ETWAS HUMORLOS.
Dann lehnte ich mich zurück und legte die Fingerspitzen der beiden Hände aneinander. Natürlich eine übertrieben arrogante Geste. Was soll ich sagen? Ich bin so.
»Was meinen Sie, welchen Wert hat Ihr Renommee, Lander? Und wie sind Sie versichert?«
Er zog seine bereits verschwitzte Stirn in Falten und versuchte, meine Frage zu verstehen. Nach zwei Sekunden fragte er resigniert:
»Wie meinen Sie das?«
Ich seufzte, als läge das auf der Hand. Sah mich um, als suchte ich nach einer pädagogischen Allegorie, auf die ich noch nicht zurückgegriffen hatte. Und fand sie schließlich wie immer an der Wand.
»Interessieren Sie sich für Kunst, Lander?«
»Nicht sehr. Aber meine Frau.«
»Meine auch. Sehen Sie das Bild dort?« Ich zeigte auf »Sara gets undressed«, ein mehr als zwei Meter hohes Gemälde auf Latex, das eine Frau in einem grünen Rock darstellte, die sich gerade einen roten Pullover über den Kopf zog. »Ein Geschenk von meiner Frau. Der Künstler heißt Julian Opie, und das Bild ist eine Viertelmillion Kronen wert. Haben Sie irgendwelche Kunstwerke in dieser Preisklasse?«
»Ja, die habe ich tatsächlich.«
»Gratuliere. Sieht man diesen Bildern auch an, wie viel sie wert sind?«
»Eine gute Frage.«
»Nicht wahr? Das Bild dort drüben besteht aus ein paar wenigen Strichen, der Kopf der Frau ist ein bloßer Kreis, eine Null ohne Gesicht, und die Farbgebung ist monoton und ohne Textur. Es ist überdies auf einem Computer erstellt worden und könnte durch einen einfachen Tastendruck millionenfach ausgedruckt werden.«
»Wow.«
»Das Einzige – und es gibt wirklich keinen anderen Grund – das Einzige, was dieses Bild so wertvoll macht, ist das Renommee des Künstlers. Sein Ruf. Das Vertrauen des Marktes in die Genialität dieses Mannes. Dabei ist es schwierig, diese Genialität konkret zu beschreiben, nichts ist sicher. So ist das auch mit Führungspersönlichkeiten, Lander.«
»Ich verstehe. Renommee. Es geht um das Vertrauen, das ein Chef weckt.«
Ich notierte:KEIN IDIOT.
»Genau«, fuhr ich fort. »Davon hängt alles ab. Nicht nur der Lohnscheck, sondern auch der Börsenwert eines Unternehmens. Darf ich fragen, was für ein Kunstwerk Sie haben und wie viel es wert ist?«
»Es ist eine Lithographie von Edvard Munch. ›Die Brosche‹. Den genauen Preis kenne ich nicht, aber …«
Ich wedelte ungeduldig mit der Hand.
»Bei der letzten Auktion lag der Preis etwa bei350000Kronen«, sagte er.
»Und wie haben Sie diesen Wertgegenstand gegen Diebstahl versichert?«
»Das Haus hat eine gute Alarmanlage«, sagte er. »Tripolis. Die haben alle in der Nachbarschaft.«
»Tripolis ist gut, aber teuer, ich benutze das System selbst«, sagte ich. »Etwa8000im Jahr. Und wie viel lassen Sie sich die Sicherheit ihres persönlichen Renommees kosten?«
»Wie meinen Sie das?«
»20000?10000? Weniger?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Keinen roten Heller«, sagte ich. »Ihr Lebenslauf und Ihre Karriere sind zehnmal mehr wert als das Bild, von dem Sie sprechen. Pro Jahr. Trotzdem lassen Sie all das von niemandem versichern, weil Sie es für unnötig halten. Sie glauben, die Resultate der Gesellschaften, die Sie leiten, sprächen für sich. Nicht wahr?«
Lander antwortete nicht.
»Nun«, sagte ich, beugte mich vor und senkte die Stimme, als wollte ich ihm ein Geheimnis anvertrauen. »So ist es nicht ganz. Ihre Resultate sind Opie-Bilder, ein paar simple Striche, ergänzt durch ein paar Nullen ohne Gesicht. Bilder sind nichts, das Renommee ist alles. Und das ist es, was wir anbieten.«
»Renommee?«
»Sie sitzen hier vor mir als einer der sechs besten Kandidaten für eine Führungsposition. Ich glaube nicht, dass Sie diese Position bekommen werden. Weil Ihnen das Renommee für einen solchen Job fehlt.«
Er öffnete den Mund, als wollte er protestieren. Aber er tat es nicht. Ich ließ mich mit meinem ganzen Gewicht zurückfallen, so dass die hohe Lehne meines Stuhles aufschrie.
»Mein Gott, Sie haben sich um diese Stelle beworben! Wissen Sie, was Sie hätten tun sollen? Sie hätten einen Strohmann bitten sollen, uns auf Sie aufmerksam zu machen, und dann, wenn wir mit Ihnen Kontakt aufgenommen hätten, so tun, als wüssten Sie von nichts. Ein Topmanager muss von Headhuntern akquiriert werden und darf sich nicht selbst anbieten.«
Ich sah, dass meine Worte die beabsichtigte Wirkung nicht verfehlten. Er war zutiefst erschüttert. Meine Äußerung passte nicht ins übliche Schema, hatte nichts zu tun mit Cuté, Disc oder einem der anderen unbrauchbaren Fragenkataloge, die von mehr oder minder stumpfsinnigen Psychologen erarbeitet worden waren, oder von Human-Ressource-Spezialisten, denen eben diese Ressource fehlte. Ich senkte die Stimme wieder.
»Ich hoffe, Ihre Frau ist nicht allzu enttäuscht, wenn Sie ihr heute Nachmittag erzählen, dass der Traumjob geplatzt ist. Dass Ihre Karriere in diesem Jahr auf Stand-by geschaltet ist. Wie schon letztes Jahr …«
Er zuckte zusammen. Volltreffer. Natürlich. Denn hier war Roger Brown in Aktion, der hellste Stern, der zurzeit am Headhunterhimmel leuchtete.
»Le… letztes Jahr?«
»Ja, das ist doch richtig, oder? Sie haben sich bei Denja um den Chefsessel beworben. Mayonnaise und Leberwurst, ist das Ihre Kragenweite?«
»Ich dachte, so etwas wäre vertraulich«, sagte Jeremias Lander leise.
»Das ist es auch. Mein Job bedarf aber einer gewissen Recherche. Und ich pflege meine Aufgaben zu erfüllen. Mit allen Methoden, die mir zur Verfügung stehen. Es ist dumm, sich um Stellen zu bemühen, die man nicht bekommt. Besonders in Ihrer Position, Lander.«
»In meiner Position?«
»Ihre Unterlagen, Ihre Resultate, die Tests und der persönliche Eindruck, den ich von Ihnen bekommen habe, sagen mir, dass Sie alles haben, was man für diese Position braucht. Ihnen fehlt bloß das Renommee. Und will man sich ein Renommee aufbauen, basiert das in erster Linie auf Exklusivität. Sich aufs Geratewohl einen Job zu suchen, untergräbt diese Exklusivität. Sie sind eine Führungskraft, die keine kleineren Herausforderungen sucht, sondern die eine, ultimative Aufgabe. Sie suchen den Job Ihres Lebens. Und der muss Ihnen angeboten werden, auf einem Silbertablett.«
»Tatsächlich?«, fragte er und versuchte sich noch einmal an einem kecken, leicht schiefen Grinsen. Es wirkte nicht mehr.
»Ich hätte Sie gerne in unserem Stall. Sie bewerben sich nicht mehr. Sie sagen nicht zu, wenn Sie von anderen Headhuntern angerufen und mit vermeintlich lukrativen Angeboten gelockt werden. Sie halten sich an uns. Verhalten sich exklusiv. Lassen Sie uns Ihr Renommee aufbauen. Und es bewachen. Lassen Sie uns das sein, was Tripolis für Ihr Haus ist. Innerhalb von zwei Jahren kommen Sie mit einem besseren Job als dem, über den wir heute reden, nach Hause zu Ihrer Frau. Das verspreche ich Ihnen.«
Jeremias Lander strich sich mit Daumen und Zeigefinger über das sorgsam rasierte Kinn. »Hm. Das nimmt jetzt eine ganz andere Richtung, als ich erwartet hatte.«
Die Niederlage hatte ihn ruhiger werden lassen. Ich beugte mich zu ihm vor. Breitete die Arme aus. Hielt die Handflächen hoch. Suchte seinen Blick. Forscher haben nachgewiesen, dass78 Prozent des ersten Eindrucks in einer Bewerbungssituation auf Körpersprache basieren und nicht auf dem, was man sagt. Der Rest geht zurück auf Kleidung, Achselschweiß, Mundgeruch und das, was an den Wänden hängt. Ich hatte eine phantastische Körpersprache. Und genau in diesem Moment strahlte ich Offenheit und Vertrauen aus. Endlich ließ ich ihn herein in die Wärme.
»Hören Sie, Lander. Morgen kommen der Vorstandsvorsitzende und der kaufmännische Geschäftsführer eines unserer Kunden hierher, um einen anderen Kandidaten zu treffen. Ich möchte, dass diese beiden auch Sie treffen. Passt es Ihnen um zwölf Uhr?«
»Ausgezeichnet.« Er hatte geantwortet, ohne so zu tun, als müsste er erst einen Kalender konsultieren. Das machte ihn mir sofort sympathischer.
»Ich möchte, dass Sie gut zuhören, was diese Männer zu sagen haben, und Ihnen dann erklären, warum Sie sich nicht mehr für die Stelle interessieren. Sagen Sie ihnen, dass das nicht die Herausforderung ist, die Sie suchen, und wünschen Sie ihnen viel Glück.«
Jeremias Lander legte den Kopf zur Seite. »Wirkt das denn nicht unseriös, wenn ich auf eine solche Art aussteige?«
»Es wird den Eindruck erwecken, dass Sie sehr ambitioniert sind«, sagte ich. »Man wird Sie als jemanden einschätzen, der seinen Wert kennt. Als einen Menschen, dessen Dienste exklusiv sind. Und das ist der Beginn Ihres …« Ich wedelte ermutigend mit der Hand.
Er lächelte. »Meines Renommees.«
»Ihr Renommee. Also, schlagen Sie ein?«
»Innerhalb von zwei Jahren, sagten Sie.«
»Das garantiere ich Ihnen.«
»Und wie wollen Sie das garantieren?«
Ich notierte.KOMMT SCHNELL WIEDER IN DIE OFFENSIVE.
»Weil ich Sie für eine der Stellen empfehlen werde, über die ich hier rede.«
»Und wenn schon? Sie treffen doch nicht die Entscheidung.«
Ich schloss die Augen halb. Ein Gesichtsausdruck, bei dem meine Frau Diana immer an einen müden Löwen denken muss, einen satten Herrscher. Das Bild gefällt mir.
»Meine Empfehlung ist deckungsgleich mit der Entscheidung meiner Kunden, Lander.«
»Wie meinen Sie das?«
»Genau so, wie Sie sich nie wieder um eine Stellung bewerben werden, die Sie nicht bekommen, habe ich niemals eine Empfehlung ausgesprochen, die meine Kunden nicht befolgt hätten.«
»Wirklich? Niemals?«
»Ich könnte mich nicht erinnern. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ein Kunde meiner Empfehlung vertraut, empfehle ich niemanden oder überlasse den Auftrag gleich einem meiner Konkurrenten. Auch wenn ich drei perfekte Kandidaten habe und zu90 Prozent sicher bin.«
»Warum?«
Ich lächelte. »Die Antwort beginnt mit einem R. Meine ganze Karriere baut darauf auf.«
Lander schüttelte den Kopf und lachte. »Man hat mir gesagt, dass Sie knallhart sind, Brown. Jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist.«
Ich lächelte und stand auf. »Und ich rate Ihnen, jetzt nach Hause zu Ihrer hübschen Frau zu gehen und ihr zu sagen, dass Sie diese Stelle ablehnen, weil Sie sich entschlossen haben, höhere Ziele anzupeilen. Ich schätze, Sie haben einen angenehmen Abend vor sich.«
»Warum tun Sie das für mich, Brown?«
»Weil die Provision, die Ihr Arbeitgeber für Sie zahlen wird, einem Drittel Ihres ersten Jahresbruttolohns entspricht. Wussten Sie, dass Rembrandt auf Auktionen gegangen ist, um auf seine eigenen Bilder zu bieten? Warum sollte ich Sie für zwei Millionen pro Jahr verkaufen, wenn ich Sie mit etwas mehr Renommee für fünf verkaufen kann? Die einzige Bedingung ist, dass Sie sich an uns halten. Wollen wir uns darauf einigen?«
Ich streckte ihm die Hand entgegen.
Er schlug begeistert ein. »Ich habe das Gefühl, dieses Gespräch hat sich gelohnt, Brown.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung«, antwortete ich und beschloss, ihm noch ein paar Tipps zu Intensität und Dauer seines Händedrucks zu geben, bevor er unseren Kunden traf.
Ferdinand rauschte in mein Büro, kaum dass Jeremias Lander gegangen war.
»Igitt«, sagte er, schnitt eine Grimasse und wedelte mit der Hand. »Eau de camouflage.«
Ich nickte und öffnete das Fenster, um durchzulüften. Ferdinand hatte ganz recht, der Bewerber hatte sich in Anbetracht seiner Nervosität extra stark parfümiert, um den Schweißgeruch zu verbergen, der sonst den ganzen Raum erfüllt hätte.
»Aber wenigstens ist es Clive Christian«, meinte ich. »Gekauftvon seiner Frau. Genau wie der Anzug, die Schuhe, das Hemd und der Schlips. Und es war ihre Idee, dass er sich die Schläfen grau färbt.«
»Woher weißt du das?« Ferdinand ließ sich auf den Stuhl fallen, auf dem Lander gesessen hatte, sprang aber gleich wieder angeekelt auf, als er die klamme Körperwärme spürte, die noch im Bezug steckte.
»Er wurde totenbleich, als ich das Register Ehefrau gezogen habe«, antwortete ich. »Ich habe ihm gesagt, wie enttäuscht sie sein wird, wenn er ihr erzählt, dass er den Job nicht bekommen hat.«
»›Das Register Ehefrau!‹ Wo hast du das denn wieder her, Roger?« Ferdinand hatte sich auf einen der anderen Stühle gesetzt und die Beine auf das Tischchen gelegt, das einem echten Noguchi-Kaffeetischchen zum Verwechseln ähnlich sah. Er schälte eine Apfelsine, und ein fast unsichtbarer Saftnebel spritzte auf sein frisch gebügeltes Hemd. Ferdinand war erstaunlich unvorsichtig für einen Homosexuellen. Und erstaunlich homosexuell für einen Headhunter.
»Inbaud, Reid und Buckley«, sagte ich.
»Das habe ich schon mal gehört«, erwiderte er. »Aber was ist eigentlich das Geheimnis dieser drei? Was macht sie besser als Cuté?«
Ich lachte. »Das ist das neunstufige Verhörmodell desFBI, Ferdinand. So etwas wie das Maschinengewehr in einer Welt aus Knallerbsen, das Werkzeug, mit dem du dir einen Weg bahnen kannst. Du machst keine Gefangenen, kommst aber trotzdem zu schnellen, handfesten Resultaten.«
»Und wie sehen diese Resultate aus, Roger?«
Ich wusste, worauf Ferdinand hinauswollte, und das war auch in Ordnung. Er war neugierig, welches Geheimnis, welcher unerklärliche Vorsprung dazu führte, dass ich der Beste war und er – vorläufig – nicht.
Und ich ließ ihn an meinem Wissen teilhaben, damit er sein Ziel erreichen konnte. So lauteten die Regeln, man teilt sein Wissen. Andererseits wusste ich aber auch, dass er niemals besser sein würde als ich, weil seine Hemden immer nach Zitrusfrüchten stinken und er sich auch noch in vielen Jahren fragen würde, ob andere eine Methode hatten, ein Geheimnis, das besser war als sein eigenes.
»Unterwerfung«, erklärte ich. »Ehrlichkeit, Wahrheit. Das alles basiert auf ganz simplen Prinzipien.«
»Als da wären?«
»Zum Beispiel, dass du einen Verdächtigen nach seiner Familie befragst.«
»Pah«, sagte Ferdinand, »das mache ich auch. Es gibt ihnen Sicherheit, über etwas zu reden, was sie kennen, was ihnen nahesteht. So öffnen sie sich schneller.«
»Genau. Aber es versetzt dich auch in die Lage, ihre Schwachpunkte zu identifizieren. Ihre Achillesferse. Und auf die kommt man dann im Laufe des Verhörs noch zurück.«
»Nein, wie du dich immer ausdrückst!«
»Wenn es um die schwierigen Themen geht, die konkreten Ereignisse, den Mord, dessen jemand verdächtigt wird, und sich der Verdächtige von allen verlassen fühlt und sich verstecken will, stellst du eine Rolle Küchenpapier so weit seitlich auf dem Tisch, dass er sie nicht erreichen kann.«
»Warum das denn?«
»Weil es in jedem Verhör irgendwann zum Crescendo kommt und es Zeit für die großen Emotionen wird. Dann fragst du, was seine Kinder wohl denken werden, wenn sie erst erfahren, dass ihr Vater ein Mörder ist. Stehen ihm dann die Tränen in den Augen, reichst du ihm die Rolle Papier. Dann bist du der Verständnisvolle, der ihm helfen will, und dem er all die schlimmen Dinge anvertrauen kann. Ja, und auch das Dumme, diesen dummen Mord, der einfach irgendwie passiert ist.«
»Mord? Ich kapiere überhaupt nicht, wovon du redest. Wir rekrutieren doch Leute, oder? Wir wollen sie doch nicht des Mordes überführen?«
»Ich tue das«, sagte ich und nahm meine Jacke vom Stuhlrücken. »Und deshalb bin ich auch der beste Headhunter der Stadt. Außerdem möchte ich dich bitten, morgen das Gespräch mit Lander und dem Kunden zu übernehmen.«
»Ich?«
Ich ging durch die Tür und lief, gefolgt von Ferdinand, über den Flur, vorbei an den25anderen Büros der Firma Alfa. Eine mittelgroße Personalvermittlung, die seit15 Jahren auf dem Markt überlebte und jedes Jahr zwischen15und20Millionen Kronen erwirtschaftete, die abzüglich einiger viel zu bescheidener Boni für die Besten von uns in den Taschen des Besitzers in Stockholm landeten.
»Piece of cake. Die Infos sind alle in seinem File gespeichert. Okay?«
»Okay«, sagte Ferdinand. »Unter einer Bedingung.«
»Bedingung? Ich tuedirdoch einen Gefallen.«
»In der Galerie deiner Frau ist heute Abend doch so eine Vernissage …?«
»Ja, was ist damit?«
»Kann ich kommen?«
»Bist du eingeladen?«
»Das ist es ja. Bin ich eingeladen?«
»Wohl kaum.«
Ferdinand blieb wie angewurzelt stehen und verschwand damit aus meinem Blickfeld. Ich ging weiter, wohl wissend, dass er jetzt mit hängenden Armen dastand, mir nachblickte und sich ärgerte, dass es ihm wieder einmal verwehrt sein würde, mit dem Jetset der Stadt anzustoßen. Wieder kein Champagner mit den Königinnen der Nacht, den Promis und dem Geldadel. Wieder würde er nicht teilhaben am Glamour, der Dianas Vernissagen umgab, und wieder blieb ihm die Gelegenheit versagt, neue Kontakte mit potenziellen Kandidaten zu knüpfen, sei es nun für eine Stellung, fürs Bett oder eine andere sündige Zusammenkunft. Der Arme.
»Roger?« Es war das Mädchen vom Empfang. »Da waren zwei Anrufe. Einer von …«
»Jetzt nicht, Oda«, unterbrach ich sie, ohne aufzublicken. »Ich bin etwa fünfundvierzig Minuten weg. Nimm keine Nachrichten entgegen.«
»Aber …«
»Die rufen schon wieder an, wenn es wichtig ist.«
Ein hübsches Mädchen, aber sie musste noch einiges lernen. Oda. Oder hieß sie Ida?
Kapitel 2
Tertiärsektor
Der frische, salzige Geschmack der Abgase weckte in mir Assoziationen zu Meer, Ölförderung und Bruttosozialprodukt. Die schräg einfallenden Sonnenstrahlen glitzerten auf den Fenstern der Bürogebäude, die scharf umrissene, rechteckige Schatten auf das alte Industriegelände warfen. Hier war inzwischen ein Stadtteil mit viel zu teuren Geschäften, viel zu teuren Wohnungen, viel zu teuren Büros und viel zu teuren Beratern gewachsen. Von meinem Standpunkt sah ich gleich drei Fitnessstudios, alle ausgebucht von morgens bis abends. Ein junger Typ im Corneliani-Anzug mit cooler Brille grüßte mich ehrerbietig, als wir aneinander vorbeigingen. Ich nickte ihm beiläufig zu, ohne die leiseste Ahnung zu haben, wer er war. Vermutlich arbeitete er in einer der anderen Personalagenturen. Vielleicht bei Edward W. Kelley? Nur Headhunter grüßten Headhunter so unterwürfig. Oder um es anders zu formulieren: Sonst grüßte niemand, sonst wusste niemand, wer ich war. Das lag zum einen sicher an meinem begrenzten sozialen Umfeld, sah man einmal vom Bekanntenkreis meiner Frau Diana ab. Zum anderen arbeitete ich in einer Firma, die – genau wie Kelley – Exklusivität verkörperte und das Rampenlicht mied. Menschen, von denen man nie etwas hörte, ehe man qualifiziert genug für eine der Toppositionen in diesem Lande war und eines Tages von uns angerufen wurde. Dann klingelte bei dem Namen Alfa etwas in den Köpfen der Leute. Wo hatte man diesen Namen bloß schon einmal gehört? Bei einer der Vorstandssitzungen, in Verbindung mit der Ernennung des neuen Abteilungsleiters? Genau, das ist es, man hat eben doch von uns gehört. Aber man weiß nichts. Denn die Diskretion ist unsere wichtigste Tugend. Unsere einzige. Das meiste sind blanke Lügen, wenn man zum Beispiel hört, wie ich am Ende eines Gespräches mein übliches Mantra vorbringe: »Sie sind der Mann, den wir für diesen Job gesucht haben. Diese Position ist Ihnen wirklich auf den Leib geschneidert, sie passt perfekt zu Ihnen. Glauben Sie mir.«
Tja. Glauben Sie mir nicht.
Doch, ich denke, er war von Kelley. Oder Amrop. Mit diesem Anzug konnte er auf keinen Fall in einer der großen, uncoolen, nicht exklusiven Gesellschaften wie Manpower oder Adecco arbeiten. Aber auch in keiner der winzigen, angesagten Agenturen wie Hopeland, denn dann würde ich ihn kennen. Natürlich konnte es auch eines der mittelgroßen, mittelcoolen Vermittlungsbüros wie Mercuri Urval oder Delphi sein, oder eine der kleinen, uncoolen Buden, die Leute für mittlere Positionen suchen und nur manchmal mit uns großen konkurrieren dürfen. Natürlich bloß, um zu verlieren und dann reumütig zu ihren Filialleitern und Buchhaltern zurückzukehren. Leute wie mich grüßten sie voller Ehrerbietung. Vermutlich hofften sie, ich würde mich eines Tages an sie erinnern und ihnen einen Job anbieten.
Es gibt keine offizielle Rangliste für Headhunter, keine Hierarchie des Rufes, wie es sie bei Maklern gibt. Es werden auch keine Preise für die Gurus des Jahres vergeben, wie in der Fernseh- oder Werbebranche. Trotzdem sind wir genau im Bilde. Wir wissen, wer den Ton angibt, wer die Herausforderer sind und wer kurz vor dem Absturz steht. Erfolge spielen sich in unserer Branche im Stillen ab, Beerdigungen in Totenstille.
Der Typ, der mich soeben gegrüßt hatte, wusste, dass ich Roger Brown war, der Headhunter, der nicht ein einziges Mal einen Kandidaten für eine Stelle vorgeschlagen hat, die dieser nicht auch bekommen hätte. Roger Brown, der – wenn nötig – manipulierte, Druck ausübte und seine Kandidaten zurechtbog, und dessen Kunden seiner Einschätzung blind vertrauten und das Schicksal ihrer Firmen ohne Zögern in seine – und nur in seine – Hände legten. Um es anders auszudrücken: Nicht die Osloer Hafenverwaltung hat im letzten Jahr den neuen Verkehrsdirektor eingestellt, AVIS nicht seinen neuen Skandinavienchef und die Stadtverwaltung von Sirdal definitiv nicht den neuen Kraftwerksdirektor.
Sondern ich.
Ich beschloss, mir den Typ zu merken.GUTER ANZUG. WEISS, WEM ER RESPEKT ZOLLEN MUSS.
Ich rief Ove aus der Telefonzelle neben dem Narvesenkiosk an und kontrollierte kurz mein Handy. Acht Nachrichten. Ich löschte sie.
»Wir haben einen Kandidaten«, sagte ich, als Ove endlich den Hörer abgenommen hatte. »Jeremias Lander, Monolitveien.«
»Soll ich überprüfen, ob der bei uns ist?«
»Nein, das weiß ich schon. Er ist morgen für ein zweites Gespräch eingeladen. Von zwölf bis zwei. Zwei Uhr exakt. Gib mir eine Stunde. Hast du das?«
»Klar, sonst noch was?«
»Schlüssel. In zwanzig Minuten im Sushi & Coffee?«
»In einer halben Stunde.«
Ich schlenderte über die kopfsteingepflasterte Straße zum Sushi & Coffee. Vermutlich haben sie sich hier aus Gründen der Idylle für einen lauteren Straßenbelag entschieden, der nicht nur teurer ist, sondern auch für noch mehr Abgase sorgt. Aus Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, Beständigen, dem Echten. Auf jeden Fall echter als die Kulisse dieses Stadtteils, der an einem Ort hochgezogen worden ist, an dem früher einmal körperlich gearbeitet wurde, unter glühender Hitze und schweren Hammerschlägen. Jetzt kam das Echo nur noch vom Sprotzen und Gurgeln der Espressomaschinen und den klirrenden Gewichten in den Fitnessstudios. Dieser Ort war die Verkörperung des Triumphs des Tertiärsektors über die Industriearbeiter, des Designs über die Wohnungsnot, der Fiktion über die Wirklichkeit. Und das gefiel mir.
Ich hielt nach den Diamantohrringen Ausschau, die mir im Schaufenster vis-à-vis des Sushi & Coffee aufgefallen waren. Sie würden perfekt zu Dianas Ohren passen, wären aber eine finanzielle Katastrophe für mich. Ich schob den Gedanken beiseite, ging über die Straße und durch die Tür des Ladens, der das Wort Sushi im Namen führte, in Wahrheit aber nur toten Fisch anbot. Gegen ihren Kaffee war allerdings nichts einzuwenden. Das Lokal war nur zur Hälfte besetzt. Schlanke, durchtrainierte, platinblonde Frauen in Trainingsanzügen. Diesen Wesen wäre es niemals in den Sinn gekommen, in einem Fitnesscenter vor anderer Leute Augen zu duschen, was im Grunde seltsam war, hatten sie doch ein Vermögen für ihre Körper bezahlt, die ebenfalls ein Triumph der Fiktion waren. Auch sie gehörten dem Tertiärsektor an, besser gesagt, dem Dienerstab, der für die reichen Ehemänner arbeitete. Wären diese Frauen wenigstens dumm gewesen, aber nein, sie hatten als ein Teil ihrer Schönheitspflege Jura studiert, Informatik oder Kunstgeschichte – natürlich auf Kosten der Gesellschaft –, um dann als überqualifiziertes Spielzeug in einer Villa zu enden. An diesem Ort tauschten sie ihre Geheimnisse aus, besprachen, wie man seine Sugardaddies zufriedenstellte, ein bisschen eifersüchtig machte und bei Laune hielt, bis man ein Kind von ihnen im Bauch hatte und die Herren der Schöpfung richtig an der Kette. Nach den Kindern war dann natürlich alles anders, dann war das Kräftegleichgewicht auf den Kopf gestellt und der Mann kastriert und schachmatt. Kinder …
»Einen doppelten Cortado«, sagte ich und setzte mich auf einen Hocker an der Bar.
Zufrieden betrachtete ich die Frauen im Spiegel. Ich konnte mich glücklich schätzen. Wie sehr Diana sich doch von diesen smarten, gedankenentleerten Parasiten unterschied. Sie hatte alles, was ich nicht hatte. Fürsorglichkeit. Empathie. Loyalität. Größe. Kurz gesagt, sie war eine schöne Seele in einem schönen Körper. Aber ihre Schönheit war nicht perfekt, dafür waren ihre Proportionen zu speziell. Diana sah aus wie im Mangastil gezeichnet, wie eine dieser puppenartigen japanischen Comicfiguren. Hatte ein kleines Gesicht mit einem klitzekleinen, schmalen Mund, eine winzige Nase und große, etwas zu verwundert dreinblickende Augen, die häufig etwas vorstanden, wenn sie müde war. Aber für mich waren es gerade diese Abweichungen von der Norm, die ihre Schönheit hervorhoben und sie so bezaubernd wirken ließen. Was hatte sie also verleitet, mich zu erwählen? Den Sohn eines Chauffeurs, einen gerade mal mittelmäßig begabten Wirtschaftsstudenten mit mittelmäßigen Zukunftsaussichten, der noch nicht einmal durchschnittlich groß war? Vor fünfzig Jahren hätte ich mit1,68Meter noch nicht zu den Kleinen gehört, auf jeden Fall nicht in Mitteleuropa. Und interessierte man sich ein bisschen für anthropometrische Geschichte, konnte man herausfinden, dass1,68Meter vor nur hundert Jahren genau die Durchschnittsgröße norwegischer Männer war. Nur dass die Entwicklung zu meinen Ungunsten verlaufen war.
Es war erstaunlich, dass sie sich in einem Augenblick geistiger Umnachtung für mich entschieden hatte. Vollkommen unbegreiflich aber war mir, dass eine Frau wie Diana – die wirklich jeden haben konnte – mich noch immer behalten wollte. Tag für Tag. Welcher geheimnisvollen Blindheit hatte ich es zu verdanken, dass sie meine Jämmerlichkeit nicht wahrnahm, meine fehlerhafte Natur, meine Schwäche, wenn ich auf Widerstand stieß, oder meine stupide Bosheit, wenn ich mit stupider Bosheit konfrontiert wurde? Wollte sie das alles nicht sehen? Oder hatte ich es meiner Gerissenheit zu verdanken, dass mein eigentliches Ich in diesem gesegneten toten Winkel der Liebe gelandet war? Natürlich war da aber auch noch das Kind, das ich mich bisher standhaft geweigert hatte, ihr zu schenken. Welche Macht hatte ich eigentlich über diesen Engel in Menschengestalt? Diana sagt, ich hätte sie vom ersten Moment an mit meiner widersprüchlichen Mischung aus Arroganz und Selbstironie verzaubert. Wir waren uns auf einem nordischen Studentenabend in London begegnet, und auf den ersten Blick hatte sie sich kaum von den Frauen unterschieden, die jetzt hier um mich herum saßen: eine blonde, nordische Schönheit aus Oslo-West, die in einer Metropole Kunstgeschichte studierte, zwischendurch als Model arbeitete, gegen Krieg und Armut war und Partys und Spaß liebte. Drei Stunden und sechs Guinness später hatte ich begriffen, wie sehr ich mich geirrt hatte. Erstens interessierte sie sich wirklich für Kunst, sie war fast besessen davon. Zweitens konnte sie ihre Frustration darüber zum Ausdruck bringen, einem System anzugehören, das Kriege gegen Menschen führte, die einfach nicht Teil des westlichen Kapitalismus sein wollten. Diana erklärte mir, dass die Ausbeutung der Entwicklungsländer durch die reichen Staaten auch noch nach Abzug der Entwicklungshilfe ein einträgliches Geschäft war. Drittens hatte sie Sinn für Humor. Meinen Humor, was wohl die Voraussetzung dafür ist, dass Typen wie ich überhaupt Frauen für sich gewinnen können, die größer als1,70sind. Und viertens – und das war ganz ohne Zweifel das Entscheidende für mich –, sie war schlecht in Sprachen und gut im logischen Denken. Ihr Englisch war, gelinde gesagt, holperig, und sie gestand mir lachend, dass es ihr nicht im Traum einfallen würde, sich an Französisch oder Spanisch heranzuwagen. Ich hatte sie deshalb gefragt, ob sie möglicherweise ein maskulines Hirn habe und Mathe möge. Sie zuckte nur mit den Schultern, doch ich gab keine Ruhe und erzählte ihr von den Aufnahmetests bei Microsoft, bei denen die Bewerber mit einer bestimmten logischen Problemstellung konfrontiert wurden.
»Es geht dabei neben dem Ergebnis ebenso sehr um den Ansatz der Bewerber, darum, wie sie an die Sache herangehen.«
»Na, erzähl schon«, sagte sie.
»Primzahlen …«
»Warte. Was sind das noch mal für Zahlen?«
»Das sind die Zahlen, die nur durch sich selbst und durch eins teilbar sind.«
»Ach ja.« Sie hatte noch immer nicht den abwesenden Blick, den Frauen gerne bekommen, wenn man über Zahlen zu reden beginnt, so dass ich fortfuhr:
»Primzahlen sind häufig zwei aufeinander folgende, ungerade Zahlen. Wie elf und dreizehn. Siebzehn und neunzehn. Neunundzwanzig und einunddreißig. Verstanden?«
»Verstanden.«
»Gibt es Fälle, in denen drei aufeinander folgende, ungerade Zahlen Primzahlen sind?«
»Natürlich nicht!«, sagte sie und hob ihr Bierglas an.
»Oh. Und warum nicht?«
»Du hältst mich wohl für dumm? In einer Reihe von fünf aufeinander folgenden Zahlen muss eine der ungeraden Zahlen durch drei teilbar sein. Erzähl weiter.«
»Weiter?«
»Ja, was ist das für eine logische Problemstellung?«
Sie hatte einen kräftigen Schluck Bier getrunken und sah mich mit echter Neugier an. Bei Microsoft hatten die Bewerber drei Minuten Zeit für den Beweis, den sie mir in drei Sekunden geliefert hatte. Im Durchschnitt schafften das nur fünf Prozent der Bewerber. Ich glaube, in diesem Moment habe ich mich in sie verliebt. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich auf meiner Serviette »EINGESTELLT!« notierte.
Mir war damals klar, dass dies der einzige Moment war, in dem auch ich ihre Liebe gewinnen konnte. Stand ich auf, war der Zauber gebrochen, deshalb redete ich weiter. Und redete. Hatte mich inzwischen verbal zu einer Körpergröße von1,85Meter aufgeschwungen, denn reden kann ich. Aber als ich gerade in meiner besten Phase war, unterbrach sie mich.
»Magst du Fußball?«
»D-d-du etwa?«, stammelte ich überrumpelt.
»Die Queens Park Rangers spielen morgen im Pokalwettbewerb gegen Arsenal. Interesse?«
»Aber klar!«, sagte ich und meinte natürlich sie. Fußball ist mir völlig egal.
Sie trug einen blau gestreiften Schal und schrie sich im Londoner Nebel an der Loftus Road heiser, während ihrem kleinen, armen ClubQPRvom großen Bruder Arsenal das Fell über die Ohren gezogen wurde. Fasziniert hatte ich ihr leidenschaftliches Gesicht studiert und nicht mehr vom Spiel mitbekommen, als dass Arsenal hübsche weiß-rote Trikots trug, während die vonQPRblaue Querstreifen auf weißem Grund hatten, wodurch die Spieler wie rennende Zuckerstangen aussahen.
In der Pause erkundigte ich mich, warum sie nicht zu einem Siegerclub wie Arsenal hielt, sondern zu so einem komischen kleinen Verein wieQPR.
»Weil sie mich brauchen«, antwortete sie. Mit vollem Ernst.Weil sie mich brauchen. Ich konnte die Weisheit hinter diesen Worten kaum fassen. Dann lachte sie in ihrer typisch gurgelnden Art und trank den letzten Schluck Bier aus ihrem Plastikbecher. »Die sind wie hilflose Babys. Sieh sie dir doch an. Die sind so süß!«
»In Strampelanzügen«, sagte ich. »Soso, dann heißt dein Lebensmotto also: Lasset die Kindlein zu mir kommen?«
»Hm«, antwortete sie, neigte den Kopf zur Seite und sah mich mit einem breiten Lächeln an. »Das kann es vielleicht mal werden.«
Wir lachten. Laut und befreiend.
An das Ergebnis des Spiels erinnere ich mich nicht mehr. Oder doch: ein Kuss vor den Toren eines strengen Mädchenwohnheims aus roten Ziegeln in Shepherd’s Bush. Und eine einsame, schlaflose Nacht mit wilden, wachen Träumen.
Zehn Tage später sah ich im flackernden Licht einer Kerze, die wir in eine Weinflasche gesteckt und auf ihr Nachtschränkchen gestellt hatten, auf ihr Gesicht hinab. Wir schliefen zum ersten Mal miteinander. Ihre Augen waren geschlossen, die Ader auf ihrer Stirn schwoll an, und ihr Gesichtsausdruck wechselte zwischen Wut und Schmerz, während ihre Hüftknochen wild auf mich einhämmerten. Die gleiche Leidenschaft, mit der sie verfolgt hatte, wie ihre Queens Park Rangers aus dem Pokal geworfen worden waren. Anschließend vertraute sie mir an, dass sie meine Haare mochte. Das war ein Refrain meines Lebens, trotzdem kam es mir vor, als hörte ich es an diesem Abend zum ersten Mal.
Es dauerte sechs Monate, bis ich ihr erzählte, dass mein Vater zwar in der Botschaft arbeitete, aber nicht zum diplomatischen Korps gehörte.
»Chauffeur«, wiederholte sie, zog meinen Kopf zu sich herab und küsste mich. »Heißt das, er kann sich ein Diplomatenauto leihen, um uns von der Kirche abzuholen?«
Ich war ihr die Antwort schuldig geblieben, aber im folgenden Frühjahr heirateten wir mit mehr Pracht als Pomp in der St. Patrick’s Church in Hammersmith. Der fehlende Pomp war damit zu erklären, dass ich Diana zu einer Hochzeit ohne Freunde und Verwandte überredet hatte. Ohne Vater. Nur wir zwei, rein und unschuldig. Für die Pracht war Diana zuständig, sie strahlte wie zwei Sonnen und ein Mond. Der Zufall wollte es, dass sich dieQPRam gleichen Nachmittag den Aufstieg sicherten, so dass sich das Taxi auf dem Rückweg zu ihrer Wohnung in Sheperd’s Bush durch Scharen von zuckerstangengestreiften Fahnen und Flaggen schlängeln musste. Alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Als wir nach Oslo zurückgezogen waren, sprach Diana zum ersten Mal das Thema Kinder an.
Ich sah auf die Uhr. Ove musste jetzt eigentlich hier sein. Ich hob den Kopf, sah in den Spiegel über der Bar und begegnete dem Blick einer dieser blonden Frauen. Wir sahen uns gerade lang genug an, um Missverständnisse erzeugen zu können, wenn wir es denn darauf abgesehen hätten. Pornohübsch, ein Meisterstück der plastischen Chirurgie. Doch ich wollte nicht und ließ meinen Blick weitergleiten. Denn genau mit einem solchen, etwas zu langen Blick hatte mein einziges, beschämendes Abenteuer begonnen. Der erste Akt hatte in der Galerie gespielt. Der zweite hier im Sushi & Coffee. Der dritte in einer Wohnung in der Eilert Sundts gate. Aber das Kapitel Lotte war mittlerweile abgeschlossen. So etwas sollte niemals, niemals wieder geschehen.
Mein Blick glitt durchs Lokal und hielt inne.
Ove saß am Tisch neben dem Ausgang.
Er tat so, als lese er Zeitung.Dagens Næringsliv. An sich ein komischer Gedanke, Ove Kjikerud interessierte sich nicht im Mindesten für Aktien oder die Welt der Wirtschaft, er war froh, überhaupt ein bisschen lesen zu können. Und schreiben. Ich erinnere mich noch gut an seine Bewerbung für den Posten des Wachleiters. Ich hatte Tränen gelacht über die zahllosen Tippfehler.
Ich rutschte vom Barhocker und ging an seinen Tisch. Er hatte die Zeitung zusammengefaltet, und ich warf fragend einen Blick darauf. Er lächelte und nickte, um mir zu sagen, dass er ausgelesen hatte. Wortlos nahm ich die Zeitung und ging zurück zu meinem Platz am Tresen. Eine Minute später hörte ich die Tür, und als ich in den Spiegel blickte, war Ove Kjikerud verschwunden. Ich schlug die Seite mit den Aktienkursen auf, legte die Finger vorsichtig um den Schlüssel, den Ove zwischen die Seiten geschoben hatte, und ließ ihn in meine Jackentasche gleiten.
Als ich ins Büro zurückkam, warteten auf meinem Handy sechsSMSauf mich. Ich löschte fünf von ihnen, ohne sie zu lesen, holte mir aber die von Diana aufs Display:
Schatz, denk an die Vernissage heute Abend, du bist mein Glücksbringer.
Sie hatte einen Smiley mit Sonnenbrille angefügt, eine dieser Finessen des Prada-Telefons, das ich ihr im Sommer zum32. Geburtstag geschenkt hatte. »Das habe ich mir am allermeisten gewünscht«, hatte sie beim Auspacken gerufen. Dabei wussten wir beide ganz genau, was sie sich am allermeisten wünschte. Und was ich ihr nicht schenken wollte. Trotzdem hatte sie gelogen und mich geküsst. Was kann man mehr von einer Frau verlangen?