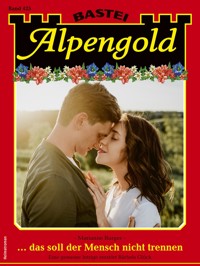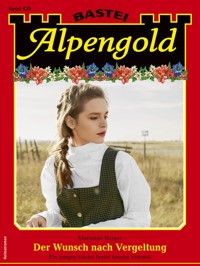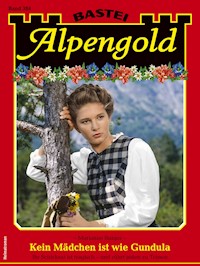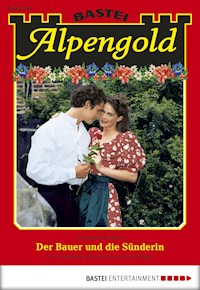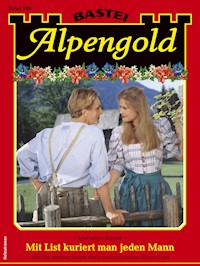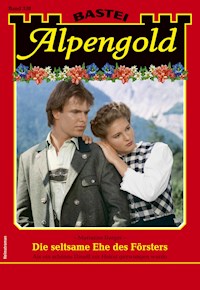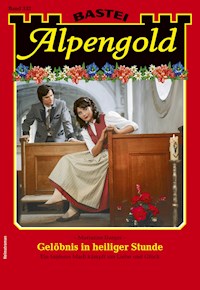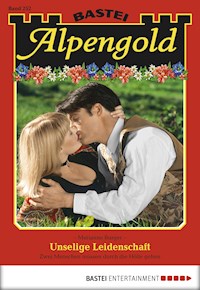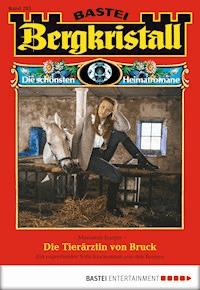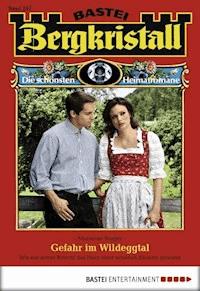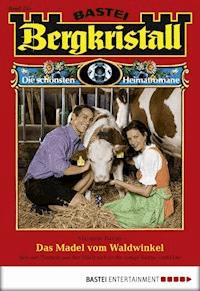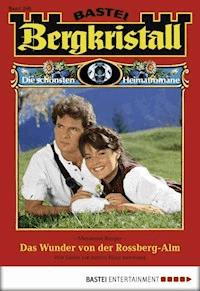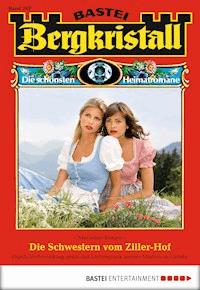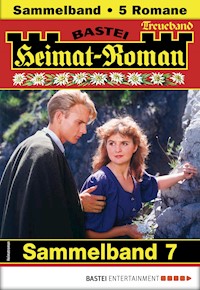
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heimat-Roman Treueband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Lesen, was glücklich macht. Und das zum Sparpreis!
Seit Jahrzehnten erfreut sich das Genre des Heimat-Bergromans sehr großer Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso größer wird unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben, wo nur das Plätschern des Brunnens und der Gesang der Amsel die Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso Thema wie Tradition, Bauernstolz und romantische heimliche Abenteuer. Ob es die schöne Magd ist oder der erfolgreiche Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von unseren beliebtesten und erfolgreichsten Autoren mit Gefühl und viel dramatischem Empfinden in Szene gesetzt.
Alle Geschichten werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Alpengold 165: Verliebt in einen Außenseiter
Bergkristall 246: Das Wunder von der Rossberg-Alm
Der Bergdoktor 1687: Frei wie ein Adler
Der Bergdoktor 1688: Lass mich keine Nacht allein
Das Berghotel 102: Ihr erstes Weihnachten allein?
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2013/2014/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln Covermotiv von © Bastei Verlag/Michael Wolf ISBN 978-3-7325-8231-0Rosi Wallner, Marianne Burger, Andreas Kufsteiner, Verena Kufsteiner
Heimat-Roman Treueband 7 - Sammelband
Inhalt
Inhalt
Cover
Impressum
Verliebt in einen Außenseiter
Vorschau
Verliebt in einen Außenseiter
Ihre Liebe bannte die düsteren Schatten
Von Rosi Wallner
Dunkel und wenig einladend liegt der Brandstetter-Hof vor ihr, und unwillkürlich kommen der hübschen Buchinger-Marie die Schauergeschichten in den Sinn, die im Dorf über diesen Hof kursieren. Ein rechter Räuberhauptmann soll der alte Brandstetter gewesen sein, verstrickt in übelste Machenschaften! Heute lebt nur noch der jüngste Brandstetter-Sohn hier, Jonas – und sein kleiner Neffe Sandro. Über ihn muss die junge Lehrerin dringend mit Jonas sprechen!
An diesem spätsommerlichen Tag verliebt sich Marie Hals über Kopf in den geheimnisvollen Jonas Brandstetter – und ist deshalb bald selbst eine Ausgestoßene im Dorf! Doch Marie und Jonas wollen nicht voneinander lassen, sondern um ihre Liebe kämpfen …
Aber ihr Glück gerät jäh in Gefahr, als eines Tages Sandros verschollene Mutter Ramona auf dem Hof auftaucht und ihren Sohn zurückfordert. Da droht das unselige Erbe der Brandstetters auch in Jonas aufzubrechen …
Marie Buchinger lächelte glücklich, als sie durch die Räume der kleinen Wohnung schritt, die ihr Zuhause war.
Die Zimmer, eigentlich waren es eher Kammern, waren altmodisch und der Flur verwinkelt, doch sie wirkten anheimelnd. Dazu trug bei, dass sie von Marie liebevoll ausgestattet worden waren. Im Wohnzimmer wurde eine Wand von einem Bücherregal eingenommen, ein ausladendes Sofa mit Kissen in verschiedenen Größen lud zum Lesen ein, und in einer Ecke stand noch ein großer, gemütlicher Ohrensessel.
Neben dem Schlafzimmer, das mit Möbeln aus Zirbenholz eingerichtet war, und einem zweckmäßigen Arbeitszimmer, gab es nur noch eine winzige Küche und ein enges Bad.
»Da kannst ja noch net mal eine Maus drin frisieren«, hatte ihre Schwägerin abschätzig gesagt, als sie Maries neue Behausung in Augenschein genommen hatte.
Maries Gesicht verdüsterter sich, wenn sie an Silvana dachte, aber dann verdrängte sie alles, was mit ihrer Schwägerin zu tun hatte, denn sie wollte sich die Freude an ihrem Heim nicht verderben lassen. Besonders jetzt, wenn die Sonne hereinfiel und ein sanfter Sommerwind die weißen Gardinen am offenen Fenster aufbauschte. Die leuchtenden Farben der Läufer, die auf den honigbraunen Dielenbrettern lagen, kamen so zur Geltung und auch der rote Blumenstrauß, der den Tisch schmückte.
Sie nahm sich vor, die Blumenkästen an den Fenstern im nächsten Frühsommer mit Geranien zu bepflanzen. Und der Flur, von dem noch eine Abstellkammer abging, war recht kahl, und würde mit einer Bilderreihe einladender aussehen.
Eigentlich war diese Wohnung ja eine Besonderheit, denn sie lag im Obergeschoss der Schule des kleinen Gebirgsortes, wo Marie nun ihre erste Stelle als Lehrerin antrat. Alles hatte sich so glücklich gefügt – der schon recht greise Schulmeister war nun doch in Ruhestand gegangen und mit seiner jüngeren verwitweten Schwester zusammengezogen. Und so hatte sich Marie die Möglichkeit geboten, in ihr Heimatdorf zurückzukehren, nach dem sie sich während ihrer Ausbildung vor Heimweh verzehrt hatte.
Manchmal beschlich sie allerdings der Verdacht, dass ihr Vater, der reiche Franz Josef Buchinger, seinen nicht unbeträchtlichen Einfluss geltend gemacht hatte, dass sie hierher versetzt wurde, doch auch daran mochte sie nicht denken. Jedenfalls würde sie die Kinder, die ihr anvertraut werden würden, nach bestem Wissen und Gewissen unterrichten und fördern, denn Marie Buchinger sah in ihrem Beruf eine Berufung.
Dass ihr nun diese Wohnung, so bescheiden sie auch sein mochte, zur Verfügung stand, war noch ein weiterer großer Vorteil, der Maries Wünschen sehr entgegenkam. Denn sie hatte, bevor die Räume bezugsfertig waren, nach ihrer Rückkehr aus der Stadt ein paar Wochen auf dem Buchinger-Hof gewohnt.
Und selten war ihr eine Zeit so lange und unerträglich vorgekommen wie diese Zeit in ihrem Elternhaus.
Es hatte nie ein offenes Zerwürfnis zwischen ihr und ihrer Familie gegeben, und dennoch fühlte sich Marie nicht wesensverwandt mit ihren Angehörigen. Besitzstolz und Eigennutz prägten das Verhalten der Buchingers, verbunden mit einem Hang zu Traditionen, die nicht mehr zeitgemäß waren. Seitdem ihr älterer Bruder, der Hoferbe, geheiratet hatte, war alles noch schlimmer geworden, denn ihre Schwägerin brachte ihr offene Abneigung entgegen und versäumte keine Gelegenheit, Marie in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen.
Am kommenden Sonntag würde auf dem Hof ein großes Familienfest stattfinden, zu Ehren Buchingers, der seinen sechzigsten Geburtstag feierte. Marie sah dieser Feier mit Bangen entgegen, doch für ihren Vater wäre es wie ein Schlag ins Gesicht, wenn sie nicht daran teilnehmen würde.
Marie seufzte und ließ sich auf das Sofa sinken. Zerstreut nahm sie ein Buch zur Hand und legte es dann wieder auf den Tisch vor ihr. Es gab noch etwas anderes, was sie innerlich nicht zur Ruhe kommen ließ.
Während ihrer Ausbildung hatte sie sich mit einem anderen Studenten angefreundet, dessen Zielstrebigkeit und engagierte Einstellung sie bewundert hatte. Auch er war von ihr angetan gewesen, sie begannen, miteinander auszugehen, und allmählich entwickelte sich eine Liebesbeziehung zwischen ihnen.
Maries Entschluss, wieder in ihre Gebirgsheimat zurückzukehren, hatte ihr bisheriges Einvernehmen ins Wanken gebracht. Er konnte nicht begreifen, dass sie sich in »der Einöde vergrub, wo das Leben an ihr vorübergehen würde«, wie er es ausdrückte. Sie hatten sich heftig gestritten, doch Marie beharrte darauf, in ihrem Heimatdorf zu unterrichten.
Sie hatten nicht miteinander gebrochen, doch Marie hatte das Empfinden, dass er sich innerlich von ihr entfernt hatte. Und darin hatte sie sich nicht getäuscht, denn seit ihrer Rückkehr hatte sie kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten.
Und sie würde auch nie mehr von ihm hören, davon war sie inzwischen überzeugt.
Die Enttäuschung brannte in ihr, doch wenn sie ehrlich zu sich selbst war, dann litt sie mehr unter der Kränkung als unter dem Verlust einer großen Liebe. Sie würde darüber hinwegkommen, das wusste sie, denn hier war sie an dem Ort, in den sie gehörte und wo eine Lebensaufgabe auf sie wartete.
Marie lehnte sich zurück und genoss die nachmittägliche Stille und den Sonnenschein, der den Raum in ein warmes Licht tauchte. Bis zum Schulbeginn blieb ihr noch etwas Zeit, denn sobald die Renovierung der Wohnung beendet gewesen war, hatte sie beinahe fluchtartig ihre Sachen gepackt und war eingezogen. Dann hatte sie sich in aller Ruhe eingerichtet, erleichtert, der angespannten Atmosphäre auf dem Buchinger-Hof entronnen zu sein.
Sie musste in einen leichten Schlummer gefallen sein, denn sie schrak auf, als das Abendläuten erklang. Das Schulgebäude stand in unmittelbarer Nähe der Kirche im Ortsmittelpunkt, doch Marie fand das Glockengeläute eher anheimelnd als störend. Das Sonnenlicht hatte sich aus dem Zimmer zurückgezogen, und durch das geöffnete Fenster drang ein kühler Abendhauch.
Von der Straße her vernahm sie laute Männerstimmen und Gelächter, die Dörfler strebten ihrem Stammtisch im Gasthaus »Zum Adler« zu, wo wahrscheinlich wieder einmal eines der zahlreichen Vereinstreffen stattfand. Bei den meisten führte ihr Vater den Vorsitz. Ihre Mutter ging ganz in der Kirchenarbeit auf und brachte sich außerdem seit Jahren bei der Landfrauenvereinigung ein.
Marie bereitete sich in ihrer gemütlichen Küche eine leichte Mahlzeit zu, die sie mit gutem Appetit verzehrte. Dann räumte sie in ihrem Arbeitszimmer die Lehrbücher und Unterlagen, die noch in Kartons auf dem Boden standen, in die dafür bestimmten Regale und Schränke ein und machte sich dabei Gedanken, wie sie den Anfangsunterricht für die Erstklässler gestalten sollte.
Ganz gewiss sollte die Musik eine große Rolle spielen …
Ihr Blick flog zu der Gitarre, die in der Ecke lehnte. Schon seit frühester Jugend begleitete das Instrument sie, das ihr Vater ihr einst in einer Anwandlung von Großzügigkeit zum Geburtstag geschenkt hatte. Ihr Spiel hatte sich in den letzten Jahren immer mehr gesteigert, außerdem besaß sie eine schöne Singstimme.
Sie vertiefte sich zuerst in ihre Notenblätter, dann in ihre Unterrichtsaufzeichnungen und darüber verfloss die Zeit, sodass Marie gegen ihre sonstige Gewohnheit viel zu spät zu Bett ging. Es war die erste Nacht, die sie in ihrem neuen Zuhause verbrachte, und sie schlief tief und traumlos. Am nächsten Morgen wachte sie erfrischt und voller Tatendrang auf und nahm die geplanten Verschönerungen ihrer Wohnung in Angriff.
***
Als Marie jedoch am Sonntagmorgen aus einem wirren Traum erwachte, blieb sie bedrückt im Bett liegen und wäre am liebsten gar nicht erst aufgestanden.
Heute fand die große Familienfeier auf dem Buchinger-Hof statt, vor der es Marie graute. Schließlich aber rief sie sich zur Ordnung und verbrachte lange Zeit unter der Dusche und trank ein großes Haferl schwarzen Kaffee, was sie jedoch nicht wie erhofft ermunterte. Sonst brachte sie keinen Bissen herunter, ihre Kehle war wie zugeschnürt.
Als es Zeit war, sich anzukleiden, trat sie vor den Schrankspiegel und betrachtete sich kritisch. Sie wirkte blass und übernächtigt, obwohl sie ausreichend geschlafen hatte, und war mit ihrem Äußeren sehr unzufrieden.
Dabei war Marie Buchinger ein auffallend schönes Mädchen mit regelmäßigen Zügen, großen tiefblauen Augen und einem reizvoll geschwungenen Mund. Üppiges goldbraunes Haar ergoss sich über ihre Schultern, und ihre Gestalt war sehr schlank, aber mit ausgeprägten weiblichen Formen.
Marie hatte eigens für diesen Tag ein Dirndlkleid in traditionellem Stil erstanden, also mit wadenlangem Rock, bauschigen Ärmeln und engem, ausgeschnittenem Mieder. Das Mittelblau mit den weißen Verzierungen stand ihr gut zu Gesicht, und die Machart brachte ihren ebenmäßigen Wuchs noch besser zur Geltung. Sie band die dunkelblaue Taftschürze fest um ihre Taille, zupfte noch an dem Ausschnitt herum, der ihr etwas zu gewagt vorkam, dann war sie einigermaßen zufrieden mit ihrem Spiegelbild.
Ihre Haare umschmeichelten seidig das Gesicht, und sie legte die Kette an, die sie von der Großmutter selig geerbt hatte. Ihre Wangen hatten sich mittlerweile etwas gerötet, und sie hoffte, durch den Gang zum Buchinger-Hof, der etwas außerhalb des Dorfes lag, ihre übliche gesunde Gesichtsfarbe vollends wiederzuerlangen.
Sie ergriff noch eine Tasche, in der sie das Geschenk für ihren Vater unterbrachte, ein Bildband über die Geschichte der Gebirgsschützen. Da Franz Josef Buchinger auch dort ein begeistertes Mitglied war, würde er sich darüber gewiss freuen oder wenigstens anerkennen, dass sie sich Mühe gegeben hatte, etwas Passendes für ihn zu finden.
Marie durchquerte das kleine Gebirgsdorf, das davon kündete, dass die Bewohner keineswegs in Armut lebten. Die Häuser waren zum Teil aufwendig restauriert, jedoch in ihrem ursprünglichen Charakter erhalten geblieben. Lüftlmalerei und kunstvolle Schnitzarbeiten zeugten von hoher Handwerkskunst, außerdem wetteiferten die Dorffrauen darin, prächtige Hängegeranien in den Blumenkästen vor den Fenstern zu kultivieren.
Auch die alte Kirche mit dem Zwiebelturm hatte ein neues Gewand erhalten, selbst das Dach war kürzlich erneuert worden, und augenblicklich wurden gerade Spenden für eine neue Glocke gesammelt. Es war ein Bild dörflichen Friedens, das sich Maries Augen bot. Die Männer saßen im »Adler« am Stammtisch, ehe sie in Erwartung eines gelungenen Sonntagsmahls an den heimischen Herd zurückkehrten. Daran hatte sich auch in den letzten Jahrzehnten nichts geändert …
Als sie das Dorf hinter sich gelassen hatte, schritt sie ein Stück die gewundene Landstraße entlang bis zu der Abzweigung zum Buchinger-Hof, die zwischen Streuobstwiesen bergan führte. Hin und wieder blieb Marie stehen, um Atem zu schöpfen oder sich an der herrlichen Gebirgslandschaft zu erfreuen.
Das fruchtbare Hochtal mit seinen Almwiesen und Feldern war von einem hohen Gebirgsmassiv umgeben. Hinter dem dunklen Bergwald, in den die Almen übergingen, wuchsen zerklüftete Felswände hoch. Die Mittagssonne ließ das Eis des Gletschers funkeln; wenn das gute Wetter anhielt, würde er gegen Abend in feurige Glut getaucht sein.
Als sie den elterlichen Hof erreichte, hielt Marie wieder inne. Der Buchinger-Hof war der stattlichste weit und breit, mit einem großen Wohnhaus, um das dunkle Holzbalkone führten, und Stallungen und Wirtschaftsgebäuden zu beiden Seiten. In der Mitte des Hofplatzes befand sich ein altertümlicher Steinbrunnen, aus dem es aber immer noch munter plätscherte und dessen Rand – genau wie die Fenster des Wohnhauses – mit brennend roten Geranien geschmückt war. Rechts und links von der massiven Eingangstür standen irdene Töpfe mit Pflanzen, die in spätsommerlicher Pracht blühten.
Marie liebte ihr Elternhaus, denn sie war sehr bodenständig und mit ihrer Bergheimat tief verwurzelt. Es war ein ständiger bohrender Schmerz für sie, dass sie sich nicht mit ihrer Familie verstand. Im Grunde genommen war es aber eher so, dass ihre Familie sie ablehnte, lediglich ihr Vater hatte ein gewisses Verständnis für sie gezeigt. Oder vielmehr hatte er sich dem Drängen von Hochwürden und dem Dorfschullehrer nicht länger ohne Schaden für seine Reputation widersetzen können.
So hatte er sie schließlich widerstrebend auf die Klosterschule geschickt, war allerdings sehr enttäuscht gewesen, dass sie nicht Rechtswissenschaft studierte, wie er es sich gewünscht hatte. Denn Buchinger band die Menschen in seiner Nähe gern in seine ehrgeizigen Pläne mit ein, und als Anwältin hätte sie ihm von Nutzen sein können.
Marie gab sich einen Ruck und durchschritt das Hoftor. Ihr Vater stand vor dem Haus und nahm mit der ihm eigenen Leutseligkeit die Glückwünsche einiger Nachbarn und Gemeinderäte entgegen. Franz Josef Buchinger war ein hochgewachsener, vierschrötiger Mann, dessen volles dunkles Haar nur an den Schläfen leicht ergraut war. Seine Züge waren gut geschnitten, wenn auch wettergegerbt, ein harter Zug um seinen Mund verriet, dass er gewohnt war, seinen Willen durchzusetzen, und keinen Widerspruch duldete.
Zu Maries Erstaunen leuchteten seine hellgrauen Augen auf, als er seine Tochter erblickte, allerdings wäre er nie so weit gegangen, sie in seine Arme zu nehmen. Doch er schien immerhin stolz darauf zu sein, dass sie als erstes weibliches Mitglied der Familie den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit geschafft hatte.
»Da kommt ja unsere zukünftige Schulmeisterin«, sagte er ironisch, doch es war ihm anzumerken, dass es ihm sichtliches Vergnügen bereitete, sie so vorzustellen.
»Dass ich das werden konnt, verdank ich auch dir, Vater. Das muss mal gesagt werden. Und außerdem wünsch ich dir zum Geburtstag Gesundheit und ein gutes, langes Leben«, gab sie zur Antwort und küsste ihn spontan rechts und links auf die Wange.
Buchinger stand wie erstarrt da, denn in dieser Familie waren weder Dankesbezeugungen noch Zärtlichkeiten gang und gäbe. Marie überspielte diesen Augenblick jedoch geschickt, indem sie ihm das Geschenk überreichte und ein paar erläuternde Worte dazu sagte. Dann trat sie zurück, da neue Festgäste eingetroffen waren und sich lautstark bemerkbar machten.
Die Begrüßung ihrer übrigen Familie fiel weit weniger herzlich aus.
»Na, hast den Weg auch noch hierher gefunden aus deinen schimmeligen Kammerln im Schulhaus?«, wurde sie von ihrer Mutter Walburga bissig empfangen.
»Die Wohnung ist saniert worden und jetzt in bester Ordnung«, erklärte Marie zum wiederholten Mal.
Ihrer Mutter passte die Unabhängigkeit, die ihre Tochter sich erkämpft hatte, nicht. Eigentlich passte ihr überhaupt nichts, was Marie dachte und tat, das war schon immer so gewesen. Sie hatte alles darangesetzt, um Maries Ausbildung an der Klosterschule und ihr Studium zu verhindern.
»Wenn ein Madl sich das Hirn zu voll stopft, dann ist sie im Haushalt nimmer zu gebrauchen und mag auch keine Kinder mehr großziehen. Das ist wider die Natur. Und die Männer mögen es halt net, wenn die Frau alles besser weiß, und am End bleibt so ein Madl sitzen und wird eine verbitterte alte Jungfer«, hatte ihr die Mutter immer gepredigt und sie im Übrigen mit kalter Nichtbeachtung gestraft.
Ihrer Meinung nach hätte Marie bis zu ihrer Verheiratung – wobei Walburga den künftigen Schwiegersohn am besten selbst ausgesucht hätte – im Elternhaus gewohnt und sich weiter in häuslichen Fertigkeiten nach dem Vorbild der Mutter geübt. Denn nur so konnte der gute Ruf einer jungen Frau gewahrt bleiben, was neben der Mitgift ihre Aussichten auf eine gute Heirat steigerte.
Maries Bruder Lorenz war der gleichen Meinung, er grollte seinem Vater sogar, dass er das Geld für seine Schwester »zum Fenster hinausgeworfen« habe und versuchte durchzusetzen, dass ihre Mitgift geschmälert wurde. Er selbst hatte nur eine landwirtschaftliche Ausbildung hinter sich gebracht, und schon das war ihm zu viel gewesen, aber sein Vater hatte unnachgiebig darauf gepocht.
Lorenz trat jetzt neben seine Mutter, nickte aber seiner Schwester nur nachlässig zu. Während Marie äußerlich ihrer Mutter glich, die in ihrer Jugend das schönste Madl im Tal gewesen war, schlug Lorenz ganz dem Vater nach. Er wirkte jedoch massiger, und seine Züge drückten Unzufriedenheit aus.
Es tat Marie weh zu sehen, wie der ältere Bruder, den sie als Kind doch geliebt hatte, sich immer mehr zu seinem Nachteil veränderte. Und sie wusste nur zu gut, worin die Ursachen seiner offenkundigen Verbitterung bestanden.
Denn wenn er gehofft hatte, dass sein Vater ihm bei der Heirat den Hof überschreiben würde, so sah er sich getäuscht. Lorenz hatte früh geheiratet, wie es bei den Buchingers üblich war, und das bedeutete, dass sein Vater noch vor Kraft strotzte und sich nicht auf das Altenteil abschieben ließ. Allerdings musste Lorenz den Hof weitgehend allein bewirtschaften, während sich sein Vater seinen Vereinsaktivitäten und der Lokalpolitik widmete.
Wenn Lorenz aber auf seine Eigenständigkeit (und das hieß: die Übergabe des Hofes) pochte, dann ließ Franz Josef Buchinger verlauten, dass er erst dazu willens sei, wenn ein Hoferbe das Licht der Welt erblicken würde. Und das war der Hauptgrund für Lorenz’ stetig zunehmende Verbitterung – seine Ehe war immer noch kinderlos geblieben, obwohl er und seine Frau vor Gesundheit strotzten.
Früher hatte Lorenz immer, wie Marie wusste, im Kreis der Spezln mit seiner Manneskraft geprahlt, wenn er ein paar Weiße zu viel getrunken hatte. Nun aber prahlte sein engster Freund Ferdl mit einer Kinderschar, während Lorenz viel Spott und anzügliche Bemerkungen erdulden musste.
Ihre Schwägerin Silvana kam aus dem Haus, sie wirkte abgehetzt und unfroh. Als sie Marie erblickte, verfinsterte sich ihre Miene noch mehr, und sie fuhr die junge Lehrerin vor allen Leuten giftig an: »Du hättest auch bei den Vorbereitungen helfen können, es ist schließlich dein Vater, für den das Fest ausgerichtet ist. Aber das Fräulein ist sich wohl inzwischen zu schad dafür und will sich net die Finger schmutzig machen.«
Marie errötete, denn so ganz unrecht hatte Silvana nicht. Sie hätte ihre Mithilfe anbieten müssen, andererseits hatte die Erfahrung sie gelehrt, dass ihre Schwägerin sehr aufgebracht reagierte, wenn das tatsächlich geschah. Silvana sah darin den Beweis, dass man ihre unbestreitbare Tüchtigkeit anzweifelte, was sie zutiefst kränkte.
Man konnte es Silvana einfach nicht recht machen.
Und ihre junge Schwägerin war ihr ganz besonders ein Dorn im Auge. Es hatte eine Weile gedauert, bis Marie begriffen hatte, dass Silvana sie beneidete, nicht gerade um ihren Beruf, aber dafür, dass sie doch weitgehend tun und lassen konnte, was sie wollte.
Eigentlich tat ihr Silvana leid, denn sie hatte wahrhaftig kein leichtes Leben auf dem Buchinger-Hof.
Die Ehe war von den Eltern eingefädelt worden, und zur allgemeinen Überraschung verliebten sich Lorenz und Silvana leidenschaftlich ineinander und konnten gar nicht schnell genug zum Traualtar gelangen. Sie waren ein Paar, das ausgezeichnet zueinanderzupassen schien – der kraftvolle Lorenz Buchinger und die kernige Silvana Haushofer mit ihren üppigen Formen und dem hübschen, rosigen Gesicht. Auch in ihren Auffassungen waren sie sich sehr ähnlich, sodass einem harmonischen Miteinander eigentlich nichts im Wege stand.
Und dennoch waren Lorenz und Silvana in ihrer Ehe nicht glücklich geworden, was zum größten Teil an den alten Buchingers lag. Genau wie Franz Josef wollte auch Walburga Buchinger nicht das Zepter aus der Hand geben, und so ließ sie die Schwiegertochter zuarbeiten, ohne je ein lobendes Wort für sie zu finden. Silvana musste tun, was die Schwiegermutter ihr anschaffte, und ihr Mann vermochte es nicht, sich gegen seine Mutter durchzusetzen und Silvana gegen sie in Schutz zu nehmen.
Ihre Kinderlosigkeit hatte ihre Lage vollends unerträglich gemacht. Immer wieder war ihre Hoffnung zerstört worden, und statt ihrer Schwiegertochter Trost zu spenden, gab es nur Bemerkungen vonseiten Walburgas, die Silvana tief trafen. Inzwischen glaubte sie selbst daran, dass sie nutzlos sei, und das hatte aus ihr eine bittere Frau gemacht, die ihren Schmerz in Zorn und Gehässigkeit umgemünzt hatte.
Marie stellte fest, dass Silvana, die kaum älter war als sie, irgendwie verblichen wirkte. Ihre Augen waren glanzlos, und um ihren Mund hatten sich Falten eingekerbt. Auch ihre gesunde Farbe hatte sie eingebüßt, und sie hatte zugenommen, was ihr nicht stand.
Glücklicherweise unterbrach die Ankunft eines Verwandten das unerquickliche Gespräch mit Silvana, und Marie entfernte sich unauffällig in Richtung der Scheune, wo ihre Schulfreundinnen kichernd zusammenstanden. Sie hörte gerade noch, wie der Großonkel Xaver, der noch nie ein Blatt vor den Mund genommen hatte, beinahe entrüstet ausrief: »Was, ihr habt noch immer keinen Nachwuchs? Heut lassen sich die jungen Leut zu viel Zeit damit, und dann ist es zu spät.«
Trotz allem bedauerte Marie die Schwägerin in diesem Augenblick, dann aber wandte sie sich ihren Freundinnen zu.
»Na, hast den Angriff der Silvana unversehrt überstanden? Es wird eh reinweg immer schlimmer mit ihr«, sagte Antonia Haslinger, die bereits ihr zweites Kind erwartete.
»Nun, sie ist halt net glücklich, ihr wisst ja, warum«, nahm Marie unwillkürlich ihre Schwägerin in Schutz.
»Das stimmt schon. Aber man kann es halt net an anderen auslassen«, meinte Gundi Hegbacher, der Marie es manchmal anvertraut hatte, wenn ihr schon einmal wieder von ihrer Schwägerin übel mitgespielt worden war.
»Und wie steht es denn so bei dir, Marie? Magst net heiraten und Kinder haben?«, wandte sich Antonia an die Freundin.
Marie lachte. »Ich werde genug mit Kindern zu tun haben in der nächsten Zeit, auch wenn es net meine eigenen sind.«
»Jesses, geh gnädig mit unserem missratenen Nachwuchs um!«, rief Antonia in scherzhaftem Tonfall, und die Gruppe brach in Gelächter aus.
Den Gästen wurde bedeutet, sich an die Tische zu setzen, und das Essen wurde aufgetragen. Ein wahres Festmahl war zubereitet worden, dazu gab es einen leichten Landwein, auch wenn die Männer lieber ein Bier getrunken hätten.
Marie war nichts anderes übrig geblieben, als sich zu ihrer Familie zu setzen, wo sie schweigend die köstliche Vorspeise und dann ein Wildgericht verzehrte. Auch der Nachtisch war sehr gelungen, und es gab viele beifällige Bemerkungen.
»Das ist wirklich ein wunderbares Essen, Silvana«, wandte sie sich an die Schwägerin, in dem aufrichtigen Bestreben, die Stimmung zu verbessern. Sie war davon überzeugt, dass die Rezepte von Silvana stammten, denn ihre Mutter hatte nie dergleichen gekocht, Walburga bevorzugte üppige ländliche Gerichte, die schwer im Magen lagen.
»Das stammt aus einem alten Büchl von der Ahne«, fuhr Walburga dazwischen, und das Lächeln, das sich auf Silvanas Gesicht ausgebreitet hatte, erlosch jäh.
Marie gab keine Antwort darauf, runzelte nur kurz die Stirn, was Silvana als Zeichen nehmen konnte, dass sie der Behauptung der Buchinger-Bäuerin keinen Glauben schenkte. Und Silvana knüpfte tatsächlich ein Gespräch mit Marie an.
»Und nächsten Monat übernimmst die erste Klasse, oder?«, fragte sie in ungewohnt friedfertigem Tonfall.
»Ja, ich freu mich schon drauf«, ging Marie erleichtert darauf ein.
»Dann bekommst ja den kleinen Brandstetter. Na, viel Glück dazu!«, sagte Silvana mit kaum verhohlener Schadenfreude.
»Heißt der Bub überhaupt Brandstetter? Der wilde Wiggerl soll doch in einem gschlamperten Verhältnis mit der Mutter von dem Kindl gelebt haben«, mutmaßte Walburga, die dem Gespräch gefolgt war.
»Doch, die waren verheiratet, das hat mir die Sissi vom Rathaus erzählt, und die hat ja den Überblick«, widersprach Silvana.
»Wenigstens das. Aber einfach so zu verschwinden und das Buberl seinem Schicksal zu überlassen bei diesen Mannsbildern auf dem heruntergekommenen Hof, das ist schon eine Schande«, sagte Walburga ergrimmt.
»Die sind halt Abschaum, die Brandstetters«, meinte Silvana und verzog den Mund auf eine abschätzige Weise, die Marie nicht an ihr mochte.
»Was hat’s denn mit denen eigentlich auf sich?«, fragte Marie, deren Interesse nun geweckt war, schließlich musste sie über den Hintergrund des Kindes, das in ihre Klasse kommen sollte, Bescheid wissen.
Marie wusste von den Brandstetters nur, dass sie auf einem Hof außerhalb des Dorfes wohnten und von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen waren. Hias Brandstetter, ein Mann von ungezügelter Wesensart, war ein unverbesserlicher Pascher gewesen, so nannte man hier die Wilderer, und war keiner Schlägerei aus dem Weg gegangen. Das hatte schließlich dazu geführt, dass er mehrmals langjährige Gefängnisstrafen abbüßen musste.
Sein ältester Sohn, der wilde Wiggerl, wie Ludwig Brandstetter allgemein genannt wurde, war in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ebenfalls straffällig geworden. Keiner wollte etwas mit den Brandstetters zu tun haben, und wenn sich einer von ihnen im Dorf hatte blicken lassen, dann nur, um Unfrieden zu stiften.
Marie hatte sich nie um den Dorfklatsch gekümmert, und da sie sich in den letzten Jahren kaum zu Hause aufgehalten hatte, war sie nicht mehr auf dem Laufenden. Doch nun wollte sie es genau wissen. »Sind die Brandstetters immer noch so arg? Aber der jüngste Sohn war doch aus der Art geschlagen. Jonas heißt er, wenn ich mich recht erinnere.«
»Du hast von nichts eine Ahnung. Der alte Brandstetter ist schon eine gute Weil nimmer unter den Lebenden. Einfach umgefallen ist er, er hat es halt zu wild getrieben. Und sein Ältester, der wilde Wiggerl, ist bei einer Verfolgung durch die Polizei ums Leben gekommen. Alle haben hinterher gesagt, er hätt es darauf angelegt, so halsbrecherisch wär er gefahren. Lieber wollt er tot sein, als noch einmal ins Gefängnis zu gehen. An den Bub hat er dabei net gedacht«, schloss Walburga ohne jedes Mitgefühl.
»Das ist ja furchtbar«, murmelte Marie, und ein Schauer überlief sie.
»Und die Mutter ist danach spurlos verschwunden, der Bub wär ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Ein schlimmes Frauenzimmer hat der Wiggerl da aufgegabelt. Aufgeführt hat sie sich wie eine Furie, aber allen Männern den Kopf verdrehen, das konnt sie«, ergänzte Silvana die Schilderung ihrer Schwiegermutter.
»Und hat sich net das Jugendamt eingeschaltet, damit das Kind in geordnete Verhältnisse kommt?«
»Doch. Aber die haben es zuletzt dem Jonas überlassen. Der Himmel weiß, warum«, meinte Walburga und schüttelte den Kopf.
»War der Jonas net immer der Hoffnungsträger der Familie? Er ist doch sogar auf das Gymnasium in der Stadt gegangen, daran kann ich mich noch erinnern. Der war ganz anders als sein Vater und der Wiggerl …«
»Das hat getäuscht«, wurde sie von Silvana unterbrochen. »Er ist mit Schimpf und Schande von der Schule geflogen, weil er seinen Lehrer verprügelt hat. Niemand hat erfahren, warum, aber der Apfel fällt halt net weit vom Stamm.«
»Und von was lebt er jetzt? Er muss doch für das Kind aufkommen.«
»Auch das weiß kein Mensch, wahrscheinlich sogar von Sozialhilfe. Er lebt völlig für sich auf dem Hof, ich hab ihn schon ewig nimmer zu Gesicht bekommen. Hin und wieder soll jemand vom Jugendamt vorbeischauen, heißt es. Wenn du mich fragst, gehört dem das Kind weggenommen. Andere wären froh, wenn …« Silvana verstummte.
»Der Bub kann einem leidtun«, sagte Marie schnell. »Er scheint ja überhaupt keine Spielkameraden zu haben.«
»Hoffentlich schlägt er net seinem Vater nach!«, meinte Walburga.
Dann wurde ihre Aufmerksamkeit auf den ersten Festredner gelenkt, der an den Rand seines Glases klopfte, dass es nur so klirrte. Er ließ sich ausführlich und weitschweifig über die Verdienste des »Geburtstagskindes« aus, was nur Franz Josef Buchinger mit großer Hingabe zu verfolgen schien. Danach kamen noch einige kürzere Reden, doch auch die rauschten an Maries Ohren vorbei, ohne dass sich ihr der Sinn des Gesagten erschloss.
Sie konnte den kleinen elternlosen Jungen, der auf dem verwahrlosten Gehöft der Brandstetters aufwuchs, nicht aus ihren Gedanken verbannen. Was für ein trauriges, liebeleeres Leben er führen musste ohne mütterliche Fürsorge! Und wie konnte ein junger Mann wie sein Onkel den Bedürfnissen eines Kindes gerecht werden?
Marie nahm sich vor, ganz besonders auf den Kleinen zu achten und ein wachsames Auge auf ihn zu haben.
Sie konnte sich nur undeutlich an Jonas Brandstetter erinnern. Er ähnelte äußerlich seinem Vater; wie er war er schlank und hochgewachsen, und ein Wust schwarzbrauner Locken fiel ihm ungebärdig in die Stirn. Schöne Mannsbilder waren die Brandstetters allesamt gewesen, doch es war etwas Wildes in ihrem Wesen, das sich nur schwer zügeln ließ.
Jonas allerdings war ihr immer besonnener vorgekommen, und er war von so wacher Intelligenz, dass er den Weg in ein Gymnasium gefunden hatte. Doch anscheinend war das unselige Erbe seiner Familie dann doch stärker gewesen, und er hatte alle Chancen auf ein besseres Leben verspielt …
»Wo bist du denn mit deinen Gedanken?«
Marie schrak zusammen, denn ihre Mutter hatte sie unsanft angestoßen.
»Heut ist der Ehrentag deines Vaters, aber du tust so, als gehörtest net zu uns«, zischte sie der Tochter zu.
Marie gab keine Antwort, versuchte aber, dem Geschehen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Zu ihrer Erleichterung wurde die Tafel bald darauf aufgehoben, und Marie war ihrer Mutter und der Schwägerin beim Abräumen behilflich, um sie zu besänftigen.
Unter Jubel wurde dann ein Fass Bier angestochen, Franz Josef Buchinger war so geübt darin, dass schon die ersten Hammerschläge trafen und die ersten Maß eingefüllt werden konnten, Die Seidel wurden erneut zu Ehren des Gastgebers erhoben und dann unter ausgelassenem Getöse geleert.
»Bei uns gibt’s keine Preußen-Halbe«, juchzte einer der Gäste, der wohl nicht viel vertrug, und schwenkte sein großes Seidel.
Und so nahm das Fest seinen Verlauf. Später am Mittag fand sich eine Gruppe Musiker ein und nahm vor der Scheune Aufstellung, dort war ein Teil des Hofplatzes als Tanzfläche freigelassen worden. Die Buchingers eröffneten den Tanz mit einem langsamen Walzer, und man war einhellig der Meinung, dass die beiden immer noch ein schönes, stattliches Paar waren. Und Walburga, die sonst immer so Strenge, lächelte, als ihr Mann sie in den Armen hielt, und ihre Züge wurden weicher, und sie schien mit einem Mal um Jahre jünger.
Marie verspürte ein ungewohntes Gefühl der Rührung, als sie ihre Eltern beobachtete. Was auch immer man über die Buchingers sagen konnte, sie hatten immer zusammengehalten, auch wenn es Schwankungen gegeben hatte. Ob sie jemals auch so eine Ehe führen würde, die von dem Gefühl der Zusammengehörigkeit geprägt war?
Innerlich seufzte sie. Sie verspürte nicht den geringsten Wunsch zu heiraten. Die Vorstellung, ihre Interessen für das Wohl der Familie in den Hintergrund zu stellen, erschien ihr nicht erstrebenswert.
»Magst mit mir tanzen, Marie?«
Kilian Kronauer, der Nachbarssohn, machte eine höfliche kleine Verbeugung vor ihr. Sie kannte ihn schon seit Kindheitstagen, sie und Lorenz waren Spielkameraden von ihm gewesen. Obwohl es selbstverständlich war, dass er an dem Fest teilnahm, denn man hielt auf gute Nachbarschaft, verspürte Marie ein Gefühl der Verärgerung in sich aufsteigen. Sie war felsenfest davon überzeugt, dass ihre Mutter wieder einmal ihre Fäden spann, denn sie hatte anklingen lassen, dass Kilian ein passender Heiratskandidat sei.
Marie machte aber gute Miene zum bösen Spiel, folgte Kilian zur Tanzfläche, wo man gerade zu einer Polka Aufstellung nahm, bei der es immer recht wild zuging. Wider Erwarten fand Marie zunehmend Vergnügen daran, denn Kilian war – im Gegensatz zu vielen anderen Jungbauern – ein guter Tänzer, und sie harmonierten miteinander.
Am Ende stampfte sie sogar mit den Füßen auf und juchzte, und Killian blieb ihr Tanzpartner bis zum Ende des Festes. Sie musste auch zugeben, dass er anschaulich zu erzählen verstand. Als er schilderte, wie der Laptop des neuen Tierarztes, der mit modernsten Mitteln arbeitete, in die Jauchegrube gefallen war, musste Marie hell auflachen.
»Er hat sogar noch versucht, das Teil dort herauszuholen, und ich musste ihn dran hindern, sonst hätt er am End selber drin gelegen«, schloss er die Geschichte.
Als die Festgäste anfingen aufzubrechen, half Marie bei den Aufräumarbeiten mit. Auch Kilian beteiligte sich daran, doch zuletzt blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zu verabschieden, ohne mit Marie noch ein persönliches Wort wechseln zu können.
»Hast dich mit dem Kilian verabredet?«, fragte ihre Mutter, die plötzlich an ihrer Seite war.
»Warum sollt ich mich mit ihm verabreden?«, gab Marie ungehalten zurück und hätte beinahe das Bierseidel, das sie gerade in der Hand hielt, fallen lassen.
»Ihr habt den ganzen Abend miteinander getanzt und euch gut verstanden. Das war net zu übersehen.«
»Das stimmt. Aber das ist trotzdem kein Grund …«
»Dem Kilian hast gefallen, er konnt ja kaum die Augen von dir lassen«, fiel ihr Walburga sofort ins Wort.
»Sag mal, willst mich mit ihm verkuppeln und hast dich auch noch mit ihm abgesprochen?«
»Und – wär das so schlimm? Der Kilian wär der Richtige für dich. Er ist net nur tüchtig, sondern auch ein rechtschaffener junger Mann. Und du machst ja keine Anstalten, dich nach einem Ehemann umzuschauen«, verteidigte sich Walburga.
»Ich such mir meinen Ehemann schon selber aus. Außerdem denk ich noch lang net ans Heiraten.«
Walburga lachte böse auf.
»Noch lang net? Du bist bald nimmer im richtigen Alter, überhaupt noch einen zu finden. Der Kilian gehört zu den wenigen ordentlichen Mannsbildern, die noch net verheiratet oder verbandelt sind. Die guten Jahre gehen für eine Frau nur allzu schnell vorbei, und wenn du dich net zur rechten Zeit entscheidest, dann stehst am End als alte Jungfer da. Und das ist immer noch eine rechte Schand«, brach sich der lange aufgestaute Groll Walburgas Bahn.
»Eine Schand ist es, jemanden zu heiraten, den man net gern hat. Außerdem will ich unabhängig von …«
»So ein Schmarren! Dazu hat die Natur uns Frauen net bestimmt. Wir haben andere Aufgaben, nämlich Leben zu schenken.«
Silvana, die den letzten Teil des Wortwechsels mitbekommen hatte, bekam schmale Lippen und wandte sich ab.
»Jeder Mensch hat das Recht, sich sein Leben so einzurichten, wie er es will. Und als Großbäuerin tät ich eh nichts taugen, das weißt ganz genau«, erwiderte Marie heftig und ließ ihre Mutter stehen.
Zum ersten Mal kam ihr zu Bewusstsein, welchem Druck ihre Schwägerin ausgesetzt war und wie sich das auf Silvana ausgewirkt haben musste. Kein Wunder, dass sie so unleidlich geworden war und mit der Schwiegermutter nicht mehr unter einem Dach leben wollte!
So endete das Fest doch noch mit einem Missklang. Marie half noch eine Weile mit, dann aber nutzte sie eine Mitfahrgelegenheit ins Dorf. Marie atmete tief auf, als sie die Tür ihrer kleinen Wohnung hinter sich zufallen ließ.
Endlich allein und nicht mehr von ihrer Familie bedrängt!
Sie nahm sich vor, den Festen auf dem Buchinger-Hof fernzubleiben, aber sie wusste, dass sie diesen Entschluss dann doch nicht in die Tat umsetzen würde. Denn trotz allem konnte sie sich der familiären Verbundenheit nicht entziehen. In diesem Geiste war Marie aufgewachsen und geprägt worden.
Aber wenigstens hatte sie hier eine Zuflucht gefunden, und sie ließ sich auf ihr Sofa sinken und schleuderte die Schuhe von den tanzmüden Füßen. Zufrieden ließ sie dann die Blicke umherschweifen. Hier fühlte sie sich geborgen.
***
Die darauf folgende Zeit verbrachte Marie auf eine für sie angenehme Weise. Sie vervollständigte die Einrichtung; eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen schmückten nun die kahlen Stellen im Flur und die Bücherregale im Arbeitszimmer waren eingeräumt.
Sie begann nun, den Unterricht in allen Einzelheiten zu planen, damit alles vorbereitet war, wenn die Schule nach den Sommerferien wieder anfing. Manchmal schlich sie sogar in eines der leeren Klassenzimmer hinunter und stellte sich vor, wie sie ihre zukünftigen Schüler am ersten Schultag begrüßen würde.
Marie traf sich auch mit ihren Freundinnen Gundi und Antonia, die meistens auch ihren kleinen Sohn mitbrachte. Peterl war ein friedliches Kind, das gerne aß und gerne schlief, sodass sich die jungen Frauen ungestört unterhalten konnten. Ohne dass Marie es beabsichtigt hatte, wandte sich das Gespräch den Brandstetters zu oder, besser gesagt, Jonas Brandstetter.
»Ich möchte nur wissen, was der Jonas den ganzen Tag treibt«, meinte Gundi, »niemand bekommt ihn zu Gesicht.«
»Aber er braucht doch Lebensmittel und allerhand Sachen für das Kind«, wandte Marie ungläubig ein.
»Hin und wieder sieht man seinen dunklen Geländewagen auf der Landstraße. Ich tät mich net wundern, wenn er zum Einkaufen bis nach München fährt«, gab Antonia Auskunft und warf einen wachsamen Blick auf ihren kleinen Sohn, der jedoch mit schräg geneigtem Köpfchen in seinem Wagen schlief.
»Ich kann einfach net glauben, dass die Frau vom wilden Wiggerl das Kind im Stich gelassen hat. Welche Mutter tut denn so etwas«, sagte Marie unvermittelt, denn dieser Gedanke ließ sie nicht los.
»Ja, die Ramona«, sagte Antonia und betonte spöttisch die Mittelsilbe des Namens, der für diese Gegend recht exotisch klang.
»Eine ganz Wilde war das, die Ramona Brandstetter«, ergänzte Gundi. »Hast die eigentlich noch gekannt?«
Marie schüttelte den Kopf.
»Da ist dir was entgangen. Gelb gefärbte Haare mit bunten Strähnen hat sie gehabt, und immer hat sie zu enge und zu kurze Kleider getragen. Das konnt sie sich leisten bei ihrer Figur, alle Mannsbilder hat sie verrückt gemacht.«
»Aber an dem wilden Wiggerl hat sie wohl gehangen«, wandte Antonia ein.
»Das stimmt. Wenn der am Leben geblieben wär, hätt sie den Hof net verlassen. Als ihr die Todesnachricht überbracht worden ist, war sie wie von Sinnen. Vielleicht ist sie deswegen weggegangen, weil sie nichts mehr an den Wiggerl erinnern durft, noch net mal sein Sohn«, fügte Gundi hinzu.
Trotz allen Unverständnisses regte sich in Marie unwillkürlich Mitgefühl für diese Frau. »Wer weiß, was aus ihr geworden ist!«, sagte sie leise.
»Aber jetzt etwas anderes«, rief Gundi munter aus, um dem Gespräch eine neue Wendung zu geben. »Hast eigentlich den Kronauer-Kilian wiedergesehen seit dem Fest?«
»Du klingst ja schon wie meine Mutter«, sagte Marie, und die Freundinnen brachen in Gelächter aus.
»Immerhin hast das ganze Fest über bei euch auf dem Hof mit dem Kilian getanzt. Ihr habt euch ja gar nimmer voneinander trennen können. Da denkt man doch, dass sich da etwas anspinnt«, hieb Antonia in dieselbe Kerbe.
»Der Kilian ist ein fescher Bursch, und es macht Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Aber das heißt noch lang net, dass ich ein Gspusi mit ihm hab«, wehrte Marie ab.
»Ist das so, weil deine Mutter gern hätt, dass ihr euch zusammentut, oder hast dich wirklich net in ihn verliebt?«, bohrte Gundi nach.
»Beides, kann man sagen. Ich hab mich deswegen schon mit meiner Mutter gestritten. Sie versucht mit aller Macht, mich an den Mann zu bringen, bald werde ich auf der nächsten Kirmes wie saures Bier angeboten«, scherzte Marie, aber es war deutlich ein bitterer Unterton herauszuhören.
»Das musst auch so sehen, Marie. Wenn der Lorenz und die Silvana weiter kinderlos bleiben und du vielleicht auch net heiraten willst – dann tät der Buchinger-Hof halt nimmer in der Familie bleiben. Ganz davon abgesehen, dass die Walburga jetzt allmählich in dem Alter ist, dass sie Enkel haben will. Es kommt sie halt arg hart an, dass bei der Silvana die Wiege leer bleibt«, meinte Antonia.
Marie seufzte. Dann aber warf sie Gundi einen verschmitzten Blick zu. »Du scheinst ja ganz genau wissen zu wollen, wie es um den Kilian und mich steht, hab ich recht?«
Gundi errötete, was ihr gut stand. »Ich wollt ja nur wissen, ob ich mich drauf einrichten sollt, bald Brautjungfer zu sein«, brachte sie schließlich hervor.
»Warum net gar Braut?«
»Ach geh, Marie! Der Kilian will eh nichts von mir wissen, der hat doch nur Augen für dich«, meinte Gundi mit gesenktem Blick.
»Da musst ihm halt die Augen öffnen! Bist doch ein hübsches Madl. Bei meinem Manderl hab ich damals auch ein bisserl nachhelfen müssen. Die Mannsleut wissen halt oft net, was gut für sie ist«, meinte Antonia.
Gundi, die sichtlich verlegen war, wurde einer Antwort enthoben, weil Peterl erwachte und lautstark seine Unzufriedenheit bekundete.
Antonia sah auf die Uhr. »Jessas! Da haben wir uns aber verratscht! Ich muss dringend nach Haus«, rief sie aus, beruhigte unter Mithilfe der Freundinnen das Kind und eilte davon.
Auch Gundi und Marie trennten sich voneinander, mit dem Versprechen, sich bald wieder zu einem gemeinsamen Sonntagsfrühstück zusammenzufinden. Marie erledigte noch ein paar Einkäufe, dann kehrte auch sie in ihre kleine Wohnung zurück, wo sie sich wieder ihren Vorbereitungen widmete.
Wenig später, es war schon gegen Abend, klingelte es. Marie wunderte sich, öffnete aber und sah in das Treppenhaus hinunter, wo sie Kilian Kronauer erblickte, der lächelnd hocheilte und ihr einen Blumenstrauß überreichte.
»Zum Einstand in deine neue Wohnung«, sagte er.
Er hatte sich für den Besuch fast feiertäglich gekleidet, zu den Hirschledernen einen dunklen Janker mit glänzend rotem Spenzer, was ihm sehr gut stand. Marie blieb nichts anderes übrig, als sich zu bedanken und ihn in die Wohnung zu bitten.
Kilian sah sich aufmerksam um. »Schön hast du’s hier, alles sehr geschmackvoll. Man soll net denken, dass in dem alten Gemäuer so eine schöne Wohnung ist«, meinte er dann.
»Es musst so einiges saniert werden«, sagte Marie. »Aber setz dich doch, Kilian. Willst was zu trinken.«
»Nur ein Wasser, danke.« Sichtlich zufrieden ließ er sich auf dem Sofa nieder und schien nicht gewillt, diesen Platz so schnell wieder zu räumen. »So kann man’s aushalten«, murmelt er und lehnte sich zurück.
Marie gab keine Antwort darauf, stellte das Wasser vor ihm auf den Tisch und setzte sich ihm gegenüber in den Lehnsessel. Sie hatte nicht vor, es ihm leicht zu machen, schließlich war er uneingeladen hier aufgetaucht, und sie hatte einmal mehr den Verdacht, dass ihre Mutter hinter diesem Besuch steckte.
»Willst mir Grüße von der Mama überbringen?«, fragte sie daher spitz.
Kilian lachte, was ihn noch sympathischer machte, und für einen Augenblick bedauerte sie, keine tieferen Gefühle für ihn zu empfinden. Sicher wäre er ein zuverlässiger Ehemann und ein fürsorglicher Vater, aber sie liebte ihn nicht. Daran war nichts zu ändern, so sehr auch ihre Mutter mit ihr hadern mochte.
Er begann, von dem zurückliegenden Fest zu reden und wie gut es ihm gefallen hatte, mit ihr zu tanzen. »Weißt, drüben in Riedstetten ist ein Vereinsfest, ich hab dort ein paar Spezln und bin dazu eingeladen. Mit Begleitung natürlich. Dann könnten wir wieder miteinander tanzen, es hat dir doch auch gefallen.«
Bei dem letzten Satz hatte seine Stimme einen fast flehenden Tonfall angenommen, der Marie ins Herz schnitt. Und sie beschloss, Kilian ein für alle Mal klarzumachen, dass er sich keinen falschen Hoffnungen hingeben durfte.
»Es war schön auf dem Fest, Kilian, das stimmt. Aber das heißt net, dass wir von jetzt an unzertrennlich sind. Ich kann dich gut leiden, doch mehr ist da net. Es wär unrecht von mir, dich hinzuhalten, das macht es am End nur noch schmerzlicher für dich. Du bist doch ein fescher Bursch, Kilian, es gibt im Tal noch genug hübsche Madln. Ich kenn sogar eine, die sehr in dich verliebt ist. Und außerdem taug ich net zur Bäuerin …«
»Ich will nur dich, Marie, keine andere! Und für den Hof kann ich jemanden einstellen, damit du weiter als Lehrerin arbeiten kannst, wenn dir das so am Herzen liegt«, fiel er ihr so heftig ins Wort, dass sie erschrak. Niemals hätte sie eine solche Leidenschaft bei ihm vermutet. Kilian gehörte eher zu den besonnenen Menschen.
»Du weißt selber, dass das net geht. Und zur Ehe gehört halt die rechte Lieb, auf beiden Seiten, sonst wird ein Unglück draus. Das musst doch verstehen, Kilian. Und es tut mir leid, wenn meine Mutter dir eingeredet hat, dass ich mich nur zieren tät«, sagte sie leise.
»Das hat nichts mit deiner Mutter zu tun, obwohl ich weiß, dass sie es gern sähe, wenn wir heiraten täten. Ich hab dich schon immer gern gehabt, schon als du noch eine brave Klosterschülerin warst«, bekannte er.
In seinen Augen lag Trauer, aber keine Wut über die Zurückweisung, und er stieg noch mehr in Maries Achtung. Es ging ihr durch den Sinn, dass es vielleicht doch ein Fehler war, nicht auf Kilians Werben einzugehen, doch sie fühlte sich nicht zu ihm hingezogen.
Kilian erhob sich langsam, das Glas mit dem Wasser hatte er nicht angerührt.
»Dann geh ich besser«, kam es von seinen Lippen.
»Kilian – ich hoff, dass wir in Zukunft aber trotzdem miteinander auskommen«, sagte sie fast bittend. Marie wusste nur zu gut, dass verschmähte Liebe oft eine lebenslange Feindschaft nach sich ziehen konnte, und bei einer so engen Nachbarschaft wie zwischen den Kronauers und den Buchingers würden sich Streitigkeiten verheerend auswirken. Auf dem Land musste man zusammenhalten.
»So einer bin ich net«, sagte Kilian, und seine Gestalt straffte sich.
»Das geht auch nur uns zwei was an«, gab Marie zurück, sodass er sich sicher sein konnte, dass niemand von seiner Niederlage erfahren würde.
Marie geleitete ihn hinaus und blieb stehen, bis seine Schritte verhallt waren und sich die Haustür hinter ihm geschlossen hatte. Sie fühlte sich bedrückt und niedergeschlagen, denn es tat ihr leid, einen liebenswerten Menschen unglücklich gemacht zu haben.
Halbherzig ging sie wieder an ihren Schreibtisch zurück, und es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren.
***
Schon als Marie Buchinger zum ersten Mal ihre Schüler, die sich im Klassenzimmer versammelt hatten, richtig ins Auge fasste, wusste sie sofort, welches der Kinder der kleine Sandro Brandstetter war. Er saß allein ganz hinten und umklammerte einen teuer aussehenden Lederrucksack und hatte weder eine Schultüte noch ein Kuscheltier dabei. Misstrauisch sah er um sich und zeigte keine Neigung, sich an dem lebhaften Treiben um ihn herum zu beteiligen.
Er hatte den gleichen schwarzbraunen Lockenwust wie sein Vater, der wilde Wiggerl, und auch dessen abwägenden Blick. Aber es spiegelte sich auch eine wache Intelligenz in Sandros Augen, statt Trotz und Aufsässigkeit, was ihn von seinem Vater unterschied. Er befolgte jede Anweisung, und irgendwie hatte Marie das Empfinden, dass er genau zu überlegen schien, ob sie auch sinnvoll war.
Ein schwieriges Kind, das erkannte sie sofort.
Und es sollte auch nicht lange dauern, bis sich zeigte, dass sie mit dieser Beurteilung recht hatte, obwohl zunächst alles sehr friedlich verlief. Die Kinder waren ganz damit beschäftigt, sich einzugewöhnen und sich miteinander anzufreunden und schenkten daher Sandro, der sich zurückhaltend verhielt, wenig Beachtung.
Sandro hingegen blieb am liebsten für sich und sprach kaum mit den anderen, geschweige denn, dass er versuchte, Freundschaften zu schließen. In den Pausen blätterte er meistens in einem abgegriffenen Büchlein, sodass man fast den Eindruck gewann, dass er schon lesen könnte. Überhaupt schien er den anderen auf eine unbestimmte Weise weit voraus zu sein, was Marie noch mehr beunruhigte.
Als sie einmal etwas verspätet auf dem Weg zum Klassenzimmer war, hörte sie lautes Geschrei, und sie beschleunigte ihre Schritte. Sandro und der Sohn des Bürgermeisters wälzten sich am Boden, die anderen standen drumherum und feuerten sie an.
Marie erriet sofort, was der Anlass zu der Rauferei gewesen war, Sandros Lieblingsbuch lag auf dem Boden, einige Blätter waren herausgerissen und verschmiert.
»Hört sofort auf!«, rief Marie streng.
Sandro versetzte seinem Kontrahenten einen so gezielten Schlag, dass der kleine Xaver Laibacher erschrocken aufjapste und benommen liegen blieb. Dann stand er auf, ein zierlicher Junge im Vergleich zu dem feisten Xaver, der jetzt schon seinem Vater nachschlug. Er sah die anderen der Reihe nach an, nicht unfreundlich, eher prüfend, und die Kinder wichen unwillkürlich vor ihm zurück.
»Es tut mir leid«, entschuldigte er sich bei Marie.
»Der Xaver hat angefangen«, meldete sich eines der Mädchen zaghaft zu Wort.
»Petze!«, erklang es gedämpft.
»Aber es stimmt doch«, trumpfte sie auf.
Doch Marie achtete schon gar nicht mehr auf die Kinder, sie hatte sich besorgt zu Xaver hinuntergebeugt, der vor sich hin wimmerte.
»Wo tut es dir weh? Kannst aufstehen?«
Xaver gab keine Antwort. In seinen Augen schimmerten Tränen, aber es waren Tränen der Wut, nicht des Schmerzes.
»Der stellt sich immer so an, wenn ihm was net passt«, sagte einer der Jungen abschätzig.
»Wenn du net aufstehen kannst, dann muss ich den Doktor rufen, damit er dich gründlich untersucht und dir eine Spritze gegen die Schmerzen gibt«, sagte Marie.
Trotz seiner Plumpheit war Xaver erstaunlich flink auf den Beinen und warf Sandro einen bösen Blick zu. Er zischte ihm kaum vernehmbar ein übles Schimpfwort zu, doch Marie hatte es sehr wohl gehört.
Sandro war blass geworden und hatte die kleinen Hände zu Fäusten geballt.
»So etwas, Xaver, will ich hier nie wieder hören, hast mich verstanden?«, sagte Marie mit aller Strenge, zu der sie imstande war.
Der Junge setzte sich auf seinen Platz und schwieg verstockt.
Marie hielt es für das Beste, sofort mit dem Unterricht zu beginnen, und nach einer Weile ging alles wieder seinen gewohnten Gang. Nur Sandro saß still und regungslos da, er war immer noch bleich.
Als er nach der letzten Stunde schnell aus dem Klassenzimmer eilen wollte, hielt Marie ihn zurück. »Hast du die Blätter von deinem Buch eingesammelt? Du kannst sie ja einkleben. Es tut mir leid, dass der Xaver das zu dir gesagt hat. Kommt so etwas öfters vor?«
Sandro zuckte gleichmütig mit den Schultern, sein Gesicht nahm einen verschlossenen Ausdruck an.
»Du musst es mir sofort sagen, wenn sie dich net in Ruh lassen«, beschwor Marie den Jungen, der mit seinem seltsamen Lederrucksack über der Schulter vor ihr stand.
Es fiel ihr auch auf, dass er eigenartig gekleidet war. Er trug teure Markensachen, die in München für Kinder angeboten werden, aber sie passten farblich nicht recht zusammen. Das Hemd war außerdem mindestens eine Nummer zu groß und hing lose um den schmächtigen Körper des Kindes.
»Hast verstanden, was ich dir eben gesagt hab?«, drang Marie in ihn.
»Schon«, murmelte er, und mehr wollte er nicht von sich geben.
Dann verschwand er so schnell aus dem Schulgebäude wie ein Wiesel, das seinem Bau entgegenstrebt, wo es vor Feinden sicher ist. Bis Marie ans Fenster getreten war, um ihm nachzusehen, befand er sich schon nicht mehr in ihrem Sichtfeld. Es hatte den Anschein, als hätte sich Sandro schon von vornherein auf einen Fluchtweg eingestellt.
Alle hatte ihr das Schlimmste prophezeit, weil Sandro in ihrer Klasse war, und nun musste sie einsehen, dass die Schwierigkeiten größer waren, als sie es sich hatte vorstellen können. Ein plötzliches Gefühl der Hilflosigkeit überkam sie: Wie sollte sie Sandro vor den Bosheiten der anderen schützen?
Und wie schwer das war, erkannte sie schon am nächsten Morgen, als der Bürgermeister in das Schulgebäude stürmte und nicht eher ruhte, bis sie den Unterricht unterbrach, um sich seine ergrimmten Tiraden anzuhören.
»Ganz elend ist mein Bub gestern nach Haus gekommen, nachdem ihn dieser Balg von den Brandstetters in der Mangel gehabt hat«, tobte Laibacher, so außer sich, dass er rot im Gesicht wurde, und sein Dreifachkinn erzitterte.
»Dem Xaver hat nichts gefehlt, ich hab mich davon überzeugt …«
»Ich werde dafür sorgen, dass der von hier verschwindet! Das Jugendamt werde ich informieren, damit er dorthin kommt, wo er hingehört, nämlich in ein Heim für verwahrloste Kinder. Eine öffentliche Gefahr ist der wie alle Brandstetters …«
Jetzt wurde auch Marie laut. »Das reicht! Der Xaver hat sich an Sandros Sachen vergriffen, deshalb ist es zu der Rauferei gekommen.«
»Das ist eine elendige Lüge!«, schäumte Laibacher.
»Das haben die Kinder mir gesagt, und ich hab das zerrissene Buch auf dem Boden liegen sehen. Und eh du hier herumschreist, Bürgermeister, solltest du deinem Xaver erst mal beibringen, dass er sich net an fremdem Eigentum vergreift und dann auch noch Lügen erzählt«, erwiderte Marie heftig.
Laibacher war es nicht gewohnt, dass man ihm widersprach, und von einer Frau ließ er sich das schon überhaupt nicht gefallen. Seine Wut wandte sich nun gegen sie.
»Was will denn so ein einfältiges Madl ohne jede Lebenserfahrung schon von Kindererziehung wissen? Ich war von vornherein dagegen, dass du die Stelle bekommst, eine erfahrene Lehrkraft, ein Mann, wär viel besser gewesen. Aber nein, dein Vater hat das ja durchsetzen müssen im Gemeinderat.«
»Darum geht es hier net«, erwiderte Marie mit äußerster Selbstbeherrschung, »das kannst mit meinem Vater ausmachen. Ich will, dass der Sandro hier net schikaniert wird, sag das deinem Sohn.«
»Und ich sag dir, dass sich keiner von uns von so einem unbedarften Madl wie du etwas sagen lässt«, herrschte Laibacher sie an und stürmte auf den Ausgang zu.
Es fiel Marie sehr schwer, den Unterricht so fröhlich und gelassen wie sonst weiterzuführen. Die Gedanken wirbelten nur so hinter ihrer Stirn. Was, wenn Laibacher seine Drohung wahrmachte und tatsächlich das Jugendamt einschaltete? Sandros Erziehungsberechtigter war sein Onkel, kein Elternteil, und Marie traute Laibacher durchaus zu, dass er eine Hetze gegen Jonas Brandstetter lostrat, damit man ihm das Sorgerecht für das Kind entzog. Und dann würde Sandro unter Umständen doch in ein Heim kommen …
Das musste sie unbedingt verhindern.
Marie entschloss sich widerstrebend, den Hof der Brandstetters aufzusuchen, um mit Jonas zu sprechen und ihn auf die Situation vorzubereiten. Sie atmete erleichtert auf, als der Unterricht vorbei war, weil sie sich kaum noch konzentrieren konnte. Und daher würde sie auch gleich nach dem Essen aufbrechen, um diese unangenehme Pflicht so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.
Schon als Kind waren ihr immer wieder Geschichten über die Brandstetters zu Ohren gekommen, die Machenschaften des Vaters und die unglaublichen Geschichten, die sich um den wilden Wiggerl rankten. Eine Familie, die von Rohheit und Gewalt geprägt war, ein unseliges Erbe für den kleinen Sandro.
Im Grunde wusste sie überhaupt nichts von Jonas, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, und so schritt sie auf einem von alten Obstbäumen gesäumten Feldweg auf das Anwesen der Brandstetters zu, nachdem sie die Landstraße hinter sich gelassen hatte.
Eigentlich hätte sie diesen Gang durch die herbstliche Landschaft genießen müssen, denn die Natur entfaltete noch einmal ihre ganze Pracht, ehe sie in winterlicher Kälte erstarren würde. Der Bergahorn erglühte rot, und die Laubbäume leuchteten wie goldene Flammen zwischen dem dunklen Nadelgehölz des Bergwaldes.
Der Himmel war von einem eigenartigen blassen Blau, und die Umrisse des Gebirgsmassivs zeichneten sich scharf dagegen ab. Der Zwiebelturm der Dorfkirche schien in dem zarten mittäglichen Dunst zu schweben. Hin und wieder spürte Marie trotz der spätsommerlichen Wärme einen kalten Hauch, der ahnen ließ, dass sich diese Zeit mit ihrer verschwenderischen Pracht dem Ende zuneigte.
Doch Maries Freude an der Natur war gedämpft, weil ihre Gedanken ganz bei der bevorstehenden Begegnung mit Jonas Brandstetter waren und sie sich eingestehen musste, dass sie sogar Angst davor empfand.
Was war aus Jonas geworden, und, vor allem, wie würde er sie empfangen?
Als sie vor dem Hoftor ankam, stellte sie fest, dass es mit einer großen eisernen Gittertür versperrt war; in der Mitte war ein Warnschild, das auf einen bissigen Hund hinwies, angebracht. Das war hier nicht üblich, bei allen anderen Gehöften stand das Hoftor immer einladend offen, während es hier wirkte, als verbarrikadierte sich jemand dahinter.
Durch die Gitter konnte sie jedoch hineinspähen, und es bot sich ihr ein Bild des Niedergangs und der Verwahrlosung, das weitaus schlimmer war, als sie es sich vorgestellt hatte. Einstmals musste das Anwesen der Brandstetters ein stattliches Gehöft gewesen sein, doch jetzt zeugte alles davon, dass es von den Besitzern sträflich vernachlässigt worden war.
Das Dach des Wohnhauses war eingesunken und nur stellenweise mit neuen Schindeln ausgebessert, wahrscheinlich hatte es hereingeregnet. Die Fensterrahmen waren verzogen, die Farbe war abgesplittert, und die Malerei an der Außenfront konnte man kaum noch erkennen, so ausgebleicht war sie.
Auf dem Hofplatz lag veraltetes Gerät verstreut, eine angerostete Egge stand neben den Überresten eines Mistplatzes. Zwischen den Steinfliesen spross das Unkraut, auf der Hausbank lag eine magere Katze und schlief.
Marie drückte zaghaft gegen die Tür und stellte fest, dass sie sich öffnen ließ. Sie trat ein, um mit einem Aufschrei zurückzufahren, denn ein riesiger Hund schoss kläffend auf sie zu.
Ein scharfer Pfiff erklang, und der Hund wandte sich abrupt um und trottete zum Haus zurück, wo eine hochgewachsene männliche Gestalt auftauchte und ihn anleinte. Erst dann wagte sich Marie, die sonst keine Angst vor Hunden hatte, weiter vor.
Jonas Brandstetter, den mächtigen schwarzen Rottweiler eng bei Fuß, trat ihr entgegen.
»Es tut mir leid, wenn dich der Luzifer so erschreckt hat, aber er hat wohl gedacht, eine der Schnepfen – Verzeihung, eine der Fürsorgerinnen – vom Jugendamt tät uns wieder heimsuchen. Auf die ist er reinweg allergisch, der Luzifer.«
Luzifer knurrte jedes Mal leise, wenn er seinen Namen hörte.
»Nun ja, so etwas Ähnliches bin ich ja auch …«
Jonas lachte auf, gab aber keine Erklärung für seine Erheiterung ab.
Marie musterte den jungen Mann, der vor ihr stand und ihr irgendwie viel zu nah war. Er war schlank und sehnig und strahlte eine urtümliche Kraft aus. Seine Züge waren sehr regelmäßig, aber durchaus männlich, und obwohl er dunkle Haare und Augen hatte, war seine Haut kaum gebräunt, als hielte er sich hauptsächlich in geschlossenen Räumen auf.
Er trug die traditionelle knielange Hirschlederhose, jedoch ohne Hosenträger. Sein Hemd war gewiss einmal teuer gewesen, doch es war vom häufigen Waschen etwas ausgebleicht und schlecht gebügelt. Marie musste den Impuls unterdrücken, ihm den zerknitterten Hemdkragen glatt zu streichen.