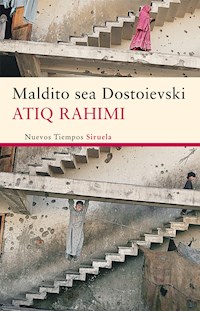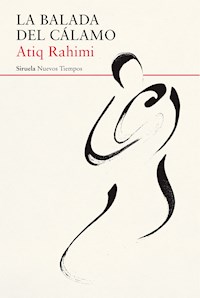9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was bleibt, wenn das Band zur Kindheit zerreißt 1973 gerät das Leben des elfjährigen Atiq Rahimi aus den Fugen: Sein Vater, Richter am Obersten Gerichtshof in Kabul, wird nach einem Staatsstreich ohne Angabe von Gründen verhaftet. Als man ihn endlich freilässt, geht er ins Exil nach Indien, wohin ihm der Sohn folgt. Ein Kulturschock für den muslimisch erzogenen Jungen, der plötzlich mit einer anderen Zivilisation konfrontiert ist, vor allem mit einer anderen Religion, dem Hinduismus, und ihren nur allzu menschlichen Göttern. Einige Jahre später verschlägt es Atiq Rahimi nach Frankreich, wo er seitdem lebt. Dreißig Jahre nach seiner Flucht aus Afghanistan schreibt Atiq Rahimi erstmals über sein Exil und sein Verhältnis zu Heimat und Muttersprache. Entstanden ist ein poetisches Journal intime, das den besonderen Lebensweg des Goncourt-Preisträgers nachzeichnet. • Atiq Rahimi ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Exilautoren • Hochwertige Ausstattung mit Kalligraphien und Zeichnungen des Autors
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
1973 gerät das Leben des elfjährigen Atiq Rahimi aus den Fugen: Sein Vater, Richter am Obersten Gerichtshof in Kabul, wird nach einem Staatsstreich ohne Angabe von Gründen verhaftet. Als man ihn endlich freilässt, geht er ins Exil nach Indien, wohin ihm der Sohn folgt. Ein Kulturschock ebenso wie eine willkommene Weitung des eigenen Horizonts für den muslimisch erzogenen Jungen, der plötzlich mit einer anderen Zivilisation konfrontiert ist. Einige Jahre später verschlägt es Atiq Rahimi nach Frankreich, wo er seitdem lebt.
Dreißig Jahre nach seiner Flucht aus Afghanistan schreibt Rahimi erstmals über sein Exil und sein Verhältnis zu Heimat und Muttersprache. Entstanden ist dieses poetisches Journal intime, das den intellektuellen Kosmos des Goncourt-Preisträgers nachzeichnet.
Der Autor
Atiq Rahimi, geboren 1962 in Kabul, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Maler. 1984 floh er während des afghanisch-sowjetischen Krieges über Pakistan nach Frankreich. 2002 erschien sein international vielbeachtetes Romandebüt Erde und Asche, das auch verfilmt wurde. Für Stein der Geduld – den ersten Roman, den er auf Französisch schrieb – erhielt Rahimi 2008 den Prix Goncourt. Zuletzt erschien auf Deutsch sein Roman Verflucht sei Dostojewski.
Waltraud Schwarze studierte Romanistik und Bibliothekswissenschaft, sie betreute über viele Jahre im Aufbau Verlag die Literatur aus den romanischen Sprachen. Zu den von ihr übersetzten Autoren gehören Fred Vargas, Annick Cojean, Delphine Coulin. Sie lebt in Berlin.
Atiq Rahimi
Heimatballade
Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze
Ullstein
Die Originalausgabe erschien 2015unter dem Titel La Ballade du calame. Portrait intime bei L’Iconoclaste, Paris.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1549-2
© L’Iconoclaste, Paris, 2015© der deutschsprachigen Ausgabe2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagabbildung: © Carl Purcell/Three Lions/Getty Images
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für R. K.,die das Land meiner Geburt in sich trägt
Was du nicht bist, ist ein Selbstporträt.
Georg Baselitz
Im Anfang …
Es ist Nacht.
Und das Wort ist immer noch abwesend.
Ich bin in meinem Atelier,
einem verschwiegenen Territorium, wohin meine unvollendeten Wünsche sich zurückziehen;
zeitweilig auch Schreibstube, wo ich meine Träume und meine Alpträume lautlos zu Papier bringe, bevor sie zu fernen, flüchtigen Erinnerungen werden.
Vor mir an der Wand eine Galerie Fotos und Reproduktionen von Bildern, die Menschen in einem Augenblick ihrer Flucht zeigen. Verbannte, Vertriebene, Verlorene …
Exil heißt, seinen Körper zurückzulassen, sagte Ovid.
Und mit seinem Körper auch seine Worte, seine Geheimnisse, seine Gesten, seinen Blick, seine Freude …
Diese Bilder, die ich seit einem Jahr gesammelt und dort angebracht habe, bilden ein Mosaik aus Gesichtern und Körpern – bekannten und unbekannten, imaginären oder auch nicht –, die alle gleich mir von der Geschichte zur Ungewissheit des Exils verdammt sind. Jeder verlorene Blick ist ein Roman, jeder Schritt ins Ungewisse ein Schicksal. Diese Umherziehenden, die es, im Spiralnebel der Zeit treibend, an die Ränder der Welt verschlagen hat, sehen mir zu, wie ich verzweifelt nach Worten suche, nach Atem ringe, um ihre Träume zu beschreiben, ihre Odysseen zu erzählen, ihre Schreie wiedergeben zu können.
Die Tragödie, die sie aus ihrer Heimat vertrieben hat, verweigert sich der Benennung … Sie verflucht die Stimme, flieht die Wörter.
Das Wort ist auf der Flucht.
Und das Buch, das Gelobte Land, verwehrt ihm die Aufnahme.
Die Bilder dieser Tragödie haben die beklemmendeMacht einer Wunde, die jedes Mal, wenn man sie ansieht, den Schmerz von neuem belebt, den man im Augenblick der Verletzung empfunden hat. Ein seltsames Gefühl, unmöglich, es durch Adjektive und Adverbien zu beschreiben. Der Bildschirm meines Rechners bleibt leer. So leer wie mein Kopf.
Ich betrachte diese Fotos und diese Bilder wie meine eigenen Wunden.
Ein Ausgestoßener wie sie,
habe ich die gleiche Vergangenheit,
dasselbe ungewisse Schicksal,
dieselben Wunden …
Ein Bild fehlt an dieser Wand. Doch es lässt meine vagabundierenden Gedanken nicht mehr los. Ein Bild, ein einziges. Eine menschenleere, schneebedeckte Ebene, ein Raum irgendwo zwischen den Zeiten, ein Schlüsselmoment meines Lebens, von dem ich immer und überall erzähle. Und jedes Mal ist mir, als erzählte ich ihn zum ersten Mal, während ich ihn doch mit den immer gleichen Worten, gleichen Sätzen, in den gleichen Einzelheiten schildere … Er ist mein Psalm.
Dieses Bild folgt mir überallhin, selbst hier in mein Atelier heute Abend, es liegt vor mir auf meinem Arbeitstisch wie ein weißes Blatt. Seine Weiße steht für das Vakuum meines Daseins eines Verbannten; sie ist Ausdruck meiner Urerfahrung des Exils:
Es war Nacht, eine kalte, lautlose Nacht.
Alles, was ich hörte, war das gedämpfte Geräusch meiner eisigen Schritte im Schnee. Ich floh aus dem Krieg, träumte von einem Anderswo, von einem besseren Leben.
Schweigend, beklommen lief ich auf eine Grenze zu, in der Hoffnung, dass Schrecken und Leid meine Spur verlieren würden.
An der Grenze angekommen, sagte der Schleuser zu mir, ich solle einen letzten Blick auf mein Heimatland werfen.
Ich blieb stehen und sah zurück: Alles, was ich sah, war eine verschneite Ebene, darin die Spuren meiner Schritte, und auf der anderen Seite der Grenze eine Wüste, unberührt wie ein jungfräuliches Blatt Papier. Ohne irgendeine Spur. Ich sagte mir, so würde es sein, das Exil, ein weißes Blatt Papier, das ich erst beschreiben müsste.
Ein seltsames Gefühl überkam mich.
Unergründlich. Ich wagte nicht weiterzugehen, auch nicht umzukehren.
Aber gehen musste ich doch!
Kaum hatte ich die Grenze überschritten, als die Leere mich aufsog. Das ist der Taumel des Exils, raunte es in mir.
Ich hatte weder die heimatliche Erde mehr unter den Füßen noch meine Familie in den Armen, noch meine Identität im Gepäck.
Nichts.
Heute, dreißig Jahre später, sitze ich müde noch immer vor diesem weißen Blatt. Wie soll ich mein Leben darauf niederschreiben? Ich kann es nicht. Seit Monaten vergrabe ich mich in meinem Atelier, um dieses Buch über mein Exil zu schreiben.
Unmöglich.
Da ist die Angst.
Eine rituelle, stets wiederkehrende Angst, aufwühlende und quälende Erfahrung, die ich jedes Mal wieder mache, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze. Immer die gleiche Geschichte, als wäre es mein erstes Buch, als überschritte ich zum ersten Mal eine Grenze, verließe ein Land für ein anderes, ein Leben für ein anderes, eine Liebe für eine andere …
Mein Umherirren währt ewig.
Meine Angst ebenso.
Meine Hand, zitternd wie meine Schritte, wenn ich Grenzen passierte, greift plötzlich nach einer Metallfeder, gleitet über das Papier, setzt zögernd einen Strich, einen unbeholfen vertikalen Strich.
Er erinnert zunächst weder an einen Buchstaben noch sonst an irgendeine Form, an gar nichts!
Es sei denn …,
ja natürlich,
… an den ersten Strich, den ein Kind malt, wie um den ersten Buchstaben der ersten Schrift anzudeuten, die sich der Mensch je ausgedacht hat. Ich höre Rabindranath Tagore, den großen indischen Dichter, wie er zu diesem Kind spricht:
Du kamst, um die Geschichten fortzuschreiben, die von unseren Vätern nie beendeten Geschichten in der verborgenen Schrift der Seiten unseres Schicksals …
Du erweckst die vergessenen Dekore wieder zum Leben, um neue Bilder entstehen zu lassen …
Dieser Federstrich versetzt mich in meine Kindheit zurück, in meine ersten Schuljahre in Kabul, und ich erinnere mich an meine ständige Angst vor der schwarzen Holztafel, die leer war wie das Universum vor dem Wort. Meine zitternden kleinen Finger hielten den Qalam umklammert, die Rohrfeder, aus ihrer Spitze tropfte flüssige weiße Kreide, die einen schwachen Geruch von Kalk verströmte. Ich wartete wie alle meine Kameraden auf den zitterigen Ruf unseres Lehrers für Kalligraphie:
Alif!
Dann befahl er uns, einen Kreis zu zeichnen, dessen Durchmesser der Buchstabe alif wäre, wie die Achse, so fügte er hinzu, die die beiden Pole der Erdkugel miteinander verbindet.
Während wir uns mühten, seine Weisungen richtig auszuführen, fuhr er ohne Rücksicht auf unser Alter und unsere Auffassungsgabe in seinem Reden fort. Aber vielleicht verstand auch nur ich nichts! Heute denke ich beim Schreiben manchmal an jene Augenblicke und an das, was er uns gesagt haben mag. Er wird heruntergespult haben, was er seit seiner Kindheit auswendig wusste und was schon sein eigener Lehrer ihm gesagt haben wird:
Alif, ein langer Vokal, Phonem »â« oder »a«, ist der erste Buchstabe des arabischen Alphabets, das unserer Sprache, dem Persischen, vor mehr als zwölf Jahrhunderten aufgezwungen wurde. Der berühmte irakische Dichter und Kalligraph Ibn Moqla (886 bis 940) war der Erste, der die Buchstaben kodifizierte, ihre Proportionen festlegte und der das alif als den »Ur-Buchstaben« definierte, das Maß aller anderen Buchstaben.
Danach durften wir uns damit plagen, das alif auf unseren Holztäfelchen zu kalligraphieren. Er zog sich in eine Ecke des Klassenraums nahe beim Fenster zurück, um seinen schmächtigen Körper den Strahlen der Frühlingssonne auszusetzen. Er nahm seine Persianermütze ab und murmelte in seinen graumelierten Bart ein Gedicht, an das ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann. Vielleicht waren es diese Verse von Hafis, dem Klassiker der persischen Dichtung des 14. Jahrhunderts:
Auf der Tafel meines Herzens
steht nur das Alef deiner einzigen Gestalt.
Was soll ich tun? Kein anderer Buchstab
wurde mir von meinem Meister doch gelehrt.
Er verlangte von uns auch, daran erinnere ich mich, auf jede Zeile zweimal das alif zu schreiben, danach dreimal, und sie alle sollten identisch sein, die gleiche Größe, die gleiche Stärke, den gleichen Schwung haben … Mir gelang es nie, und auch heute noch kann ich es nicht. Ich habe nie ganz gerade, ganz senkrechte und einander vollkommen gleiche Striche zeichnen können. Sie waren immer leicht nach rechts geneigt, etwas gebogen und von unterschiedlichen Proportionen.
Achtung, es ist ein heiliger Buchstabe! Man darf nie mit ihm spaßen, ihn niemals irgendwie oder irgendwo hinschreiben, ihn gar wegwerfen … Denn mit dem alif beginnt Allahs Name!
Ein göttlicher Buchstabe, gewiss, doch ausgestattet mit menschlichen Körperteilen.
Ich stellte mir Gott daraufhin als einen weißen Mann vor, groß und hager stand Er vor dem Nachthimmel (Warum lag Er eigentlich nicht? Man braucht doch nur den Blickwinkel zu wechseln!), von einer unmerklichen Bewegung beseelt. Ich sagte mir, dass Er, Allah, wohl am Tag schlief und der Sonne den Platz überließ, in der Nacht aber wiederkam, um unseren Schlaf zu behüten und unsere Träume zu beschützen.
Aber …
woher …
kamen dann meine Alpträume?
Meine erste Sünde
Drei Jahre später musste ich dann die schwarze Tafel und den Kalkgeruch tauschen gegen chinesische Tusche, mit der ich auf weiße Blätter schrieb. Wir mussten die heiligen Worte aus dem Koran kopieren, sorgfältig, als wären es Hieroglyphen. Und so fromm, als wären sie ein Gebet. Sonst gab es auf die kleinen Finger ein paar Schläge mit dem khat-kash, der Reißfeder, also dem Lineal.
Ich hasste die Khatâti-Stunden, weil wir nur abschreiben sollten, nichts weiter. Und ich schaffte es nie, denselben Buchstaben genau zu kopieren oder ihn, gleichmäßig mit Tusche gefüllt, verlaufen zu lassen. Meine Buchstaben nahmen ihre eigene Form an, ich kopierte sie auf meine Weise; sie waren immer auf eine unbekümmerte Art leicht angeschlagen, selbst wenn ich meine Feder tief ins Tintenfass tauchte. Ich war ungeduldig, ich wollte alles in einem einzigen Schwung hinzeichnen. Meinen Lehrer regte das wahnsinnig auf, aber mich machte es stolz, weil ich so Nuancen von Grau in die Schriftzüge brachte, die auf magische Weise das Schwarz mit dem Weiß, die Tinte mit dem Papier, die Fülle mit der Leere verbanden. Das gab ihnen ein Relief, eine Perspektive. Meine Buchstaben waren nicht mehr starr, sie bewegten sich. Erst heute wird mir das so recht bewusst.
Folglich wurde ich oft bestraft: Ich musste mit einer sehr scharfen Klinge die Rohrfedern der anderen Schüler anspitzen. Eine schmerzhafte, gewalttätige, blutige Strafe, deren Spuren der Haut meiner heute fünfzigjährigen Hände unauslöschlich eingraviert bleiben.
Der Lehrer begann seine Unterrichtsstunden immer mit der Sure 68 des Korans, in der Gott, zu Mohammed gewandt, im Namen des Qalams gelobt:
Beim Schreibrohr und bei dem, was mit ihm niedergeschrieben wird!
Du bist dank der Gnade deines Herrn nicht besessen.
Der Lehrer erzählte uns dabei auch folgende Anekdote, die meine überschäumende Phantasie gleich in eine Comic-Szene umsetzte:
Als Gott das Schreibrohr schuf, befahl er ihm: »Schreib!«, und das Rohr fragte: »Was soll ich schreiben?« Er sagte: »Schreib, was bis zum Tage der Auferstehung geschehen wird. Auch dass, was den Menschen heimsuchen wird, ihm nicht fehlen durfte, und was er nicht besitzt, ihm nicht bestimmt war.« Die Tinte in den Federn ist getrocknet, und die Blätter sind weggeräumt.
Der Lehrer war ein sehr ernster Mann. Ich habe ihn nie lächeln sehen. Er glaubte uns zu ermutigen, wenn er sagte, wer die Kalligraphie beherrsche, der würde nach seinem Tod ein Schreiber-Engel, der in Allahs Auftrag die Worte, die Gedanken und Handlungen der Lebenden aufzeichnete.
Engel fürchtete ich. Ich wollte ganz und gar nicht, dass meine Gedanken Gott berichtet würden, noch wollte ich nach meinem Tod, im Jenseits, ihm die Gedanken anderer Menschen übermitteln. Niemals!
Nein, ich werde niemals Kalligraph!, schwor ich mir.
Es war an einem Sommertag.
Die Sonne stand im Zenit.
Und unser Lehrer, der sich in den Hintergrund des Klassenzimmers zurückgezogen hatte, war eingenickt.
Ich nutzte diesen Augenblick der Stille, in dem wir nur noch Schatten im Schlaf des Meisters waren, und zeichnete mit dem Qalam arglos das Gesicht eines Mannes. Von uns unbemerkt aus seiner Siesta erwacht, überraschte mich der Lehrer dabei und befahl mir, sofort den Unterricht zu verlassen. Ich war ein Ungläubiger! Der Prophet sagt, wer am Tag des Jüngsten Gerichts am schlimmsten bestraft werden wird, das sind die Maler!, predigte uns der Lehrer immer.
Warum aber maßte er sich dann an, mich hier im Diesseits schon zu bestrafen, lange vor dem Tag des Jüngsten Gerichts? Hält er sich für Allah?, fragte ich mich insgeheim, während ich mit gesenktem Blick die Klasse verließ.
Ich verstand überhaupt nichts.
So habe ich endgültig die Kalligraphie für die Malerei aufgegeben. Zur großen Freude meiner Mutter, die einst an einem Mädchengymnasium Kunstunterricht gegeben hatte. Und meine Mutter war es auch, die mir alles im Zeichnen beigebracht hat.
Sie war abergläubisch.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.