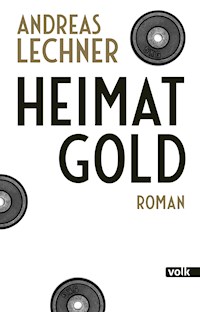
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Volk Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vorkriegszeit im ländlichen Bayern: Während die Industrialisierung im Inntal Einzug hält, stemmt ein Bauernbub aus Kolbermoor jeden Tag Mehlsäcke im Dachkammerl über der Sägemühle des Großvaters. Josef Straßberger hat ein Ziel – der stärkste Mann der Welt zu werden. Und weder seine Herkunft noch die Einberufung ins „1. Bayerische Fußartillerie-Regiment“ können ihn aufhalten. Er überlebt den Ersten Weltkrieg und geht in die große Stadt zu den Gewichthebern des TSV 1860 München. Bald folgt Titel auf Titel – alles führt ihn zu seinem größten Triumph bei den Olympischen Spielen 1928. Die schillernden Zwanzigerjahre bringen den wirtschaftlichen Aufschwung, mit Gastronomie und Pferden häuft er ein Vermögen an. Doch dann entfachen die Nationalsozialisten den Weltenbrand … Andreas Lechner taucht tief in das Leben seines Großvaters, des Gewichthebers und Olympiasiegers Josef Straßberger, ein und entwirft dabei das grandiose Sittengemälde eines halben Jahrhunderts deutscher Geschichte, von der Jahrhundertwende bis in die frühen Tage des Wirtschaftswunders.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Lechner
HEIMAT GOLD
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2019 by Volk Verlag München
Neumarkter Straße 23; 81673 München
Tel. 089 / 420 79 69 80; Fax: 089 / 420 79 69 86
Druck: Kösel Krugzell
Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
ISBN 978-3-86222-322-0 (epub)ISBN 978-3-86222-323-7 (mobi)
www.volkverlag.de
»Das Kapital sucht neuen Raum – es herrscht wieder Krieg im Land.«
Als alle tot waren, kündigte die Erbengemeinschaft mir die Mietwohnung und verkaufte das Haus an eine Investorengemeinschaft.
Langsam schreite ich durch meine Behausung, die eigentlich für einen allein zu groß ist. Aber wer bestimmt das?
In der Kammer stöbere ich in den Nachlasskisten und stoße auf wenige Dinge. Alte Fotos und Ausschnitte aus Zeitungen. Ein schwarzes, einfaches Holz-Kruzifix. Ein mit Brüsseler Spitze eingefasstes Taufkleidchen. Ein auf Holz gemaltes Ölbild – das Porträt meiner Mutter Frieda als Kind. Zwei Porzellanpuppen – Dorle und Fritzi. Ich klappe ein Etui mit einem Silberessbesteck auf. Darin eingraviert: Hotel Münchner Hof, Josef Straßberger, Olympiasieger 1928.
In einem Kuvert die Sterbebildchen des Großvaters und der Großmutter. Ein Daumenrosenkranz. Ich blättere in den Fotoalben mit den Schwarzweißfotografien. Die Kontraste sind verschwommen und die Ränder stark vergilbt.
In einer Schatulle finde ich alte Feldpostbriefe, mit einem Geschenkband und einer Schleife zusammengebunden. Fein geschwungen ist die Sütterlinschrift auf dünnem, fast schon zerfallendem Papier.
Ich stoße auf Großvaters Notizbücher und beginne, darin zu lesen. Am Kleiderständer hängt sein Borsalino – mein Erbe.
Es verschwimmt die Zeit und hervor tritt der kleine, kräftige Bub im Kolbermoor. Man schreibt das Jahr 1902.
Auf einem kleinen Bauernhof, an der Landstraße zwischen Bad Aibling und Kolbermoor, bin ich am 20. August 1894 als Ältester geboren. Meine sechs nachgeborenen Geschwister sind getauft auf die Namen: Franz, André, Hans, Anna, Amalie und Babette. Zwei Fehlgeburten hat meine Mutter gehabt, was nichts Besonderes ist, ein Kindstod halt.
16 Kühe stehen im Stall, ein paar Ziegen, ein Ziegenbock und ein paar Sauen, etliche Hühner, Enten, Gänse. Letztere sind immer um die Weihnachtszeit und an Kirchweih verschwunden, ebenso fort ist der Ziegenbock, nachdem er die Tante Resi umgerannt hat und ihr Fuß deswegen eingegipst werden musste. Mei, das war eine Aufregung! Seitdem humpelt die Resi, weil der Knochen ein wenig scheps zusammengewachsen ist. Die Resi, die Schwester vom Großvater, der übergeben hat, nachdem die Großmutter vor zwei Jahren gestorben ist. Da hat der Großvater geweint und gestützt hat ihn die Resi, als die Familie und die Verwandtschaft am Kolbermoorer Friedhof am Grab standen und die Blasmusik den Trauermarsch von Chopin spielte. Schaurig schön war das.
Die Resi, das Jungfrauerl, wie die Leute im Dorf immer sagen – aber so ganz kann es nicht sein, denn im 70/71er-Krieg, wo es um Elsass und Lothringen ging, hat sie ihrer großen Liebe, dem Bertl, die ewige Treue versprochen wie dem Heiland und hat ihn im Feld lassen müssen. Und seitdem ist sie einschichtig geblieben, wie es im Volksmund so schön heißt.
Es ist ein kleiner Hof, an einem malerischen Bachlauf gelegen, der zur Mangfall hinführt und die Bauernfamilie so recht und schlecht ernährt. Nichts, um große Reichtümer anzuhäufen, eher etwas, wo immer am Rande der Existenz ums Überleben gearbeitet wird. Denn Bauer ist nicht gleich Bauer. Und so ist ein Zusatzerwerb von Vorteil, um die Familie satt zu bekommen. Unten am Bachlauf gehört noch eine kleine Sägemühle zum Hof, wo insbesondere im Winter, wenn die Feldarbeit ruht, die Bretter, Latten und Balken aus den Baumstämmen geschnitten werden, die im Herbst und Winter gefällt werden. Die Sägemühle ist voll und ganz das Refugium vom Großvater Alois.
Bei ihm bin ich am liebsten. Ihm helfe ich gerne und rolle die Baumstämme nach dem Schepsen auf den Frosch, der den Stamm am unteren Ende mit einer gusseisernen Klammer einzwängt und auf einer Schiene dem Gatter zuführt. Da werden die Sägeblätter eingespannt, gerade so viele, wie es jeweils braucht für die Balken, Latten oder Bretter, und rattern mit vielen Hüben auf und ab. Ein Wasserrad treibt das Schwungrad an, das eine Pleuelstange nach oben und unten mit rasender Geschwindigkeit mehrere hundert Male in der Minute bewegt. Fasziniert stehe ich oft neben dem Gatter und bestaune dieses Wunderwerk der Technik. Und kehre dann nach einer Zeit mit einem Besen das Sägemehl und die Holzspäne zusammen, die später im Stall zum Einstreuen hergenommen werden.
Der besondere Stolz vom Vater sind seine Rosse, die beiden Kaltblüter, die Wallache Flori und Beri, die im Sommer auf dem Acker und im Winter zum Holzrücken im Wald zu gebrauchen sind und auch vor die Chaisn gespannt werden. Flori, das Sattelpferd, ist ein Rotbrauner aus Frankreich, der mit hoch erhobenem Kopf wiehert und Feuer hat wie ein Hengst. Niemand Fremden lässt der an sich heran und beißt jeden weg. Vorsichtig muss man sein, wenn man bei ihm an der Hinterhand vorbeigeht, denn da schlägt er gerne aus. Daneben Beri, das Handpferd, ein alter Belgier, der ist das genaue Gegenteil vom Flori, ja fast ein Langweiler, bringt aber gerade dadurch die Ruhe ins Zweiergespann. Ihn darf ein jeder anfassen und zwischen den Ohren kraulen, lammfromm ist er.
•
Nach der Weltausstellung in Paris befand sich der Industrialisierungsprozess in vollem Gange und erreichte peu à peu auch die ländlichen Gegenden. Die ersten Umwälzungen kündigten sich an und veränderten die bäuerliche Arbeitswelt, ja das Leben.
Wenn es zu Lichtmess neue Schuhe gab, wussten die Knechte und die Mägde, dass sie für ein weiteres Jahr eine Arbeit am Hof hatten. Gab es keine, so mussten sie aufbrechen und in den umliegenden Höfen anfragen. Oft wurden sie nur eine Erntesaison lang gebraucht.
So kam auf den Straßberger’schen Hof ein Knecht und fragte, ob er zur Ernte dableiben könne, worauf Josefs Vater sagte: »Ich kann dir keine neuen Schuh’ geben, so viel wirft der Hof nicht ab. Der Nachbarhof, der Huabahof, ist dreimal so groß und kann sich mehrere Knechte und Mägde leisten. Frag halt da nach.«
Und der Knecht antwortete ihm: »Ja, da komm ich grad her, der alte Huababauer braucht mich nicht mehr, hat er gsagt, des macht jetzt alles die neue Maschin’.«
Im Sommer zuvor hatte der Huababauer, der größte Bauer in der Gegend, als Erster im Landkreis einen Langmähdrescher bei der Ernte eingesetzt und so nach und nach die kraft-, zeit- und personalintensiven Arbeitsgänge eingespart. Die Zeit der Knechte und Mägde war vorbei. Wie ein Drache aus einer untergegangenen Zeit, der aus seinen Nüstern dampft und raucht, war das Monstrum über die Landstraße hinaus aufs Feld gerollt. Fast hatten die Leute gedacht, der Teufel käme leibhaftig damit aus der Hölle geritten, doch der Pfarrer hatte sie bei der Messe am Sonntag beruhigt: »Das ist die neue Zeit, die jetzt auch zu uns aufs Dorf kommt.« So hatte er von der Kanzel heruntergesprochen und alle hatten das Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht. »Es wird schon nicht schlimmer kommen als es eh schon ist.«
Der abgewiesene Knecht jedoch hatte auch ein Auge auf die Resi geworfen. Und Resi hatte ihm die kalte Schulter gezeigt. Sonst wäre er vielleicht auch ohne neue Lichtmess-Schuhe geblieben.
So kann ein Treuschwur, und nicht zuletzt auch der Stolz darauf, zum Hemmschuh werden. Und Resi blieb weiter allein.
•
Die Dorfschule ist nicht unbedingt das Meine. Ich sitze im Klassenzimmer und blicke gedankenverloren aus dem Fenster und schaue den Vögeln zu, wie sie in der Baumkrone der Eiche auf dem Schulhof von Ast zu Ast hüpfen. In den Nestern wartet die frisch geschlüpfte Brut, die ihre Schnäbel weit aufreißt und in den Himmel reckt, wenn die Vogeleltern ihre Beute bringen.
Ich träume vom Wald, wo ich auf die Jagd mitgehen darf. Vom Ansitzen am frühen Morgen, kurz vor Sonnenaufgang. Und vom Ansitzen am frühen Abend, bis der feuerrote Mond am Himmel steht und die Lichtung in geheimnisvollen Dämmer taucht. Wenn das Reh- und Rotwild aus dem Dickicht heraus zur Äsung tritt, wie hingezaubert. Wenn der Fuchs sich leise von hinten an den Hochsitz anschleicht, weil der Großvater das Fiepen einer Maus täuschend echt imitiert und ihn so anlockt. Oder Großvater faltet ein Ahorn- oder Buchenblatt zur Brunftzeit und nimmt es so zwischen die Daumen und Zeigefinger und bläst an den gefalteten Blattenden vorbei, dass sie vibrieren und es wie der Angst- oder Lustschrei einer Rehgeiß klingt. Und plötzlich knacken ringsum die Äste. Und es raschelt im Laub. Und aus brechendem Gehölz springen die geifernden Rehböcke heran, um ihre Geiß zu verteidigen. Dann stehen sie still, wie vom Bildhauer in die Lichtung hineingemeißelt, wie Wiesenblumen, wie der Wald, angespannt und zum Sprung bereit. Scheu.
Ich träume von der Feldarbeit, wo ich beim Heumandlmachen helfe. Vom Hof daheim, von den Gerüchen und Geräuschen im Stall, wo der Stier seinen Hals am Gatter wetzt und die Kette klirrt.
Von der Kuh, die letzte Woche allein ihr Kalb in die Welt gepresst hat. Vom Kälberziehen, wenn ein Strick um die Läufe des Kalbs geschlungen und mit aller Kraft gezogen wird, wenn die Kuh die Kraft verlassen hat oder das Kalb verkehrt herum liegt und zu ersticken droht.
Von fremden Ländern, von Negern, von Chinesen. Von Elefanten und Giraffen.
Und ich male mit dem Radiergummi Kreise auf die zerkratzte Schulbank und stochere im Tintenfass herum und warte, dass die Uhr im Kirchturm zwölf Mal schlägt und der Unterricht vorbei ist.
Und dann nichts wie weg, hinaus in den Wald, wo der Großvater Alois zusammen mit dem Vater beim Holzrücken ist und eine helfende Hand gerne in Anspruch genommen wird.
Ich male mit dem Radiergummi auf der Landkarte der Träume.
Im Wald draußen habe ich einmal Tannenzapfen gesammelt und unter dem Bett in einem Obstkistl zum Trocknen gelagert, um sie an Weihnachten an den Christbaum zu hängen oder in die Krippe zu legen. So war der Plan. Und was ist das für eine Aufregung, als einen Monat später aus den Tannenzapfen hunderte, nein tausende Ohrwuzler aus den Ohrwuzlereiern schlüpfen, die in den Tannenzapfen verborgen waren, im ganzen Haus herumkrabbeln und sich in den Ritzen der Wände verstecken.
Nun werden die Hausmittel angewendet, denn Resi hat mit einer ähnlichen Plage schon einmal Bekanntschaft gemacht. Im ganzen Bauernhaus stehen auf einmal Blumentöpfe, die mit Holzwolle ausgestopft sind, und zwar verkehrt herum: jeder Topf mit der Öffnung nach unten und leicht angekippt. Über Nacht sollen sich die Tiere in dem Gefäß sammeln und am nächsten Morgen einfach nach draußen transportiert werden – so die Theorie. In den Töpfen finden sich am nächsten Tag zwar ein paar der Wuzler, aber die kann man an zwei Händen abzählen.
Die Mutter, die eh schon skeptisch war, ob die Blumentopfmethode funktioniert, greift nun doch zu ihrer Radikalkur. Jede Ritze und jedes Löchlein im Haus wird mit einer speziellen Tinktur aus Essig und Chlor eingesprüht und berieben. Und plötzlich sind ganze Armeen von Ohrwuzlern unterwegs, stürmen hinaus ins Freie.
Irgendwann einmal, da steht plötzlich der Sohn vom Huababauer, der Wimmerl, in der Mühle. »Helfts mir, ich weiß nicht, was ich machen soll!«
Und er bringt einen quietschenden Feldhasen mit, dem die neue Mähmaschine alle vier Pfoten weggeschnitten hat. Es ist unglaublich, wie dieses Geschöpf Gottes schreit, wie ein Kind in höchster Pein.
»Wie lang bist denn schon unterwegs mit deiner Kreatur?«, fragt ihn der Großvater.
»Ja, schon eine Zeit«, sagt darauf der Wimmerl.
Schon fast eine halbe Stunde lang muss das Geschöpf so leiden, weil der Wimmerl nicht weiß, wie das Feldhasenmartyrium beendet werden kann. Wimmerl ist kreidebleich im Gesicht. Der Großvater greift sich einen Haselnussstecken, schlägt dem Hasen kurz ins Genick und die Sache ist erledigt. Und Wimmerl staunt, wie friedvoll der Hase nun daliegt, fast schlafend.
»So, und jetzt nehmts den Hasen aus und ziehts ihm das Fell ab, dann gibt’s ein Hasenragout am Sonntag nach dem Hochamt«, meint der Großvater verschmitzt und er wendet sich, in sich hineingrinsend, wieder seiner Gattersäge zu, um die Sägeblätter neu zu justieren.
Da stehen wir beide nun wie zwei begossene Pudel und wissen nicht, wie das zu bewerkstelligen ist. Zugeschaut haben wir des Öfteren auf der Jagd, wo wir als Treiber dabei sind. Mit einem »Huraxdax, huraxdax, pack’s beim Hax« auf den Lippen und mit den Schlägen eines Steckens auf die Baumstämme und Stauden im Unterholz scheuchen wir das Niederwild auf und den Jägern vor die Flinte. Das erlegte Wild wird dann am Ende des Jagdtages ausgenommen. Die Innereien, der Bruch, wie das Herz, die Lungen, die Nieren und die Leber heißen, kommen in einen großen Topf, wo die Wildsuppe dann zusammen mit duftenden Kräutern dahinköchelt und mit Mehlstaub eingedickt wird. Später dann, wenn die Jagdgesellschaft beim Füglein-Wirt zu einem Trunk zusammensitzt, wird die dampfende Suppe aus original Hutschenreuther Maria-Theresia-Weißporzellan-Löwenkopfterrinen serviert.
Und der Großvater drückt mir sein Jagdmesser in die Hand und sagt: »So, und jetzt ans Werk.«
Und ich steche in die Bauchseite des Hasen, um die Innereien herauszunehmen. Gleich spritzt mir eine braungrüne Masse aus dem Schlitz entgegen, die vermengt ist mit gelbem Urin.
»Mei, stinkt dees«, meint darauf der Wimmerl und hält sich die Nase zu.
Und mit dem – im wahrsten Sinne – Mut der Verzweiflung mache ich weiter und beende das stinkende Werk.
Zwei wesentliche Schritte habe ich nicht ausgeführt. Zuallererst muss die Harnröhre geleert werden, indem man sie ausdrückt. Der Großvater lehrt mich: »Ausbrunzen musst ihn zuerst lassen und dann die Bauchdecke einen Zentimeter anheben. Und dann die Messerspitze zwischen Zeige- und Mittelfinger nehmen. Und unter der Bauchdecke einen Schlitz schneiden, um die Blase und die Därme nicht zu verletzen.«
Fürs nächste Mal weiß ich nun Bescheid, denn nur durch Fehler lernt man ja bekanntlich. Unten am Bach habe ich dann den Hasen ausgewaschen und die Decke abgezogen, wobei mir der Großvater mit Rat zur Seite gestanden hat.
Am Wochenende ist das Malheur dann vergessen, und der Großvater erzählt auch niemandem etwas davon, als das Hasenragout in der Küche im Kessel dampft und mit deftigen Knödeln auf den Tisch kommt. Und allen schmeckt’s und niemand bemerkt etwas. Was der Großvater nämlich nicht verrät, ist, dass er heimlich ein paar Bisamratten mit der Falle gefangen und der Mutter für das Ragout gegeben hat. Der Bisam ist ein Nagetier, das vor einiger Zeit hier aufgetaucht ist und sich rasend vermehrt. Man sagt, wir haben’s aus Amerika, wo alles Verwerfliche herkommt. Oder aus dem Osten. Am schlimmsten aber sind die Kommunisten und der Jud. So ist die vorherrschende Meinung. Die Bisamratten jedenfalls graben ihre Gänge in die Bachdämme, die vor dem Hochwasser im Frühling, wenn die Schneeschmelze ist, schützen sollen, und durchlöchern ihn wie einen Schweizer Käse, sodass es oft zu Dammbrüchen kommt. Darum hat der Großvater einen Hass auf den Bisam-Ratz. Und immer, wenn er einen findet, macht er kurzen Prozess.
Einmal fische ich ohne Köder im Weiher neben dem Hof, eher aus Langeweile. Der Großvater spottet: »Ja, da fängst ja nix, wennsd keinen Köder am Haken hast.«
Doch ich bleibe stur. »Wirst schon sehen«, sage ich.
Und auf einmal zuckt etwas an der Angelschnur und ein riesiger Frosch hängt am Haken. Der Frosch hat den Haken wohl mit einer Libelle oder einem anderen Insekt verwechselt. Die Notoperation, um den Haken zu entfernen, hat der Frosch jedenfalls nicht überlebt. Wie ein Ballon hängt ihm die Luftblase, die herausgehüpft ist, aus dem Maul heraus, sodass ich das Jagdmesser auf ihn herabfallen lasse, weil er so zappelt und weil ich den Haken retten will. Frosch oder Haken, das ist hier die Frage.
Ausgezappelt hat er jetzt. Warum muss er auch so gierig sein und einen Haken ohne Köder schlucken.
Und ein großes Quaken, ein Jammern, der Froschtrauerchor, setzt am Teich ein. Der Frosch muss wohl eine große Verwandtschaft haben.
Am Weißen Sonntag dann, nach Ostern, habe ich meine erste heilige Kommunion. Ich knie im Beichtstuhl, denn die Seele muss ja kniend reingewaschen werden.
Und der Pfarrer sagt: »Gelobt sei Jesus Christus« und macht ein Kreuzzeichen.
Darauf sage ich: »In Ewigkeit. Amen.«
Und darauf wieder der Pfarrer: »Gottes Liebe, Güte und Barmherzigkeit sei mit dir. Und nun bekenne deine Sünden.«
Darauf wieder ich: »In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden.« Und wie ich es im Religionsunterricht gelernt habe, mühe ich mich nun mit den Geboten ab.
»Komm ruhig ein bissel näher, dass ich dich besser hören kann«, nuschelt der Pfarrer und hält sein Ohr ganz dicht an das Holzgitter des Beichtstuhls, vor dem ich ehrfürchtig knie.
Es ist ein harter Schemel ohne Polsterung. In der Hand hält der Pfarrer ein weißes Beichttuch, etwa taschentuchgroß, legt es sich über Mund und Nase und neigt den Kopf, während ich, das Beichtkind, meine Sünden abhake. Das Beichttuch dient als Atemschutz. Wer will sich auch schon stundenlang ins Gesicht schnaufen lassen? Um den Hals hat er die violette Stola gehängt, die ganz schön dreckig und schmierig ist.
Und ich blicke unter dem verrutschten Beichttuch in den Mund des Pfarrers wie in den Abgrund der Hölle, der gesäumt ist von schwarzen, löchrigen Zähnen. Wie schiefe Grabsteine auf einem Friedhof. »Und wahrscheinlich nimmt er sein Beichttuch auch als Schneuztüchl her«, denk ich mir, denn denken ist ja erlaubt. Und weiter geht’s mit dem Beichten auf dem Pfad der Zehn Gebote bis hin zur Absolution.
Als dann das fünfte Gebot – »Du sollst nicht töten« – an der Reihe ist, gerate ich ins Stocken und erzähle meine Geschichte vom Froschmord, aber so wenig ausgeschmückt wie nötig.
Und der Pfarrer kommt ins Schmunzeln und fragt, nachdem ich fertig bin: »Hast auch nichts vergessen?«
»Nein, nein«, sage ich, »das wär alles, mehr hab ich nicht verbrochen.«
»Na, dann gehe hin in Frieden. Und als Buße betest du mir drei Gegrüßet seiest Du, Maria und ein Vaterunser. Und nun spreche ich dich los von deinen Sünden. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine patris et filii et spiritus sancti.«
Mit einem »Amen« bin ich nun zum ersten Mal alle meine Sünden los und alles ist paletti.
Eine feine Sache ist das, da haben es die Evangelischen nicht so leicht, denn die haben ja keine Beichte. Das weiß ich, weil in der Schulklasse ein Protestantenkind sitzt – ein Akatholischer. Seine Familie ist aus dem Zillertal ausgewandert und hat sich zunächst in Hall in Tirol und erst viel später in Kolbermoor angesiedelt, weil der Vater hier eine Anstellung in der Spinnerei bekommen hat.
Und wie das Protestantenkind dann bei uns in der Dorfschule saß, hat das Fräulein Herbst die Unterschiede zwischen den Evangelischen und den Christkatholischen erklärt. Die Evangelischen wollen das Gottesreich schon jetzt auf Erden verwirklichen, nicht erst im Paradies, und dürfen nicht beichten, um ihre Sünden loszuwerden. Deshalb möchte ich niemals ein Evangelischer sein. Der Protestant in der Schule ist fast schon ein Aussätziger. Fast wie ein Jud’.
•
Tatsächlich dachte Josef damals so. Alle dachten so. Denn es dauert seine Zeit, bis man das, was man ohne nachzudenken übernommen hat, durch Erfahrung und Bildung revidiert. Leider machen diesen Schritt zu wenige und deshalb ist die Welt so, wie sie ist. Das Katholische jedenfalls, darin waren sich Josef, seine Mitschüler und das ganze Dorf einig, würde es immer geben, denn es hatte ja auch schon 2.000 Jahre auf dem Buckel, das Evanglische nur 500. Und das wollte ja schon was heißen.
•
Daheim auf dem Hof ist die Eingangstür zur Erstkommunion mit Girlanden eingerahmt und der folgende Spruch ist zu lesen: »Bleibe, wie du heute bist / Der Himmel dir dann sicher ist.«
Alle Mädchen und Knaben sind an diesem Tag festlich angezogen. Die Knaben im dunklen Anzug, die Mädchen in weißen Kleidern mit einem Blumenkranz im Haar. Mir haben sie ein weißes Sträußchen ans Revers der Anzugjacke gesteckt. Auch neue Schnürschuhe hat der Dorfschuhmacher angefertigt, aus kräftigem Leder und mit dicken Sohlen. Nicht gerade elegant und sehr steif. Aber dafür halten sie ewig. In den Tagen danach werden sie zudem mit Eisen und Nägeln beschlagen. Und ich weiß keinen, der keine Blasen an den Füßen hat, weil die Schuhe noch nicht eingelaufen sind. Und jeder hält einen Rosenkranz in den Händen.
Die Mädchen sitzen links, die Buben rechts in der Kirchenbank, in der ersten Reihe, die für sie reserviert ist. Vor uns ist ein Kerzenhalter angeschraubt, in dem steckt die fast einen Meter lange und kinderarmdicke Kommunionkerze. Auf ihr ist ein Heiligenbild angebracht und alles ist reichhaltigst verziert mit Blumengirlanden und Ornamenten. Höllisch muss man aufpassen, dass das Wachs nicht auf den nigelnagelneuen Anzug tropft. Der Kommunionanzug muss auch noch für die Firmung herhalten und auch für den André, für den Hans und den Franz.
»Da schau her – und nicht bewegen«, sagt der Fotograf später, es blitzt und das Kommunionfoto ist gemacht. Stolz und auch ein wenig verlegen blinzele ich in die Kamera.
Nach der Zeremonie in der Kirche geht es in den Gasthof Füglein, wo ein Tisch reserviert ist. Da gibt’s dann vom Vater eine Limonade und dazu Wiener Würstel mit Sauerkraut. Warum die gleichen Würstel woanders »Frankfurter« heißen, wird mir immer ein Rätsel bleiben, und warum gerade »Wiener«, auch. Im Schwäbischen heißen sie »Wienerle«, was dann schon eine ausgemachte Schmach gegenüber dem Wiener ist.
Die Mama ist an diesem Jubeltag daheimgeblieben, weil sie wieder ein Baby bekommt und in den Wehen liegt. Die Resi kümmert sich um sie und auch eine Hebamme.
In der Chaisn, die vom Flori und vom Beri gezogen wird, meint der Vater dann: »Für die Firmung in ein paar Jahr’, da suchst dir einen reichen Paten, am besten gleich den Huababauer, der kann sich des leisten.«
Und als wir mit dem Gespann in den Hof einbiegen, schreit uns schon ein neugeborenes Bündel entgegen. Ein Schwesterlein. Die Mama ist gleich an den nächsten Tagen wieder im Stall, wie immer. In aller Früh melkt sie die Kühe, füttert die Schweine, die Hühner und Gänse. Danach steht sie in der Küche und hält das Haus rein. Und nebenbei säugt sie das Baby, fast in einem Aufwasch. An den Frauen hängt viel, an den Müttern. Ohne sie geht nichts voran. Fast nebenbei ziehen sie die Kinder groß.
Ein paar Monate später wird das Schwesterlein auf den Namen Anni getauft und sie scheut wie der Teufel das Weihwasser.
»Warum schreist du denn wie am Spieß? Es ist doch nur ein wenig Wasser«, versucht selbst der Pfarrer das Schwesterlein zu beruhigen.
»Wieder ein Maul zu stopfen«, stößt der Vater gepresst hervor, doch in seinen Augen ist ein glückliches Leuchten.
Der Gockel Hansi ist schon alt, er genießt sozusagen sein Gnadenbrot, wie der Großvater Alois immer zu sagen pflegt. »Das Gnadenbrot«, so sagt er, »ist der Vorläufer zur Wohltätigkeit, die das Recht aufs Leben im Mistloch der Gnade ersäuft.«
Und bevor Hansi heute Morgen kräht, bin ich schon auf, denn heute habe ich noch Großes vor. Deshalb bin ich so früh aus den Federn raus, um die Stallarbeit zu erledigen. Schnell ist das Heu bei den Kühen verteilt und auch Flori und Beri bekommen ihren Hafer, werden gestriegelt, gekämmt und die Stallgasse wird gekehrt.
»Bist aber heut schon früh auf, sonst muss man dich immer bitten und betteln«, frotzelt Tante Resi, die immer als erste am Herd steht und einschürt und das Wassergrandl mit frischem Wasser auffüllt. »Hast denn schon eine Freundin?«, stichelt sie weiter, was mir ein wenig die Röte ins Gesicht treibt.
»Jetzt hör halt auf und sei nicht so neugierig, ich hab was vor«, anworte ich.
»So, so« meint sie, »aber vorher schaust noch nach den Kühen im Stall.«
Und ich ganz stolz: »Ist alles schon gmacht.«
Und langsam füllt sich die Stube und es kommen auch die Geschwister hinzu, der Vater, die Mutter und der Großvater.
»Ich muss nach Kolbermoor, ich muss den Stumpenverschnitt vom Großvater beim Kramer holen«, antworte ich auf keine Frage und merke, wie der Großvater grinst.
»Ja, ja, dann mach dich bald auf den Weg, nicht dass der Tabak trocken wird«, meint er darauf.
Im ›Landboten‹ stand nämlich vor ein paar Wochen geschrieben, dass ein Wettlauf anlässlich der Gründung des »Athletikklubs Kolbermoor« ausgerichtet wird und aktive sowie passive Vereinsmitglieder für die Neugründung gesucht werden. »Da mache ich mit«, habe ich mir gedacht und den Großvater heimlich eingeweiht. Dass ich Zigarrenstumpenverschnitt für Großvaters Pfeife im Kolonialwarenladen holen will, ist nur ein Vorwand und unser Komplott.
Der Großvater, ja, der ist mir der Liebste. Auch er war beim 70/71er-Krieg dabei, der bei der Schlacht in Sedan sein Ende fand, wo Kaiser Napoleon III. verlor, kapitulierte, gefangen genommen wurde und das Reich endete.
Ein paar Jahre ist es her, als der Großvater plötzlich vor mir stand und sagte: »Kimmst mit, wir fahren nach Rosenheim, dort hat der Zirkus Herzog sein Zelt aufgeschlagen. Der Steyrer Hans, der stärkste Bayer, kommt. Beim Wirt in Kolbermoor ist ein Plakat angeschlagen.«
•
Der Steyrer Hans war der Sohn eines Münchner Metzgermeisters und Gastwirts, er hatte sein Schlachterhandwerk beim Vater gelernt und schon als Lehrling ohne Hilfe jedes Kalb und jedes Ochsenviertel auf den Haken gehoben und einen Hektoliterbanzen auf den Ganter gestellt. Und nun befand sich der bayerische Herkules quasi auf Tournee und trat als starker Mann auf. Alle Männer, die sich trauten, durften gegen ihn im Steinheben antreten. Aus dem ganzen bayerischen Oberland und selbst aus Wien reisten Gleichgesinnte an, um sich mit dem kräftigen Münchner Wirt zu messen.
So manch ein Landwirt trainierte monatelang mit gefüllten Milchkannen seinen Bizeps. Ansonsten konkurrierten auffallend robust gebaute Mannsbilder aus allerlei Berufen, in denen körperliche Arbeit eine Rolle spielte: Vom Bierfahrer bis zum Bauarbeiter reichte die Palette. Doch nur die wirklich Starken durften zum Steyrer Hans auf die Bühne.
Der Kraftsport erfreute sich Ende des 19. Jahrhunderts allgemein großer Beliebtheit. Man traf sich in sogenannten Klubs, um die Muskeln zu stählen, bevor sie auf den Jahrmärkten zur Schau gestellt wurden. In der Münchner Feilitzschstraße war das Ledergeschäft der Familie Weil eine beliebte Anlaufstelle, nicht nur für viele Schuster der Stadt, die ihr Leder sowie andere Utensilien, die ein Schuhmacher benötigt, dort kauften. Im Hinterzimmer des Ledergeschäfts Weil war ein Kraftraum eingerichtet, ein Klub für Leibesertüchtigung, wo auch der Steyrer Hans häufig anzutreffen war.
Der alte Weil war einer der Ersten, der Leistungstabellen für die Kraftsportler führte und bei dem die Athleten nach einem speziellen Plan trainierten. Peinlichst mussten sie diesen Plan einhalten und merkten bald, dass sie nach und nach höhere Leistungen erzielten. Darum waren auch bei den Schauwettkämpfen auf den Jahrmärkten und Volksfesten oft die Kraftsportler aus der Feilitzschstraße die Gewinner oder ganz weit vorne dabei. Auch für Verletzungen wie Überdehnungen oder Verrenkungen hielt Weil einige Haussalben bereit, die er selber herstellte. Je nach Trainingsschwerpunkt waren Schäden an bestimmten Gelenken, Muskeln und deren Sehnenansätzen am Knochen zu finden. Fast immer aber handelte es sich um Folgen von Fehl- oder Überbelastungen. Unfälle waren eher eine Seltenheit.
•
Mit dem Zug ging’s dann damals mit dem Großvater zum Steyrer Hans nach Rosenheim.
Und zum Festplatz kommen wir, wo ein großes Zelt steht. In einem kleineren Vorzelt wird jeder Kandidat einem Krafttest unterzogen und so die Spreu vom Weizen getrennt. Bis zirka ein Dutzend lokale Muskelmänner übrigbleiben, die sich dann zum Gaudium aller im Festzelt mit dem Steyrer Hans im Steinlupfen messen. Und nach seinem Vorbild lupfen die starken Kerle einen zentnerschweren Stein in die Höhe oder versuchen es und scheitern.
Mit großen Augen verfolge ich das Geschehen auf der Bretterbühne und niemand hat natürlich den Steyrer Hans bezwungen, als der Großvater sagt: »Kimm mit, jetzt gehen wir zu ihm vor und lassen uns ein Autogramm geben.«
Spätestens nach dieser Begegnung ist es um mich geschehen. Der Steyrer Hans gibt mir ein Porträtfoto mit seiner Signatur und ich strecke ihm meine Hand hin, um mich zu bedanken, und denke mir, dass er sie hoffentlich nicht zerquetschen wird. Doch die Pranken des Steyrer Hans sind gar nicht so riesig, fast zierlich, aber mit einem festen Griff.
Eng umschließen sie meine Hand und er sagt zum Großvater hin: »Für die Gewichtheberei tät er schon passen, nicht zu groß, ein wenig untersetzt. Und keine zu langen Arme darf er haben, wegen der Umsetzung und der Hebelwirkung.«
Der Stachel ist gesetzt.
Gleich nach der Rückkehr richte ich mir unter dem Dach der Sägemühle einen kleinen Kraftraum ein, mein Muckikammerl, von dem zunächst niemand wissen darf. Dort stemme ich heimlich Mehlsäcke und aus übrigen Eisenteilen selbst zusammengeschraubte Gewichte und Hanteln. Beim Schmied habe ich mir auf alten Kanonenkugeln spezielle Griffe anbringen lassen für mein Muskeltraining und Eisenstifte einschmelzen lassen für weitere unterschiedliche Gewichte.
Mein Training beginnt immer mit einer Aufwärmrunde, dem Seilspringen. Da habe ich es zu einer wahren Meisterschaft gebracht. Aufrecht und schulterbreit stelle ich mich hin; die Oberarme und Unterarme eng am Oberkörper angelegt, springe ich gerade einmal so hoch, dass das Seil unter den Füßen hindurchpasst. So springe ich eine Stunde, bis ich schweißnass bin. Dann beginne ich mit den Hanteln und steigere langsam das Gewicht, bis die Muskeln brennen.
Irgendwann bin ich natürlich aufgeflogen mit meinem Muckikammerl. Der Vater hat sich nämlich schon länger gefragt, wo denn sein Erstgeborener wohl stecken mag, wenn man ihn braucht. Und so findet er mich oben in der kleinen Kammer in der Sägemühle und gerät derart in Rage, dass er mich am liebsten an den Ohren gepackt hätte. Wie ein wildgewordener Esel ist er hinter mir her und schreit mit hochrotem Kopf: »Ich nehm dir dein ganzes Hantelzeug weg und versenk’s in der Odelgruben.«
Bald darauf hat er sich wieder beruhigt. Der Vater möchte halt gern, dass sein Ältester einmal den Hof übernimmt und sich nicht in anderen Dingen verzettelt. Vielleicht hat er aber schon eine Vorahnung, dass es mich einmal weg von der Heimat treiben wird. Dieser Gedanke ist ja nicht ganz unbegründet.
Und so mache ich mich heute auf den Weg nach Kolbermoor, zu meiner geheimen Mission. Vereinzelt gehen gebückte Gestalten ihrem Tagewerk im Torfstich nach. Hinter ihnen zeichnen sich die Felsmassive des Kaisergebirges in Richtung Tirol nach Innsbruck ab und auf der anderen Seite hinein ins Salzburgische. Vorbei beim ›Schmied am Kolber‹, um den herum sich im Laufe der Zeit der aus fünf Häusern bestehende Weiler Kolber gebildet hat. Entlang des Wegs zur Maschinenfabrik Riedlinger höre ich schon das leise Surren der Spindeln, die sich lustig zur Garnherstellung um die eigene Achse drehen. Die Fabrik ist der Grund, weshalb die Bahn hier eine Zughaltestelle mit einer Verladerampe eingeplant hat. Am Mangfallkanal entlang geht’s an der Baumwollspinnerei vorbei.
Es zirpt. Es surrt. Es gurrt. Fast meint man, die Singvögel, Grillen und Wildtauben begrüßen mich und applaudieren meinem Entschluss, diesen, meinen Weg zu gehen.
•
16 Jahre war Josef alt und die letzten Monate hatte er jeden Tag mindestens drei Stunden in seinem »Muckikammerl« verbracht und geschwitzt, oft bis in die Nacht hinein. Aus dem eher schmächtigen, hageren Burschen war ein junger Mann von stattlicher Statur geworden, mit muskulösem Oberkörper und muskelbepackten Oberarmen.
Dabei machte ihm ein Handicap das Training nicht gerade leichter, fürs Gewichtheben hätte es sogar fatal sein können: Ihm fehlte nämlich an Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand das jeweils erste Fingerglied. Beim Anschirren vom Flori hatte er sich die Fingerkuppen abgerissen. Zwischen den Deichselring und die Kette, die mit dem Kummet verbunden war, waren sie gekommen, als eine Hornisse haarscharf an Floris Kopf vorbeigeflogen war und die Mähne gestreift hatte. Und Flori war aufgeschreckt und hatte an der Kette der Deichsel gerissen.
Vor Schmerz hatte Josef aufgeschrien und war zum Kutschbock hingerannt, hatte die Geißel genommen und auf den Gaul eingeschlagen, der doch gar nichts dafür konnte. Aber es hatte nichts geholfen, die Finger waren gequetscht und vom herbeigerufenen Doktor amputiert worden.
Vor Wut hätte Josef schreien können. Er wusste, dass sich dies im beidhändigen Stoßen bemerkbar machen würde, einer der drei Disziplinen beim Gewichtheben neben dem beidhändigen Drücken und Reißen. Da war es noch wichtiger, die Stange fest mit der ganzen Hand zu umgreifen.
•
Zielgerichtet stapfe ich zum Marktplatz vor dem Gasthof Füglein, wo sich schon eine kleine Menschenmenge um einen Lkw drängt. Mit einem Stock wird die Startlinie für den Wettlauf in den Kieselsandboden gerissen, wo unzählige Ameisen herumwuseln. Auf der hölzernen Ladepritsche des Lastwagens steht breitbeinig der Bäckermeister Spiegel und wuchtet schwere Mehlsäcke auf die Schultern von vier kräftigen jungen Männern. Es herrscht eine große Aufregung im Weiler. Auch der Pfarrer ist gekommen, um dem Ereignis beizuwohnen. Und mittendrin steh nun auch ich und beobachte die Vorbereitungen für den Wettkampf.
»Na, Josef«, stichelt der Pfarrer und grinst fast zahnlos, »juckt’s dich nicht, auch mitzumachen? Traust dich nicht?«
»Ich trau mich schon, aber die Konkurrenz ist mir zu schwach«, feixe ich zurück und denke mir insgeheim: »Wenn der Herr Pfarrer wüsste. Heut ist mein Tag, heut werd ich es allen zeigen. Unbedingt will ich Mitglied werden, deshalb bin ich da. Und gewinnen will ich auch.«
Füglein erklärt die Regeln: »Das Ziel ist der Prellbock am Torfverladegleis.« Und weiter: »Dem Ersten meine goldene Uhr!« Demonstrativ hebt er die Uhr in die Höhe. Der Sprungdeckel funkelt im hellen Sonnenlicht.
Spiegel, der immer noch auf der Ladepritsche steht, ruft herausfordernd in die Menge: »Und, wer traut sich noch?«
Wetten werden angeboten und angenommen.
»Sammas«, meint Füglein dann und zieht eine Pistole aus seiner Jackentasche. Er krümmt den Finger und ein Schuss kracht.
Unter lautem Anfeuern der Zuschauer rennen die Burschen mit den Mehlsäcken auf dem Buckel los.
Und die Zuschauer rufen aufgeregt durcheinander: »Ich setz auf den Wimmerl!« – »Ach geh, das schafft der nie!« – »Auf geht’s!«
Ein wenig amüsiert beobachte ich die Szenerie und schlendere fast hochmütig an die Pritsche, um mir ebenfalls einen Mehlsack zu nehmen.
Spiegel lacht mich aus: »Geh, Bürscherl, der Mehlsack lauft ja mit dir spazieren.« Und die Zuschauer fallen in das Lachen ein.
Nur Marie, die junge Bedienung vom Gasthof Füglein, mustert mich neugierig. Sie ist die Tochter vom Frisörmeister Fuss, dem die Frau vor einigen Jahren gestorben ist. Fuss ist sozusagen ein Alleinerziehender und Marie sein Ein und Alles.
Marie ist beliebt im Dorf und jeder von den jungen Burschen möchte gern mit ihr anbandeln. Ein Mädchen zum Pferdestehlen. Das denkt sich außer mir sicher noch so mancher, wenn er ihr beim Servieren in der Gaststube oder im Wirtsgarten zusieht. Viele der jungen Männer, auch aus dem Umkreis, kommen ins Wirtshaus, wenn sie wissen, dass Marie bedient. Da hocken sie dann, bis der Füglein, der am Zapfhahn steht, zusperren wll, und niemand möchte heimgehen. So eine Bedienung ist immer auch eine Projektionsfläche.
»Sperrstunde!«, ruft Füglein am Schluss immer laut.
Und wenn der Wimmerl auf den letzten Drücker noch bettelt »Marie, nur ein Schluss-Quarterl«, erwidert die: »Wart lieber bis morgen, dann bring ich dir auch eine Halbe.«
Das größte Auge hat Wimmerl auf Marie geworfen. Als Sohn vom reichsten Bauern glaubt er, er kann alles haben, obwohl er außer seiner Geburt nichts dazugetan hat. Und Wimmerl ist nicht unattraktiv, man kann auch sagen, er kommt schön schneidig daher mit seinem Schnurrbart. Und er investiert so einiges in sein Gewand als Hoferbe vom reichsten Bauern der Gegend.
Ich habe genau hingehört, wie die Marie ihm letztens zugerufen hat: »Ach geh, such dir doch eine ledige Bauerntochter, die einen Hof daheim hat, dann könnts alles zammlegen. Ich hab doch kaum eine Aussteuer von daheim.«
Geschickt hat sie bisher jede seiner Avancen abgelehnt, ohne ihn allzu schwer zu verletzen. »Letztlich wär ich, wenn ich beim Huababauern einheiraten würd, doch nur so was wie eine bessere Magd und müsst dazu noch irgendwann die Kinder aufziehn.« Das sagt sie erst, wenn der Wimmerl nicht mehr dabei ist. »Und auf dem Hof versauern.«
Aber Wimmerl ist hartnäckig und hat ihr wieder einmal einen halben Antrag gemacht. »Ach geh, komm halt her, was willst denn hier in der Gaststubn versauern. Wärst doch die Bäuerin vom Huabahof!«
Doch so leicht lässt sich Marie nicht erobern. »Ich such mir den Meinen schon selber aus und mein Geld verdien ich mir lieber auch selber. Bei dir würd ich doch höchstens die Schlüssel für die Speiskammer bekommen.«
•
Kaiserzeit. Männerzeit. Noch an der Schwelle zum 20. Jahrhundert herrschte eine große Ungleichheit zwischen Mann und Frau. In den Städten mochten sich zwar einige Damen mit neuem Selbstverständnis und Selbstvertrauen finden, die Bildung und eigenes Recht forderten. Daneben gab es aber Dutzende von Frauen, die erst nach der Hochzeit erlebten, dass es zwei Geschlechter gab. Es wurde ja früh geheiratet. Und über Zeugung und Fortpflanzung wurde der Mantel des Schweigens gelegt. Auf dem Land war das ein wenig anders, denn da sah ja ein jeder, wie der Stier die Kuh besprang oder der Gockel auf die Henne Jagd machte.
Trotz der großen gesellschaftlichen Veränderungen um die Jahrhundertwende blieben die Rollen klar verteilt: Der Mann galt als alleiniger Versorger der Familie. Er war der strenge Vater und das Familienoberhaupt. Ihm wurden männliche Aktivität, Energie, Willenskraft und Stärke zugesprochen. Die Frau hingegen hatte sich um die »drei Ks« zu kümmern: Kirche, Küche, Kinder. Und war eine Frau nicht verheiratet, blieb sie das Fräulein, wie das Fräulein Herbst, das erst vor Kurzem verstorben war.
Fast ihr ganzes Leben hatte sie im Schulhaus neben dem Pfarrhaus unterrichtet und dort unter dem Dach in einer kleinen Lehrerwohnung logiert. Sogar mit 70 Jahren wurde sie immer noch mit »Fräulein« angesprochen und später auch so zu Grabe getragen. Bei der Beerdigung spielte die Blasmusik nicht den Trauermarsch von Chopin, nein, das Fräulein Herbst hatte alles verfügt, nämlich, dass der Kirchenchor am Grab stehen und den ›Lindenbaum‹ – »Am Brunnen vor dem Tore« – singen sollte. Auch hinterher, für die Totensuppe beim Wirt, war alles geregelt.
Die Aussicht auf so ein Ende war in Maries Augen keine Lösung. Die Heirat um der Tradition und Ehrbarkeit willen übte aber genauso wenig Reiz aus. »Raus aus dem Korsett« war ihre Devise. Aufgeschlossen war sie dem Neuen gegenüber und verkörperte schon den modernen Typus Frau.
»Bis zum Traualtar machen s’ einem den Hof, dann versinkt die Liebenswürdigkeit im Alltag.«
Seit die Mutter gestorben war, lebte Marie mit ihrem Vater allein im Dorf und führte den Haushalt, während der Frisörmeister und Bader Fuss vorne im Ladengeschäft die Haare schnitt und auch sonst die kleinen Wehwehchen der Kunden linderte. Ein Bader war so etwas wie der Arzt der kleinen Leute, die sich keinen Rat von den studierten, meist klerikalen Ärzten leisten konnten. Fuss war hochgeachtet im Weiler, so manchen faulen Zahn hatte er gezogen.
Seine Tochter hatte er zur Ausbildung in die Klosterküche der Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth im Chiemsee geschickt, neben dem Nonnenberg in Salzburg das älteste bestehende Frauenkloster nördlich der Alpen. Dort wurde sie Hauswirtschafterin. Die Priorin Plazida von Eischendorff hätte Marie gerne als Novizin übernehmen wollen, doch für ein Leben als Nonne, verheiratet mit dem Heiland, mochte Marie sich nicht entscheiden.
Als sie dann heimkam, machte sie für den Vater erst mal Speckknödel mit Sauerkraut, so wie sie es in der Klosterküche beim Zuschauen gelernt hatte. Während das Sauerkraut, in das sie ein Wammerl, ein Geselchtes, hineinlegte, so vor sich hinköchelte, knetete sie die vorher eingeweichten alten Semmeln, tat ein paar Eier hinzu und ließ den Speck aus, um Semmelwürfel darin zu rösten.
Milch mit Eiern versprudeln, salzen, über die Semmelwürfel gießen. Zwiebel in Butter rösten. Selchfleisch fein hacken, mit der Petersilie unter die Semmelmasse mengen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Das Mehl über die Knödelmasse streuen, untermengen, mit feuchten Händen Knödel formen und in Salzwasser zum Kochen einlegen.
Und da stand Marie dann und schrie laut: »Vatter, Vatter!«
Denn die Knödel wurden immer größer und größer. Als wollten sie aus dem Topf hüpfen. Ja weil? Marie hatte unterschätzt, dass Knödel aufgehen. Und so groß wie Kindsköpfe wurden sie.
•
Mir ist die Marie an dem Tag vor dem Gasthof Füglein gleich aufgefallen. Hübsch trägt sie einen geblümten Rock, den sie sich selbst geschneidert hat, fast schon ein wenig extravagant. Daheim bei ihr im Frisörladen liegen nämlich jede Menge Modejournale herum, das weiß ich, obwohl ich noch nie drinnen war, die Mutter schneidet bei uns die Haare. Und ich stelle mir vor, wie Marie mit großen Augen in den Journalen blättert, bis alles ganz und gar zerfleddert ist.
Mitten in diesem rohen Männerhaufen sticht sie heute mit ihrem fröhlichen Wesen und mit ihrem natürlichen Lachen wohl heraus. Furchtbar können Männergruppen über drei Personen sein und bei entsprechender Konstellation leicht gewaltbereit. Das ist dann bei einer feminin dominierten Ansammlung doch etwas anderes. Der Großvater sagt, dass es aus diesem Grundverhalten heraus auch viel einfacher ist, Männer in den Krieg zu schicken. Freilich soll es so etwas wie Amazonenkriegerinnen gegeben haben, aber anscheinend hat sich durch die Jahrhunderte dieses Anwendungsmodell strategisch nicht bewährt.
Ich stehe immer noch beim Spiegel an der Pritsche, wie festgefroren.
»Lass dir nichts gefallen, ich setz auf dich«, ruft mir Marie zu und hebt resolut ein Geldstück in die Höhe.
Da läuft es mir gleich heiß den Rücken herunter und mein Ehrgeiz ist neu geweckt.
Ich greife zu und fast mühelos schultere ich den Mehlsack, laufe beherzt los und merke, wie ich meiner weiblichen Unterstützung imponieren will. So direkt hat mich noch kein Mädchen angesprochen und das beflügelt mich geradezu.
»Ich setz dagegen«, brummt der Spiegel und Füglein setzt nach: »Ich auch.«
»Wirst es nicht bereuen«, rufe ich Marie über die Schulter noch zu, so keck, dass ich fast erschrecke über meinen Mut und meine Schlagfertigkeit, mit der ich aber eher meine Unsicherheit überspiele, obwohl ich ganz rote Ohren dabei bekomme und meine Kehle sich zuschnürt.
Schon bin ich den Zuerstgestarteten, die gerade hinter einem Hauseck verschwinden, dicht auf den Fersen.
Und Spiegel brüllt und setzt sich in die Führerkabine des Lkw: »Aufsitzen und hinterher, schmeiß an!«
Rumpelnd setzt sich das rußende Ungetüm in Bewegung in Richtung Torfverladegleisrampe, die etwa 1.000 Meter weiter am Ende der langen Dorfstraße, etwas außerhalb der Fabrik, zu erkennen ist.
Vorn am Eck sehe ich schon den Frisörsalon vom Bader Fuss, der schärft drinnen gerade fachmännisch das aufklappbare Rasiermesser an einem Lederriemen. Das laute Getöse lockt ihn aber durch die offene Tür hinaus. Auch sein Kunde steht auf und stellt sich Fuss zur Seite. Mit eingeschäumtem Gesicht beobachtet er staunend das Wettkampfgeschehen. Wie schweißnass vier Läufer die Straße entlanghetzen. Ich als Fünfter hintendrein.
Und ich höre, wie Fuss ihn aufklärt: »Des ist der Wimmerl, der Sohn vom Huababauer, der erbt einmal den Hof. Und der da hinten, des ist der Straßberger-Bua. Der Bua vom Kleinbauer gegen den Großbauernsohn.«
Die vier Sackläufer biegen um eine weitere Hausecke und sind damit aus dem Blickfeld hinaus. Ich meine aber noch gesehen zu haben, wie der Wimmerl ein kleines Messer aus dem Hosensack zieht.
Kurz darauf schnaufe ich um die Ecke und werde von einer weißen Mehlwolke empfangen. Wimmerl hat einem Konkurrenten den Sack aufgeschlitzt, der Sauhund. Schwer hustend laufe ich durch den feinen, weißen Staub und schon ein paar Meter weiter bin ich von einer Schicht aus Mehl bedeckt. Doch nichts kann mich im Moment aufhalten.
Schon überhole ich den ersten Ausgeschiedenen, der aufgegeben hat. Und kurz darauf die nächsten zwei.
Nur Wimmerl ist noch vor mir.
Mit jedem Schritt schmilzt sein Vorsprung. Die tobende Zuschauermenge verleiht mir zusätzliche Kraft.
Mit Mehlstaub am ganzen Körper und schweißverschmiertem Gesicht bin ich nun auf der gleichen Höhe mit Wimmerl. Der grinst unverschämt und will mich schwer schnaufend abdrängen. »Schleich dich, Bürscherl. Die Uhr gehört mir!«
»Das werden wir dann schon sehn«, grinse ich zurück.
Wimmerl erfasst die Furcht, seinen Kampf zu verlieren, und er versucht noch einmal, mit unsauberem Ellenbogenrempeln das Ruder herumzureißen. Doch das kann mich nicht aus der Bahn bringen. Auch ich versetze dem etwas Kleineren einen kräftigen Renner, was ich aber eher als eine Notwehr im besten Sinne verstehe.
An der Ziellinie nimmt Füglein ein Okular aus der Jackentasche und richtet es auf die Dorfstraße.
»Siehst was?«, fragt Spiegel.
Und Marie angespannt: »Wer führt?«
Verdutzt blickt Füglein durch sein Okular und sagt anerkennend: »Tatsächlich, der Straßberger.«
Und ich erreiche das Ziel und werfe elegant den Mehlsack auf das Pflaster. Und schon bin ich eine kleine Berühmtheit im Weiler Kolbermoor. Noch lange wird am Stammtisch von meinem ersten Streich erzählt werden.
Grinsend klopfe ich mir den Mehlstaub aus der Kleidung. »Da schauts, ha!« Und der Stolz steht mir ins Gesicht geschrieben.
Abgeschlagen torkeln auch die Verlierer ins Ziel. Als Erster erscheint Wimmerl und reicht mir die Hand, obwohl er natürlich enttäuscht ist. »Nichts für ungut«, sagt er, »im Eifer des Gefechts.«
Und ich: »Passt scho.«
Marie ist hocherfreut, mit geröteten Wangen vom Anfeuern: »Da hab ich auf den Richtigen gesetzt. Kommst auch zur Siegesfeier zum Füglein-Wirt? Zur Siegerehrung?«
»Freilich komm ich. Ich hab ja die goldene Uhr gewonnen.«
Dabei schauen sich Füglein und Spiegel so verschmitzt an, die haben anscheinend etwas ausgeheckt. Aber das kann mich gerade nicht schrecken.
Alle stehen dicht gedrängt um mich herum und klopfen dem stolzen Sieger auf die Schultern. Hände werden geschüttelt und Wetteinsätze ausbezahlt. Marie zupft triumphierend Füglein und Spiegel die Münzen aus der Hand. »Und die gehört auch noch mir«, freut sie sich.
»Auf zur Vereinsgründungsfeier, herein mit euch«, muntert Füglein die Herumstehenden auf.
Langsam tröpfeln die neuen Vereinsmitglieder in die Gaststube herein, wo Füglein eine Tafel mit der geschnitzten Aufschrift »Athletikklub Kolbermoor« präsentiert. Schon freue ich mich auf die Bekanntgabe meines Sieges. Verstohlen werfe ich einen Blick zu Marie hin, die mit großer Anmut die Bierkrüge durch die Menge balanciert. Alles gefällt mir an ihr.
Auch Marie bemerkt meine heimlichen Blicke und mir scheint es, als würde sie die Krüge danach noch eleganter verteilen. Sehr adrett, wie sie ihren Schopf zu einem kleinen Dutt gebändigt hat.
Und Füglein hebt zu seiner ersten pathetischen Ansprache an: »Im Namen auch von unserem geliebten Prinzregenten möchte ich als Erster Vorstand die heute Anwesenden zur Vereinsgründung des ›Athletikklubs Kolbermoor‹ in unserem Vereinslokal begrüßen. Mag die Monarchie in Portugal wackeln, wir bleiben unserem Königreich treu. Darauf trinken wir. Hebt die Gläser, hoch!«
Alle stoßen mit den Krügen an.
»Auch wir, das heißt ich, der Bäckermeister Spiegel und der Huababauer, haben uns in langen Sitzungen dazu entschlossen, mit der Gründung des ›Athletikklubs‹ einen Meilenstein in der Sportgeschichte des SV Kolbermoor zu legen. Auch, um alle Kraftsporttreibenden in der Region unter einem, nämlich unserem Dach zu vereinen. Wir möchten uns beim Huababauern, dem edlen Spender, für die Vereinstafel bedanken und auch für die Mass Bier für jedes Vereinsmitglied, gespendet von der Geschäftsleitung der Baumwollspinnerei Kolbermoor. Hebt die Gläser, hoch!«
Wieder krachen die Krüge.
»Und mit dem Vereinsspruch ›Griabig san mir! Und griabig bleim mir! Auf den Bergen und im Tal! Siegen tun wir überall! Prost, Sportkameraden! Athletikklub Kolbermoor!‹, beenden wir die erste Vereinssitzung.«
Allen im Raum ist natürlich schon aufgefallen, dass ich noch mit keinem Wort erwähnt worden bin und so erhebe ich die Stimme: »Und was ist mit meinem Preis, der goldenen Uhr?«
Drauf führt Füglein seine Rede fort, als ob er auf diesen Einwurf schon gewartet hätte: »Und natürlich ist das neue Mitglied Josef Straßberger einstimmig aufgenommen und wir gratulieren ihm herzlichst zur heutigen sportlichen Leistung. Die Vereinsleitung, das heißt der Bäcker Spiegel und ich, haben uns gesagt, dass das neue Mitglied zum Zeitpunkt des Wettkampfes aber noch kein Mitglied war und somit in der sogenannten ›Gästeklasse‹ gestartet ist. Wir haben also beschlossen, dass die Uhr ins Vereinsvermögen übergeht und bei einer anderen Gelegenheit zur Verfügung gestellt wird. Wir hoffen aber, dass unser neues Mitglied in zwei Wochen zum Kraftsporttag in Wörgl unseren Klub als unser neuer aktiver Athlet im Ausland würdig vertreten wird.«
Brüllendes Gelächter erhebt sich, als ich aufspringe und wütend aus der Gaststube laufe.
Nur Marie ergreift für mich Partei: »Ach geh, des könnts doch nicht machen, er hat doch gewonnen.«
»Dann lauf ihm doch nach, deinem Sieger«, erwidert Spiegel.
Und tatsächlich nimmt Marie meinen Krug vom Tisch und läuft mir hinterher. An der gebändigten Mangfall entlang, vorbei am sechsstöckigen Hauptgebäude der Baumwollspinnerei.
Am Werkskanal drehe ich mich um und sehe, wie sie mit fliegendem Rock daherkommt und das Bier schwappt über den Krugrand. Die Luft ist erfüllt vom Sirren der Spindeln. »Josef!«, schreit sie mir nach.
Ich stocke, noch immer wütend über meine Schmach.
Und sie streckt mir den Krug hin. »Da, trink.«
Marie staunt nicht schlecht – nicht darüber, dass ich schlucke wie ein Ackergaul, sondern mit welcher naturgemäßen Kraft ich am Masskrug sauge und sich meine Halsmuskeln dabei aufpumpen.
»Bin die Tochter vom Bader Fuss. Du gefällst mir – Josef«, wirft sie lässig hin.
Und ich, ganz karg und überrascht: »Du mir auch – Marie.« Und schon werde ich mutiger: »Krieg ich wenigstens einen Siegerkuss?«
Marie lacht. » So schnell geht’s auch nicht. Besuch mich halt bei meinem Vater im Frisörladen, dann stell ich dir auch Karlo vor.« Und als ich verdutzt schaue ob dieser Offenbarung, fügt sie an: »Mein liebster Verehrer, Kater Karlo. Da sollst du mal sehen, wie der pfaucht und zischt, wenn wer seinem Reich zu nahe kommt.«
Abrupt dreht sie sich um und drückt mir einen Schmatz auf die Wange. »Der Siegerkuss.«





























