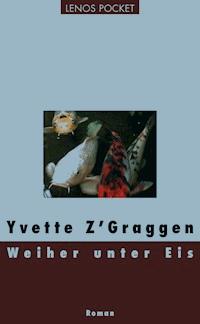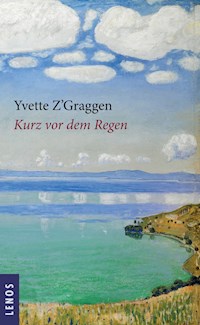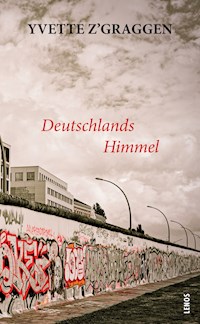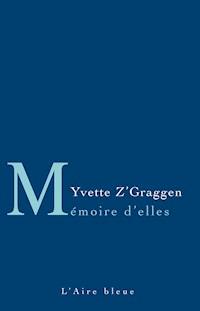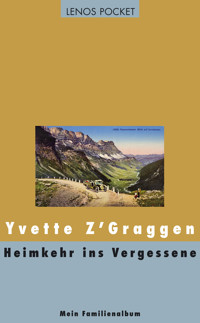
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über viele einschneidende Vorkommnisse wird in der kleinen Familie des angesehenen Zahnarztes Dr. Henry Z. in Genf nicht gesprochen: nicht über die Gründe der häufigen Wohnungswechsel, nicht über die zusehends abnehmende Zahl von Hausangestellten, nicht über den plötzlichen Verzicht auf ein Auto, nicht über die Muttersprache des Vaters. "Woher kommt eigentlich dein ungewöhnlicher Familienname?", wird die kleine Yvette von ihren Schulkameradinnen in der Privatschule gefragt und gerät dabei in peinliche Verlegenheit. Woher stammt der Vater wirklich? Yvette Z'Graggens Spurensuche führt in ein enges Tal in der Innerschweiz, von Genf meilenweit entfernt, fremd und ungewohnt. Es entsteht das brüchige Porträt einer Familie, deren Geschichte beispielhaft einen Teil der schweizerischen Sozialgeschichte widerspiegelt: eine Geschichte von Armut und Not, von menschenunwürdigen Arbeits- und Wohnverhältnissen sowie der existentiellen Notwendigkeit zur Migration im eigenen Land oder in die Fremde. Yvette Z'Graggen gelingt es, im Nachforschen über die eigenen familiären Wurzeln sensibel und eindrücklich individuelle Schicksale zu beschreiben, die wohl auch als exemplarisch für ihre Zeit gelten können. Lebenswege, die von Disziplin, Anstrengung, Anpassungsfähigkeit und Hartnäckigkeit, aber auch von Lebenslust, Risikobereitschaft und Übermut geprägt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Yvette Z’Graggen
Heimkehr ins Vergessene
Mein Familienalbum
Aus dem Französischenvon Maria Spälti-Elmer
Lenos Verlag
Die Autorin
Yvette Z’Graggen (1920–2012), aufgewachsen in Genf. Nach langjähriger Tätigkeit beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz war sie als Übersetzerin und als Mitarbeiterin von Radio Suisse Romande tätig. Mit vierundzwanzig Jahren veröffentlichte sie ihren ersten Roman. Seither publizierte sie zahlreiche Werke – Romane, Erzählungen und Hörspiele –, von denen etliche ins Deutsche übersetzt wurden. Für ihr Werk wurde Yvette Z’Graggen mehrfach ausgezeichnet, u.a. erhielt sie 1951 für ihren Roman L’Herbe d’octobre (Oktobergras) und 1996 für ihr Gesamtwerk den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung sowie für die Erzählung Les Années silencieuses (Die Jahre des Schweigens) 1982 den Preis der Genfer Schriftstellergesellschaft. Ihr Roman La Punta wurde 1992 mit dem Prix des Auditeurs de la Radio Suisse Romande gewürdigt.
Titel der französischen Originalausgabe: Changer l’oubli
Copyright © 1989 by Editions de l’Aire
E-Book-Ausgabe 2024
Copyright © der deutschen Übersetzung
1990 by Gemeinschaftsverlag Neujahrsbote, Linthal,
und Buchhandlung Baeschlin, Glarus
Alle Rechte vorbehalten
Coverbild: Keystone, Photochrom (Klausenstrasse, Blick auf Urnerboden)
eISBN 978 3 03925 719 5
www.lenos.ch
Für Cleophea, Joseph, Johanna, Carl,
Niklaus und alle andern
Kapitel 1
Es war im April 1932, als ich das letzte Mal in dieses Tal kam. Ich war eben zwölf Jahre alt geworden, mein Vater einundvierzig.
Es ist die einzige Reise, die wir zusammen gemacht haben.
Es war ihm nicht wohl beim Gedanken, sein Dorf, seine Eltern wiederzusehen. Ich selbst drückte ein dickes, schwarzes Wachstuchheft an mich: meine Zuflucht.
Wir sprachen wenig im Dampfzug, der durchs Glarnerland von Ziegelbrücke nach Linthal hinauffuhr. Ich wusste nie, worüber ich mit meinem Vater sprechen sollte, er schüchterte mich ein; meine Mutter war es, der ich mich anvertraute. Er selbst wusste auch nicht, wie er den Graben überschreiten sollte, der ihn von seiner Tochter trennte, die in Genf geboren worden war und nichts von seiner Vergangenheit verstehen konnte.
An diesem Junimorgen des Jahres 1988 fahre ich im Auto durch das Tal und erkenne nichts wieder. Ich suche das Ortsschild Luchsingen, sehe wohl viele andere, Ennenda, Schwanden, Nidfurn, dann Betschwanden, Rüti. Am Fuss des Bergmassivs, das den Horizont begrenzt, kündigt sich bereits Linthal an.
Kein Zweifel, ich habe das Ortsschild übersehen, habe das Dorf durchfahren, ohne es zu bemerken, ohne dass irgendeine Erinnerung wach geworden wäre.
Ich halte am Strassenrand an. Ist es möglich, dass ich es jetzt noch, nach so vielen Jahren, zurückweise, dieses Dorf Luchsingen?
Kapitel 2
Ich wurde wie ein kleines Mädchen des Genfer Bürgertums erzogen.
Privatschule. Eine grosse Wohnung in einem der schönen Quartiere der Stadt. Das Parkett auf Hochglanz gewichst. Lederfauteuils, Orientteppiche, viel Silberzeug. Ein Dienstmädchen. Manchmal zwei. Eine Wäscherin, und Catherine, die alte Glätterin, tiefgebeugt von der Arbeit.
Oft brachten mich meine Kameradinnen in Verlegenheit: »Dein Name, woher kommt er überhaupt?« Widerstrebend antwortete ich, dass dies ein Urner Name sei. Manchmal spöttelte dann eine: »Uri, das Land von Wilhelm Tell …« Sie machte sich über mich lustig, und ich gab ihr recht, denn auch ich fand das ein bisschen lächerlich.
Deshalb versuchte ich mich zu verbessern: »Mein Vater ist im Kanton Glarus geboren«, ohne mir dabei darüber klar zu sein, dass ich damit meine Sache noch verschlimmerte. Denn Glarus, das war für diese kleinen Genferinnen nun wahrlich die Finsternis, das Nichts. Uri immerhin, das kannte man ein wenig, eben gerade wegen Wilhelm Tell und des Schwurs der drei Eidgenossen, des Rütlis und so. Aber Glarus …
Ich rief meinen Grossvater mütterlicherseits zu Hilfe, sagte sehr schnell, dass er Ungar war, aber in Wien geboren. Das machte sich gut, selbst wenn das Kaiserreich Österreich-Ungarn seit etlichen Jahren nicht mehr bestand. Und schliesslich fügte ich noch hinzu: »Meine Mutter ist in Genf geboren«, was mich einigermassen gleichsetzte mit diesen Töchtern von Bankiers, von Professoren, von reichen Kaufleuten.
Im Übrigen war ich stolz auf meinen Vater. Meistens dachte ich gar nicht an seine Herkunft. Er sprach Französisch fast ohne jeden Akzent, auf jeden Fall ohne jene Schwerfälligkeit, die man spöttisch nachahmte. Er war gut angezogen und übte einen Beruf aus, den ich als ehrenhaft empfand: Zahnarzt. In seiner Praxis am Boulevard des Philosophes trug er einen weissen Kittel und handhabte gewandt allerlei geheimnisvolle Instrumente.
Er besass auch ein Auto, in jenen zwanziger wie auch Anfang der dreissiger Jahre in Genf noch eine Seltenheit.
Papa sprach fast nie vom Dorf, in dem er zur Welt gekommen war, obschon seine Eltern dort noch lebten: sein Vater Joseph und seine Mutter, die einen so eigenartigen Vornamen trug, dass man ihn fast nicht einzugestehen wagte: Cleophea. Glücklicherweise haben meine Kameradinnen nie danach gefragt. Diesen Grosseltern schrieben wir von Zeit zu Zeit, aber Jahre vergingen, ohne dass wir sie besuchten.
Ich wusste wenig über sie; so hatte ich beispielsweise keine Ahnung, ob er, der Grossvater, überhaupt einen Beruf ausübte. Wenn ich danach fragte, antwortete man mir ausweichend, mit verlegener Miene, und ich war danach auch nicht gescheiter als vorher. Ob er vielleicht ein Schmuggler war? Ich hätte gerne einen Schmuggler als Grossvater gehabt. Aber das war ja nicht möglich: Der Kanton Glarus liegt mitten in der Schweiz, grenzt an keinen fremden Staat, und von einem Kanton in den andern wird auch nicht geschmuggelt.
Hingegen kann es vorkommen, dass man in einen andern Kanton zieht, um dem Elend zu entfliehen, um zu versuchen, einigermassen menschenwürdig zu leben.
Aber solche Dinge erzählt man einem kleinen, verwöhnten Mädchen nicht.
Kapitel 3
Man schreibt das Jahr 1885, als mein Grossvater Joseph zu Fuss den Klausenpass überquert, um ins Glarnerland hinunterzugelangen, zusammen mit seinen Brüdern Carl und Niklaus und seiner Schwester Johanna. Er ist neunzehnjährig. In Schattdorf im Kanton Uri bleiben, wo man keine Arbeit findet und wo es fast nichts zu essen gibt, das will er nicht mehr.
Heute ist Altdorf ein blühender, sauberer Flecken, mit seinem Denkmal, das unsern Nationalhelden darstellt, die Armbrust auf der Schulter, den Arm um seinen Sohn gelegt, der vertrauensvoll zu seinem Vater aufschaut, seinem Wilhelm-Tell-Pub, seiner Tell-Drogerie samt ihren Schildern mit dem vom Pfeil durchbohrten Apfel. Tourismus verpflichtet. Zwei, drei Kilometer weiter liegt Schattdorf, an Einwohnerzahl mit dem Hauptort wetteifernd, mit Chalets und stattlichen Häusern, Reihenhäusern, Wohnblöcken.
An der Fassade eines Bauernhauses nahe der mächtigen, weissen Kirche steht die Inschrift:
Dieses Haus ist von Gott umgeben,
Schützend vor Unheil auf alle Zeit.
Wir werden drin wohnen und leben,
In Gottes Hand liegt die Ewigkeit.
Im letzten Jahrhundert jedoch verliess Gott wohl kaum seine schöne barocke Kirche; zu sehr gefiel es ihm bei seinen Engelchen, dem Gold und den Stuckaturen. Er kümmerte sich nicht um die Leute, die in den Hütten in qualvoller Enge hausten, wo die Kleinkinder an Krankheiten starben, an Unterernährung und Kälte, wo man auf Laubsäcken schlief und mit Kartonstücken die zerbrochenen Scheiben mehr schlecht als recht flickte. Gott sorgte sich offensichtlich wenig um das Schicksal dieser Menschen, weder um die, welche im Dorf blieben und langsam dahinsiechten, noch um jene, die nicht den Mut hatten, in ferne Länder auszuwandern, aber immerhin versuchten, ihr Glück auf der andern Seite des Berges zu finden, im Kanton Glarus, wo die Textilindustrie Arbeitskräfte benötigte.
Allerdings, die Nachrichten, die man von dort drüben vom Schicksal der Fabrikarbeiter erhielt, waren auch nicht sehr ermutigend: lange Arbeitszeiten – seit 1877 täglich elf Stunden, immerhin ein Fortschritt im Vergleich zum bisherigen 15-Stunden-Tag –, schlechte sanitäre Einrichtungen, vielfach missliche Unterkünfte und niedrige Löhne. Den Beweis, dass dort nicht das Paradies sein konnte, lieferten die Glarner selbst: Sie verliessen ihren Kanton, viele von ihnen waren nach Wisconsin ausgewandert, wo sie das Städtchen New Glarus gründeten; und nach der Hungersnot von 1855 waren einige Hundert Männer, Frauen und Kinder nach Brasilien emigriert, voller Hoffnung, dort das versprochene Glück und den Wohlstand zu finden (»mehr Fleisch in acht Tagen als in der Schweiz während eines ganzen Jahres«).
Die Urner aber hatten keine Wahl. Sie wollten Arbeit, und bei ihnen welche zu finden, dafür bestand nicht die leiseste Hoffnung. Doch drüben, auf der andern Seite des Klausenpasses, würde sich in einer der neunundsechzig Textilfabriken des Glarnerlandes bestimmt ein Platz für sie finden, auch wenn es eine Stelle war, die selbst die Glarner nicht mehr wollten. Also schnürten die Auswanderer ihr bisschen Habe in ein Bündel, banden es an einen Stecken und verliessen die Alten, wohl wissend, dass man einander nie wiedersehen würde. Dann machten sie sich auf den steinigen Weg über den Klausenpass. Die Wanderung dauerte zwei oder drei Tage, sie schliefen in Ställen und assen, um zu sparen, das Stück Brot, das sie mitgenommen hatten. Auf der Passhöhe stiessen sie einen Seufzer der Erleichterung aus, als sie ein Tal erblickten. »Endlich angekommen!« Die Klügeren aber wussten, dass es sich nur um den Urnerboden handelte, ein langes, wildes Hochtal von fast fünf Kilometern, nach hinten begrenzt von einer Reihe schwarzer Tannen. Erst nach Überschreiten dieser Schranke stieg man endlich ins Linthtal ab. Die Frauen konnten nicht mehr, die Kinder weinten. In ihren schlechten Schuhen bluteten die Füsse.
Noch einige Stunden der Anstrengung, bis man den spitzen Kirchturm von Linthal sah. Man machte halt, um es zu betrachten, dieses Tal des Exils: breiter als das Urnerland, grüner auch mit seinen Wiesenhängen und den Wäldern. Sie trauten ihren Augen nicht, sie, die aus einem Land grauer Felsen kamen.
Das Dorf Linthal. Die ersten Fabriken. Hier war es, wo die Glücklicheren unter ihnen gleich Arbeit fanden.
Die Übrigen setzten ihre Wanderung fort, wahrscheinlich ohne zu wissen, dass sie schon über vierzig Kilometer zurückgelegt hatten. Von jetzt an, Gott sei’s gedankt, ging man auf einer richtigen Strasse, staubig zwar, aber wenigstens eben. Und man wusste, dass man sich einer Bleibe näherte. Allerdings mit einer Beklommenheit, die das Herz schwermachte, angesichts der Ungewissheit dieses neuen Lebens.
Der Grossvater Joseph, seine beiden Brüder und Johanna, sie erst fünfzehnjährig, hatten noch etwa zwei Stunden zu gehen, ehe sie zu einer Fabrik kamen, wo sie den Bescheid erhielten, ja, man habe Arbeit für sie. Das war in Hätzingen, nur durch eine Brücke über die Linth von Luchsingen getrennt: zwei Dörfer, die eigentlich ein einziges sind. Die grosse Fabrik am Flussufer mit ihren hohen Schloten. Einige niedrige Häuser und ein hochaufragendes Kosthaus – eine Art Pension für die Fabrikarbeiter –, das aussieht wie eine Kaserne, graue Mauern, dunkelgrüne Fensterläden.
Kapitel 4
Die Unterkunft ist eng. Die drei Brüder in einer Kammer, Johanna mit zwei Frauen in einer andern. Man steht um fünf Uhr auf. Nimmt in der gemeinsamen Küche hastig das Frühstück ein: Kartoffeln, schlechten Kaffee.
Um sechs Uhr beginnt die Arbeit.
Schwierig zu beschreiben, die Arbeitstage des Grossvaters, da ich nicht weiss, was er tat. War er in einer Textildruckerei? Das hätte Arbeit in heisser, stickiger und feuchter Luft bedeutet. Die Dämpfe, die man einatmet, sind unangenehm. Das Bild eines Arbeiters: hager, die Wangen eingefallen, die Augen tief in ihren Höhlen, knotige, arthritische Hände. Vielleicht hatte er aber auch eine andere Arbeit, der Grossvater Joseph, weniger hart und weniger ungesund. Ich hoffe es für ihn. Aber ich weiss ja nichts davon. Niemand hat je mit mir darüber gesprochen. Erst seit ungefähr einem Jahrzehnt weiss ich, dass er Fabrikarbeiter gewesen war, ehe er jenen andern Beruf ausübte, den man mir ebenfalls verheimlichte.
Einigermassen sicher scheint der Tagesablauf: Gegen halb zwölf Arbeitsunterbruch. Das Mittagessen wieder gemeinsam eingenommen: Kartoffeln, Wassersuppe, Brot. Um 13 Uhr Wiederbeginn der Arbeit bis zur Abenddämmerung. Zum Abendessen: Kaffee und Kartoffeln.
Monatlicher Lohn: 40 bis 45 Franken. Die Frauen verdienen 30 bis 35 Franken. In der Haushaltsrechnung stehen die Ausgaben für das Brot an erster Stelle (vor der Miete): 61 Kilo pro Monat für eine fünfköpfige Familie. Dann folgen die Kartoffeln mit 51 Kilo. Erst viel weiter hinten kommen die Ausgaben für Hülsenfrüchte, Mehl, Käse, Fett, Kaffee. Kein frisches Fleisch, keine Früchte, kein frisches Gemüse.
Man lebt. Mehr schlecht als recht. Man hat den Sonntag, um sich auszuruhen. Joseph erinnert sich des Elends drüben in Schattdorf. Aber er sieht auch die Villen der Fabrikbesitzer: richtigen kleinen Schlössern gleich, welche die Dörfer beherrschen. Er begegnet ihnen manchmal, diesen Fabrikherren: gut angezogen, steifer Kragen, Krawatte, Weste, dicke Zigarren rauchend. Joseph ist neunzehn- oder zwanzigjährig. Er fühlt wieder den Schwung, der ihn zum Aufbruch getrieben, der ihm auch auf dem Weg über den Klausen Kraft gegeben hat. Er gehört nicht zu jenen, die sich unterkriegen lassen.
Er will weiterkommen.
Cleophea S. ist elf Jahre älter als Joseph. Ihr Vater ist ein angesehener Bürger, er besitzt ein kleines Vermögen. Sie selbst ist Schneiderin, Junggesellin noch, mit über dreissig Jahren. Ein grosses Mädchen mit aufrechter Haltung, etwas streng. Ihre Eltern überwachen sie aufmerksam. Sie wohnt in einem behäbigen Haus in Luchsingen, auf der andern Seite der Linth also, ganz in der Nähe des Kosthauses, das Joseph verlassen möchte.
Und nun kann ich mir mit den spärlichen Angaben, über die ich verfüge, verschiedene Versionen ausmalen.
Joseph und Cleophea begegnen sich, verlieben sich. Um den Widerstand der Eltern zu überwinden, die nicht willens sind, ihre Tochter einem zugewanderten Fabrikler zu geben, richten die Verliebten es ein, dass Cleophea schwanger wird – zu jener Zeit ein Skandal. Deshalb galt es, so schnell als möglich zu heiraten.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Grossvater überhaupt nicht verliebt war, dass er Cleophea ganz einfach verführt hat, weil er nur zu gut wusste, dass dies die einzige Möglichkeit war, seiner jetzigen Lage zu entrinnen und so, später einmal, vielleicht selbst Herr zu werden.
Schliesslich kann ich mir eine dritte Version vorstellen, in der sich alles vermischt: die körperliche Anziehung, der Ehrgeiz, die Liebe, die Berechnung. Und dies wird wohl der Wirklichkeit am nächsten kommen.
Ausser ich wäre nicht imstande, mir vorzustellen, was sich Ende des 19. Jahrhunderts in einem Bergdorf wirklich abgespielt hat, wo das Dasein so hart war, dass die Notwendigkeit des Überlebens Gefühlen nur wenig Platz liess.
Was ich weiss: Sie haben geheiratet, Joseph und Cleophea, am 6. Juni 1887. Er war einundzwanzig, sie zweiunddreissig. Ihr erster Sohn, Carl, wurde am 23. Dezember desselben Jahres geboren.
Vier Jahre später, am 1. März 1891, ein weiterer Sohn: Johann Heinrich. Mein Vater.
Von nun an wohnt Grossvater Joseph nicht mehr im Kosthaus wie die andern, sondern in einem kleinen Haus aus Stein.
Er ist nicht mehr Fabrikarbeiter.
Er ist jetzt Metzger.
Kapitel 5
Mein Vater hat mir nichts von seiner Kindheit erzählt.
Ich habe ihm auch nie Fragen gestellt. Als ob er keine andere Vergangenheit hätte als die in Genf verbrachte Zeit.
Ich wünschte nicht, dass er über sein Dorf sprach. Er selbst tat, als ob er alles vergessen hätte.
Sie war vielleicht auch für mich, vor allem für mich, diese Verdrängung. Damit ich in der Gesellschaft, in der wir lebten, seinetwegen nicht zu erröten hatte. Damit ich kleines Mädchen mich den andern ebenbürtig fühlen konnte.
Ich will versuchen, so gut ich es kann, diese Zeit um die Jahrhundertwende wiederauferstehen zu lassen.
Das Tal ist abgeschieden. Auf der einen Talseite wie auf der andern, im Süden wie im Norden begrenzen Berge das Blickfeld, und nur weit vorn kann man erahnen, wo das Tal sich öffnet, wo man ihm entrinnen kann. Eine kleine Welt, ganz in sich geschlossen.
Wenig Sonne. Im Winter, trotz der niedrigen Lage – 600 Meter über Meer – fällt Schnee während Wochen. Stille breitet sich aus. Von Oktober bis Mai bleibt die Strasse über den Klausen unpassierbar (1900 eröffnet, sommers befährt sie eine Postkutsche). Nun ist man in einer Sackgasse. Nur selten besteigt man den Dampfzug, der nach Glarus fährt. Man bleibt im Dorf. Was ausserhalb geschieht, in Europa oder auch nur in der übrigen Schweiz, davon weiss man nicht viel; ausserdem hat man kaum Zeit, sich darum zu kümmern. Wenn es jetzt auch nicht mehr ums Überleben geht – die Armut weicht langsam –, um zu leben, braucht es alles an Willen und Kraft. Alles ist mühsam: waschen (fliessendes Wasser wird es erst 1904 geben), kochen, Geschirr spülen.
Die alten Holzhäuser des Dorfes drücken sich an die Bergflanke. Weiter unten, entlang der Strasse, einige neuere Häuser – und dort befindet sich auch dasjenige von Joseph und Cleophea, gleich neben der Metzgerei. Die Stube, die Küche mit einem Holzherd, zwei Zimmer, in die man über eine Leiter gelangt.
Zwischen Strasse und Bahnhof, in der Ebene, stehen Gebäude, die nach und nach, den Bedürfnissen der Fabrik entsprechend, gebaut wurden: einige grössere mit Arbeiterwohnungen, und kleinere Häuser mit einem Gärtlein davor für die Angestellten und die Meister.
Der Bahnhof am Ufer der Linth, jenseits, am andern Berghang, das Dorf Hätzingen und die Fabrik.
Das Leben scheint Joseph leichter im Vergleich zu dem, was er vorher gekannt hatte. Die Arbeit in der Metzgerei gefällt ihm, er ist glücklich, sein eigener Herr und Meister zu sein. Cleophea kümmert sich um seine Sachen, sie ersetzt die Mutter, die zurückblieb, drüben, auf der andern Seite des Berges. Cleophea schuftet vom Morgen bis zum Abend. Umsichtig sorgt sie für alles: entfacht am Morgen das Feuer im Ofen, bereitet die Mahlzeiten zu, wäscht und flickt die Kleider, putzt das Haus. Und während sie nach wie vor als Schneiderin tätig ist, verwaltet sie die Einkünfte der Metzgerei sowie das Geld, das sie von ihrem Vater geerbt hat. Sie erzieht ihre beiden Söhne und passt auf, dass Joseph sich nicht zu lange im Wirtshaus aufhält. Sie hat alles in der Hand, diese Cleophea. Ist verschlossen, ein wenig streng. Schweigsam.