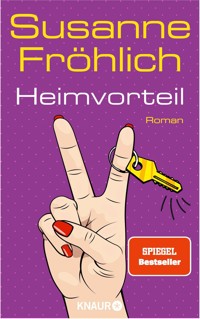
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Herz, Humor und Heimvorteil: Im humorvollen Roman von Susanne Fröhlich zeigt Mama ihren Kindern, wie altersgerechtes Wohnen geht! Geht's eigentlich noch? Drei erwachsene Kinder wollen ihre verwitwete 68-jährige Mutter ganz charmant aus dem Eigenheim komplimentieren – weil sie das Haus lieber selbst nutzen möchten. Ob Mama nicht auch finde, dass so viel Platz für eine allein nur unnötig Arbeit macht? Mama findet, dass sie jetzt erst mal ganz in Ruhe durchs Land reist und sich die unterschiedlichsten Alterswohnsitze anschaut. Da tun sich nämlich ganz neue Welten auf. Unterwegs findet Mama neue Freunde, verliert ein bisschen ihr Herz und hat eine grandiose Idee, was sie mit ihrem »viel zu großen« Haus anfangen will. Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich ist auch abseits ihrer Andrea-Schnidt-Romane eine Garantin für empathischen, aus dem Leben gegriffenen Humor. »Ein Mutmach-Roman […]. Schwungvoll und überraschend.« FÜR SIE über Susanne Fröhlichs lustigen Roman »Ausgemustert«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Susanne Fröhlich
Heimvorteil
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eigentlich fühlt sich Jutta mit 68 deutlich zu jung, um schon über betreutes Wohnen nachzudenken. Ihre Kinder sind da anderer Meinung. Zumal ihre verwitwete Mutter in einem hübschen Eigenheim lebt, für das der erwachsene Nachwuchs durchaus auch Verwendung hätte. So leicht ist Jutta aber nicht zur Alterseinsicht zu bewegen. Sie will lieber selbst über ihre Zukunft entscheiden und begibt sich auf eine große Reise, um zu sehen, was noch für drin ist für eine Rentnerin mit undankbaren Kinder in dieser großen Wundertüte ›Leben‹.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Für Conny und Bärbel
Mit Euch gehe ich in jedes Heim
Sie war überrascht, wie schnell Sterben gehen kann.
So lautlos und ohne jedwedes Aufsehen.
Auf den Tag genau vor zehn Jahren ist Klaus gestorben. Da war sie gerade mal achtundfünfzig Jahre alt. Es war ein sonniger Frühlingstag, harmlos, ein ganz gewöhnlicher Morgen. Klaus und sie haben gefrühstückt, 6.45 Uhr, wie immer. Als er sich die erste Zigarette des Tages anstecken wollte, hatte sie gemeckert. Auch wie immer. »Sei nicht so eine zickige Ziege!«, hatte er erwidert. Und als sie in die Küche ging, um für beide eine weitere Tasse Kaffee zu holen, ist er vornüber auf den Tisch gesunken und war, als sie mit dem Kaffee ins Esszimmer zurückkam, tot.
Ein Herzinfarkt. »Nichts zu machen, das war heftig!«, hatte der Notarzt nur gesagt und bedauernd den Kopf geschüttelt.
Sie hatte sich hingesetzt und eine Zigarette aus Klaus’ Packung genommen. Sie, die Nichtraucherin. Er braucht sie ja nicht mehr, hatte sie nur gedacht. »Zickige Ziege« war das Letzte, was er zu ihr gesagt hatte. Weil sie, wie eigentlich jeden Morgen, genörgelt hatte. Über seine Raucherei. Jetzt war es zu spät für jegliche Freundlichkeit. »Gehen Sie nie schlafen oder getrennter Wege, ohne jede Streitigkeit aus dem Weg geräumt zu haben!«, lautet eine Weisheit aus Frauenzeitschriften. Aber sie war bloß mal eben in die Küche gegangen. Und statt zu rauchen, stirbt Klaus. Das kann man nun wirklich nicht ahnen. Da dürfte man ja nie was sagen. Er hat die kurze Gelegenheit genutzt, um sich davonzustehlen. So jedenfalls hat sie es eine Weile gesehen. Inzwischen ist sie milder gestimmt, zehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Genug, um Tatsachen zu akzeptieren.
Zweiundvierzig Jahre waren sie zusammen, seit der Schule. Sie haben die Mittlere Reife gemeinsam gemacht. Sie nennt es noch immer Mittlere Reife. Passt besser als Realschule, findet sie. Und Klaus macht sich einfach aus dem Staub. Stirbt. Nach all den Jahren, ohne jede Vorwarnung. Das hatte sie sich anders vorgestellt.
Noch heute wird sie ein klein bisschen wütend, wenn sie daran denkt. Nie ist er zur Vorsorge gegangen, egal, wie sehr sie gedrängt hat. »Brauche ich nicht, keine Zeit, ich geh zum Arzt, wenn ich krank bin!«, waren seine Ausreden. »Das kommt davon!«, hätte sie ihm gerne am Grab hinterhergerufen. »Jetzt hast du wirklich keine Zeit mehr!«
Diese Wut hat ihre Trauer all die Jahre überschattet. Vielleicht auch erträglicher gemacht. Heute, zum zehnjährigen Todestag, will sie rausfahren zum Grab. Das macht sie nur noch selten. Wozu auch? Es ist kein Ort, an dem sie Klaus nah ist. Aber waren sie sich je wirklich nah? Funktioniert haben sie, sich etwas aufgebaut, und gut verstanden haben sie sich zumeist auch. Verlässlich war er gewesen. Berechenbar. Kein schlechter Ehemann.
Ist das Nähe? Oder braucht es da mehr? Sie weiß es nicht, sie kennt es ja nicht anders. Vielleicht ist diese romantische Vorstellung, diese oftmals zitierte Seelenverwandtschaft nur ein Mythos, eine Überhöhung. Etwas, was zu einer immerwährenden Enttäuschung führt. Vielleicht ist das, was sie beide hatten, das, was man auf der langen Strecke im besten Fall erwarten kann. Diese Sehnsucht nach dem Mehr impliziert auch immer das Vermissen. Eine latente Unzufriedenheit.
Und trotzdem: Jutta hatte insgeheim immer auf die Rente gehofft. Die Zeit ohne Arbeit. Da werden wir uns mal was gönnen. Da durchbrechen wir diesen unsäglichen Kreislauf von Arbeit und noch mehr Arbeit. Klaus und der Betrieb. Sie und ihre Filiale. Für viel mehr war nie Muße. Und dann war der Kreislauf abrupt unterbrochen. Aber eben nicht durch die herbeigesehnte Rente, sondern durch Klaus’ Tod. Das Danach war erledigt. Ohne dass sie entscheiden konnte. Es würde keines geben. Keines, an dem sie beide teilhaben konnten.
Zumindest das Haus war abbezahlt. Das Haus. Das war Klaus wichtig. All die Jahre hatten sie sich abgerackert, um die Hypotheken für das Haus zu bezahlen. Und jedes Jahr noch ein paar Euro Sondertilgung obendrauf erwirtschaftet. Als wäre die schuldenfreie Immobilie das angestrebte Klassenziel. Zu welchem Preis? Wenig Urlaub und wenig Zeit. »Die Kinder sollen mal alle Möglichkeiten haben!«, war sein Credo. Wie stolz war er gewesen, als die Zwillinge mit dem Studium angefangen hatten. Seine Söhne auf dem Weg ins Akademikerdasein. Die Jungs.
Die beiden haben ein wirklich prima Abitur hingelegt und dann an der Uni irgendwie nicht die Kurve gekriegt. Vielleicht gut, dass er das nicht erlebt hat. Er wäre sehr enttäuscht gewesen von Mads und Pelle. Die Namen hat Klaus ausgesucht. Jutta fand sie nie gut. Noch heute bereut sie, vor allem zu Pelle Ja gesagt zu haben. Immer muss sie an Wurst denken, wenn sie den Namen ausspricht. Dänische Vornamen, was für eine Schnapsidee!
Klaus hat Dänemark immer geliebt. Wenn es mal in den Urlaub ging, dann nach Dänemark. Eine Woche, selten zehn ganze Tage. Mehr ging nicht. Die immer gleiche Ferienwohnung. Günstig und zentral gelegen. Klaus war kein Mann für Experimente. Wenn was gut ist, sollte man daran festhalten, fand er. Und Dänemark war gut für ihn. Nicht so heiß und nicht so weit weg. Sie wäre gern mal woanders hingefahren. Hätte sich gern mehr von der Welt angeguckt. Hätte gern mal nicht gekocht und geräumt und geputzt im Urlaub. Hätte und wäre. Der ewige Konjunktiv steht stellvertretend für ihr Leben. Aber sie hat sich gefügt. Für die Familie, das große Ganze. Hat sich selbst nie in den Fokus gestellt. So ist sie nicht erzogen. »Wir statt ich« lautete die Devise.
Nach dem Tod von Klaus hat sie sich die erste wirkliche Unvernünftigkeit ihres Lebens gegönnt. Eine neue Küche. Jahrelang hatte sie darum fast schon gebettelt. »Die tut es doch noch!«, war die Antwort ihres Mannes gewesen. Es stimmte ja. Kaputt war nichts, aber diesen Holzcharme der Achtziger war sie nach all den Jahren einfach leid. Sie wollte was Modernes. Helles. »Ich kaufe mir doch auch kein neues Auto, nur weil mir die Farbe nicht mehr gefällt!«, hatte Klaus ihren Wunsch immer abgetan. Die neue Küche war eine Form der besonderen Trauerbewältigung. Ein Zeichen dafür, dass sie ab sofort allein für sich verantwortlich ist. Entscheidungen selbst trifft. Ohne Rücksprache.
Die Kinder waren entsetzt. Obwohl sie beim Preis nicht die Wahrheit gesagt hat. Zwanzigtausend hat sie behauptet. Sie haben es geschluckt. Daran sieht man, dass die drei von Küchen keinen Schimmer haben. Für zwanzigtausend hätte sie eine solche Küche nicht bekommen. »IKEA hat auch schöne Sachen, und bisher war die Küche schließlich gut genug!«, hat ihre Tochter gemeckert. »Dafür ist das Geld aber wirklich zu schade!«, fanden die Zwillinge. Alle drei waren sich einig, dass es wirklich sinnvollere Verwendungszwecke für diese Summe gegeben hätte. Sie selbst zum Beispiel. »Du bist allein, was musst du da groß kochen?«, war ein weiteres Argument. Aber obwohl sie sonst nicht zu Alleinentscheidungen neigt, wie auch – jahrelang hatte Klaus bestimmt, welche Anschaffung wichtig ist und getätigt wird –, hat sie die Sache durchgezogen. Und die Kinder vorab auch nicht über ihre Pläne informiert. Sie wollte über den Kauf nicht diskutieren.
Geplant, gekauft und auch noch aufbauen lassen. Etwas, was für Klaus an Dekadenz sicherlich kaum zu überbieten wäre. »Was man selbst machen kann, dafür zahlt man doch nicht!«, hatte er immer gesagt. Die Kinder waren ziemlich baff, als sie ihre Superküche gesehen haben. Erster Kommentar: Lohnt sich das denn noch? Sie war gekränkt. »Ich bin sechzig und nicht achtundachtzig!«, hatte sie nur gesagt. Und gedacht: Alles muss man sich ja nicht gefallen lassen. »Kann man die zurückgeben?«, wollte Mads, der eine Minute ältere der Zwillinge, wissen. Eine Einbauküche zurückgeben? Nein. Zum Glück nicht, denn sie liebt ihre neue Küche bis heute. Nicht nur weil sie neu und schön und praktisch ist, sondern weil sie ihre ist. Weil sie sie einfach gekauft hat. Ohne Zögern, ohne Handeln, ohne Angebot. Ein Wunsch, den sie sich einfach erfüllt hat. Es ist mehr als eine Küche, es ist ein Zeichen. Dafür, dass sie nicht länger jemand ist, der so gar nichts zu melden und zu entscheiden hat. Diesmal hat sie sich von niemandem reinreden lassen. Die Hälfte ihrer Ersparnisse hat sie für die Küche ausgegeben. Fünfunddreißigtausend Euro. Einmal nicht knausern, einmal kein Sonderangebot. Wenn die Kinder das wüssten, würden sie sie einweisen lassen. Siebzigtausend Euro hatten Klaus und sie zusammengespart. Ein Teil davon war das Erbe ihrer Eltern, schon deshalb hält sich ihr schlechtes Gewissen in Grenzen. Dass sie überhaupt was geerbt hat, hat sie damals erstaunt. Ihre Eltern waren sogenannte kleine Leute. Der Vater Bäcker, die Mutter Aushilfe im Laden.
Immer Streuselkuchen, nie Geld. Kein Urlaub, und wie der Vater sagte: keine Ausgaben für Fisimatenten. Unter Fisimatenten fiel alles, was nicht lebensnotwendig war. Markenjeans, ein zusätzlicher Badeanzug, undenkbar. Und dann knapp dreißigtausend Euro Erbe. Für jeden ihrer Brüder noch mal dasselbe. Da wären die ein oder anderen Fisimatenten ab und an durchaus drin gewesen. Neunzigtausend Euro auf dem Konto und immer geknausert.
Sie ist das Nesthäkchen der Familie, ungeplant, wie ihre Mutter ihr mal ungefragt erzählt hat. Kontakt zu ihren Brüdern hat sie eher selten. Sie streiten nicht, selbst dafür sind nicht genug Emotionen da. Hans und Peter sind nicht unrecht, aber drei sind halt eine zu viel, hat sie oft gedacht. Beide Brüder sind Handwerker geworden, reich ist keiner, aber, wie sagt man immer, sie haben ihr Auskommen. Auf dem Land in Schleswig kann man auch mit wenig ganz gut leben. Außerdem: Keiner von ihnen neigt zur Prasserei. Woher sollte das auch kommen, woher sollten sie es können? Prasserei muss man lernen, und verwöhnt worden sind sie nun wirklich nicht. Oft genug hat sie in ihrer Jugend eifersüchtig auf die Meiers geschaut. Die Metzgersfamilie. Nur einen Sohn hatten die. Neidisch war sie auf sein Einzelkinddasein. Daniel. Klein und breit um die Hüften. Schon als Jugendlicher leicht schwammig. Eine riesige Metzgerei hatten die Meiers, zwei Autos und ein Haus mit einem kleinen Außenpool. Die waren wer damals. Lange hat ihre Mutter gedacht, dass sie vielleicht die Richtige für den Meier-Sohn sein könnte. Raufheiraten nannte die Mutter es. Gucken und planen. Nicht blind verlieben. »Die Liebe trägt kein Leben lang, aber keine Geldsorgen zu haben, entspannt enorm.« Früher fand sie das oberflächlich und hat nur milde und einen Hauch mitleidig gelächelt bei dem Gedanken, Pummel-Daniel zu heiraten. Heute würde sie es vielleicht anders sehen. Vielleicht. Aber Daniel hatte sowieso nie Interesse an ihr. Er hat Sybille aus dem Nachbarort geheiratet. »Geld zu Geld«, hatte ihre Mutter gesagt, und es hatte bitter geklungen. Die Schöne und das Biest, hatte man im Ort getratscht. Sybille war ein ausgesprochen hübsches Mädchen. Und ihre Eltern hatten einen Hof mit einer riesigen Schweinezucht. Hat eben gut gepasst, allerdings nicht lange gehalten. Die beiden seien geschieden, hat man ihr erzählt. Sybille hat einen aus der Stadt genommen. Einen Anwalt. Mit Doktortitel sogar. Da konnte auch die Metzgerei mit Pool nicht mithalten.
Ihre Eltern leben schon lange nicht mehr. Kaputtgerackert könnte man sagen. So will sie nicht enden. Der Tod von Klaus war eine Art Warnschuss. Wenn ich weiter so mache, hat sie gedacht, dann bin ich auch bald in der Kiste. Aber das will sie mit Sicherheit nicht, weder bald sterben, noch in einem Sarg verwesen. Von Insekten und Würmern zerfressen werden. Sie möchte nicht neben Klaus auf dem Dorffriedhof liegen, auch wenn das so geplant ist. Das Grab hatte Klaus schon vor Jahren gekauft. Da waren sie noch keine fünfzig. Keine neue Küche, aber ein Grab.
»Niemandem zur Last fallen, seine Angelegenheiten vorab regeln«, das war ihm wichtig. Sie hingegen möchte verbrannt werden. Und dann verstreut. Irgendwo, wo es schön ist. Am liebsten unter ihren Hortensien. Den rosafarbenen, die Klaus so geliebt hat. Keine Steinplatte auf sich drauf, keine schwülstige Grabinschrift. Als sie das den Kindern gesagt hat, waren die verwirrt. »Wir dachten, du willst bei Papa sein, ihr habt doch ein Doppelgrab gekauft. Wer soll da denn jetzt mit rein?« Ist mir wurscht, hätte sie fast gesagt. »Das ist Vergeudung«, haben sie noch ergänzt. »Ihr könnt meinen Platz anderweitig vergeben!«, hat sie, für ihre Verhältnisse recht forsch, erwidert. Ob sie sich an ihre Wünsche halten werden? Sie hofft es.
Manchmal hat sie den Eindruck, den Kindern kann es gar nicht schnell genug gehen mit ihrem Ableben. Aber vielleicht ist sie da auch zu empfindlich. Wirklich kümmern tun sich die drei jedenfalls nicht. Sie haben eben ihr eigenes Leben, ihre eigenen Sorgen, das ist der normale Lauf der Dinge, versucht sie eine Entschuldigung für ihre Kinder zu finden. Sie ist gut darin, anderer Leute Verhalten zu beschönigen. Aber insgeheim kränkt es sie. Wie sehr hatten sie sich die Kinder gewünscht. Es hat lange gedauert, bis sie damals endlich schwanger war. Sie hatten es schon fast aufgegeben, Klaus und sie. Waren enttäuscht. Und dann, mit zweiunddreißig, hat es doch noch überraschend geklappt. Sophia kam auf die Welt. Auch hier war Klaus der Namensgeber. Sophia Loren war für ihn immer »die« Frau überhaupt. Die lebende Sinnlichkeit. Objektiv betrachtet, ohne den mütterlichen Blick, hat Sophia wenig bis gar nichts von ihrer Namenspatin. Kurven ja, aber nicht da, wo die Schauspielerin ihre hat. Ihre Tochter hat all ihr Gewicht an Beinen und Po. Das, was sie untenrum zu viel hat, fehlt ihr an Oberweite. Ihr Gesicht ist nett, aber weit entfernt von aufregend. Sophia hat viel von Klaus, ist weder hübsch noch hässlich. Durchschnitt eben. Sympathisch aussehend, aber mehr nicht. Aber clever ist sie, das muss man ihr lassen. Mit Sicherheit klüger als ihre Brüder. Trotzdem hat sie nach der Mittleren Reife aufgehört mit der Schule und bei der hiesigen Sparkasse eine Banklehre gestartet. Klaus war einverstanden, sie hingegen hätte es gern gesehen, wenn Sophia Abitur gemacht hätte. »Hat bei uns ja auch gelangt! Wahrscheinlich wird sie eh bald heiraten«, fand Klaus. Das hat sie dann auch früh getan. Und direkt Kinder bekommen.
»Ich wollte nicht so eine alte Mutter wie du sein!«, hat sie Jutta spitz gesagt. Als wäre das bei ihr eine bewusste Entscheidung gewesen. Außerdem: Alt ist zweiunddreißig nun nicht gerade. Heutzutage schon gar nicht mehr. Sophia hat kurz nach ihrer Lehre Heiner geheiratet, einen Polizisten, den sie in der Tanzschule kennengelernt hat. Heiner arbeitet auf dem Revier im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Spannend findet er es. Oft ernüchternd, aber immer spannend. Sophia will unbedingt, dass Heiner sich nach all den Dienstjahren endlich als Revierleiter bewirbt, aber Heiner hat wenig Ambitionen. Schreibtisch ist nix für mich, lautet sein Argument. Sophia arbeitet wegen der Kinder nur noch halbtags. Die beiden leben in Fulda, und Heiner pendelt täglich mit dem Zug nach Frankfurt. Eine Stunde hin, eine zurück. Zum Leidwesen von Sophia. Nie habe Heiner Zeit. Alles bliebe an ihr hängen. Der Garten, der Haushalt und die Mädchen. Aber in der Stadt oder dem unmittelbar angrenzenden Speckgürtel könnten sie sich ein eigenes Haus nicht leisten. Wäre Heiner endlich Revierleiter oder zumindest Stellvertreter, sähe das, ihrer Meinung nach, anders aus. All das ein Grund für ihre latente Unzufriedenheit. Für ihr Quengeln und Drängeln. Aber Heiner, sonst nicht sehr konsequent und willensstark, zeigt bei diesem Thema, dass er auch anders kann. Er will nicht. Und das ist ein ständiges Thema und Ärgernis zwischen den beiden. »Wenn du Karriere willst, mach doch selbst eine!«, argumentiert Heiner. »Waschlappen!«, hat ihn Sophia beim letzten gemeinsamen Grillen im Reihenhäuschen der beiden genannt. Angst vor der Verantwortung hat sie ihm unterstellt. Und das alles vor Jutta. Ihr war das unangenehm. Klaus und sie haben solche Dinge unter sich ausgemacht. Außerdem: Sie mag Heiner. Aber es ist ihr peinlich, wenn der sich so gar nicht wehrt.
Sophia kennt, einmal in Rage gekommen, wenige Grenzen. Und Heiner hält die Klappe. Lässt sich das gefallen. Sitzt es einfach aus. Mit ihren Töchtern ist Sophia anders. Weniger rabiat, liebevoller und fast schon auf eine seltsame Art devot. Sie will ihren Kindern gefallen. Jutta will das auch, aber nicht um jeden Preis. Kinder sind Kinder, und Eltern sind Eltern, denkt sie. Sie und Klaus hätten gar nicht die Zeit gehabt, den Kindern diesen immensen Raum zuzugestehen. Bei ihnen musste jeder funktionieren. Sie waren strenge Eltern, schon weil das Zusammenleben damit einen klaren Rahmen hatte. Die Strenge nicht als bewusste Entscheidung, eher als Notwendigkeit. Es war nun mal so.
Laura und Lisa, ihre Enkelinnen, sind inzwischen zehn und dreizehn und anstrengend präpubertär und pubertär. Hübsche kleine Diven, die ihren Eltern ganz schön auf der Nase rumtanzen. Jutta mag die Ältere, Lisa, lieber. Irgendwie hat sie einen besseren Draht zu ihr. Vielleicht weil sie sich in den ersten Jahren viel um sie gekümmert hat. Um ihre Tochter zu entlasten. Obwohl sie voll berufstätig war, hat sie an ihren freien Tagen und an vielen Abenden Lisa bespaßt. Klaus war das manchmal zu viel. Er wollte, nach dem Arbeiten, kein Baby um sich haben. »Ich brauche Ruhe, habe den ganzen Tag auf den Baustellen genug Remmidemmi.« Aber ihr war es wichtig. Vielleicht eine Art von Wiedergutmachung. Eine Kompensationsleistung. Für Sophia hatte sie immer zu wenig Zeit. Unterschwellig hat sie sicherlich auch gedacht, damit das Verhältnis zu Sophia verbessern zu können. Ein Irrtum. Besonders dankbar hat sich Sophia nie gezeigt.
Mit der Geburt von Laura sind Heiner, Sophia und Lisa dann in die Nähe von Fulda gezogen. In ein kleines Reihenhäuschen, das sie seither abbezahlen. Manchmal hat Jutta das Gefühl, Geschichte wiederholt sich. Dieser unbändige Drang nach dem Eigenheim. Woher kommt der eigentlich? Wäre eine bezahlbare Wohnung zur Miete, nah an Heiners Arbeitsplatz, nicht die viel bessere Lösung? Familienfreundlicher? Für Sophia, ihre Tochter, nicht vorstellbar. Ein Haus ist ein Haus. Drunter tut sie es nicht. In einer Wohnung zu leben, ist für sie ein Synonym für die, die es nicht geschafft haben.
Sie hatte Jutta und Klaus vorgeschlagen, die Häuser zu tauschen, später, wenn die in Rente gehen. Klaus war nicht abgeneigt. »Für uns ist es doch egal, wo wir im Alter leben!«, hatte er gesagt. Aber Jutta war alles andere als begeistert. Was soll sie in der Peripherie von Fulda? Ihr Haus ist so nah an Frankfurt, dass man wunderbar mit der S-Bahn in die Stadt fahren kann. Vielleicht sogar mal in die Oper oder auch in eine Ausstellung. Einfach etwas zum puren Vergnügen tun. Oder zumindest die Möglichkeit haben. Direkt abgesagt haben sie Sophia allerdings nie. »Wir werden sehen, wenn wir Rentner sind, entscheiden wir!«, haben sie sich um eine klare Antwort gedrückt und das Thema so gut es ging vermieden.
Als Sophia kurz nach dem Tod ihres Vaters den Haustausch erneut mit Vehemenz angesprochen hat, hat sie abgelehnt. In einem kühnen, mutigen Moment. Sie will den Häusertausch jetzt noch weniger als vorher. Ohne Klaus wäre sie sehr allein da draußen. Hier kennt und mag sie die Nachbarn, und ihre paar Freunde leben in der Nähe. Sophia war enttäuscht und hat damit nicht hinterm Berg gehalten. »Du könntest in eine kleine Wohnung ziehen, du brauchst all den Platz doch gar nicht. Und du könntest echt auch mal an mich und deine Enkelinnen denken.«
Jutta hat jahrzehntelang an alle außer sich selbst gedacht und fühlt sich trotzdem ertappt von Sophias Vorwürfen. Sie hat mit dem Platzargument natürlich recht. Sie braucht kein Haus mit vier Schlafzimmern. Aber sie mag ihr Haus. Klaus und sie haben geschuftet für ihr Haus. Sie liebt den kleinen Garten, will ihn nicht tauschen gegen die kiesige Steinwüste mit Schaukel und Sandkiste bei ihrer Tochter, und vor allem will sie sich dafür nicht ständig rechtfertigen. Mit welchem Recht erwartet Sophia, dass sie ihr Leben dem ihrer Tochter unterordnet? Das bisschen Leben, das ihr noch bleibt.
Nach dem Tod von Klaus hat sie zunächst weitergemacht wie bisher. Nicht mal eine Woche hatte sie sich freigenommen. Nur den Todestag, den Tag danach und den Tag der Beerdigung. Die Arbeit hatte sie abgelenkt. Aber nicht nur das. Es war die Struktur, die sie brauchte. Die Kollegen und Kolleginnen waren erstaunt gewesen, und selbst Fred, ihr Chef, der normalerweise nicht zur Großzügigkeit neigte, hatte ihr mehrfach vorgeschlagen, es geruhsam wieder anzugehen. »Nimm dir halt ein paar Tage frei, Jutta!«, hatte er gesagt. »Du hast doch noch Urlaub über!« Aber einfach so weiterzumachen, kam ihr am natürlichsten vor. Einfach zur Arbeit zu gehen. Zu Hause zu hocken, hieße, ständig zu denken, dass etwas nicht stimme. Beim Arbeiten war kaum Zeit nachzudenken. Jedenfalls nicht über Klaus. Ihr bisschen Urlaub zu vergeuden, um daheim Trübsal zu blasen, kam ihr abwegig vor. Um zu trauern, brauche ich keinen Urlaub, hatte sie nur gedacht. Das kann ich nebenher erledigen.
Außerdem war es ja so: Sie als stellvertretende Filialleiterin von Fred hatte jede Menge Aufgaben. Und dazu Personalverantwortung. Angefangen hat sie mal als Kassiererin. Ein Job, den sie immer gemocht hat. Kassiererin zu sein, ist anspruchsvoller, als Menschen denken. Es heißt schnell sein, aufmerksam sein und dazu im besten Falle noch freundlich. Nach einigen Monaten an der Kasse ahnt man, was in Familien vorgeht. Man weiß, wer zu viel trinkt, raucht oder nie Obst isst. Wer gerade Diät macht, wer klamm ist und jedes Mal ängstlich auf die Gesamtsumme schaut oder wer sich nie was gönnt. Weil es gerade nicht geht oder weil es eben nie geht. Und auch nie gehen wird. Das ist ja oft das Schlimmste. Zu wissen, dass Einschränkungen keine zeitliche Sache sind, sondern der Dauerzustand. Einer, aus dem es keinen Weg hinaus gibt.
In ihrem Discounter kaufen aber nicht nur Menschen, die nicht anders können. Es gibt auch welche, die sehr wohl genüsslich an kleinen Marktständen oder anderweitig hochpreisiger einkaufen könnten. Die legen dann acht Flaschen des hauseigenen Champagners auf das Band. Eine der Kundinnen, die mit der immer perfekt geföhnten blonden Mähne wie aus den Achtzigern, hat ihr bei jedem Einkauf zugezwinkert und beteuert, dass der fast wie Markenchampagner schmecke. »Den müssen Sie mal probieren! Der ist wirklich gut. Und das bei dem Preis!« Sie hatte immer nett geguckt und genickt. Champagner! Wozu brauchte sie Champagner? Klaus hätte nur mit dem Kopf geschüttelt. 11,99 für einen Rosé-Champagner! Für Klaus war Alkohol etwas, um sich ein wenig zu beduseln. Ein Bier war ihm immer das Liebste. Bier ist was Reelles, hatte er immer gesagt. Bei Feiern auch mal ein Glas Wein oder für besondere Anlässe ein Gläschen Sekt. Champagner ist nicht für Leute wie uns, fand Klaus. Warum mehr Geld ausgeben, wenn gar nicht mehr Prickel drin ist? Jutta hatte gelegentlich überlegt, ob sie eine Flasche mitnehmen soll. Zu seiner Beerdigung hat sie sich eine geholt und sie, nachdem alle weg waren, alleine getrunken. Hatte auf ihren Klaus angestoßen. Und dabei nur gedacht: In unserem Leben war zu wenig Champagner, und die Kundin hat recht. Er ist gut, der 11,99-Rosé-Champagner.
Alles auf die Zeit der Rente zu verschieben war dumm. Das weiß sie jetzt. Hinterher ist man immer schlauer. Klaus hat auf die Rente hingefiebert. Und hat sie nie erlebt. Das zumindest hat sie durch seinen Tod gelernt: dass dieses Aufschieben bedeuten kann, dass etwas nie stattfindet. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben, sagt der Volksmund. Von wegen.
Seit seinem Tod gibt es deshalb jeden Monat eine Flasche Champagner. Auch ohne erkennbaren Anlass. Einfach nur, weil sie noch lebt. Als sie in Rente gegangen ist, hat sie fünf Kisten davon gekauft. Sicher ist sicher. Nicht, dass Lidl eines Tages entscheidet, den Champagner aus dem Sortiment zu nehmen.
Auf dem Weg zum Grab, zehn Jahre nach seinem Tod. Seinem sehr stillen Abgang. Sie hat die Kinder gefragt, ob sie sich mit ihr auf dem Friedhof treffen wollen. Und danach vielleicht gemeinsam was essen gehen und ein Glas auf Papa trinken. »Ich kann mir dafür nicht freinehmen!«, hat Sophia nur geantwortet, und sie hat nichts entgegnet, nur gedacht: Wieso eigentlich nicht? Einen Tag für deine Mutter und indirekt für deinen Vater. Ist das wirklich zu viel erwartet? Auch die Zwillinge haben direkt verneint und irgendwas von einem wichtigen Termin erzählt.
Sophia hat, auch ohne dass sie etwas gesagt hat, immerhin gemerkt, dass sie ihre Mutter gekränkt hat. »Vielleicht schaffen wir es, am Wochenende vorbeizuschauen!«, hat sie versucht, mit einem kleinen Köder gut Wetter zu machen. »Das wäre schön!«, hat sie geantwortet und sich trotzdem still geärgert. Warum nur ist immer alles wichtiger als sie? »Papa ist es sicherlich egal, ob wir pünktlich am Jahrestag hinkommen!«, hat Pelle noch gesagt. Aber mir nicht, hätte sie sagen sollen. Ihre Bedürfnisse klar zu formulieren, macht ihr Probleme. Vielleicht, weil ihre Bedürfnisse nie eine Rolle gespielt haben. Sie muss ihre Ansprüche deutlicher machen. Sie weiß das und schafft es trotzdem nicht. Harmonie war ihr immer wichtig. Auch, wenn die auf ihre Kosten ging.
Natürlich könnte sie die Fahrt zum Friedhof verschieben. Auf irgendwann, irgendwann dann, wenn es den Kindern in den Kram passt. Sie beschließt, nicht darauf zu warten und alleine zu gehen. Der Jahrestag ist nun mal heute und nicht irgendwann.
Es ist ein kühler Morgen, noch ein wenig neblig, fast schon novemberlich, und das im Mai. Damals war es sonnig. Das Grab sieht schlampig aus. Ungepflegt. Und das bei einem Mann, der seinen Garten so geliebt hat. Zum Glück kann er nicht rausgucken, hat Jutta nur gedacht. Er wäre entsetzt, das weiß sie. »Also echt, Jutta, das kleine Stückchen Grün in den Griff zu bekommen, ist doch wohl machbar!«, hätte er gesagt, und es wäre ein kleiner Vorwurf mitgeschwungen. »Ich mache es dir hübscher«, hat sie geflüstert. »Ich pflanze dir was Blühendes. Etwas, was nicht nur praktisch und pflegeleicht ist.«
Sie spricht sonst nicht mit ihm. Jedenfalls nicht hier. Es kommt ihr komisch vor. Zu jemandem zu sprechen, der in zwei Meter vierzig Tiefe liegt und wahrscheinlich inzwischen mehr Erde als Körper ist. Der ihr niemals mehr antworten wird. Es erscheint ihr albern. Aber heute hat sie erstmals dieses Bedürfnis. Zu reden. Noch lieber würde sie einfach nur ihren Kopf in seine Armbeuge legen. Vor dem Einschlafen hat sie das oft gemacht. Und sich dabei auf eine Art doll beschützt gefühlt. Sie hat die starken Arme von Klaus sehr geliebt. Und seinen Geruch.
»Ach, Klaus, das hätte doch echt nicht sein müssen! Dieses Scheißsterben«, sagt sie und schaut auf den Grabstein. Marmor. Ein Fast-Geschenk von Manni, einem Handwerkerkollegen von Klaus. »Kriegst du zum Einkaufspreis, Jutta!«, hatte der gesagt. Und den kitschigen, eingravierten Engel gab’s als Gratisüberraschung dazu. Gefallen hat der ihr nie, aber sie hat sich nicht getraut, ihm das zu sagen, und irgendwie war es ja auch egal. Am meisten verstört hat sie der weitere Platz auf dem Stein. Der, wie Manni ihr erklärt hat, für ihren Namen gedacht war. Eine Leerstelle, die sie schon bei der Beerdigung lautlos angeschrien hat. Noch nicht genug gelebt, aber schon einen Platz auf dem Friedhof! Nur noch einziehen muss sie, um die Leerstelle auf dem Grabstein zu füllen.
»Ich wollte nicht mehr, als mein Mann gestorben ist, am liebsten wäre ich mitgestorben! Hinterhergesprungen in die Grube.« Das hat sie schon einige Male von anderen Frauen gehört. Ist das die große wahre Liebe, wenn man sich ein Weiterleben ohne den Ehemann gar nicht vorstellen kann und will? Manchmal hat sie sich ein bisschen geschämt, dass ihr dieser Gedanke nie gekommen ist. Ihr Wille zum Leben ist durch den Tod von Klaus geradezu neu entflammt worden. Der Tod bringt neben der Trauer auch die Frage mit sich, wie Leben sein sollte. Die Endgültigkeit, diese Radikalität des Todes, verlangt die nicht automatisch dieselbe Radikalität des Lebens? Muss man richtig leben, um das Leben zu schätzen? Und was heißt das mit dem richtig Leben? Wie geht richtig leben? Diese Frage hat sie sich in den Wochen nach Klaus’ Tod häufig gestellt. Noch heute – zehn Jahre danach – ist sie unsicher, wie das mit dem richtig Leben geht. Mehr Risiko und mehr Egoismus? Mehr auf die »innere Stimme« hören? Aber sie hört da nichts in sich.
Sie hat lange überlegt, wer in ihrem Umfeld »richtig« lebt? Gibt es ein »richtig« für alle, oder ist »richtig« für die eine noch lange nicht richtig für die nächste Person? Wo und wie ist mein richtig? Ist richtig leben zunächst eine Entscheidung und dann ein Weg? Schritt für Schritt hat sie für sich entschieden, radikale schnelle Umbrüche sind und waren nie ihr Ding. Da wäre das Scheitern vorprogrammiert. So wie man ja beim ersten Joggingversuch auch nicht direkt bei einem Marathon antritt.
Während sie den hässlichen, leicht verdorrten Bodendecker rausreißt, fragt sie leise Richtung Grab: »Was mache ich bloß mit den Kindern? Sie sind erwachsen, aber ich habe das Gefühl, sie kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe.« Es ist, in jeder Hinsicht, eine rhetorische Frage. Nicht nur, weil aus dem Grab sicherlich keine Antwort kommt, sondern auch weil sie ahnt, nein, genau weiß, was ihr Klaus antworten würde. »Lass sie ihr Leben leben, Jutta. Misch dich nicht ein.«
Klaus war nie ein Mann, der die Auseinandersetzung gesucht hat. Im Gegenteil. Er hat sie gemieden. »Bringt nichts, außer Ärger!«, war seine Meinung. Diskutieren, schön und gut, aber wozu? Streiten hat Klaus fast schon Angst gemacht. Er war noch harmoniesüchtiger als sie. »Ruhe an der Front«, hat er es genannt. »Jedem Tierchen sein Pläsierchen, Hauptsache, wir wissen, was und wohin wir wollen. Andere können uns egal sein.« In Klaus’ Leben war viel egal und wenig Haltung. Einmischen fand er übergriffig und unnötig. »Ich will auch nicht, dass mir jemand sagt, wie ich mein Leben zu leben habe, also halte ich mich aus anderen Leben raus.« Zugegeben, eine stringente Linie. Trotzdem hatte Jutta oft ein Problem damit. Sich raushalten ist immer eine Form der kleinen Feigheit. Und so ganz stimmte es eben auch nicht. Klaus hat sehr wohl seine Meinung durchgesetzt. Er hat einfach bestimmt, subtil entschieden, wo es langgeht. Ohne groß zu fragen. Wer nicht fragt, bekommt auch keine Antwort, die ihm nicht gefällt. Sie war die Frau, die sich gefügt hat. Für den lieben Frieden oder das, was sie dafür gehalten hat, denkt sie. Hätte sie mehr streiten müssen? Mehr kämpfen, für das, was sie insgeheim wollte? Braucht eine Gemeinschaft jeder Form genau solche Leute, Menschen wie sie, um zu funktionieren? Könnten zwei Bestimmer überhaupt entspannt zusammenleben? Oder braucht es immer den gefügigen Gegenpol?
»Du würdest dich wundern, Klaus, noch merkt man es kaum, aber in mir brodelt es«, sagt sie, und während sie es ausspricht, in die Leere und Stille des Friedhofs hinein, hat sie das Gefühl, dass es tatsächlich wahr ist. »Da staunst du, gell?«, legt sie nach. Noch nach zehn Jahren weiß sie genau, wie er jetzt gucken würde. Überrascht und einen Hauch ungläubig. Hat er ihr je viel zugetraut? Oder hat das mit Zutrauen gar nicht viel zu tun? Er fand sie fleißig, das weiß sie mit Sicherheit. Und er hat sie geliebt. Auch da ist sie sich sicher. Sein Bild von Liebe war immer auf eine Art genügsamer als das ihre. Zusammenhalten, gemeinsame Ziele haben und natürlich durchhalten. Als wäre eine Familie eine Firma. Romantik, rasende Leidenschaft und das ganze Rosa waren nie seins. »Man muss nur wollen und machen!«, hat er oft gesagt. Sie hat gewollt und sie hat gemacht. Auszubrechen aus diesem Hamsterrad war nie eine Option für sie gewesen. Das machte man nicht. Sie hat sich eingepasst in sein Schema. Und nein, es war wirklich nicht alles schlecht. Sie will sich nicht rückblickend beschweren. Sie hat durch ihr Nichtstun ja auch Zustimmung signalisiert. Das muss ich mir vorwerfen, denkt sie. Und es wird Zeit zu überlegen, wohin es für mich geht. Vor allem was ich wirklich will. »Frauen sind mir ein Rätsel!«, hätte er jetzt nur gebrummt. Sie will ihr Rätsel lösen.
Auf der Heimfahrt im Bus ist sie seltsam beschwingt. Fast so, als hätte sie ein Glas von diesem 11,99-Euro-Rosé-Schampus intus.
Dieses Gefühl ist mit einem Schlag weg, als sie zu Hause ankommt. Sie hat den Hausschlüssel vergessen. Verdammt. Es ist das zweite Mal in dieser Woche. Beim letzten Mal hat ihr Gerda aus der Bredouille geholfen. Gerda, ihre Nachbarin, hat einen Ersatzschlüssel. Aber hat sie ihn ihr wiedergegeben? Sie kann sich nicht erinnern. Noch mal verdammt. Was ist nur mit ihrem Kopf los? Neulich hat sie im Keller gestanden und nicht mehr gewusst, was sie dort wollte. So was ist ihr früher nie passiert.
Gerda hat keinen Schlüssel. »Den hast du vor einer Woche geholt und ihn mir noch nicht zurückgegeben!«, erklärt sie Jutta. Peinlich, denkt die nur. »Ich war nicht mehr sicher, ob ich ihn dir gegeben habe!«, sagt sie.
»Hat nicht deine Tochter auch einen?«, fragt Gerda dann. Stimmt, denkt sie. Aber Sophia lebt nicht um die Ecke, und es ist ihr unangenehm, sie anzurufen, aber manchmal hat man keine Wahl.
»Mama, das kann doch nicht sein, das ist doch schon das zweite Mal in kurzer Zeit«, kommt ihr Sophia direkt mit einem Vorwurf. Sie wäre, wie Jutta ja wohl wisse, beim Arbeiten, und danach müsse sie die Kleine zum Voltigieren fahren. Mit anderen Worten, sie habe für die Schussligkeit ihrer Mutter eigentlich keine Zeit. Der Reitstall, in dem Laura, die jüngere ihrer Enkelinnen, Unterricht nimmt, liegt zehn Minuten von Sophias Haus entfernt.
»Kann Laura nicht mal das Fahrrad nehmen, und du kommst eben schnell vorbei?«, wagt Jutta einen kleinen Einspruch.
»Schnell vorbeikommen!«, zischt Sophia. »Du wirst dich wohl erinnern, dass wir nicht um die Ecke wohnen. Das fehlt mir echt noch heute. Eine Stunde Fahrt hin, eine zurück.« Wie oft sie schon für ganz andere Dinge hin- und hergefahren ist. Aber das jetzt anzuführen, bringt nichts, wenn Sophia nicht selbst darauf kommt. »Gut, ich komme!«, stöhnt Sophia. »Aber erst mal muss ich heim und sammle Laura ein, und wenn ich sie im Reitstall abgeladen habe, komme ich. So lange musst du dich leider gedulden.«
Auf den Fahrradvorschlag ist ihre Tochter mit keinem Wort eingegangen. Hätte Jutta auch gewundert. Sophia ist das, was man heutzutage eine Helikoptermutter nennt. Früher hieß es einfach Glucke. Sie hat ihre Kinder nie zum Sport gefahren. Wie auch? Sie hat ja dauernd gearbeitet. Wer Sport machen wollte, durfte das selbstverständlich, aber es gab keinen Lieferservice. »Ihr habt Fahrräder, und es gibt einen Bus!«, hat Klaus immer gesagt, und keiner hat das je infrage gestellt. Andere Zeiten waren das.
Als sie mit Sophia mal darüber gesprochen hat, hat die nur geschnaubt. »Schon deshalb fahre ich meine Kinder. Nicht nur, weil es gefährlich ist, sie allein loszuschicken, sondern auch, weil ich mich für sie interessiere.« Als hätte das eine mit dem anderen zu tun. »Wir konnten nicht, selbst wenn wir gewollt hätten!«, hat sich Jutta versucht zu verteidigen. »Ihr habt aber nicht gewollt, und ich will«, hat Sophia nur geantwortet, und es hat traurig geklungen. Haben sie da einen Fehler gemacht? Hätten sie den Fokus mehr auf die Kinder legen sollen? Hätten sie weniger arbeiten sollen? Wieder dieses verdammte »hätten«. »Wenn ich nicht gearbeitet hätte, dann hätten wir uns sehr einschränken müssen, Papa war damals noch angestellt, und das Gehalt eines Elektrikers allein hätte nicht für unser Haus gereicht«, hat Jutta erneut nach Verständnis bei ihrer Tochter gesucht. »Wir kriegen es ja auch hin!«, hat Sophia geantwortet, und Jutta war still. Wer nicht verstehen will, wird auch nicht verstehen. Egal, wie viel man erklärt. Das immerhin hat Jutta verstanden.
»Kommst du bis heute Nachmittag irgendwo unter?«, fragt Sophia und zeigt wenigstens ein bisschen Interesse und Anteilnahme.
»Kein Problem, das ist sehr lieb von dir, dass du fragst und dass du den Weg auf dich nimmst!«, beteuert Jutta schnell. Nicht, dass es sich Sophia noch anders überlegt. »Bring doch die Kinder mit, und wir essen gemeinsam Abendbrot?«, ergänzt sie.
»Mama, wir müssen noch für die Mathearbeit lernen, und die Kinder haben jede Menge Hausaufgaben.« Wir müssen für die Mathearbeit lernen! Meine Güte, wie Jutta das nervt. Sophia muss doch nicht lernen. Sie hat ihren Schulabschluss. Einmal hat sie es gewagt, darüber eine Art Witz zu machen. Sophia hatte nicht gelacht. Sondern ihr, im Gegenteil, eine lange Ansprache gehalten, wie wichtig es ist, sich zu kümmern.
Sie ärgert sich über sich selbst. Eigentlich die schlimmste Form von Ärger. Man kann niemanden haftbar machen. Jetzt muss sie die Zeit totschlagen, bis Sophia ihr den Schlüssel bringt. Warum nur ist sie in letzter Zeit so dusselig? Natürlich könnte sie Gerda fragen, ob sie die Stunden bei ihr im Haus oder Garten warten kann. Aber die Vorstellung, über Stunden angestrengt Konversation zu machen, schreckt sie. Gerda ist eine nette Frau, mehr allerdings auch nicht. Sie sind Nachbarn, waren aber nie Freunde. Nicht die Art von Nachbarn, die gemeinsam grillen, sich gegenseitig einladen. Freundlich selbstverständlich, aber auf eine eher distanzierte Weise. »Zu viel Nähe schlägt schnell um, und dann hat man das Malheur!«, hatte Klaus gemeint. Da waren sie sich einig gewesen. Sich ein Ei leihen, den Schlüssel der anderen verwahren und mal im Urlaub nach dem Rechten sehen, das haben sie immer getan. Aber zu einer Freundschaft hat sich das nie ausgewachsen. Weil sie und Klaus auf die Bremse getreten sind. Gerda hat sich immer wieder bemüht, aber selbst nach dem Tod von Klaus hat Jutta sehr zögerlich auf die Annäherungsversuche reagiert. »Wenn du dich allein fühlst, kannst du gerne jederzeit vorbeikommen!«, hatte ihr Gerda auf der Beerdigung zugeraunt und ihr dabei sanft über den Rücken gestreichelt. Irgendwas hat Jutta davon abgehalten. Obwohl sie sich sehr oft alleine gefühlt hat. Manchmal war sie in Gedanken schon an Gerdas Haustür, hat sich dann aber doch letztlich immer dagegen entschieden. Gerda ist ihr zu direkt. Fragt immer die eine Frage zu viel. Ein Gespräch mit Gerda hat etwas von einem freundlichen Verhör. Gerda ist eine Frau, die nachfragt, die nichts einfach so im Raum stehen lässt. Keine Frau, die sich mit einem lapidaren »Danke, mir geht’s gut« abspeisen lässt. An sich findet Jutta das gut. In der Theorie. Schließlich zeugt es von Interesse. Doch die vielen Fragen werfen auch in Jutta Fragen auf. Und das wollte sie lange Zeit nicht. Sich Fragen stellen und damit die gesamte Situation infrage stellen.
Nach Klaus’ Tod hat es sich schmerzlich bemerkbar gemacht, dass sie ihre sozialen Kontakte nie wirklich gepflegt haben. Klaus war kein besonders geselliger Mann. Abendessen mit Freunden waren rar. Wenn Klaus von den diversen Baustellen nach Hause kam, wollte er nur eins: seine Ruhe. Einmal im Monat hat er mit Manni, dem Steinmetz, und zwei anderen Kumpels Karten gespielt. Reihum, mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Kamen die Männer zu ihnen, hat Jutta ein bisschen was hergerichtet. Einen Kartoffelsalat, ein paar belegte Brote oder einen schönen Nudelauflauf. Einmal einen Quinoa-Salat, aber der war kein Erfolg. Während die Männer gespielt haben, hat sie sich ins Schlafzimmer zurückgezogen und ein wenig ferngesehen.
Wenn sie Klaus gefragt hat, ob sie mal ins Kino gehen wollen oder in ein Konzert, hat er zumeist abgewunken: »Geh du ruhig, für mich ist das nichts! Ich muss ja morgens früh raus.« Ab und an hat sie sich nach der Arbeit mit einer Freundin getroffen. Für ein, zwei Stündchen in einem Lokal. Aber auch sie war eigentlich jahrelang nur müde gewesen. Zu müde für irgendwas. Ihr Leben war anstrengend gewesen. Jeden Morgen die Kinder fertig machen, dann zur Arbeit hetzen und danach die Kinder wieder einsammeln. Haushalt, Kinder und Arbeit, das lässt das Interesse an zusätzlichen Aktivitäten enorm schrumpfen. Die dauernde Müdigkeit lässt alles in den Hintergrund rücken. Schon morgens mal länger als bis 6.15 Uhr zu schlafen, hat sich angefühlt wie unglaublicher Luxus. Es gab viele Morgen, an denen sie einfach nur wieder die Augen zumachen wollte und weiterschlafen. Sich damit ausblenden aus ihrem Leben. Aus ihren Verpflichtungen. Aber sie kannte es nicht anders. Bei ihr zu Hause war es ja noch schlimmer gewesen.
»Ist das jetzt unser Leben?«, hatte sie Klaus mal sehr ernüchtert nach einer harten Woche gefragt.
»Bist du unzufrieden damit?«, hatte er erwidert und beleidigt gewirkt. Dabei war es doch gar kein Vorwurf an ihn, sondern eher eine generelle Frage.
Sie hatte schnell den Kopf geschüttelt und den Mund gehalten. War sich vorgekommen wie eine dieser Frauen, die nach Selbstverwirklichung streben. Für Klaus ein Synonym für Menschen, die nichts zu tun haben. »Was für Sperenzchen!«, hatte er oft gesagt, wenn im Fernsehen jemand das Wort aussprach.
Jetzt kann sie jederzeit ausschlafen und kann es trotzdem nicht. Ihr Körper ist aufs frühe Aufstehen programmiert. Ihr Körper ist ein Soldat. Manchmal bleibt sie trotzdem einfach liegen. Weil sie es kann. Dann trinkt sie ein oder zwei Kaffee im Bett und fühlt sich dekadent.




























