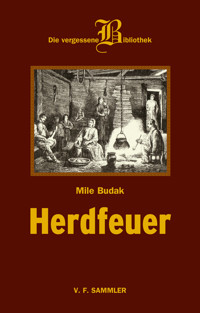
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wieder da: der beste kroatische Volksroman •Meistererzählung über das bäuerliche Leben in der Lika •Klassiker der realistischen slawischen Dorferzählung •in einer Liga mit Nobelpreisträger Ivo Andrić "Herdfeuer" gilt als der wichtigste kroatische Roman aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der deutsche Slawist Reinhold Trautmann stellte ihn 1947 in die Reihe der "großen slawischen Romane", für den österreichischen Literaturkritiker Josef Laßl stand er 1966 gar auf einer Höhe mit dem jugoslawischen Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić. Während des Ersten Weltkrieges entfaltet sich in einem kleinen Dorf in der Lika im heutigen Kroatien eine mörderische Tragödie. Im Mittelpunkt stehen die klassische südslawische Großfamilie ("Zadruga") und das mystische Herdfeuer, das nie verlöschen darf. Aus eigenem Erleben schildert der Autor das europäische Volksleben vor Elektrifizierung und Mechanisierung der ländlichen Regionen. Univ.-Prof. Dr. Slobodan Novak, der an verschiedenen Universitäten in Zagreb, Rom und den USA slawische Literatur gelehrt und mehr als 70 Bücher veröffentlicht hat, steuert ein kundiges Vorwort über Roman und Autor zum Buch bei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1420
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mile Budak
Herdfeuer
V. F. SAMMLER
Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka, 8143 Dobl
Umschlagabb. Vorderseite: zeitgenössische Darstellung des Zusammenlebens am traditionellen bäuerlichen Herdfeuer in Südosteuropa von Felix Kanitz, 1868 (gemeinfrei)
Umschlagabb. Rückseite: gemeinfrei
Textnachweis: Es handelt sich bei diesem Buch um eine fotomechanische Reproduktion der 1943 im Verlag Karl H. Bischoff zu Berlin, Wien und Leipzig erschienenen Erstausgabe. Der Originaltext wurde um eindeutige Satzfehler und Verschmutzungen bereinigt. Eigens für die Neuausgabe verfasst wurden Vorwort sowie vereinzelte Erläuterungen von Fremdwörtern. Der ursprüngliche Übersetzer Franz Hille konnte verlagsseitig auch durch erheblichen Aufwand nicht ausfindig gemacht werden; sollten Urheberrechtsansprüche an der Übersetzung bestehen, so bitten wir um Kontaktaufnahme.
Vorwort übersetzt von Sladjanka Peric
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.
Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
V. F. Sammler
Hofgasse 5 / Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-85365-341-8
eISBN 978-3-85365-349-4
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by V. F. SAMMLER, Graz 2023
Layout: Werbeagentur Rypka, 8143 Dobl
Inhalt
VORWORT
von Univ.-Prof. Dr. Slobodan Novak
HERDFEUER
von Mile Budak
VORWORT
von Univ.-Prof. em. Dr. Slobodan Prosperov Novak
Mile Budak, ein 1889 in der Lika geborener kroatischer Schriftsteller und Politiker, dessen bedeutendsten Roman „Ognjište“ Sie 80 Jahre nach der ersten deutschsprachigen Ausgabe jetzt wieder übersetzt in Ihren Händen halten, wurde noch vor dem Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften 1912 wegen der Beteiligung an einem Anschlag auf den österreichisch-ungarischen königlichen Gesandten Slavko Cuvaj zusammen mit einer Gruppe von Schulkindern und jungen Rebellen in Zagreb angeklagt.
Bei diesem Prozess befanden sich auf derselben Anklagebank zusammen mit Kommunisten und Anarchisten zukünftige kroatische Politiker, die sich für die Unabhängigkeit Kroatiens einsetzen sollten, unter ihnen zwei junge Menschen, die bestimmend für die Entstehung und den Werdegang des Unabhängigen Staates Kroatien von 1941 bis 1945 sein würden. Dies waren der Jurastudent Ante Pavelić, der spätere Regierungsund Staatschef, und sein zukünftiger Mitstreiter Mile Budak, der Autor des vorliegenden Buches. Der Zagreber Prozess gegen Cuvajs Attentäter prägte das Schicksal vieler kroatischer Politiker und Schriftsteller, der bedeutendsten Aktivisten der beiden Ideologien, die die kroatische Realität und das spirituelle Leben im gesamten 20. Jahrhundert bestimmten. Einige waren Verfechter der kroatischen Staatlichkeit und der nationalen Souveränität, während andere die jugoslawische Gemeinschaft und den Kommunismus förderten. Das spätere Leben von Mila Budak und Ante Pavelić war vor allem von der Geschichte und dem Zerfall des „ersten Jugoslawien“ geprägt. Dieser Staat, das Königreich Jugoslawien, wurde im Jahr 1918 gegründet und war geprägt von der brutalen und offen antikroatischen Herrschaft der serbischen Karađorđević-Dynastie.
Die beiden wurden nicht mehr Zeugen der Ära, in der nach 1945 das „zweite Jugoslawien“ entstand, dessen Schöpfer Stalins später rebellischer Schüler Josip Broz Tito war. Mile Budak, einst Minister und Botschafter des Unabhängigen Staates Kroatien in Berlin, erlebte dies zusammen mit Hunderttausenden von vermissten und aus Rachsucht ermordeten Kroaten nicht mit, da er bereits im Juni 1945 ohne ordentlichen Prozess hingerichtet worden war, während Pavelić, einst Führer des kroatischen Staates im Krieg, über Italien nach Argentinien emigrierte und nach einer Reihe von Attentaten im Dezember 1959 an den Spätfolgen des letzten Mordversuches in Spanien, wo ihm Francisco Franco Asyl gewährt hatte, starb.
Budak wurde 1945 nicht wegen seiner literarischen Werke hingerichtet, so heißt es zumindest in den erhaltenen Dokumenten, sondern er wurde gehängt, weil er dem Ustascha-Regime gedient hatte. Unmittelbar nach seinem Tod wurden seine Schriften zensiert und verboten, verbrannt und aus Bibliotheken geworfen, sodass die heranwachsenden Generationen von Kroaten weder durch die Lektüre von Büchern noch aus Enzyklopädien etwas über diesen Schriftsteller erfahren konnten. Mile Budak wurde infolge des Urteils eines ad hoc eingesetzten Militärgerichtes ohne ordentlichen Prozess feige hingerichtet, wobei diejenigen, die das Urteil fällten, nicht berücksichtigten, dass es sich um denselben Budak handelte, der unmittelbar nach dem Fall des faschistischen Italien, als sich für Kroatien die geostrategischen Umstände änderten, zum Befürworter der inneren wie äußeren Liberalisierung des Ustascha-Staates geworden war. Budaks Henker durften und wollten im Juni 1945 darauf keine Rücksicht nehmen.
Sie interessierten sich weder für die tatsächliche Biographie des Mannes, der da gehängt werden sollte, noch waren sie an seinem literarischen Schaffen interessiert. Sie hatten nicht im Hinterkopf, dass dieser Schriftsteller nur wenige Jahre zuvor öffentlich für die Freilassung des inhaftierten Vlatko Maček, des politischen Führers der gemäßigten Kroatischen Bauernpartei, eingetreten war. Diese Richter vergaßen, dass es Mile Budak gewesen war, der mitten im Krieg sogar zwei Treffen zwischen dem berühmten kroatischen Schriftsteller Miroslav Krleža und dem Oberbefehlshaber Ante Pavelić organisiert hatte, wobei Pavelić diesem materialistisch und kommunistisch eingestellten Intellektuellen auf Budaks Empfehlung hin einflussreiche Positionen in der Kroatischen Akademie, im Kulturverband „Matica hrvatska“ und an der Universität angeboten hatte.
Auf dem Höhepunkt seiner politischen Macht während des Krieges hatte Budak nichts dagegen, dass ein Gegner des Ustascha-Staates wie der Literaturprofessor Antun Barac 1944 in die Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste gewählt wurde, ebenso wenig wie dagegen, dass der im Konzentrationslager Stara Gradiška inhaftierte Universitätsprofessor Grga Novak eine Zusammenfassung der Geschichte Dalmatiens schrieb, die in künftigen geopolitischen Verhandlungen über die südkroatische Provinz, auf die Italien ein Anrecht zu haben glaubte, verwendet werden sollte. Dies alles hatte für die Militärrichter keine Bedeutung gegenüber der Tatsache, dass Budak Mitunterzeichner einiger Gesetze des Unabhängigen Staates Kroatien gewesen war, der mit dem Deutschen Reich Hitlers verbündet und aus Sicht der Richter dessen Marionette war – wobei ausgerechnet der Schriftsteller Mile Budak eines der schwerwiegendsten Dokumente unterzeichnet hatte, nämlich die „Bestimmung über den Schutz des arischen Blutes und der Ehre des kroatischen Volkes“ vom 30. April 1941.
Es bestand für Budak wenig Hoffnung, nicht auf der Liste der Kriegsverbrecher vor dem Militärgericht in Zagreb zu stehen. Sein Prozess war schon vorüber, noch bevor er begonnen hatte. Aus den erhaltenen Protokollen geht hervor, dass die Anhörung des Angeklagten und die Verlesung des Urteils insgesamt kaum zehn Minuten dauerten und dass der zum Tode verurteilte Schriftsteller bereits im Morgengrauen des nächsten Tages gehängt und sein Leichnam an einem unbekannten Ort begraben wurde. Budaks Zeitgenossen und politische Gleichgesinnte erlebten in vielen Fällen zumindest faire Prozesse vor den Gerichten der damaligen Sieger. So wurde beispielsweise der Architekt Albert Speer, obwohl er Rüstungsminister des Deutschen Reiches gewesen war, lediglich zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt und nach deren Verbüßung im Jahr 1966 freigelassen. 15 Jahre später starb er nach einem Interview mit dem britischen Rundfunk in einem Londoner Hotelzimmer.
Mile Budak besuchte das Gymnasium in Sarajevo und kam dort der nationalistischen Bewegung „Mlada Hrvatska“ („Junges Kroatien“) nahe, die zu jener Zeit deutlich die Ideen der Partei des Rechts und die öffentlichen Reden ihres ehemaligen Führers Ante Starčević vertrat und an die Opfer des Aufstandes gegen die österreichisch-ungarische Monarchie unter Eugen Kvaternik 1871 erinnerte. Die Bewegung hatte in Bosnien und Herzegowina beachtliche Erfolge, vor allem, weil ihre Anhänger sehr erfolgreich mit Muslimen zusammenarbeiteten. Von Sarajevo zog der junge Budak 1910 im Alter von 20 Jahren nach Zagreb. Er schrieb sich an der Philosophischen Fakultät für Geschichte und Geografie ein, begann aber – wie er betonte – aufgrund seiner schlechten finanziellen Verhältnisse bald ein Jurastudium. Als Student war er sehr fleißig, sodass er bereits 1913 als Kanzleischreiber arbeitete. Nach dem Krieg setzte er seine Studien fort und hatte mit seiner Frau Ivanka vier Kinder, von denen der Sohn Branimir kurz nach der Geburt starb, woraufhin der Schriftsteller pessimistisch notierte: „Er hatte genug von dieser Welt, sobald er sie ein wenig gerochen hatte … Es ist sehr schade, dass er so ein kluges Kind ist, aber ihm nicht geholfen werden kann.“
Schon in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hatte der junge Schriftsteller seine ersten politischen Texte verfasst. So schrieb er etwa, dass es nicht gut sei, die Präsenz von Serben in Kroatien völlig zu leugnen, und mahnte seine kroatischen Zeitgenossen zur Vorsicht, da sie zu diesem Zeitpunkt in zwei Staaten ansässig seien und es im Hinblick auf Kroatien eine erhebliche Gefahr darstelle, sich immer zu den offensichtlichsten Feinden der Kroaten zu gesellen. Deshalb ermahnte der junge Mile Budak seine Zeitgenossen: „Die kroatischen Gefühle gegenüber dieser Nation dürfen nicht in Hass und fanatische Intoleranz umschlagen …“ Er behauptete, dass es in allen Gesellschaften, einschließlich jener der Serben, sowohl Schurken als auch ehrliche Menschen gebe.
Der Erste Weltkrieg ging auch an Mile Budak nicht vorüber. Während dieses Krieges geriet er bereits im Dezember 1914 als österreichisch-ungarischer Offizier in serbische Gefangenschaft und zog sich mit der serbischen Armee und ihren Gefangenen nach Albanien zurück. Während er verwundet im Krankenhaus in Valjevo (Serbien) lag, beschrieb er die Erfahrung der Kriegsgräuel in einem sehr wertvollen Memoirenbuch, „Ratno roblje“, das erstmals im Jahr 1941 veröffentlicht wurde. Es beschreibt die langen Leidensjahre des Autors, aber auch, wie er 1915 in italienische Gefangenschaft geriet. Er hielt sich zunächst auf der Insel Asinara unweit von Sardinien auf und wurde dann, nachdem ihm der Rang eines Fähnrichs zuerkannt worden war, nach Muro Lucano verlegt. Budak befand sich bis 1919 in Gefangenschaft, wonach er mit anderen Gefangenen in einem kroatischen Hafen unweit der Altstadt von Dubrovnik landete. Nun erst, nach fünfjähriger Abwesenheit, kehrte er zu seiner Familie zurück.
Was Budaks politische Ausrichtung anbelangt, so kehrte er nach fünf Jahren in der Fremde in das neu geschaffene Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zurück – als entschiedener Gegner desselben und als Verfechter eines unabhängigen kroatischen Staates. Damals, am Ende des Großen Krieges, war er nicht nur unzufrieden mit dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit dem allein er sich noch hätte abfinden können. Was ihn am meisten frustrierte und für seine menschliche und politische Zukunft entscheidend werden sollte, war der Fortbestand eines Staates, in dem den Kroaten der jugoslawische Rahmen aufgezwungen wurde. In Zagreb schloss sich Mile Budak sofort dem damaligen Kulturverein „Matica hrvatska“ an, der seiner Meinung nach den richtigen Rahmen für die Verwirklichung nationaler Interessen darstellte. Für ihn sollte die „Matica hrvatska“ zeitlebens die wichtigste kulturelle Institution sein; er hinterließ darin bedeutende Spuren, da sie alleinige Herausgeberin all seiner Prosawerke war und er in ihren Zeitschriften häufig spezielle literarische und politische Artikel veröffentlichte. Nur weniger Tage nach der Rückkehr in seine Heimat nahm Budak sein Jurastudium wieder auf und schloss es im Juli 1920 mit der Promotion ab. Sein Praktikum absolvierte er bei seinem alten Bekannten Ante Pavelić. Die beiden kamen sich noch näher. Nach drei Jahren Ausbildung und Praxis erlangte Mile Budak das Recht, seine eigene Anwaltskanzlei zu eröffnen.
Zu dieser Zeit engagierte er sich in einer Reihe von Vereinen der damaligen Zeit, natürlich auch in solchen, die die Werte der kroatischen Identität förderten und den Weg zur staatlichen Unabhängigkeit befürworteten. Erwähnenswert ist seine Arbeit im Sportverein „Hrvatski sokol“ („Kroatischer Falke“), der eine Art Unterorganisation der Kroatischen Partei des Rechts war. Es waren die Mitglieder dieses Vereins, die „Hrvatski sokoli“, die den eigentlichen Widerstand gegen den Terror des Belgrader Regimes mit seinen Verbänden organisierten: Sie standen gegen den offiziellen „Jugosokol“ ebenso wie gegen von Belgrad materiell und ideologisch unterstützte Untergrundorganisationen wie die für einen jugoslawischen Einheitsstaat kämpfende Terrorgruppe ORJUNA. „Hrvatski sokol“ war den serbischen Behörden ein Dorn im Auge, weshalb sie den Verein über Nacht verboten, nachdem König Alexander I. 1929 die Diktatur ausgerufen hatte. Zum Zeitpunkt seiner Auflösung hatte „Hrvatski sokol“ bis zu 40.000 Mitglieder, darunter eine Reihe prominenter Intellektueller und Politiker, neben Mile Budak u. a. auch der Vorsitzende der Kroatischen Bauernpartei Vlatko Maček, Ivan Perišić, der Historiker Rudolf Horvat, die Politiker Ivan Krnic und Matej Mintas, der Wissenschaftler Josip Torbar und Hunderte hoch angesehener Bürger, Fachleute und Politiker. Es handelte sich um einen Verein, der Mitglieder aller kroatischen Parteien versammelte und aus verständlichen Gründen aufgrund ihres latenten Souveränismus der Partei des Rechts am nächsten stand. Schließlich waren die 1920er-Jahre genau die Zeit, in der Budak und Pavelić eng verbunden waren, nicht nur, weil sie in juristischen Angelegenheiten zusammenarbeiteten, sondern auch, weil sie ähnliche politische Ansichten hatten. Die Kroatische Partei des Rechts stand stets im Schatten von Stjepan Radić und dessen Bauernbewegung, die im Gegensatz zur Rechtspartei von Pavelić und Budak teilweise mit dem Belgrader Regime kooperierte. Die kroatische Rechtsbewegung war in diesem Sinne unbeugsam, denn für sie waren Jugoslawien und Jugoslawismus keine Option für das kroatische Volk. Ein Jugoslawien – welcher Art auch immer – wurde als ein Gefängnis für die Kroaten angesehen. Doch nachdem Stjepan Radić 1928 während einer Parlamentssitzung in Belgrad niedergeschossen worden und seinen Verletzungen erlegen war, begann sich die politische Szenerie Kroatiens deutlich zu verändern. Dieser Umstand wirkte sich auch auf die politischen Aktivitäten Ante Pavelićs aus und führte schnell zu dessen Emigration sowie geheimer politischer Arbeit, die darauf abzielte, das Belgrader Königsregime mit seiner immer unerträglicher werdenden Gewaltherrschaft zu stürzen.
Mile Budak veröffentlichte damals viel Politisches, doch verschob die Beschäftigung mit Belletristik auf eine andere Zeit, in der er fieberhaft und wie unter Zeitdruck eine ganze Reihe von Romanen und autobiografischen Werken verfasste. In den zehn Jahren vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Budak zu einem der produktivsten und gefeiertsten kroatischen Prosaschriftsteller, der hinsichtlich der Anzahl seiner Texte in der kroatischen Literatur mit den Trivialromanen von Marija Jurić Zagorka verglichen werden kann. Der Unterschied besteht darin, dass Budaks Bücher zum Prosakanon gehörten und von der „Matica hrvatska“ veröffentlicht wurden.
Als 1929 im damaligen Königreich Jugoslawien die Diktatur ausgerufen wurde, unmittelbar nachdem Pavelić das Land verlassen hatte, wurde Mile Budak der prominenteste einheimische Vertreter der damals offiziell verbotenen Kroatischen Partei des Rechts, deren Mitglieder sogar in Abwesenheit angeklagt wurden. In dieser Zeit wurde Budak mehrmals vor Gericht gestellt, er wurde verhaftet und für mehrere Monate inhaftiert. Zu diesem Zeitpunkt begann er mit der Veröffentlichung seiner ersten bemerkenswerten und positiv rezensierten Bücher. So wurden bereits 1931 seine „Ličke priče“ („Geschichten aus der Lika“) veröffentlicht, gefolgt von den Romanen „Raspeće“ („Die Kreuzigung“) und „Na ponorima“ („Über Abgründen“).
Der entscheidende Moment in Budaks Leben ereignete sich, als 1932 drei gedungene Mörder des Königs versuchten, ihn im Zentrum von Zagreb zu töten. Es war am 7. Juni 1932, als sie ihn mitten am Tag in einem Hauseingang niederschossen. Er wurde von den Angreifern mit Eisenstangen auf den Kopf geschlagen und beinahe getötet. Anders als der Historiker Sufflay, der ein Jahr zuvor ebenfalls überfallen worden war, überlebte Budak diesen brutalen Angriff. Da er sich lange Zeit in einem kritischen Zustand befand, veröffentlichte die in Buenos Aires erscheinende Auswandererzeitschrift „Hrvatski domobran“ einen Nachruf auf ihn. Die Attentäter wurden später festgenommen, und ihre Anwälte versuchten vor Gericht, die Schuld kroatischen Patrioten zuzuschieben, die sich mit Feinden des jugoslawischen Staates im Ausland verbündet hätten, womit dieser Mordversuch seine eigene Rechtfertigung gehabt habe. Damals wurde sogar eine Liste von 27 Personen veröffentlicht, die von Agenten des Königs auf ähnliche Weise in Zagreb angegriffen und getötet werden sollten. Budaks Angreifer wurden vor Gericht und in der Öffentlichkeit als wahre Patrioten bezeichnet, daher ist es bemerkenswert, dass einer von ihnen sich 1941 hilfesuchend an Budak wandte, als er in einem Lager landete. Es ist nicht bekannt, wie Mile Budak auf dieses Gesuch reagierte, aber aus den Dokumenten geht hervor, dass der Attentäter seine Inhaftierung auf dem Boden des Unabhängigen Staates Kroatien überlebte. Einige Tage nach seiner Bitte um Entlassung konnte er sich sogar schon in Belgrad in einer sozialen Einrichtung registrieren lassen.
Verwundet, verbittert und außerstande, sein literarisches und politisches Wirken in seiner Heimat fortzusetzen, entschloss sich Mile Budak schweren Herzens zur Emigration. Anders als Ante Pavelić war er nicht bereit für einen illegalen Kampf vom Ausland aus. Im Exil schloss sich Budak jedoch bald den ersten Kämpfern des militanten Pavelić und ihren Geheimverbänden an, zunächst in Deutschland, wo er in Berlin lebte, und dann in Italien, wo er im zweiten Jahr seiner Emigration Leiter eines Ustascha-Lagers auf der Insel Lipari wurde. Er ging Anfang 1933 ins Exil, das etwas mehr als fünf Jahre dauerte, im Besitz eines legalen Passes, den er aufgrund einer Behandlung in Karlsbad erhalten hatte. Man glaubt, dass ihn der große Bildhauer Ivan Mestrovic gegenüber den Belgrader Behörden unterstützt hat. Budak sprach nicht viel über seine Auswanderungspläne. Das ist durchaus logisch, denn schon damals gab es unter den kroatischen Politikern eine Kluft zwischen denen, die sich Ustaschas nannten und einen revolutionären Kampf bis zur vollständigen Unabhängigkeit Kroatiens befürworteten, und denen, die noch der Idee des reformistischen konföderativen Jugoslawien anhingen. Nach Radićs Tod wurden Letztere von Vlatko Maček angeführt, der bei seinem Volk sehr beliebt war und die Kroatische Bauernpartei leitete.
Unmittelbar nach seiner Ankunft in Italien beschäftigte sich Mile Budak intensiv mit propagandistischen und journalistischen Aktivitäten. Er unterhielt enge Beziehungen zu hochrangigen italienischen Ministerialbeamten, vor allem im Bereich der Kultur, da er sich zum Ziel gesetzt hatte, für eine bessere Darstellung und Wahrnehmung des kroatischen Volkes, der kroatischen Kultur, Geschichte und des kroatischen Landes in Italien zu kämpfen. Diese seine Arbeit brachte merkliche und sogar bedeutende Erfolge, zieht man in Betracht, was in Bezug auf die italienisch-kroatischen Kulturbeziehungen in nur wenigen Jahren bis Ende des Zweiten Weltkrieges alles erreicht wurde. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Italien schrieb Mile Budak sein wichtigstes Buch über das politische Leben, „Hrvatski narod u borbi za samostalnu i nezavisnu hrvatsku državu“ („Das kroatische Volk im Kampf für einen selbstständigen und unabhängigen Staat Kroatien“). Das Buch wurde 1934 im amerikanischen Youngstown, Ohio, veröffentlicht. Darin liefert der Autor eine Synthese der kroatischen politischen Geschichte mit besonderem Schwerpunkt auf der jüngsten Zeit. Das Buch wurde zu einem grundlegenden Handbuch für die politische Bildung und Ausbildung von Kroaten in den Ustascha-Lagern in Italien. Zu dieser Zeit wurde Budak – sicherlich nicht ausschließlich, aber auch wegen dieses Buches – zum Hauptverwalter und damit zum ersten stellvertretenden Führer der Ustascha-Bewegung ernannt. Nach Ansicht des damaligen Ustascha-Führers hätte es zwölf dieser Verwalter geben sollen, bezogen auf die zwölf kroatischen Stämme, doch diese ehrgeizige Idee wurde zumindest zahlenmäßig nie verwirklicht. Übrigens war Budaks Wahl zum Kommandeur der Auswanderer-Militärlager aufgrund seines guten Rufs ein völlig logischer Akt. Später, als er von dieser Position abgelöst worden war, wurde sein ideologisches Handbuch zur Ausbildung der Nachkommen kroatischer Emigranten verwendet.
Ende 1933 zog Mile Budak plötzlich von Italien nach Berlin, da man unter den kroatischen Emigranten beschlossen hatte, dass er in Deutschland dringender gebraucht würde. In Berlin verhielt sich Budak weiterhin so, wie er es in Italien begonnen hatte, indem er für die Anerkennung Kroatiens warb. Er und seine Frau lebten ein Jahr lang in Berlin. Dort gab er die halbmonatliche Zeitschrift „Nezavisna Hrvatska Država“ heraus. Einigen Quellen zufolge sollte Budak von Berlin aus nach Amerika reisen und dort seine Propagandaarbeit unter kroatischen Emigranten fortsetzen. Die Idee wurde nicht verwirklicht, da man davon ausging, dass der Autor in Europa nützlicher sei. Anhand des erhaltenen Materials wird deutlich, wie schwierig es war, in Hitlerdeutschland an der kroatischen Sache zu arbeiten. Das Eintreten der Ustascha für demokratische Werte und das Recht des kroatischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit fand zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft keinen Anklang und wurde auch später noch in Kreisen der Machthaber abgelehnt. Bei seinem Prozess in Zagreb 1945 sprach Budak über seinen Aufenthalt in Berlin und erwähnte dabei die sehr dürftigen Erfolge, die er und seine Mitarbeiter erzielten konnten. Dazu stellte er fest, dass die Nationalsozialisten die Kroaten einfach nicht hätten ausstehen können. Das baldige Verbot der Zeitschrift, die Budak in Berlin herausgab, veranschaulicht dies sehr deutlich. Um sein Werk zu bewahren und es vor der Zensur zu retten, war er gezwungen, es fortan in Danzig zu drucken, was möglich war, weil diese Stadt damals eine besondere Autonomie hatte und unter der Verwaltung des Völkerbundes stand.
Vor der Ermordung von König Alexander I. in Marseille im Oktober 1934 rief Ante Pavelić seinen Freund und engen Mitarbeiter Budak dazu auf, dringend nach Italien zurückzukehren. Damit schützte er ihn vor der drohenden Verfolgung durch die deutsche Polizei, die nach dem erfolgreichen Attentat alle kroatischen Emigranten verfolgte. Budak folgte Pavelićs Rat und verließ eilig seine Berliner Wohnung, wobei er kompromittierendes Fotomaterial zurückließ. Die deutsche Polizei, die dieses Material später fand, brachte es mit den Organisatoren der Ermordung des Königs in Verbindung, was perfekt zur Geschichte passte, wonach die Kroaten (und nicht die bulgarischen Nationalisten der IMRO, der der Todesschütze selbst angehörte) bei der Ermordung des Königs federführend gewesen seien. Mile Budak ließ sich mit seiner Frau in Turin nieder, wo zuvor Ante Pavelić mit seiner Familie gelebt hatte.
Unmittelbar nach dem Attentat in Marseille verschärfte sich die Verfolgung kroatischer Auswanderer in ganz Europa. Ihre bislang relativ friedliche Arbeit in Bulgarien und Ungarn war nun unmöglich, eine ihrer Gruppen wurde aus Österreich vertrieben, und zahlreiche kroatische Auswanderer, die bis dahin frei in Italien gelebt hatten, wurden gefangen genommen und auf die südliche Vulkaninsel Lipari deportiert. Budak und andere wurden bei dieser Gelegenheit getäuscht, weil die italienischen Behörden ihnen sagten, dass sie in ihre Heimat transportiert würden, nachdem dort eine Revolution stattgefunden habe. Die Italiener sperrten sie auf der einsamen Insel fernab jeglicher Zivilisation in ein Lager. Dort wurde Budak sofort zum Kommandeur nicht nur dieses Lagers, sondern aller Lager, die sich in Italien befanden, ernannt. Es war ein heikler Moment für die kroatische Bewegung, da Ante Pavelić im Gefängnis saß und Budak gegen seinen Willen zum Führer der gesamten kroatischen Emigrantenbewegung erhoben worden war.
Aus einigen Quellen geht hervor, wie Budak mit seiner Frau und Anhängern der Ustascha-Bewegung in der Kleinstadt Lipari lebte. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass es dem Schriftsteller dabei nicht besonders gut ging. Einige hielten ihn für in seiner militärischen Position zu nachsichtig gegenüber den italienischen Behörden, und so kam es, dass er bereits im Februar 1936 darum bat, von der unangenehmen Funktion des Oberbefehlshabers entbunden zu werden. Sein Antrag wurde zunächst abgelehnt, da Pavelić, der noch im Gefängnis saß, Budaks Bitte nicht nachkommen wollte. Für Mile Budak waren es schwierige Zeiten, vor allem, weil seine Frau Ivka psychische Probleme hatte und die häufigen Trennungen von ihrem Mann nicht ertragen konnte. Aus diesem Grund zog sie in das nahe gelegene Messina, doch dieser Umzug brachte keine Verbesserung für die Familie, da Budak noch einige Zeit lang Kommandeur des Militärlagers auf Lipari blieb und oft abwesend war.
Ante Pavelić wurde im selben Jahr aus dem Gefängnis entlassen und lebte danach eine Zeit lang in Siena. Kroatische Auswanderer erhielten im Februar 1937 erstmals Informationen aus ihrer Heimat über das etwas verbesserte nationale Klima sowie über die ständige Abkühlung der serbisch-kroatischen Beziehungen. Pavelić erklärte sich bereit, Budak von dessen Pflichten als Kommandeur der italienischen Lager zu entbinden. Diese Entscheidung brachte dem Schriftsteller große Erleichterung. Da er nun frei war, zog er bald mit seiner Familie nach Salerno bei Neapel. Budaks sehr fruchtbare literarische Periode begann. Nun konnte er sich ganz der schriftstellerischen Arbeit widmen, und so beendete er in nur wenigen Monaten mehrere große Romane sowie sein sehr wichtiges Buch „Na vulkanima“ („Auf dem Vulkan“), in dem das Lager auf Lipari beschrieben wird. In Salerno vollendete er den dritten und vierten Teil des Romans „Rascvjetana trešnja“ („Kirschbaum in Blüte“) sowie sein Meisterwerk, das wichtigste Buch seines Lebens, den vierbändigen Roman „Ognjište“, den Sie hier in Händen halten.
Die Menge dieser Manuskripte überstieg alles, was zu diesem Zeitpunkt in Kroatien an Literatur entstand. Budak arbeitete in Salerno intensiv und fieberhaft, sodass er in sehr kurzer Zeit die Bücher abschließen konnte, an denen er bereits zuvor gearbeitet hatte. Weiters erreichten ihn immer mehr erfreuliche Nachrichten aus der Heimat, sodass er öfters darüber nachdachte, mit seiner Familie zurückzukehren. Im Gegensatz zu Ante Pavelić war Budak in der Lage, einen solchen Plan zu verwirklichen: Pavelić war von den jugoslawischen Behörden in Abwesenheit zweimal zum Tode verurteilt worden, ein weiteres Mal in Frankreich. Gegen Mile Budak gab es weder Anklagen noch Urteile, sodass seine Rückkehr in die Heimat immer sicherer wurde. Schließlich war er nicht der Einzige, der dorthin zurückkehrte: Bis Anfang 1940 waren bereits 260 Auswanderer aus Italien in die damalige Banschaft Kroatien zurückgekehrt. Den erhaltenen Quellen zufolge verhielt sich Budak damals bewusst passiv gegenüber der Politik.
Aus dieser Zeit sind serbische Polizeiberichte erhalten geblieben, in denen – wenn auch vorsichtig – angedeutet wird, dass Mile Budak nun als Unterstützer der Lösung der Kroatienfrage innerhalb Jugoslawiens bezeichnet werden könne und dass die Öffentlichkeit sogar davon ausgehe, er werde dazu beitragen, engere und akzeptablere Beziehungen zwischen der Regierung in Belgrad und den Kroaten herzustellen. Natürlich waren dies alles nur Gerüchte und falsche Einschätzungen seitens der Polizei, aber Tatsache ist, dass Budak in dieser Zeit, 1938, ein friedlicher Rückkehrer in seine Heimat war, zusammen mit seiner Frau und den Töchtern Grozda und Neda. Sein Sohn Zvonko hielt sich damals in den USA auf. Es ist kein Geheimnis, dass Budak der jugoslawischen Botschaft in Berlin schriftlich versichert hat, sich nach seiner Rückkehr in die Heimat in der Öffentlichkeit gesetzeskonform zu verhalten.
Zunächst einmal hatte Budak Zeit, sich weiter seinen Büchern zu widmen. Gern legte er sie dem Verlag der „Matica hrvatska“ vor, der er seit seiner Jugend treu geblieben war. Es war die fruchtbarste Zeit seines literarischen Schaffens, die Zeit, in der seine wichtigsten Werke veröffentlicht wurden und er sehr positive Kritiken der wichtigsten kroatischen Kritiker erhielt. Nachdem er nach Zagreb zurückgekehrt war, engagierte sich Budak trotz seiner Versprechungen gegenüber den Behörden sofort wieder im politischen Leben, gründete die Wochenzeitung „Hrvatski narod“ („Das kroatische Volk“) und widmete sich darüber hinaus mit größter Sorgfalt dem Druck seiner bereits geschriebenen oder gerade fertiggestellten Werke. Nach seiner Rückkehr druckte die „Matica hrvatska“ in vier Bänden seinen Roman „Ognjište“. Täglich trafen positive Bewertungen von Budaks literarischer und redaktioneller Arbeit ein. Der angesehenste kroatische Literaturkritiker seiner Zeit, Ljubomir Maraković, schrieb unter anderem, dass Budak mit seinen Lebensidealen versuche, den rechten christlichen Glauben hervorzuheben. Erzbischof Alojzije Stepinac selbst, ein späterer Märtyrer, schrieb 1940 in seinem „Dnevnik“ („Tagblatt“), dass die „Hrvatski narod“ von Budak glücklich mache, weil daraus offenbar der gute Wille und die Frömmigkeit des Schriftstellers gegenüber dem Glauben der Väter hervortrete. Natürlich hielten Budaks serbische und jugoslawische Feinde nicht still, weshalb die Zensurbehörden die „Hrvatski narod“ kurzerhand verboten, und mehr als ein Jahr vor Kriegsausbruch wurde Mile Budak auch festgenommen. All dies war eine direkte Folge seiner Ansichten zu den aktuellen Fragen der kroatischen Souveränität und hing unter anderem mit seiner Kritik an der Kompromisspolitik von Stjepko Maček und der Kroatischen Bauernpartei zusammen. Darüber hinaus gab es auch Streitigkeiten über Budaks sehr scharfe und unverhohlene Ansichten zu Bosnien und Herzegowina, die er im Geiste der Partei des Rechts als zweifellos kroatisches Territorium ansah, während serbische Ansprüche auf diese Gebiete Anlass zu Meinungsverschiedenheiten und unerträglichem Säbelrasseln waren. Während Budak vor Kriegsbeginn in einem jugoslawischen Gefängnis saß, wurde seine Frau Ivka am 11. April 1940 tot im Brunnen des Weinbergs der Familie Budak aufgefunden.
Als dem Schriftsteller diese tragische Nachricht überbracht wurde, entließ man ihn aus dem Gefängnis, um die Tote ein letztes Mal zu sehen. Die Beerdigung von Budaks Frau war ein großes Ereignis und wurde von vielen Menschen besucht, die das Opfer der Familie Budak für die kroatische Sache im Kampf um die nationale Unabhängigkeit respektierten. Obwohl es keine ernsthaften Beweise gab, glaubte die Öffentlichkeit, dass Budaks Frau ermordet worden sei. Ihr Tod war sicherlich ein gewaltsamer und stand zweifellos im Zusammenhang mit der Inhaftierung ihres Mannes, dem schwierigen Leben der Familie im Exil und den Verfolgungen, die diese kroatische Schriftstellerin erlebt hatte und über die die Weltpresse mehr als einmal schrieb.
Die Zeit, die dem Erscheinen dieses Schriftstellers in der kroatischen Literatur unmittelbar vorausging, war durch die Veröffentlichung von Werken gekennzeichnet, die auf neue Tendenzen hindeuteten. Dies betraf vor allem das einflussreiche Werk von Antun Gustav Matoš, seine fantastische Prosa, Kritiken und Gedichte, sowie die rebellischen Verse, Geschichten und Theaterstücke von Janko Polić Kamov, dann auch noch Belletristik und Poesie von Fran Galović. Alle drei Autoren waren offen für avantgardistische Veränderungen, überlebten den Ersten Weltkrieg jedoch nicht. Matoš starb 1914 im Alter von 42 Jahren, Kamov als Exilant in seinen Zwanzigern in Barcelona, und Galović wurde schon in den ersten Tagen des Großen Krieges von einer serbischen Kugel getötet. In den 1920er-Jahren kam es zu einer deutlichen Politisierung des literarischen Lebens, wobei damals vor allem projugoslawisch orientierte Schriftsteller aggressiv agierten. Jüngere Autoren hatten einen starken Einfluss auf die poetischen und ideologischen Prinzipien des großen Bildhauers Ivan Meštrović und die Werke der etwas älteren bedeutenden Schriftsteller Ivo Vojnović und Vladimir Nazor, die gerade zur Zeit der Gründung des jugoslawischen Staates tätig waren. Die Poetik stimmte mit der Moderne überein und belebte Themen aus der slawischen Mythologie. Einer solchen Entwicklung literarischer Möglichkeiten, die der serbischen Hegemonie und den Tendenzen, die die kroatische Identität erstickten, nicht angemessen standhielten, leistete ein Teil der Schriftsteller im neuen südslawischen Staat immer noch Widerstand und verweigerte die unitären Strömungen und versteckten Vorstellungen von Großserbien. Unter ihnen, und sie waren eine Zeit lang in der Minderheit, war Mile Budak. Erst 1928, als Stjepan Radić im Belgrader Parlament getötet wurde, begannen sich sowohl die literarischen als auch die politischen Richtungen zu radikalisieren. In Zagreb scharte sich eine bedeutende Gruppe souveräner Autoren um die „Matica hrvatska“, während die von der Gesellschaft kroatischer Schriftsteller herausgegebene Zeitschrift „Savremenik“ auf ihren Seiten Vertreter verschiedener Generationen und oft gegensätzlicher poetischer und sogar politischer Ausrichtungen versammelte. Der einflussreichste und beste kroatische Literat der politischen Linken zu dieser Zeit war Miroslav Krleža. 1923 gründete er die einflussreiche Zeitschrift „Književna republika“, die führende linke Schriftsteller zusammenbrachte, Autoren, die die Herrschaft des Königs in Jugoslawien scharf kritisierten, aber nationale Gleichheit und die Beseitigung sozialer Ungerechtigkeiten befürworteten.
Nach dem Tod von Radić und der Einführung der Königsdiktatur wuchs unter kroatischen Schriftstellern das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer nationalen Homogenisierung und eines verstärkten Widerstandes gegen die großserbische Hegemonie. So wurde die „Matica hrvatska“ zum Zentrum literarischer und intellektueller Zusammenkünfte. Diese Arbeit wurde von katholisch orientierten Schriftstellern dominiert, denen Budak nahe stand, aber auch kommunistische Schriftsteller wie Miroslav Krleža und August Cesarac wurden zumindest zeitweise einbezogen. Sie versuchten, zusammen mit dem kommunistischen Internationalismus das Nationalbewusstsein zu stärken. Die von der „Matica hrvatska“ herausgegebene Zeitschrift „Hrvatska revija“ wurde zur zentralen kroatischen Literaturzeitschrift und vereinte wie „Savremenik“ die besten kroatischen Schriftsteller aller Richtungen. Die führenden katholischen Intellektuellen dieser Zeit waren Ivo Lendić, Ljubomir Maraković, Mate Ujević, Petar Grgec, Dušan Žanko und Vinko Nikolić. Sie befürworteten einen politischen Konservatismus auf der Grundlage religiöser und familiärer Werte und die Bekräftigung der kroatischen kulturellen Identität. Aus diesem Kreis kam es zu heftigen Polemiken nicht nur gegenüber der linksorientierten kroatischen Intelligenz unter der Führung des bereits erwähnten Miroslav Krleža, sondern auch gegenüber liberal-freimaurerischen bürgerlichen Zirkeln. Für die damalige kroatische Literatur war es eine Rettung, dass Krleža die normative Konzeption der sozialistisch-realistischen Literatur ablehnte und mit den Kritikern der sozialen Zustände auf breiterer jugoslawischer Ebene in Konflikt geriet. Die Bedeutung der damaligen europäischen Gesellschaftskritik hatte einen starken Einfluss auf alle Gruppen der kroatischen Literatur, sodass neben der Existenz modernistischer Tendenzen, die auf dem deutschen Expressionismus und dem italienischen Futurismus basierten, immer noch eine Rückkehr zur realistischen und naturalistischen Art des Geschichtenerzählens vorherrschte, mit Interesse an den Schichten des Volkes, die in ländlichen Gegenden lebten, und an den Armen aus den Städten. Die meisten Prosaautoren folgten dieser Tendenz, etwa Slavko Kolar, Mihovil Pavlek Miškina, Ivo Kozarčanin und viele der katholischen Schriftsteller. Trotz seiner prinzipiellen Ablehnung der normativen Poetik dieser Literaturgattung zeigte Miroslav Krleža ein Interesse an Themen, die soziales Elend widerspiegelten, an den Befindlichkeiten entrechteter Klassen, was zur Entstehung eines außergewöhnlichen Gedichtes führte, „Balada Petrice Kerempuha“ aus dem Jahr 1936. Der vorherrschende literarische Stil in Kroatien war damals der synthetische Realismus.
Die Gründung des Unabhängigen Staates Kroatien weckte bei kroatischen Schriftstellern Hoffnungen auf den Sturz des monarchistischen Jugoslawien. Diese Vision setzte auf allen Ebenen viel kreative Energie frei, doch herrschte bald Enttäuschung, da das Ustascha-Regime nicht souverän und von den Achsenmächten abhängig war. Viele kroatische Schriftsteller gaben sich mit den Themen der nationalen Befreiung zufrieden, doch sehr schnell wurden repressive Maßnahmen ergriffen. Wichtige Schriftsteller wie August Cesarec, Mihovil Pavlek Miškina und Otokar Keršovani wurden getötet, sodass es zu einer gewissen Distanzierung einiger Schriftsteller vom Regime kam. Dies nahm immer mehr zu, und es kam zum Überlaufen des berühmten Schriftstellers Vladimir Nazor zu den Partisanen, dem sich der junge und sehr nationalbewusste Ivan Goran Kovačić anschloss. Allerdings gab es in der Ustascha-Führung umsichtige Personen, die erkannten, dass sie die Unterstützung eines Teils der Schriftsteller verloren, und so versuchten sie, die unentschlossenen Autoren zurückzugewinnen, während sie gleichzeitig eine starke Verlagstätigkeit organisierten. Während des Zweiten Weltkrieges wurde quantitativ und qualitativ viel veröffentlicht, besonders repräsentative Anthologien von Gedichten und Prosa; auch die Veröffentlichung der sehr wertvollen „Hrvatske enciklopedije“ („Kroatische Enzyklopädie“) wurde fortgesetzt.
Der führende Dichter der Zwischenkriegszeit, der Zeit von Budaks intensivstem Schaffen, war der einsame Tin Ujević mit seinem gigantischen poetischen Oeuvre. Neben ihm etablierte sich in der Literatur der bosnische Kroate Ivo Andrić. Als hervorragender Prosaschriftsteller sprach er öffentlich über seine untrennbare Verbindung zur serbischen Literatur. Sein Werk gehört jedoch organisch zur zentralen Strömung der kroatischen Literatur und macht ihn zum besten Schriftsteller seiner Zeit. Ivo Andrić war ein Virtuose im Ausdruck mit einem ausgeprägten Sinn für die psychologische Analyse, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr er weltweit große Anerkennung und erhielt den Nobelpreis für Literatur. Es sollte gesagt werden, dass bei den brutalen Liquidationen der Nachkriegszeit, die von den Kommunisten unter der Führung von Josip Broz Tito aus Rache an den Kroaten durchgeführt wurden, viele kroatische Schriftsteller starben, während eine beträchtliche Anzahl ihre Arbeit in der Emigration fortsetzte. In dieser Zwischenkriegszeit hat auch Mile Budak, dessen literarisches Schicksal stark von der Politik geprägt war, Raum für seine Motivation gefunden, was sicherlich paradox ist: Er behandelte in keinem seiner Romane oder Kurzgeschichten politische Inhalte, und es gab auch keine Fälle, in denen in seiner künstlerischen Prosa Politik in irgendeiner Weise erwähnt wurde.
Als im April 1941 der Unabhängige Staat Kroatien ausgerufen wurde, wurde dieser Schriftsteller, Rechtsanwalt und Militärbefehlshaber erneut der engste und einflussreichste Mitarbeiter von Ante Pavelić, dem neu ernannten ersten Mann im neuen Staate. Budaks literarisches Werk hatte schon damals weder direkten noch indirekten Bezug zur teilweise intoleranten politischen Agitation. Dem Schriftsteller werden mehrere rassistische und nationalistische Ausbrüche in dieser Kriegszeit vorgeworfen, die glücklicherweise weder authentisch noch dokumentierbar sind. Einer der direktesten Sätze dieser Art, die ihm zugeschrieben werden, ist der, mit dem er die aufständischen Serben öffentlich verteufelt haben soll: So sagte er angeblich, dass ein Teil der Serben getötet, andere vertrieben und der dritte zum katholischen Glauben konvertiert und somit als Kroaten anerkannt werden sollte. Während des Krieges lebte Mile Budak unfreiwillig zwischen der Welt des Rechtes und der Ordnung und der Welt des Terrors. Er war nicht nur ein berühmter Schriftsteller, sondern auch im Herzen ein Revolutionär, so glaubte er an den Messianismus der Ustascha-Bewegung, der er angehörte und die sein Lebensschicksal bestimmte. Mit seiner Visionalität stand Mile Budak der Mehrheit der damaligen europäischen Verfechter der „Blut-und-Boden“-Literatur nahe, wobei er in seinen eigenen Texten am deutlichsten die Poetik und Ideologie der Katholischen Aktion vertrat, die zu seiner Zeit in Italien und Frankreich als am weitesten verbreitet galt. Er glaubte aber gleichzeitig, dass der Staat immer wichtiger sei als der Einzelne. Für Budak wie für die gesamte Ustascha entstand der Staat nicht aus den in ihm lebenden Individuen, sondern die Individuen waren „Gefangene“ des Staates und hatten ihm zu dienen – ein klarer Widerspruch zur vorgeblich katholischen Ausrichtung der Bewegung. Für Budak entsprang der Staat nicht aus einem Gesellschaftsvertrag zwischen Menschen, er war vielmehr ein spirituelles Prinzip, das durch die Identität des Führers, durch seine Rolle als Messias bei der Erlangung der Freiheit erreicht wurde. Budak wollte glauben, dass das nationale Recht über allen anderen Rechten stehen und die gesellschaftliche Moral an der Religion ausgerichtet sein sollte.
Während er politische Ideen präsentierte, kam er vom Weg ab, als er Rassenprinzipien unbegründet mit den religiösen Lehren des Katholizismus verband. Als Schriftsteller verwendete er Ideen und Themen, die von den Ideologen des europäischen Katholizismus übernommen waren. Während er sich in seiner literarischen und publizistischen Arbeit nicht eindeutig positionierte, suchte er seine Nähe zur katholischen Bewegung ausgerechnet durch die Mitarbeit am faschistischen Regime zu bekräftigen. Darüber hinaus vertrat er Meinungen, die später als kommunistisches Anklagematerial verwendet wurden, nicht nur im Prozess gegen ihn, sondern auch im inszenierten Prozess gegen den Erzbischof von Zagreb und späteren Kardinal Alojzij Stepinac. Budak sprach mit Leichtigkeit über Religion, wenn er über Politik sprach, und über Politik, wenn er über Religion sprach. In seinen Romanen herrschte ein lebhafter romantischer und idealistischer Nationalismus, der sich sicherlich auch aus Theorien über Blut und Boden speiste, wobei seine Texte die Mängel von Liberalismus und Kommunismus in Bezug auf Zivilisation, Öffentlichkeit und Politik fokussierten.
Mile Budak besaß in seinen Romanen ungewöhnliche Weisheit, aber auch hingebungsvollen Enthusiasmus. Seine Popularität drängte Miroslav Krleža in den Hintergrund. Nach 1930 drängte er mit Orkangewalt in die kroatische Literatur, und von da an erschien fast jedes Jahr ein Buch: zuerst 1930 „Pod gorom. Ličke priče“, 1932 dann „Raspeće. Zapisci jednog malog intelektualca“ und „Nad ponorima“ sowie 1933 „Opanci dida Vidurine. Ličke novele“.
Budaks Erzählwerk besteht aus 16 Titeln, veröffentlicht in 25 Büchern. Die Grundlage dieses Prosawerkes ist der große Roman „Ognjište“, den Sie in Ihren Händen halten, der eine Geschichte aus dem Leben in der Lika enthält und dessen Rückgrat eine fatale Dreiecksbeziehung ist. Das heimische Lika-Thema findet sich auch in den genannten Kurzgeschichten- und Novellensammlungen sowie in einem Band des Romans „Vučja smrt“ („Tod eines Wolfes“).
„Ognjište“, Budaks berühmtestes Buch, wurde zu Recht mit dem vierbändigen Roman „Chłopi“ („Die Bauern“) von Władysław Reymont verglichen. Letzteres Buch wurde 1909 fertiggestellt, später wurde es in Polen mit dem Phänomen der Chlopomanie in Verbindung gebracht, also der politischen und literarischen Verherrlichung des Dorfes und des bäuerlichen Volksbewusstseins. „Ognjište“ ist ein neorealistischer und sozialpsychologischer Roman, und wie in Reymonts „Die Bauern“, der in Kroatien sehr beliebt war, erzählt Budak geradlinig und präzise eine Geschichte über die Liebe und die inneren Konflikte einer Frau namens Anera und der Männer um sie herum. Im Zentrum der Geschichte erzählt er – meist in Form des Dialoges – das Schicksal des aus Amerika zurückgekehrten Blažić, eines Kriminellen und Oberhauptes einer Stammesgenossenschaft (Zadruga). Dieser ist vor allem ein wütender Lüstling, der nur Aneras Körper haben will. Auch der während des Krieges verschwundene Sohn des Rückkehrers, Mića, hatte sich sich in die unberührte Anera verliebt, was seinen kriminellen Vater zusätzlich reizt, der Witwe seines Sohnes näherkommen zu wollen. Anera stellt sich mit allen Mitteln gegen den alten Blažić, der auch auf den Widerstand des erhabenen Dorfmärtyrers Lukan stößt, der zum einzigen Halt in Aneras Leben wird. Im Gegensatz zueinander werden Blažić und Anera beschrieben: Sie als unschuldige und religiöse Frau, er als Mann, der seine Leidenschaft weder kontrollieren kann noch kontrollieren will. „Ognjište“ ist eine belletristische Bejahung der Theorie über die Vererbung bestimmter Merkmale der Vorfahren, ein Roman über die ethische Physiologie des Menschen und ein in einem archaischen Dialekt geschriebenes Buch, durchdrungen von zahlreichen folkloristischen Exkursen, aber auch Anklängen an die Lektüre Dostojewskis mit seinen dämonischen Männern und tödlichen Frauen. Am Ende des Romans tötet Lukan Blažić, nachdem dieser Anera vergewaltigt und ermordet hat. Lukans Tat wird als rechtschaffener Racheakt dargestellt.
Mile Budak ist ein epischer Geschichtenerzähler, der es beim Erzählen nicht eilig zu haben scheint und daher in der allegorischen Welt seines Romans nicht dem Lauf der Geschichte folgt, das heißt: Lineare Zeit existiert nicht. Alles hier ist zyklisch und mythisch und gehört zu einer erhabenen Liturgie von Worten und Taten. Die Handlung ist nur scheinbar nicht komplex, sie spielt in einem begrenzten und sehr homogenen Raum, und auf allen Seiten dieser Langprosa hält sich eine sehr starke Spannung.
Nach seiner eigenen Aussage schrieb Budak den Roman „Ognjište“ in nur zwei Monaten während seines Aufenthaltes in Salerno, nicht weit von Neapel, im Jahr 1937, während er wartete und nach Möglichkeiten suchte, mit seiner Frau in die Heimat zurückzukehren. Es war für diesen gequälten und ohnehin schon müden Mann eine entscheidende Zeit.
In Salerno wurde er von allen politischen Verpflichtungen und Pflichten entbunden, und die damaligen jugoslawischen Behörden versuchten, ihm über geheime Kanäle mitzuteilen, dass er nach seiner Rückkehr nach Zagreb in Sicherheit sein würde. Für sie hatte dieser kroatische Schriftsteller nur eine Bedingung: Die Veröffentlichung seines Romans „Ognjište“, den er bereits 1938 bei der „Matica hrvatska“ zum Druck einreichte, sollte nicht verboten werden.
Zu dieser Zeit traf sich Budak, wie einige Quellen bestätigen, auch mit dem angesehensten kroatischen Politiker seiner Zeit, Vlatko Maček, und dieses Treffen führte zu ihrer persönlichen und politischen Entfremdung. Zwischen den beiden Männern stand, dass Maček, der die stärkste und größte kroatische Partei leitete, die Föderalisierung von Kroatien in einem zukünftigen reformierten Jugoslawien als das politische Maximum ansah. Mile Budak hingegen konnte keinem Jugoslawien jedweder Art zustimmen. Ohne jede Kompromissbereitschaft trat er für eine souveräne kroatische Politik und die Unabhängigkeit seines Heimatlandes ein. Während seines Aufenthaltes in Italien traf sich Budak einigen Quellen zufolge auch am Comer See mit dem führenden serbischen Politiker Milan Stojadinović. Über dieses Treffen sind unvollständige Polizeiberichte erhalten geblieben, aus denen hervorgeht, dass die damaligen serbischen Behörden den Anteil Ante Pavelićs an der Ustascha-Bewegung genau von dem Anteil Mile Budaks an dieser Bewegung unterschieden. Aus dieser Dokumentation geht auch klar hervor, dass Pavelić der wahre Anführer der Ustascha-Bewegung war, fast alle Entscheidungen allein traf, und dass Budak mit seinem Handeln oft nicht einverstanden war. Nachdem dieser mit seiner Familie nach Kroatien zurückgekehrt und sein „Ognjište“ veröffentlicht worden war, der großen Zuspruch fand, gründete er die Zeitschrift „Hrvatski narod“. Er arbeitete weiter an der Organisation der antijugoslawischen Bewegung unter den Kroaten. Die Zeitschrift, die er gegründet hatte, beschäftigte ihn völlig, und so sagte er gleich nach Erscheinen der ersten Ausgabe begeistert, dass er auf diese Zeitschrift ebenso stolz sei wie auf seinen „Ognjište“.
Die Kritiken, die der Roman „Ognjište“ erhielt, waren durchweg positiv. Es wurde viel über den Autor und sein Werk geschrieben, es wurde mit Sympathie geschrieben. Der Kritiker und Autor historischer Romane Josip Horvat, der Budak weltanschaulich nicht nahe stand, nannte das Werk die „Ilias der Lika“, weil es ihn auch ohne Hexameter an Homer erinnerte. Dieser Kritiker betonte die ursprüngliche Einfachheit von Budaks Prosa und lobte gleichzeitig seine Fähigkeit, die Charaktere hervorragend zu charakterisieren. Besonders beeindruckte ihn, dass der Autor in seiner Erzählung auf Künstlichkeit verzichtete, er schätzte seine Dialoge und die hervorragenden, von Homer inspirierten Metaphern. Dušan Žanko, ein Wissenschaftskritiker, der Budak ideologisch sehr nahe stand, betonte die Fähigkeit des Autors, die zitternde Emotionalität seiner Figuren einzufangen und den Lesern das Gefühl zu vermitteln, dass sie durch die Lektüre dieses Buches einer tieferen Ebene des Lebens näher kämen, die vom Schmerz gereinigt ist, einer Welt, in der alles wie in einem Herd glüht und vom ursprünglichen, göttlichen Licht erleuchtet wird. Ante Bonifačić, damals der herausragendste kroatische Kenner der französischen Literatur, erklärte Budaks Roman zum besten Werk der kroatischen Literatur überhaupt. Und in der Tat gilt „Ognjište“ seit seinem Erscheinen am Horizont der kroatischen Leser als Kultwerk. Die vier Bände dieses Romans sind zum Synonym für Budaks Namen geworden. Wenn der Name Budaks ausgesprochen wird, denken meist alle sogleich an „Ognjište“. Und wenn man „Ognjište“ sagt, denken alle an Budak. „Ognjište“ ist das repräsentativste Werk dieses Schöpfers. Es ist ein Beweis für seine außergewöhnliche Virtuosität, seine epische Stärke und seine hoch entwickelten Gestaltungs- und Erzählfähigkeiten. Im Jahr seines Erscheinens veränderte „Ognjište“ das Gefühl für die Integrität der zeitgenössischen kroatischen Literatur positiv, in dessen Mitte sich ein riesiges romanhaftes Gebilde befand, das an große Einheiten erinnerte, die eher zum 19. Jahrhundert als zu dieser Zeit gehörten und in der damaligen kroatischen Literatur selten waren.
Mile Budak hat seinen Roman als Drama geschrieben. Der Aufbau ist so gestaltet, dass alle Elemente funktionieren und in einem dynamischen Verhältnis zueinander stehen. Dementsprechend verfügt das Werk über eine leicht erkennbare dramatische Struktur, und es ist kein Zufall, dass es nur wenige Jahre nach seiner Veröffentlichung für die Bühnenaufführung umgearbeitet wurde. Die Dialoge des Romans sind prägnant und scharf, eindringlich, mit der Funktion, Urgefühle zu fördern, einfach und erleichtern die Kommunikation mit dem Leser. Sie enthalten ein undurchschaubares, mehrdeutiges, dichtes Geflecht, in dem psychologische und semantische Nuancen dominieren. Budaks „Ognjište“ ist ein sozialpsychologischer Roman, ein monumentales Fresko, eine Art Saga, die wie eine mittel-alterliche Geschichte über Leben und Schicksal mehrerer Generationen zweier Familien anmutet. In diesem Lebensraum wollen sämtliche Figuren unter allen Umständen ihr Leben bewahren, ihre Abstammung und die Kontinuität ihrer Familiengenossenschaften. Die Feuerstelle ist die zentrale Metapher, der Herd ist das Zentrum der Geschichte, die Idee, die alles bestimmt. Alle Schicksale und alle Orte werden von der Feuerstelle bestimmt. Aus dieser Tatsache baut Mile Budak die ethische Dimension seiner Geschichte auf, denn um das Feuer des Herdes zu bewahren, die Nachwelt zu sichern, oder besser: um den metaphysischen Kreislauf der Existenz zu gewährleisten, handeln die Figuren innerhalb ihrer geschlossenen Gemeinschaft – auf eine Weise, die nicht immer mit dem geltenden Gesetz übereinstimmt. Die Moral im Roman ist instinktive Moral, sie entsteht in Situationen, die übertrieben, exzessiv sind, und deshalb sind die Lösungen unerwartet. Angesichts der üblichen Sicht auf die Welt werden diese Handlungen der Menschen zumindest relativiert. Aus diesem Grund können Budaks Figuren in „Ognjište“ keine moralischen Übertretungen begehen, da ihren Handlungen eine starke Intuition vorausgeht. Dadurch entsteht in der Welt von „Ognjište“ ein ungewöhnlicher Moralkodex, den selbst tragische Ereignisse nicht infrage stellen können. Der Leser dieses Buches wird darauf vorbereitet, die beschriebenen Taten zu verurteilen, er wird sich nicht dazu bereit erklären, das Verbrechen zu rechtfertigen, noch wird er die Befleckung rechtfertigen. Nichts davon führt aber dazu, dass die Welt dieses Romans von Rassen bzw. Rassismus dominiert wird. Rationalität gibt es weder in der Geschichte noch in den Charakteren. Dort regieren nur Leidenschaften und Instinkte, die Menschen werden vor allem von dem Drang geleitet, im Kampf ums Überleben um jeden Preis die Feuerstelle zu bewahren. Gerade deshalb geht dieser Roman angesichts seines mythologischen Potenzials über den Rahmen realistischer Prosa hinaus und problematisiert die für das Überleben der menschlichen Gemeinschaft wichtigsten Kategorien, die ihre Funktion verloren haben. Alles in allem ist Budaks „Ognjište“ ein Roman des dynamischen Vitalismus, in dem ein besonderer Wert auf der Fähigkeit des Schriftstellers liegt, die psychologischen Abstürze und Irrwege der Charaktere aufzuzeichnen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Budaks Lektüre, die einige Schichten dieser Prosa maßgeblich beeinflusste, Dostojewskis Romane und Nietzsches Schriften waren. Budak nimmt die Natur ebenso vitalistisch wahr wie die menschliche Seele.
Über den beiden gegensätzlichen männlichen Figuren erhebt sich die Figur der wunderbaren Frau Anera. Sie ist die einzig wahre Heldin dieser prägnanten Prosa, das Zentrum der dörflichen Welt. Mit moralischer Stärke erhebt sich Anera über ihre enge und begrenzte Umgebung, in der sie schließlich getötet wird. Die unschuldige Anera ist das Opfer eines gigantischen Kampfes zwischen Gut und Böse, eines Aufeinandertreffens blinder Leidenschaft und reiner Güte. Budaks „Ognjište“ erzählt seine Geschichte mit einer Intensität, die auf keiner Seite nachlässt. Der Autor schafft es auf unglaubliche Weise, die Magie des Geschichtenerzählens in seiner persönlichen Saga zu bewahren, sodass er nie einen Faden seiner Erzählung verliert, ebenso wenig wie die zentrale Idee, die außerhalb der üblichen Moral liegt und auf die er im Verlauf des Komponierens zurückkommt. Während Budaks Zeitgenossen, die Autoren ähnlicher Freskenromane, in ihren Schöpfungen die Figuren nebeneinander stellen, wird die Welterfahrung des kroatischen Schriftstellers vertikal dargestellt. Ganz oben steht Aneras reines Opfer, ganz unten Blažićs zuvor aufgezeichneter mythischer Sturz, der Untergang, der ihm vorherbestimmt war, noch bevor die Geschichte über ihn überhaupt begann. „Ognjište“ ist eine Erzählung über eine Welt, an der die Geschichte vorbeigegangen ist, eine Welt, die von Archetypen, also Grundursachen und einigen unsichtbaren Fremden, bestimmt wird. Sie versammelt sich um den Herd wie um ein prähistorisches Steinmonument, um den heiligen Ort und Gott und Moral und Schicksal, um das Feuer als zentralen Punkt der Vitalität dieser Gemeinschaft, dem alle moralischen Prinzipien untergeordnet sind.
Zu der Zeit, als „Ognjište“ gedruckt wurde, war Mile Budak dabei, mehrere weitere seiner großartigen Romane fertigzustellen und für den Druck vorzubereiten. Ein besonders komplexes Romangebilde sind die Romane über die Familie Kresojević. Von den sechs geplanten Romanen schrieb er nur drei, nämlich die Bände „Kresina“, „Gospodin Tome“ und „Hajduk“. Diese Reihe ist eine Art Ergänzung zu „Ognjište“. Sie ist nämlich ein weiterer Teil der Lika-Epos-Reihe, einer langwierigen Darstellung des Kampfes der Lika-Grenzsoldaten. Ausländische Offiziere behandeln sie gewalttätig und missachten nicht nur ihre Grundrechte, sondern auch ihre Menschlichkeit und Würde. Angesichts all des Drucks, dem die Charaktere im Roman ausgesetzt sind, fühlen wir uns in sie hinein als in diejenigen, die das Recht auf Leben haben. Am Ende erkennen sie, dass der Staat, die ausländische Militärregierung, kein einziges Recht für sie anerkennt, weder das Existenzrecht noch die Rechte in der Gesellschaft. Sie rebellieren, weil sie verstehen, dass das Volk nicht einfach Opfer bringen kann, für die es nur Undankbarkeit zurückerhält.
Dieses Wissen und diese Emotionen wecken in den Figuren das Bedürfnis, in Zukunft nicht nur für sich selbst und ihre Familien, sondern auch für ihr kroatisches Volk zu arbeiten. In diesem Romanzyklus spricht Mile Budak direkter über nationale Gefühle als in „Ognjište“, aber er verliert kein Wort über Politik oder herrschende Ideologien.
Allerdings erzählen nicht alle Romane Budaks Geschichten über das Dorf und das Dorfleben. Mehrere seiner großen Werke behandeln Themen aus dem Leben in Zagreb. Sie sind von den Themen und Mythen des Landlebens befreit und kommen so gattungsmäßig in Kontakt mit der feuilletonistischen und trivialen Literatur der Zeit. Budaks urbanes Oeuvre wird dominiert von dem großen, in vier Bänden gedruckten und komponierten Roman „Rascvjetana trešnja“ von 1939, in dem der Autor sein Thema mit zahlreichen Überlegungen und Dialogen darstellt, die Zeitungsaufsätzen und Feuilletons entnommen zu sein scheinen.
In „Ognjište“ sieht man Budaks solide Erzählkunst, die in allen Abschnitten die Meinung des Autors widerspiegelt. „Rascvjetana trešnja“ ist ein weiterer kroatischer Roman aus dieser Zeit, der der Vorliebe des Autors für erfundene, fiktive Dinge zu unterliegen scheint. Mit dem gleichen Thema, dem Leben in der Stadt, beschäftigte sich der Autor in dem 1938 erschienenen Roman „Direktor Križanić“, der den Untertitel „Patriot und Wohltäter“ trug.
Budak beschreibt einen städtischen Konformisten und Wucherer, einen typischen schleimigen Pfennigfuchser. Die Hauptfigur Micek Križanić ist ein Spiegelbild der Pathologie der Zeit und der Menschen, die in dieser Zeit lebten. Als angeblicher Patriot und falscher Wohltäter gehört er zu den Menschen, durch die sich die gesamte politische Landschaft Kroatiens in entscheidenden Zeiten, in denen es darum ging, ehrlich und gerecht zu handeln, in einen Sumpf verwandelte.
Ein weiterer Teil von Budaks Prosa ist autobiografisch und wird von Memoiren aus der serbischen Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg dominiert. Es gibt das Buch „Ratno roblje“ („Kriegsgefangene“) und dann den Roman „Na vulkanima“, der von der politischen Reifung des Schriftstellers in jener Zeit, als er Kommandant des Ustascha-Lagers auf Lipari war, zeugt. Der 1941 erschienene Roman „Na vulkanima“ ist eine politische Allegorie, eine fast unwirkliche Geschichte über ein Lager, über einen gefährlichen und nur in Träumen erkennbaren Vulkanboden, über eine Anomalie im Weltraum, in der Janko, offenbar das Alter Ego des Schriftstellers, zukünftige Soldaten trainiert und sie auf den Kampf für hohe politische Ziele vorbereitet. Ihm steht ein finsterer und sehr abstrakter Gegner gegenüber, ein gewisser Stožina, der Unruhe unter die Kämpfer bringt. Die Ursache aller Schwierigkeiten auf dem Weg zur Verwirklichung heiliger politischer und militärischer Ziele ist eine tödliche Frau, Marialba, die barocken Romanen entnommen zu sein scheint. Im selben Jahr wie „Na vulkanima“ veröffentlichte Budak das bereits erwähnte Tagebuch aus serbischer Gefangenschaft, in dem er seine kaum überlebte Odyssee in einer Kolonne österreichisch-ungarischer Offiziere auf dem Rückzug von Niš nach Albanien schilderte. In „Ratno roblje“ gibt es keine fiktiven Ereignisse oder irgendeinen Überbau. Es ist ein Buch mit sehr ausgereifter, entwickelter Psychologie, ein überzeugendes Dokument über den Feind, dessen Denke und Position fast identisch mit der des gefangenen Autors ist. Wenn er nur „Ratno roblje“ geschrieben hätte, wäre Budak einer der besseren kroatischen Autoren dokumentarischer Prosa geblieben. Aus dem Kreis der autobiografischen Prosa gefiel den Lesern Budaks „San o sreci“ („Der Traum vom Glück“) am besten, vielleicht sein schwächstes Werk. Darin beschreibt er das universitäre Umfeld in Zagreb und entwickelt daraus einen Liebesroman, der an Autobiografie grenzt.
Mile Budak war in erster Linie ein Romanautor von großer Energie, ein Autor, der in der Lage war, fast homerische Erzählstrukturen zu schaffen, besessen vom Leben auf dem Land, vom Erbe, von Rachsucht, ein einzigartiger Schriftsteller, der auf den Titanismus der Zeit hörte, aber nicht immer erkannte, woher das Böse kam. Er wusste nicht einmal, wie er dieses Übel loswerden sollte, und so verschwanden am Ende diejenigen, die die politische Rede dieses konservativen und wichtigen Geschichtenerzählers nicht verstehen wollten. Durch bestimmte Umstände gelangte er in die Welt der Politik, die ihm von Anfang an zuwider gewesen war und vor der er mehrmals erfolglos davonlief.
Mile Budak trat am fünften Tag nach der Ausrufung des Unabhängigen Staates Kroatien in die erste kroatische Regierung ein und bekleidete damals das Amt des Ministers für Religion und Unterricht.
Leider wurde die damalige kroatische Führung zum Ziel der serbischen Untergrundbewegung. Budak äußerte sich am häufigsten in der Öffentlichkeit gegen deren destruktives Handeln und Verhalten. Allerdings erhielt der serbische Aufstand seinen internationalistischen Charakter erst nach Hitlers Angriff auf Sowjetrussland am 22. Juni 1941, als in Kroatien ein organisierter kommunistischer Aufstand ausbrach und die serbische Unzufriedenheit von den Kommunisten instrumentalisiert wurde.
Tatsache ist, dass der serbische Aufstand gegen den kroatischen Staat zu Unrecht als antifaschistisch bezeichnet wurde. Sein Ziel war nicht eine Erhebung gegen den Faschismus, sondern in erster Linie ein Bürgerkrieg, ein Krieg gegen den kroatischen Staat, der gewollt war vor allem von den Serben, von denen es auf dem Territorium des Unabhängigen Staates Kroatien mehr als eine Million gab und die sich als Teil der Bewegung für die Wiederherstellung Großserbiens, das wieder Jugoslawien heißen sollte, fühlten. Es handelte sich also um einen Konflikt zwischen denen, die die Zukunft Kroatiens in einem unabhängigen Nationalstaat sahen, und denen, die sich entschieden, für den Wiederaufbau des jugoslawischen und eigentlich großserbischen Staates zu kämpfen.
Mile Budak war mit der politischen Tagesarbeit nicht zufrieden, was sich am besten daran zeigt, dass er bereits im ersten Jahr des neuen Staates, nach nur wenigen Monaten Regierungstätigkeit, zum Botschafter in Berlin ernannt wurde. Er kannte Berlin gut, weil er dort gelebt und sich erfolgreich politisch engagiert hatte, als er sich Hitlers Herrschaft widersetzte, weil die kroatischen Flüchtlinge zu Recht als demokratisches Volk und weit entfernt von der Ideologie des Nationalsozialismus galten. Budak blieb mitten im Krieg zwei Jahre lang in Berlin und wurde in der Folge – offenbar auf eigenen Wunsch – zum Außenminister ernannt. Nach dem Fall Mussolinis begann er, sich immer stärker für eine Änderung des außenpolitischen Kurses des kroatischen Staates und die Aufgabe des Bündnisses mit dem Dritten Reich einzusetzen. Zuvor hatte seine Amtsführung viele einflussreiche Unterstützer gehabt, darunter Ante Pavelić, Budaks alten Freund und ehemaligen Vorgesetzten, doch nun stieß er auf ein unüberwindbares Hindernis.
Seine reformistischen Einstellungen führten dazu, dass Budak sehr schnell endgültig in den Ruhestand geschickt wurde, was eine Folge seiner zunehmend offenen Ablehnung von Pavelićs Politik gegenüber der neu geschaffenen Italienischen Sozialrepublik war. Aus den damaligen Dokumenten geht eindeutig hervor, dass Mile Budak Ende 1943 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde. Es wird klar, dass er von diesem Moment an nicht mehr am politischen Leben teilnahm.
Er ging dazu über, wieder fieberhaft Prosa zu schreiben, fast mit der gleichen Inbrunst wie am Ende seines Aufenthaltes in den Auswandererlagern Italiens im Jahr 1938. Jetzt, am Ende des Krieges, erschien seine bereits erwähnte Romanreihe über die Familie Kresojević. Während dieser Zeit arbeitete er weiter an dem Roman „Bazalo“, der beim Tod des Autors nur als Manuskript vorlag. Es ist ein beeindruckendes Buch, ein Testament und wunderschön geschrieben, ein Werk reiner Gedanken, ohne jegliche Politik oder Ideologie. Es gibt darin keine Vorurteile oder Aufrufe zum Hass. Es gibt nur das, worüber erzählt wird, und das ist in Budaks gesamtem literarischen Werk grundlegend. Im Zentrum steht das ungeschönte und aufregende Leben der Menschen.
Er hatte vor, noch die beiden verbleibenden Romane der Reihe, „Mala žena“ und „Mali će u pisare“ zu schreiben, aber diese blieben unvollendet und nur in Fragmenten erhalten. Ehrlicherweise sollte man sagen, dass der pensionierte Budak, damals Mitglied der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste, sich an der Arbeit des Hauptrates, dem er angehörte, beteiligte, aber es ist ziemlich sicher, dass seine Konflikte mit Ante Pavelić immer häufiger und unüberwindbarer wurden. Sie verschärften sich insbesondere, als dieser die aufständischen Minister Vokić und Lorković hinrichten ließ. Zwar gab es einige Überlegungen, Budak noch einmal als Botschafter nach Berlin zu entsenden, doch war dies in den Wirren der letzten Kriegstage nicht möglich.
Mittlerweile 60 Jahre alt, müde von schwierigen Prüfungen, Verbannungen und Missverständnissen, brach er am Sonntag, dem 6. Mai, in ein neues Exil auf. Titos Kommunisten rückten Richtung Zagreb vor, im Süden Österreichs standen britische Truppen. Budak strebte auf die Briten zu. Er war nicht allein. Von Zagreb aus zog er in einer Kolonne von Ministerialfahrzeugen in Richtung Österreich, um sich den britischen Kommandeuren zu ergeben und so Schutz vor Titos Truppen zu suchen.
Es ist bekannt, dass Mile Budak bereits am nächsten Tag, dem 7. Mai, im Kärntener Ort Turracher Höhe eintraf, wo er nicht blieb, sondern sofort weiter in Richtung Turrach, Predlitz und Tamsweg weiterfuhr. Kroatische Minister zogen damals in Begleitung britischer Streitkräfte, die die Macht über diesen Teil Österreichs fest innehatten, nach Westen. Am Ende wurde Budak zusammen mit anderen Ministern interniert und den kommunistischen jugoslawischen Behörden übergeben, die ihren latenten Stalinismus und serbischen Nationalismus vor den Alliierten verheimlichten. Die Briten entledigten sich jeder Verantwortung für die Gefangenen, die auf ihren Schutz gehofft hatten.
Budak wurde sofort nach Zagreb zurückgebracht, wo er mitten im Stadtzentrum, in der Petrinjska-Straße, festgehalten wurde. Dort lag er eine Woche lang in Zelle 5 und wurde dann am 26. Mai verhört. Danach verbrachte er eine weitere Woche in seiner Zelle und wurde schließlich zusammen mit den anderen Ministern des Unabhängigen Staates Kroatien vor das Militärgericht der 2. Armee der kommunistischen Jugoslawischen Volksarmee gestellt. Der Prozess dauerte nur zehn Minuten, danach wurde er zum Tode durch Erhängen, zum dauerhaften Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und zur Beschlagnahme seines Eigentums verurteilt.
Keiner von denen, für deren Sicherheit er während des Krieges Sorge getragen hatte, war da. Von nirgendwo kam Hilfe für ihn. Einsam und verstört wartete er auf den nächsten Morgen. In den frühen Morgenstunden des 7. Juni wurde der Schriftsteller Mile Budak in Zagreb gehängt und an einem unbekannten Ort begraben. All dies geschah genau an dem Tag, an dem er 13 Jahre zuvor dem Attentat, das auf Befehl des serbischen Königs auf ihn verübt wurde, knapp entkommen war.
Mile Budak wurde aufgrund seiner politischen Aktivitäten in einem Prozess verurteilt, der kein Prozess war, weil kein einziger Zeuge der Verteidigung gehört wurde. Sein Prozess hielt sich an den Grundsatz: Heute verhandeln, morgen hängen. Auf dieser Grundlage wurde Budak jahrzehntelang aus dem kroatischen literarischen Gedächtnis gelöscht. Es wäre ungehörig, diesen Schriftsteller aufgrund eines solchen Urteils auf ewig aus dem Kulturkreis, dem er so intensiv angehört hatte, aus dem nationalen Kreis, in dem er so dynamisch gelebt und so engagiert gearbeitet hatte, auszuschließen.
Auf die Hinrichtung folgten Jahrzehnte des Schweigens, des Vergessens und der Verbote. Das Interesse an seiner Persönlichkeit und seinem literarischen Werk erwachte erst wieder, als 1990, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in allen europäischen Ländern, die Voraussetzungen für die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen kroatischen Staates geschaffen wurden. Zu dieser Zeit entstand vor den Augen von Budaks Landsleuten die Umgebung, von der dieser Schriftsteller und Politiker sein ganzes Leben lang geträumt und die er zu verwirklichen versucht hatte. Seitdem und bis heute werden seine Werke immer wieder gelesen, von Literaturkritikern und Historikern studiert, und sein Leben – die tiefen Spuren, die er in seiner Zeit hinterlassen hat – wird in den Archiven erforscht. Heute sind diese Studien von der Last des schwierigen Schicksals dieses Mannes befreit. So lebt Mile Budak auf den Seiten dieses Buches sein zweites und viel schöneres, würdigeres Leben.
I
„In Jojos Haus brennen zwei Herdfeuer!“ sagte Baruša, die Tochter des Blažić, zu ihrer Mutter. Sie war wie ein Pfeil ins Haus geschossen, klopfte den Schnee von den Opanken und hauchte immer wieder in ihre kleinen zarten Hände, die sie vor dem Mund hielt.
„Sprich keinen Unsinn!“ wies die Mutter schroff ab. „Wozu brauchen sie zwei Feuer?“





























