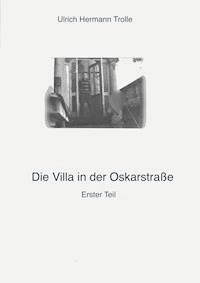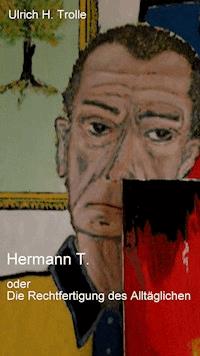
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn einem alles auf den Wecker geht, die Mitmenschen mit ihren Verhaltensweisen unverständlich werden und die Ehe schon lange währt, ist die eigene Haltung dringend neu zu bestimmen. Hermann T. tut dies, aber nicht auf direktem Wege. Er hat den Ruhestand vor sich, ist verheiratet mit der im öffentlichen Dienst stehenden Lisa, die Kinder sind aus dem Haus, er sorgt für das Alltägliche, liebt seine Bücher und schreibt in kontemplativ versunkenen Stunden literarische Geschichten. Seit er die neue Hausärztin aufsuchen musste, merkt Hermann, wie hochgradig nervös er in ungewohnten Situationen werden kann und wie gereizt, wenn die Dinge nicht so ablaufen, wie er es sich vorstellt. Hermann ist unbemerkt zum Nörgeler geworden. Er beschimpft die junge Hausärztin ob ihrer Jugend, verachtet den Regierenden Bürgermeister, der Berlin verschlampen lässt und zur gewaltbereiten Trinkerstadt macht. Die Abendschau des regionalen Fernsehens und die Zeitungsmedien erhalten rundweg schlecht Noten. Er mokiert sich über den "Vierschröter" und sein vollbusiges Weibchen von gegenüber. Die Menschen in seiner Straße erscheinen ihm kalt und gleichgültig. Den Neubau vor seinem Fenster, das so genannte "Aquarium" kritisiert er als Fehlplanung und Fremdkörper und insbesondere die eine darin wohnende gehbehinderte Frau attackiert er als "Krücke" ohne jegliche nachbarschaftliche Regungen. Sogar über den nächtlichen Zeitungszusteller regt er sich auf und scheut sich nicht, körperliche Gewalt gegen ihn aufzufahren. Gehässig wird Hermann angesichts einer dicken Frau, die als Pflegekraft angestellt ist und schlechten Mundgeruch haben muss, weil sie raucht. Die Ehe mit Lisa durchforstet Hermann eitel nach Schwachstellen und stellt abenteuerliche, ausspähende Theorien des Zusammenlebens mit Lisa auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Hermann Trolle
Hermann T.
oder Die Rechtfertigung des Alltäglichen
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Hermann T. oder Die Rechtfertigung des Alltäglichen
Fünfzehn Meter entfernt
Für die Geschichte von und über den Hermann
An dieser Stelle ist der gedankliche Umweg
Hermann erlebt in der Arztpraxis
Hermann reitet.
Die Nacht, die auf den Arzttermin folgte,
Wenige Minuten sind es gewesen,
Aber wir wollen nicht abschweifen.
Die ersten beiden Sätze
Es ist immer noch Sommer.
Also nun von dem fremdartigen Haus
Hermann bleibt lange in seiner Brust gekränkt.
Hermann nimmt die Kaffeetassen vom Küchenbord
„Der Kaffee ist fertig.
Als Schreiber von Geschichten
In der Tat sitzt am besagten frühen Nachmittag
Lisa lachte, als Hermann
Diejenigen Mieter aus dem Aquarium,
Als Hermann am folgenden Morgen
Der Tautropfen auf dem Phlox ist verschwunden.
Auf einmal zuckt Hermann zusammen.
Hermann ging mit schwachen Füßen
Für Hermann wurde die folgende eine schlechte Nacht.
Der Phlox im Garten ist längst verblüht,
Hermann schlendert mit unsicherem Gang
Die eingetretene Mattigkeit
Wie zögernd reagiert unsere Phantasie,
Impressum
Hermann T. oder Die Rechtfertigung des Alltäglichen
„... wozu lebt man, wenn der Wind hinter unserm Schuh schon die letzte Spur von uns wegträgt...“ (Stefan Zweig)
Fünfzehn Meter entfernt
von der verputzen Außenwand mit den weißen Fenstern glitzert im Garten auf dem rosafarbenen Blütenblatt des Phlox’ ein Tautropfen in der kühlen Morgenluft. Es scheint, als habe er geduldig auf den ersten Lichtstrahl der aufgehenden Frühsonne gewartet, um im Moment ihrer Berührung vom Blatt herab zu fallen und zwischen den Grashalmen hindurch mit einem leisen Seufzer Hermanns flüchtigem Blick zu entschwinden. Die zwei Sätze werden Hermann noch lange Zeit beschäftigen. Aber jetzt steht Hermann erst einmal am geöffneten Fenster seines Badezimmers. Er sieht hinaus in den beginnenden Tag und lächelt. Er fühlt sich wenige Augenblicke lang wie ein arrivierter Gutsbesitzer, der von der erhöhten Terrasse seines ansehnlichen Landsitzes gemächlichen Blickes über die Weiten der Ländereien schaut und eine gute Ernte erwartet. Im realen Leben aber hat Hermann weder einen Gutshof noch Ländereien. Worauf Hermann schaut, ist der ihm vertraute Hausgarten. Hermann weiß darin alle Bäume zu unterscheiden und die meisten Sträucher benennt er sowohl mit ihrem botanischen als auch mit ihrem gebräuchlichen Namen. Das Strauchwerk steht breit und dicht und gibt den Sperlingen gute Deckung. Die Bäume sind schlank und hoch gewachsen. Manche von ihnen stehen eigenwillig schräg, als wollten sie den Nachbargrundstücken ausweichen. Mit ihrer Neigung aber deuten sie auf die ungefähre Trennung der Grundstücke hin, deren mit Efeu überwachsene Grenzen vor mehr als einem Jahrhundert vermessen wurden, und die sichtbar zu erhalten sich niemand in den darauf folgenden zwei, drei Generationen wohl sorgfältig gekümmert haben muss und an deren erneuter Markierung heute weder Hermann noch irgendjemand in der aktuellen Nachbarschaft bisher deutliches Interesse gezeigt hat. Und Hermann selber weiß auch von keinem Grenzstein, auf den er Bezug nehmen könnte. Die Sommerblumen prangen an den lichten Stellen des Gartens und im Unterholz wuchern Bodendecker. Auf der Seite mit dem einfallenden gleißenden Sonnenlicht des Nachmittags, blüht die Staude jenes rosafarbenen Phlox’, auf deren einer Blüte eben noch der Tautropfen glitzerte und der Hermanns Aufmerksamkeit heute früh für einen kurzen Augenblick anzog. An der Staude führt ein schmaler und mit alten quadratischen in Beton gegossenen Platten befestigter Weg vorbei und endet unvollendet im Rasen, als hätte der Bauherr von einst die Lust oder die Orientierung verloren oder vergessen, wohin der Weg einmal führen sollte. Das kurze unfertige Wegstück ist die einzige Pflasterung in dem Garten, für Hermann eine stete Lockung, Hand anzulegen. Jedoch weiß Hermann einzuschätzen, dass er den Weg auch nur ein paar Meter verlängern würde, ohne ein sinnvolles Ende für den Weg zu finden. Der Weg hat keinen Sinn. Hermann sieht auf das Rasengrün und auf die hie und da am Rand verstreut und halb eingegraben liegend rötlichfarbenen Feldsteine. Der Rasen fällt mit seiner von Gänseblümchen und flach wachsendem Klee durchzogenen weichen Fläche besonders auf. Er gibt dem Garten eine lässige, wenn auch mäßige Weite. Man möchte sofort dorthin laufen, alle Kleidung abwerfen und sich nackt auf dem Grün ausstrecken. Am Fuß der niedrigen und nur provisorisch erhaltenen Einzäunung im hinteren Gartenteil wächst jedes Jahr das gelb blühende Schöllkraut. An den Zaunpfosten, zwischen Büscheln von Gräsern, hält sich der Schwarze Nachtschatten. Eine Kolonie grüner Nesseln mit ihren dicken Stängeln und Blütendolden lockt die Schmetterlinge an. In diesem Garten haben Hermanns Kinder gespielt und unbeschwerte Zeiten erlebt. Davon gibt es Fotos, die Hermann sorgsam aufbewahrt. Durch das satte dichte Grün der Blätter dringen nur wenige neugierige Blicke in Hermanns Garten hinein. Eine Idylle, wären da nicht die Verkehrsgeräusche von der nahen vierspurigen Straße, die zwischen den Fahrbahnen der Autos auch noch zwei Gleise für die Straßenbahn aufnimmt und damit von Nord nach Süd verlaufend durch den östlichen Teil der Hauptstadt Berlin eine breite und schmerzlich trennende Schneise schlägt. Das Laut und Leise, das sich von der Straße her über die Häuser des siedlungsartigen Stadtteils legt, wechselt ununterbrochen, und nur hin und wieder verstummt es für zwei bis drei Sekunden, wenn der zeitliche Zufall in der Ampelschaltung an der weitflächigen Straßenkreuzung jegliche Fahrzeuge zum Stehen zwingt. Die eintretende unfassbare Stille verwirrt dann einen Lidschlag lang die Sinne der Empfindsamen, weckt ihre Wünsche nach völliger Vertreibung aller Fahrzeuge aus dem irdischen Leben, bis der erdrückende Motorenkrach wieder anschwillt und die Menschen schneller laufen, als könnten sie so dem Gebrüll der Straße entfliehen. Von den großzügig bemessenen Grundstücken links und rechts seiner direkten Nachbarschaft sieht Hermann über die Baumkronen hinweg die Ziegeldächer mit den schlanken Schornsteinköpfen auf den zwei- und dreistöckigen, stuckverzierten Häusern aus der Kaiserzeit des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts. Jeden Morgen entschwinden über breite, fachkundig gepflasterte und sorgsam gepflegte Auffahrten dunkle Limousinen aus diesen Grundstücken und folgen der Spur zu einem für Hermann unbekannten Ziel. Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, steht ein Neubau aus den deutschen Wendejahren des vergangenen zweiten Jahrtausends nach Christus. Von diesem deplatzierten Steinprotz wird noch zu reden sein. Hermann schläft morgens ab der fünften Stunde meist nur oberflächlich und etwas unruhig. Es durchfahren ihn Traumbilder, durch die er seine eigenen tiefen Atemzüge vernimmt. Manchmal dringt sogar das Kratzen seiner Bartstoppeln am Bettbezug in den Halbschlaf ein wie ein fremdes sich näherndes und dann wieder sich entfernendes Geräusch, das den Spuk des letzten Schlaftraumes verdreifacht. Hermann empfindet diese schleichende Wach-Traum-Schlaf-Zeit am frühen Morgen nicht als lästig und nimmt sie nicht als entrissene Schlafzeit, nicht als Verlust wichtiger Erholphasen. Sein Aufstehen nach diesen Stunden ist weder gelähmt noch verlangsamt. Er fühlt sich genauso wie nach einer durchgeschlafenen Nacht. Hermann kommt sich mitunter sogar agiler vor, weil alle diese Geräusche, das laute Ticken der Uhr, das Beben der Holzbalkendecke, das Zanken der Elstern, die Schweißarbeiten an der Straßenbahnkreuzung ihm bewusst machen, immer noch im Leben zu sein und alle Gefühle zu haben wie ein Erdenwesen aus Fleisch und Blut. Die banalen Geräusche aus dem Dämmer des anbrechenden Morgens schaffen höchste Momente in ihm. Wie oft muss er sich eingestehen, dass die hellsten Bilder, die pfiffigsten Ideen und die gelungensten Wortgedanken für seine Geschichten gerade in diesen frühen Morgenzeiten geboren werden, ins Greifbare mitunter Erhabene aufsteigen. Hermann möchte alles in sich aufnehmen, was diese frühen Morgenstunden wie von selbst in ihm verschönern. Im Tiefschlaf werden ihm solche hebenden Gefühle nicht geboten. Im Tiefschlaf erfährt er nichts von dem Herzschlag in seiner Brust, als wäre der Tiefschlaf eine Auszeit vom Leben. Der Tiefschlaf kommt ihm wie ein Koma vor. Wenn er das Erleben des frühen Morgens nicht mehr spüren könnte, wäre er abgetrennt vom Leben, dann wäre er mausetot. Sagt Hermann. Später, etwa gegen ein halb sieben Uhr, verflüchtigt sich der seltsame Morgenzauber. Hermanns Gliedmaßen erschlaffen wieder, bleiben unbeweglich und bald erwacht er, wie ein Kind, das nach dem Schlaf die Augen öffnet. Hermann blinzelt dann auf das Weiß der Zimmerdecke, bis sich der Schleier des Halbschlafes über der Raufasertapete auflöst mit einem Geräusch weit hinten in seinem Ohr, als würde Wasser leise knisternd durch ein Leinentuch versickern. Hermann bleibt gewöhnlich noch einige Minuten nach dem Erwachen im Bett liegen, trotz des heftigen Dranges, auf die Toilette zu müssen. Er döst vor sich hin und versucht, diesen oder jenen Traumfetzen nun mit klarem Bewusstsein aus dem Dämmer des Morgens fest zu halten und nach einem Zusammenhang mit seinem täglichen Tun und Lassen abzutasten. Er streckt und dehnt noch seine Beine und knetet mit den Fingern vorsichtig, den Schmerz vermeidend, einen kleinen Gummiball, der immer griffbereit neben dem Bett auf den Nachttischchen liegt, bevor er dann die Bettdecke zurückschlägt, sich aufrichtet und noch einige Augenblicke auf dem Bettrand verharrt. Danach geht er im weit geschnittenen Schlafanzug über den Flur in sein Bad. Ja, eigentlich hat er da noch keinen festen Tritt. Die Badtür bleibt angelehnt. Dahinter hantiert Hermann mit Restschlaf in den Gliedern an einem deckellosen Kästchen aus verleimtem und braun gebeiztem Sperrholz, das auf dem breiten Fensterbrett seinen Platz hat. In dem Kästchen verstaut Hermann Krimskrams. Er sagt Krimskrams zu den Teilen, die sonst, wie er vor sich selber den Kauf des unscheinbaren Kästchens rechtfertigte, ungeordnet herum liegen würden: Pinzette, Sonnenschutzcreme, zwei Nagelfeilen, ein Ehering, eine winzige Tube Öl für den Rasierapparat, eine rote Massagekugel mit Noppen für die Füße, eine Cremedose, ein Minischraubenzieher für die Brille, ein Probierfläschchen mit Parfüm, eine angerissene Packung Tabletten. Das fremde Auge sucht im Bad vergeblich nach einem Schrank, nach einem Regal, nach einer Schublade. Es findet weder einen Haken für die Kleider noch eine Ablage für Wäsche. Es entdeckt statt der vermissten Möbelstücke drei verschieden große Bilder an der Wand und einen breiten Spiegel über dem Waschbecken, wie auch nur wenig Platz für eine Anzahl gewöhnlicher, für die Körperhygiene ausreichender Utensilien, sowie eine runde Uhr mit großen Ziffern. Das Bad ist hell, wirkt nüchtern, fast karg. Die Erwartung, in einem Bad zu sein, fordert noch etwas Verschönerndes. Sie möchte, wohl auch wegen des haftlosen Widerscheins von den Wänden, geradezu unhöflich tadeln, verkneift sich aber den Hinweis auf die Ähnlichkeit von Hermanns Badeinrichtung mit einer Kaue der Bergarbeiter im Schacht. Hermann nähme diesen Vergleich, würde er tatsächlich damit konfrontiert werden, mit einem freudigen Lächeln entgegen, weil ihm einst, als er noch Schüler in der Unterstufe war, während eines ganztägigen Klassenausfluges mit eingestreuter Besichtigung eines Bergwerkes, weil ihm nicht die Maschinenpistole der uniformierten Wachposten am Werktor, sondern das Schlichte und Zweckmäßige der Kaue der Schachtkumpel imponierte und derart als nachahmenswert in der Erinnerung geblieben ist, dass Hermann Jahrzehnte später die Nachahmung ausführte. Hermann würde, falls er sich zu seinem Bad äußern sollte, deshalb für Fremde etwas umständlich erklären und vielleicht auch nur zögernd hinzufügen: Diese Einrichtung habe ich gewollt. Alles im Bad soll ein wenig wie Kaue sein. Aber Hermann wird sich keinem fremden Auge gegenüber erklären müssen. Er wird nicht ohne einen zwingenden äußeren Grund sein kleines Badezimmer Dritten öffnen und sich dadurch eventuell dem Vorwurf aussetzen, es sei eigenwillig eingerichtet. Allein schon in den beiden und nur bei Bedarf zu äußernden knappen Worten ‚gewollt’ und ‚Kaue’ ist das eindeutig Unerschütterliche von Hermanns gestalterischer Badidee auszumachen. Die Sicherheit seiner eigenen Überzeugung, es richtig gemacht zu haben, hält jeden ablehnenden Widerspruch aus. Somit ist Hermann immun gegen jedes weitere nervende Argument zum Warum und Weshalb. Und auch für eine mögliche Bemerkung gelegentlicher fremder Benutzer seines Bades, denen er übrigens nur äußerst ungern ihre Verrichtung gestatten würde, die Bemerkung, die etwa so klingen könnte: „…wäre Dir nicht auch eine andere Raumlösung eingefallen auf den wenigen Quadratmetern…“, gibt es keine Gelegenheit geäußert zu werden, da kein Fremder Hermanns Bad bisher betreten hat und fernerhin auch nicht betreten soll, vor allem, weil Hermann sich nicht verkneifen würde, jeden Nutzer barsch anzuweisen, auf seinem Klo sauberer zu sein als bei sich zu Hause, auf deren Standort, von dem es Hermann übrigens völlig egal ist, ob man dort aufgefordert wird, im Sitzen zu pinkeln und die Bürste zu bedienen, solange Hermann nicht durch Umstände gezwungen wäre, mit seinen empfindlichen Sinnen durch die fremde Klotür zu treten und den fremden Ort widerwillig zu füllen. Überdies würde das fremde Auge in seinem Bad sowieso nicht auf die innewohnende Endgültigkeit der zwei gewichtigen Worte achten, sondern skeptisch auf die helle Eierschalenfarbe der Fliesen schauen und die Raum vergrößernde Wirkung des Spiegels vielleicht gerade noch akzeptieren, aus dem das Licht von der gläsernen Lampe in den Raum zurückfällt. Wahrscheinlich würde der fremde Blick die Beleuchtung lieber von einer Handvoll in die Decke eingelassener Strahler gespeist sehen wollen, als von der ein wenig ältlich wirkenden hängenden Lampe. Eine Lampe, das ist doch in der Empfindung immer etwas Baumelndes, wie ein schon lange nutzloser Gegenstand, der im Wind getrocknet wird. Hermann also will Niemandem eine Erklärung schulden. Sein Bad ist für ihn kein Raum zum Aufhalten. Es ist für ihn ein Raum zum Verschwinden. Es ist ein Raum der übergehenden Verrichtungen vom Schlaf in den Tag und vom Tag in den Schlaf. Der Zweck zählt hier und zu allererst. Wo hat es auf dem Plumpsklo seiner frühen Erziehungsjahre jemals mehr als nur den einen Zweck gegeben, schnell wieder von diesem Ort zu verschwinden? Also sind in Hermanns winzigem Badezimmer die drei abstrakten Bilder an der Wand, das Bidet gleich neben dem Klobecken und die wandhoch geflieste Duschecke vergleichsweise Zeiten überspringende Weiterentwicklungen und erleichternde Vorrichtungen angesichts der damaligen, weißkalkig getünchten Ziegelwände des Donnerbalkens auf dem kalten Hof, an denen die Kinder manchmal ihren Kot abschmierten, wenn entweder die teure Rolle Klopapier geklaut worden war und als Ersatz die regionale Tageszeitung, die den Namen „Freiheit“ trug, nicht seitwärts abgelegt, sondern provokant in Gänze im Loch steckte, unerreichbar für Kinderarme. Nur die zerknüllten Achtelstücken der „Freiheit“ oder die teure papierne Rolle hätten der braunen, fingerspurig grafischen Hinterlassenschaft an der gepinselten Wand einen Ausweg geboten. Nicht zu übergehen ist in Hermanns Bad außerdem das bequem zu bedienende Fenster, neu eingebaut, 16 mm Scheibenabstand, Licht durchscheinend doch blickdicht und schalldämpfend. Das Fenster hat einen handlichen Griff, ist schnell geöffnet und gut geeignet für den morgendlichen entspannenden Blick in den Garten. Das frühere Örtchen, jenes aus der eben angedeuteten vaterstädtischen Rückerinnerung, besaß für die Lüftung und für einen Blick nach draußen in den Garten, so man ihn überhaupt von dieser Stelle aus tun wollte, weil die hölzern harte Kante des rund eingesägten Sitzloches sich schmerzhaft ins Fleisch kerbte und zum schnellen Handeln aufforderte, jenes Örtchen also besaß statt eines Fensters eine rüde Öffnung im Format von zwei kreuzweise im Mauerverband ausgelassenen Ziegelsteinen an der rechten Wandseite. Da strich der Wind das ganze Jahr hindurch. Egal aus welcher Richtung er über das Land kam, mal als heulender Ostwind, mal als lauer Hauch aus der Ebene, immer traf er auf die dünnen Wände des schmalen kalten Abtritts und fand immer seinen zugigen Weg durch das heilige Kreuz hindurch. Bei diesem Gedanken huscht ein seliges Lächeln über Hermanns Gesicht und er gibt einen Eindruck von sich, so wie er da am Fenster steht, mit dem Handtuch lose über der Schulter, ein wenig nach vorn gebeugt schon, ohne Brille, als komme er langsam zurück aus der Erinnerung und prüfe jetzt die Klarsicht seiner Augen, schätze die Regenschwere der Wolken ab und suche am Himmel nach dem Greifvogel, dessen Schrei er soeben aus der Höhe vernommen hat, wie zu den Zeiten des Abtritts, hinten am Ende des Hofes. Noch heute ist es so, und vor Jahrmillionen bereits, seit dem aufrechten Gang des menschlichen Vorfahrens war es so, und zur Zeit des Neandertalers und des Mammuts vor vierzigtausend Jahren wird es mit dem ersten Blick nach dem Aufwachen am frühen Morgen schon so gewesen sein, denkt sich Hermann. Und seit Hermann diesen Blick bei seinem Vater beobachtet und von ihm übernommen hat und bei dessen Vater ihn ebenso bemerkt hatte, sagt er sich: Der erste Blick am frühen Morgen geht nach oben. Der erste Blick ist ein Reflex.
Für die Geschichte von und über den Hermann
muss nun ein Umweg gegangen werden. Der Umweg ist in Kauf zu nehmen, damit das Geschehen im Bad verständlich bleibt und der Grund sichtbar wird, warum Hermann sich morgens etwas länger als es die hygienische Sorgfalt erfordert, im Bad aufhält, und sich seine Finger auch noch mit einer angerissenen Packung Tabletten abmühen. Derweil, also während des zu erzählenden Umweges, soll Hermann am Fenster stehen bleiben, und sich nicht davon weg bewegen. Er soll in seinen Garten schauen und vielleicht die Reihenfolge der an diesem Tag von ihm zu erledigenden Arbeiten gedanklich noch einmal durchgehen. Vom Stehen am Fenster werden Teile der einen halben Stunde Wartezeit bis zur einsetzenden Wirkung der Tablette gegen das Wachstum des Knotens in der Schilddrüse verstreichen. Hermann soll ja die eine halbe Stunde Zeit vollständig einhalten, um die Tablette nicht umsonst eingenommen zu haben. Den Auftakt für seinen Gang zu den Tabletten gab Hermann selber, als vor etwa einem halben Dutzend Jahren seine Schilddrüse bei einer Routinekontrolle ins ärztliche Visier geriet. Bis dahin schien Hermann dieses winzige Organ in seinem Körper unbekannt gewesen zu sein, und wenn unbekannt nicht ganz zutrifft, so verhielt er sich diesen Drüsen gegenüber zumindest aber völlig gleichgültig. Jedoch bei dem erwähnten Gesundheitscheck mit einbezogener Blutanalyse zeigte sich eine Auffälligkeit. Der Hausarzt vermutete eine Fehlfunktion der Schilddrüse und in der Sonografie wurde ein unerwarteter Knoten in der rechten Seite des Halses sichtbar. In den darauf folgenden Tagen bis zur vereinbarten Biopsie verbrachte Hermann die Stunden des Tageslichts nervös und gereizt. Äußerlich jedoch, er wäre sonst nicht Hermann, blieb er gelassen. Im Inneren aber konnte er die immer wieder aufkeimende Unruhe nur wenig vertreiben. Er geriet in noch größere Verdrießlichkeit, je mehr er sich einredete, er habe nun eine ernsthafte Erkrankung. Er rang sich zeitweilig aber eine spöttische Seite seines Zustandes ab, in dem er sich die Frage stellte, ob mit der Diagnose, der Knoten befände sich in der rechten Schilddrüse, die rechte Körperhälfte aus seiner Augensicht gemeint sei oder vielleicht die rechte Seite seines Körpers aus der Blickrichtung des Arztes. Die Biopsie brachte kein Ergebnis, sie misslang. Hermann nahm es hin. Er wollte sich die offensichtlich handwerkliche Unfähigkeit des Arztes nicht bewusst machen. Er verlangte keine nähere Erklärung für den Fehlschlag. Er begnügte sich mit der Auskunft, man habe in dem entnommenen Gewebe nichts finden können und ließ seinen Zweifel am Wahrheitsgehalt der ärztlichen Aussage nur eine Weile noch in sich. Sicherlich ist die Biopsie einfach falsch gemacht, vielleicht an falscher Stelle, oder am gesunden Gewebe vorgenommen worden, sagte er sich und ging fortan mit der Existenz seines Knotens um, als wäre es sein unabwendbares Schicksal. Hermann wollte nichts wissen über Gut oder Böse seines Knotens. Es war ihm sogar recht, nichts Weiteres von ärztlicher Seite her in dieser Angelegenheit zu vernehmen. Und auf seine schüchtern und verwundernd fragende innere Stimme, warum er den Gleichgültigen abgebe und sich abspeisen lasse, gab er nicht Acht. Da Hermann an seinem Körper und an seinem täglichen Dasein auch nichts anderes feststellen mochte, als dass alles an und in ihm einen vorzüglichen, tauglichen und sportlichen Zustand habe, ja es ihm alles genauso vorkommen wolle, als wäre der Knoten nie festgestellt worden, vergaß er allmählich und ohne Anstrengung die gedankliche Beschäftigung mit diesem Teil an seinem schon faltig gewordenen Hals und die Angelegenheit geriet über den Notwendigkeiten der immer ausgefüllten, nie langweilig dahingehenden Tage, Wochen und Monate wieder zurück in die verdunkelten Abstellwinkel seines Gleichmutes. Aber irgendein verschlungenes und unbenennbares Areal in seinem Gehirn, aus dem wohl auch die Verwunderung hinsichtlich seiner Gleichgültigkeit hergekommen war, musste die einmal entstandenen Fakten doch verknüpft und Hermann eines frühen Morgens im Bett zu einigen geistigen Aufhellungen geführt haben. Hermann bemerkte an diesem besagten einen Morgen in sich nicht nur ein plötzliches Misstrauen gegen den diagnostizierenden Arzt, sondern in ihm kam auch die Absicht auf, einen neuen Radiologen und einen anderen Hausarzt zu bemühen, sobald er eine ungewöhnliche Reaktion an seinem Hals spüren werde. Hermann wartete deshalb darauf, dass sein Hals nun immer mehr anschwellen würde. Er schaute von Zeit zu Zeit genauer in den Spiegel, tastete und fühlte die linke und die rechte Seite der Halspartie nach Veränderungen ab, stellte sich vor, dass er bald einen Kropf am Hals haben werde, so einen, wie ihn die alte Tante Profalla aus seiner Kindheit besaß, die pustend die Treppe heraufstieg, wenn sie zum Sonntagskaffee an den Familientisch eingeladen worden war. In Gedanken zählte er schon die Hemden in seinem Schrank ab und rechnete sich aus, wie viele Drückknöpfe er ungefähr noch annähen könne, um dem bald mehr und mehr anschwellenden Ungetüm an seinem Hals ausreichend Platz zu schaffen und trotzdem der Hemdkragen noch zuzuknöpfen möglich bleiben sollte. Sein empfindsamer Hals sollte solange gewärmt bleiben, bis durch den angeschwollenen Umfang der Kauf neuer Oberhemden unausweichlich würde und die neue Halsweite den Kropf dann auch ohne Druckknöpfe wieder verbergen könnte. Die neuen Hemden hätten dann allerdings einen immensen Halsumfang. Sie entsprächen dann bestimmt nicht mehr seiner normalen Körpergröße, wären viel zu weit und besäßen Ärmel so lang wie für einen Schimpansen. Hermann verpönt den Kauf neuer Dinge, wenn die alten noch nicht verschlissen oder aufgebraucht sind. Aber bei einem Kropf wollte er eigentlich nicht kleinlich sein. Jedoch an seinem Hals zeigte sich weder ein Verschleiß noch eine körperliche Schwellung, noch irgendeine andere Auffälligkeit. Die Missbildung blieb aus. Der Kropf an seinem Hals kam nicht. Und so behielt Hermann seine Hemden mit der Kragengröße vierzig im Schrank. Alle zwei Tage zog er ein frisches hervor und knöpfte sich bis oben hin zu. Der Kauf neuer Hemden konnte aus der Liste seiner geplanten Erledigungen gestrichen werden. Und die alte Dame Profalla verschwand samt ihrem Kropf wieder im Erdreich des heimatlichen Gottesackers, in dem sie bereits seit Jahrzehnten ruhte. Die Druckknöpfe die Hermann besaß, noch aus seiner Mutter Aussteuer, verstaubten weiter unberührt im Nähkasten. Und die zurückliegende misslungene Biopsie versteckte sich samt Hermanns halbherziger, nie ernsthaft gestellter Fragen hinter dem alltäglichen Kleinkram in seinem Kopf, als ginge sie ihn überhaupt nichts mehr an, als gäbe es für Hermann keinerlei Anreiz, die Biopsie in sein aktuelles Denken weder in positiver noch in negativer Art und Weise zurück zu holen. Nicht ein einziger, seine Ignoranz kontrollierender Zweifel stellte sich in ihm ein. Und über diesem allen freut sich Hermann immer noch der seinerzeit von ihm gezeigten Gelassenheit gegenüber der aufregenden Situation um die fehl gelaufene Biopsie. Und auch darüber, dass er damals nicht sogleich mit der ersten Aufwallung den Arzt gewechselt hatte, sondern erst dann Weiteres zu unternehmen als geeignet ansah, wenn sich ein tatsächlicher Handlungsbedarf etwa durch Schmerzen oder durch Wachstum am Hals bemerkbar gemacht hätte. Hermann sah sich dadurch in seiner Überzeugung bestätigt, dass gesunder Menschenverstand dem nervösen Aktionismus überlegen ist, überlegen sein muss. Zudem erleichterte ein fremder und von außen kommender Umstand Hermann den Verbleib in der gewohnten ärztlichen Praxis seines Wohnviertels. Überraschend übernahm nämlich eine junge Ärztin jene vertraute Hausarztpraxis, zu der sich Hermann bisher alle zwei Jahre wegen der seinem Alter geschuldeten Vorsorge aufmachte, und in deren Räumen all seine gesundheitliche Unzufriedenheit aufgespeichert herum schwebte, weil sie ja dort angefangen hatte. Er wollte ursprünglich diese Praxis verlassen und zu einer anderen wechseln, sobald sich ein Kropf an seinem Hals entwickeln würde, weil er dann diesem alten Hausarzt wirklich nicht mehr vertrauen könne, da dieser ihn dem handwerklich unfähigen Radiologen anempfohlen hatte. Dieser Grund zum Wechseln war nun nicht mehr gegeben. Aber eine klamm heimliche Freude erfasste Hermann dennoch, dass er sich auf so unerwartet leichte natürliche Art und Weise und ohne eigenes mutwilliges Zutun doch in die Obhut eines neuen Arztes begeben konnte, ohne dem alten über Gebühr zu zürnen. Einzig, dass der Arztwechsel ihm nicht vorher bekannt gegeben worden war, stimmte Hermann ein klein wenig nachdenklich. Er musste sich eingestehen, für den bisherigen Hausarzt doch nicht so ein bevorzugter Patient gewesen zu sein, wie er sich selber vorgekommen war, ja, wie er sich eingebildet hatte. Er war also nicht so ein Patient, dem der beabsichtigte Ruhestand des bisherigen Arztes aus Gründen des über die Jahre aufgebauten persönlichen Vertrauens, oder des sozialen Selbstverständnisses wegen, oder aus Gründen des erfolgreichen weiteren Heilungsverlaufes in einem vertraulichen Gespräch hätte mitgeteilt werden sollen. Dachte sich Hermann. Der alte Arzt aber dachte anders, hatte wohl eine andere Sicht auf seinen unzufriedenen, meist skeptisch redenden Patienten Hermann gehabt. Den ersten Termin bei der neuen ärztlichen Besetzung trat Hermann aus freien Stücken an, übrigens wie bisher auch. Er tat damit auch diesmal wieder der turnusmäßig fälligen Gesundheitsvorsorge Genüge. Ihn begleitete vor allem eine gewisse Neugier auf den ihn erwartenden unbekannten Zustand, eine Neugier, die wohl immer mit der Änderung gewohnter und dem Erscheinen neuer Dinge einher geht, und die in Hermann das Augenmerk auf den Verlauf des ersten Kontaktes hinzielen ließ, in diesem Fall auf die Tonlage der Stimme, die seinen Namen aufrufen und in das Sprechzimmer zu kommen auffordern würde, und auf den ersten Händedruck bei der Begrüßung zwischen ihm, dem Patienten und ihr, der neuen jungen Ärztin. Wie oft in seinem Leben hatte doch der erste Eindruck von einem Zusammentreffen Hermanns Verhältnis zu einem Fremden dauerhaft und meist ohne wesentliche Korrekturen in der Folgezeit, bei manchen sogar über Jahrzehnte hin bestimmt. Hermann trat mit einem etwas indolenten Gesichtsausdruck und einer verschlafen wirkenden Körperhaltung in das Sprechzimmer der Ärztin, als er aufgerufen wurde. Er wollte aber in der Lage sein, sofort lebhaft zu werden, sofort eine freundliche Miene aufzulegen, wenn die Situation es erfordere und eine solche Wandlung nötig mache. Nicht die Feststellung seiner gesundheitlichen Verfassung, sondern die Wirkung dieser neuen Person auf ihn, die für sie gefühlte Sympathie oder Antipathie sollten das Primäre und Grundlegende sein an diesem Termin. Und von diesem eigenwilligen Ranking wollte Hermann dann seine Entscheidung abhängig machen, in dieser Praxis weiterhin Patient zu bleiben oder doch endlich zu wechseln. Hermann durchzuckte es beim Eintreten. Hermann war sogar entsetzt, weil die Ärztin, auf die er zuging, allem Anschein nach das Alter von dreißig Jahren gerade erreicht oder nur unwesentlich überschritten haben musste. Ihr glattes Gesicht, von keinen Falten und Fältchen beeinträchtigt, ihre engen auf ausgewaschen getrimmten Jeans und der sehr an Modeschmuck erinnernde Ring am Mittelfinger der linken Hand, herrjeh, mit solchem Zeug staffiert sich jemand aus, der einen Partner anlocken will, aber nicht, wer Patienten zu behandeln hat und das fünf Tage in der Woche und bei dem Mittwoch Nachmittag noch ein halbes Dutzend Untersuchungstermine im Seniorenstift der Caritas im Terminkalender vorgemerkt sind. Diese junge Frau, dieses schmale Person hier, ist doch wohl ein Witz. Sie ist vielleicht eine verspätete Studentin im endlich erreichten letzten Semester, oder sie ist eine in Weiß getarnte Heilpraktikerin. Wann will diese Puppe denn ihre Approbation erhalten haben? Hermann bedauerte innerlich, im Wartezimmer auf dem harten Stuhl gesessen und dem Aufruf mit übertriebenem Interesse entgegen gesehen zu haben. Er bedauerte, überhaupt auf diesen Termin eingegangen zu sein, anstatt sich gleich eine neue Arztpraxis zu suchen. Sein Instinkt hatte ihn doch ständig gemahnt, er soll sich einem behandelnden Arzt im gesetzten Alter in die Hände begeben. Und hatte er sich das nicht manchmal schon frühmorgens im dösigen Zustand des Aufwachens vorgenommen, aber diese ureigenste antreibende Absicht vernachlässigt, weiß der Teufel warum? Und nun steht er vor so einer hier! Hermann sah keine sichtbaren Anzeichen dafür, dass sie deutlich über Dreißig ist. Wonach hätte er sinnvoll suchen sollen? Welche weiblichen Zeichen hätte er deuten müssen, um ihr geschätztes Alter davon abzuleiten? Vielleicht die mutige Farbkombination zwischen dem Schmuck und ihren Streetwear-Klamotten von s.Oliver, die lustig zerzaust wirkende, kurzsträhnig gestylte Frisur, die flüchtige Zeichnung der schattigen Augenränder, das vom Ausschnitt des T-Shirts halbverdeckte winzige Tattoo auf der noch spannglatten Haut zwischen Hals und den allerdings etwas klein und flach geratenen Brüsten, denen ein Büstenhalter besser stehen würde, als überhaupt keine Körbchen. Sollte Hermann nach den Spuren eventueller Küchenarbeit an ihren Fingern suchen, zum Beispiel nach der Färbung an Daumen und Zeigefinger infolge der geschälten Mohrrüben, die sie leicht in Butter gedünstet auf den Esstisch der Familie am Vorabend kredenzte? Oder nach der frappierenden Übereinstimmung ihres Habitus mit dem jugendlich flatternden textilen Weibsbildern aus den Werbebeilagen der Tagespresse? Ach was! Eine Allgemeinmedizinerin muss a priori über Dreißig sein, zürnte Hermann unter der Zuchtkappe seiner äußeren Höflichkeit. Zugleich wurde ihm aber unheimlich zumute, dass er wie ein Heißsporn schnell und ohne irgendeine Vorsicht weitere Vorbehalte und unausgegorene Gedanken aus seinem Unmut heran schleppte, und er all den oberflächlichen Meckerkram hemmungslos gegen die Neue auffahren konnte, mit dem er sie und die für ihn lästige Situation innerlich beschimpfte. Der Missstand überforderte ihn. Der Missstand kam zu plötzlich in sein Bewusstsein und konnte nicht verarbeitet werden. Hermann musste etwas im Innern geschehen lassen und mit einer gewissen sekundenschnellen Neugier spannte er darauf, welche Seite seiner inneren Aufgewühltheit ausschlagen werde, die Vernunft oder die grobe Gehässigkeit. Hermann war handlungsgehemmt und er musste dem folgen, worauf er keinen Einfluss hatte. Letztendlich kam es so, dass er innerlich weiter zeterte: Diese Generation von jungen Ärzten schaut dich als Kassenpatienten nur oberflächlich an. Es fehlen ihr Lebenserfahrung und Einfühlungsvermögen, ganz klar. Sie schaut nur kurz an dir herunter, checkt dein Outfit und glotzt dann viel länger auf den Computerschirm, ob deine Angaben an richtiger Spalte der Patientendatei eingetragen sind. Und sie achtet darauf, dass die Behandlungszeit aus Kostengründen nicht überzogen wird. Trotzdem wartest du als Patient über den Bestelltermin hinaus unter der hustenden und rotzverschleimten Klientel des Wartezimmers. Hermann war in Rage geraten. Er merkte aber, wie sein größter Ärger sich über ihn selbst und sein unkontrolliertes Schimpfen ergoss. Und trotzdem gelang es ihm nicht, sein dummes inneres Gerede zu unterdrücken. Er ließ sich gehen. Und Hermann dachte noch zusätzlich und mit Genugtuung: Nun habe ich doch Grund genug, die Arztpraxis zu wechseln. Plötzlich spürte Hermann die Hände der Ärztin unter seinem Kinn, sie tastete seinen Hals und er erschrak, wie sie ihn abrupt und hart aus seinen Gedanken wach rief: „Das muss ich mir mal genauer anschauen.“ Ihre Hände glitten von Hermanns Hals ab, nestelten an der Tasche des Kittels. Sie bewegte sich in kurzen Schritten auf den Schreibtisch zu. Diese Frau, der die weichen Hände gehören, muss erst ausreifen, dachte Hermann erneut. Wer vor ihrer Reife hier Patient ist, wird Misstrauen gegen sie aufbauen. Er begann sich wieder zu ärgern. Und ihm fiel auf, dass die junge Ärztin in ihrer Bemerkung kein pluralisierendes, die Situation verwässerndes „wir“ gebrauchte. Hatte er anderes erwartet, oder das „wir“ nur überhört? Er sann der Bemerkung noch einmal nach. Sie hatte tatsächlich den generösen Plural, die lässige Geringschätzung, die mit der Verbrüderungsrhetorik des „wir“ einhergeht, vermieden. Hermann stoppte sofort die Überlagerung aufgekommener alter Gedanken auf die neuen. Er ist doch Patient in der Gegenwart. Da gibt es das „wir“ nicht, sondern das Abstand haltende „Sie“. In der Gegenwart nimmt der Arzt den Patienten ernst. Aber vom letzten Jahrhundert holte Hermann aus seinem Gedächtnis die Erinnerung herbei, dass sich der Arzt hie und da das Vertrauen beim Patienten durch eine lässige Entpersönlichung und Verniedlichung der Krankheit erschlich, was ihm leicht gemacht wurde, da der Patient zum Arzt hoffnungsvoll aufschaute. Der Arzt machte die Krankheit klein und rückte sehr nahe heran an den Patienten mit näselnder Stimme: „Ja, wo fehlt es uns denn? Was machen wir denn für Sachen?“ Hermann sah den groß gewachsenen dicken Doktor seiner Kinderzeit vor Augen, der ihm gegen die häufig auftretende Mandelentzündung Tabletten verschrieb, das abendliche und morgendliche Gurgeln ans Herz legte und Bettruhe verordnete. Und eines Tages kam dieser dicke Arzt auch an Mutters Bett, wegen ihrer Koliken, die wohl von der Galle herkamen, da Mutter gern fett aß. Der kleine Hermann war deshalb zuvor an eben diesem Tage mit der anderen, der Gott erbarmenden Angst um die kranke Mutter zum dicken Arzt gerannt, natürlich vom Vater auch zusätzlich geschickt, damit der auch Anteil habe am Gesunden seines Weibes und nicht nur unschlüssig herum stehen, und zwischen Bett und Küche irgendwie nur fehl am Platze scheinen sollte. Und das Kind Hermann war mehr als gerannt, bis ihm die Luft weg blieb und die heiße Lunge nichts mehr hergab außer Keuchen und Röcheln an dem einem Nachmittag mitten in der Arbeitswoche. „Du, sage deiner Mutter, ich komme in einer Stunde“, antwortete der dicke Arzt. Und dann kam er in einem sehr alten Auto vorgefahren, ging ins Haus, fand das Schlafzimmer. Er setzte sich an den Bettrand sprach mit Hermanns Mutter, tastete sie ab. Und Hermann hörte ihn zu Beginn seiner Untersuchung eben dieses fragen, woran er sich jetzt erinnerte: „Ja, wo fehlt es uns denn? Was machen wir denn für Sachen?“ Mutter sah ihn in gläubiger Erwartung und tränennassen Augen an. Hermann hatte immer gedacht, der Dicke da an Mutters Bett sei ein Kinderarzt und würde nur die Kinder der Straße gesund machen, und nur die Kinder in der Stadt duzen. Im Krankenbett aber liegt das Du anscheinend immer näher als außerhalb des Bettes. Oder war Mutter in ihrem Bett wieder Kind geworden? Sie heulte ja wie ein Kind und krümmte sich. Mutter hatte Schmerzen in ihrem Leib und die Angst vor den Schmerzen noch obendrein. Die Angst vor dem Schmerz löscht die Persönlichkeit aus. Und eine kranke erwachsene Mutter heißt dann eben wie ein Kind: Du. Die Ärztin, vor der Hermann jetzt zur Untersuchung saß, sprach unbeteiligt, ja, wie es Hermann vorkam, sogar ein wenig gleichgültig im Tonfall und mit einem sachlichen Abstand, der wohl dem Altersunterschied zwischen ihr und dem Patienten Hermann hätte geschuldet sein können. „Ich werde Sie noch einmal untersuchen. Nehmen Sie bitte im Untersuchungszimmer 2 auf dem Stuhl platz. Dort, auf diesem da.“ Und sie zeigte durch eine geöffnete Tür in den anderen Raum auf einen dort mittendrin platzierten drehbaren Stuhl ohne Armlehnen. „Die Jacke können Sie anlassen. Aber den zweiten Hemdknopf bitte öffnen. Ja, noch ein wenig weiter aufmachen. Geht das? Ja, so reicht es schon.“ Hermann vernahm ihre schnellen kurzen Schritte hinter sich, verspürte einen leichten Lufthauch aus ihren Körperbewegungen. Sie nimmt kein Deodorant, dachte er noch, da waren ihre Hände auch schon wieder an seinem Hals, legten sich vom Rücken her um ihn. Leichtes Gleiten, Drücken und Tasten mit den zweiten und dritten Fingern. Es wurde still. Ihr Atem kam sanft aus ihrem Mund strich um Hermann herum. Hermann begann zu pumpen, auf einmal bebte sein Brustkorb. Hermann wurde aufgeregter auf seinem Stuhl. Er sah links von sich eine angejahrte flache Liege stehen auf schlicht gedrechselten Holzfüßen. Die vorderen Füße waren schief, als hätte jemand wütend dagegen getreten. Über der dunklen Bespannung erkannte er eine durchsichtige glänzende Folie. Darauf lag lose und leicht herabhängend eine weißliche Papierbahn, länger als ein menschlicher Körper und wie es aussah, für die weitere Benutzung vorbereitet. Hermann spürte, wie sein Arm sich nach dieser Liege ausstrecken wollte, wie es ihn drängte, sie zu berühren, als sei er erst dann überzeugt von der realen Körperlichkeit der Liege und von seiner eigenen Anwesenheit hier in der Praxis. Wenn er doch die Liege jetzt benutzen könnte, die harte Unterlage unter sich fühlen könnte, anstatt auf dem Drehstuhl sitzen zu müssen so aufrecht, dass es ihm Mühe machte. Erst auf der Liege würde er das Gefühl haben, wirklich in ärztlichen Händen zu sein. Der Kittel der jungen Ärztin berührte Hermanns Rücken. Zu beiden Seiten schoben sich ihre schlanken Beine um den Drehstuhl. Er sah ihre hellen Socken, schaute auf die Riemen ihrer Sandalen, auf das grüne Linoleum des Fußbodens. Ihr Atem strömte wieder geruchlos, umfächerte seinen Hals, durchfuhr seine Haare. Hermann versuchte zu entspannen, irgendwie aus der Beklemmung zu kommen und aufzuweichen, um seinen Groll endlich zu überwinden. Da hieß sie ihn: „Machen Sie sich bitte mal frei. Nur oben ´rum.“ Hermann stand auf. Er bekam erneut Gänsehaut. Er zog die Jacke aus, raffte kurzerhand mit überkreuzten Armen sein T-Shirt samt Unterhemd, zog beides über den Kopf und legte die baumwollenen Sachen lose über den Rand der Liege mit den schiefen Beinen. Die Ärztin prüfte seine Haltung und die Waagerechte seiner Schultern. Dann fuhr sie mit einem Gegenstand, den Hermann nicht erkennen konnte und der in ihm ein elektrisierendes Gefühl verursachte, an der Wirbelsäule entlang. Sie fragte ihn nach dem Wachstum der braunen Flecken auf seiner Haut, ließ ihn ein paar Mal kräftig durch den Mund ein- und ausatmen, das Stethoskop dabei auf verschiedene Stellen von Hermanns Rücken und auch noch auf Brust und Bauch haltend. Die Arzthelfrein kam und fragte nach den Werten der Blutdruckmessung. 135 zu 81 hörte er die Ärztin sagen, dann ging die andere wieder aus dem Raum. Hermann und die junge Ärztin standen sich allein gegenüber. Ihre Haare..., dachte Hermann auf einmal. Hermann sollte sich erneut umdrehen. Sie pochte ihm auf den Rücken, hämmerte mit ihren Händen in seine Nierengegend und fragte, ob ihm das Schmerzen bereiten würde. Wenn ja, wo am heftigsten. Hermanns Gesicht begann sich zu röten. Er empfand keine Schmerzen. Und als wäre es nicht genug, forderte die Ärztin während des Drückens und Klopfens Hermann auf, für das nächste Mal einer Blutprobe zuzustimmen, die er zu dem neuen Termin auf nüchternen Magen, natürlich frühmorgens vor halb acht Uhr, im winzigen Laborraum nebenan, von der ebenfalls neuen Krankenschwester vornehmen lassen sollte. „Sie sind doch damit einverstanden.“ Halb verdutzt, halb sich schnell befragend antwortete er: „Ja.“ So kam er zum zweiten Mal vor die junge Ärztin, schneller als ihm lieb war. Mit einer fixen Körperdrehung, die Hermanns Eintreten galt, warf ihm die Ärztin hinter ihrem Schreibtisch, noch bevor Hermann auf dem Behandlungsstuhl wieder Platz nehmen konnte, mit freundlichem Gesicht die Frage an den Kopf, warum er, der mündige Patient Hermann, den Knoten an seinem Hals nicht habe bereits behandeln lassen. Der Knoten sei inzwischen, äußerlich zwar nicht erkennbar, innerlich aber unzulässig gewachsen. Das ergebe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Vergleich mit den Daten der ersten Untersuchung, die vor einigen Jahren erfolgt war und die aus Hermanns alten, aber noch nicht im Archiv abgelegten Patientenunterlagen herangezogen wurden. Und sogleich begann sie mit ihren jungen weichen Händen genau wie zum ersten Termin an Hermanns Hals zu tasten und zu fühlen. „Haben Sie Beschwerden beim Schlucken oder beim Sprechen? Wenn sie sich sputen, ist die Untersuchung im laufenden Quartal noch zu erledigen, und es würde keine neue Praxisgebühr anfallen. Die Überweisung für den Radiologen mache ich gleich fertig. Die Assistentin an der Aufnahme wird sie Ihnen aushändigen.“ Dem Wachstum entgegen zu treten heißt für Hermann jeden Morgen auf nüchternen Magen eine Tablette einzunehmen und geduldig, der heilenden Wirkung wegen, bis zum Frühstück dreißig Minuten zu warten und die Wartezeit mit dem auszufüllen, wofür sich tagsüber nie die richtige Gelegenheit bietet, das Ölen der Scharniere an der Haustür zum Beispiel, oder das Küchenfenster putzen, oder den Blick auf die Leute aus dem Haus gegenüber etwas länger ausdehnen. Aber davon später.
An dieser Stelle ist der gedankliche Umweg
erst einmal zu Ende, der verständlich machen sollte, warum Hermann morgens an der Tablettenpackung hantiert und danach, so wie jetzt, für einige Momente und wenn das Wetter nicht zu kalt ist, am geöffneten Fenster steht und wartet, bevor er anderes tut. Mit diesem Blick aus dem Fenster vergeht ein Teil von der geforderten Wartezeit und Hermann hebt am Fenster den Kopf, schaut, wie wir wissen, nach oben zum Firmament und danach schaut er ins Freie und in den Garten mit seinem Grün. Und manchmal durchströmt ihn eben jenes behagliche Gefühl von dem besagten Gutsherren, der von seiner Terrasse aus auf seine Äcker, Wiesen und Wälder schaut und auf eine gute Ernte hofft. Eigentlich wünscht sich Hermann nicht nur in der Phantasie, sondern in einer lebendigen Wirklichkeit Gutsherr über Wälder, Wiesen und Äcker zu sein. Aber mehr als eine kurze heimliche Gedankenschwärmerei von einem anderen Dasein lässt sein nüchterner Verstand nicht zu. Und aus dem Widerstreit zwischen dem die Seele bewegenden Wunschbild und dem sachlich ausbremsenden Verstand huscht über Hermanns Gesicht ein Lächeln und hinterlässt ein kleines Amüsieren in ihm zurück über sich und seine seltsam einfältige Träumerei. Da drängt sich plötzlich ein anderer Gedanke über die Äcker, Wiesen und Wälder der Gutsherrenphantasie und schiebt Hermanns sehnsüchtige Träume von der bäuerlichen Gegend wie einen breit hängenden Vorhang zur Seite. Denn aus diesem zweiten Arztbesuch ist noch etwas mit Temperament nachzuarbeiten, nicht ganz ohne Ironie und voller Vermischung von hohlem Unfug, schaumigen Gedankenblasen, gefühlter Täuschung und johanniszeitlicher Aufwallung. Hermann gleitet gedanklich wieder auf den Behandlungsstuhl in der Arztpraxis. Im Verlauf dieser zweiten ärztlichen Sprechstunde ist Hermann zunächst noch etwas unruhig geblieben, und er kann seine erneut aufgetretene Verlegenheit über die Jugend der Ärztin und über die Umstände, wie er mit ihr zusammen gekommen ist, noch immer nicht ganz beherrschen. Es entstehen ein paar unverdächtige Bemerkungen zwischen beiden und als Hermann die ruhigen Bewegungen und die routiniert geführten Handgriffe der Ärztin bemerkt, wird er schnell wieder der Alte und öffnet erneut den Mund zum Sprechen und ordnet seine Worte zu der provokanten wie dämlichen Frage, die er im Sitzen stellt, mit einer leicht und flüchtig nach rechts angedeuteten Bewegung über seine Schultern hinweg: „Wofür, Frau Doktor, sollen die Tabletten gut sein, helfen die denn überhaupt?“ Als wenn sich Hermann den erwünschten Nutzen der verschriebenen Tablettenpackung nicht mit seinem gesunden Menschenverstand oder auf eine, dem Allgemeinwissen entnommenen Art und Weise einigermaßen selber erklären könnte. Hermann ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Der Hermann fragt scheinheilig und wie ein vorwitziger zehnjähriger Knabe über das Abtasten hinweg. Er fragt allerdings nicht grundlos und nicht einfach so aus Laune in die Situation hinein, weil er sich eventuell nicht im Griff hat. Hermann möchte auch nicht ein vorgespieltes, ein scheinbares Unwissen damit beseitigen. Er will sich zu allererst von dem peinlichen Vorwurf der Sorglosigkeit befreien, will die eingangs erlittene Schlappe, warum er den Knoten nicht behandeln ließe, nicht auf sich sitzen lassen. Zumindest will er die ihm von der Ärztin unterstellte Vernachlässigung der bereits seit längerem bekannten Diagnose mit seiner maliziös geblödelten Frage nach der Wirkung der Tabletten abschwächen und klein reden. Hermann will ablenken, er will die Zweifel an der Wahrheit seiner eigenen Ignoranz gegenüber der medizinischen Behandlung des Knotens beseitigen, gänzlich ausrotten. Ohne den Knoten im Hals wäre seine Stirn glatter geblieben. „Haben Sie Misstrauen gegen die Schulmedizin?“, fragt die Ärztin zurück. Ein Lachen entspannt den Raum zwischen beiden. Woher weiß sie von seiner Abneigung gegen Tabletten? Oder ahnt sie seine Abneigung? „Na, nee, nee nee. Ich meine, es gibt keine vernünftige andere Chance, gesund zu werden, als die Schulmedizin an sich heran zu lassen, sonst bleibt man krank, wird nicht mehr gesund.“ Da setzt Hermann eine billige Bemerkung hintendran: „Entweder zum Facharzt oder man ist dem Fatum ergeben.“ Noch blöder kann er ihr nicht kommen können. Eine kleine Pause entsteht. Er stutzt. Sie schweigt. Hermann beginnt sich zu ärgern über seinen Schwachsinn und denkt, sie wird jetzt die Banalität des kurzen Austausches erst aus dem Fenster entweichen lassen. Sie wird solche Bemerkung von ihm nicht erwartet haben. Warum hat er nicht die Homöopathie erwähnt? Stattdessen spricht er vom Fatum und von Selbstheilung. Wichtigtuerei! Wo doch die andere Chance, einer Krankheit Herr zu werden, bei der Homöopathie liegt, weniger bei der Selbstheilung. „Worauf legen Sie Wert?“ fragt sie wie nebenbei und kommt auf ihn zu. Und dann fragt sie noch: „Ja, worauf verlassen Sie sich eigentlich. Auf den Arzt? Oder sagen sie sich, es wird schon alles gut gehen.“ Hermann: „Ich habe die Gene meiner Vorfahren, hoffentlich, bei denen niemals… Schilddrüse? Nein. Ist mir als Krankheit nicht bekannt. Nein, nein. Mein Vater wurde über neunzig Jahre alt und hatte keine Beschwerden. Da möchte ich auch hin.“ Hermann will aufatmen nach seiner Antwort. Die weichen Hände der jungen Ärztin bereiten ihm Unbehagen. Sie gleiten ihm zu warm über die seitlichen Hautpartien, sie tasten geübt und mit leichtem Druck vorn oberhalb der Schlüsselbeine jene Stellen am Hals ab, die ihn in die jetzige Situation gebracht haben. „Sie müssen locker bleiben, ich tue ihnen doch nichts Schlimmes an.“ Die Ärztin fühlt weiter an seinem Hals. Hermanns Hemd wird nass. Schweiß rinnt unter den Achseln, nichts als Schweiß. Was soll er jetzt bloß machen? Er kann nicht einfach sagen, halt, warten Sie einen Augenblick, und dann vom Stuhl aufstehen, zum Becken gehen, den Wasserhahn aufdrehen und sich waschen. Hermanns Augen huschen hin und her, durchsuchen den Raum nervös und aufgeschreckt und wollen etwas erspähen. Aber es ist nichts weiter geschehen, als dass die warmen Fingerspitzen der jungen Ärztin unerwartet sanft seinen nackten Hals berühren. Die Hände einer Fee müssen so sein, denkt er. In Kindergeschichten, da kommt immer mal eine Fee vor. Welche von den Geschichten war denn das nur? Aber angefasst hat die Fee nichts und niemanden. Die Fee hat in den Geschichten geschwebt. Leichtes Antippen und wieder entfernen und erneutes Antippen. Ja, die Fee ist die Ärztin. Wirklich, der Zauber kann beginnen. Die Finger der Ärztin schneiden ihm den Atem ab. Und seine lächerliche Frage, ob die Tabletten helfen würden, gerade noch wie in einem Zweierspiel mit der Ärztin in den Raum geworfen, wird mit einem Schleier zugedeckt und weg gewischt. Sein Körper zuckt zusammen, es überzieht ihn ein Schaudern und ihm ist, als würde er immer steifer werden. Jetzt sitzt er regungslos auf dem Stuhl. Das knisternde Geräusch ihrer weißen Ärmel an seinem Ohr verwandelt sich in ein hallendes Rauschen, das von den Wänden zurück geworfen wird und sich über ihn legt. Von ihren Fingerspitzen spürt er einen leichten Druck. Hermann muss hastig schlucken. Ihre warmen Hände legen sich mit der ganzen Fläche auf seinen Hals. Vor Hermanns Augen flimmert es und weiße Pünktchen tanzen, entschwinden, kommen wieder, tanzen. Seine Schultern fallen nach vorn. Hermann fühlt so, als… ja, es ist gewiss so,… er weiß es einfach nicht mehr, ob er überhaupt jemals mit solcher Macht, die Hände, diese warmen Frauenhände an sich gespürt hat, ob er jemals zu solch einer Empfindung fähig gewesen war, wie sie ihn jetzt auf diesem ungeschickten Behandlungsstuhl so benommen macht. Hermann hat Frauenhände schon lange nicht mehr gebraucht. Sie sind für nichts mehr an ihm gut gewesen. Ihr Fehlen hat er nicht beklagt. Mit dem Abtasten an seinem Hals aber scheint aus seiner Vergangenheit her wieder etwas in ihm sich los zu machen und sogleich eine Unruhe in ihm sich auszubreiten, über deren Wühlen in seinem Körper das Blut mehr und mehr und ziemlich stark in Wallung gerät und sein Brustkorb sich nun übertrieben hebt und senkt. Und je länger er sich wie verirrt im gedanklichen Erinnerungsnebel verfängt und sich fragt, was ihn in Gottes Namen so in Erregung bringt, und wo das enden soll, desto deutlicher wird ihm, dass Jahre vergangen sind, seit Frauenhände seinen Körper so sanft berührten. Wie viele Jahre? Wie lange sind die Frauenhände schon weg? Hermanns Puls pocht in den Adern. Es hämmert in seinem Körper, als würde urplötzlich nach einem langen versteckten Dasein etwas voreilig und nachlässig Abgelegtes aus ihm hastig wieder herausbrechen. Wärme treibt den Schweiß weiter seinen Rücken entlang. Bis in die Fingerspitzen wird ihm heiß. Und aus einer tiefen Schicht seines Bewusstseins werden auf einmal wie von selbst deutlich klare, erotische Bilder frei gegeben. Über alle seine Sinne, die er zu beherrschen glaubt, wiederholt sich in ihm ein Drang, der ihn als Teenager am Körper eines Mädchens in schwindelnd ausladendes Verlangen trieb. Längst hat Hermann an Frauenkörpern kein Vergnügen mehr und fühlt auch keine Schwierigkeit, erotischen Phantasien locker eine Absage zu erteilen, sie als lästig und hinderlich zu empfinden. Und nun aber, plötzlich, dieses unerwartete Aufwallen. Er tastet, riecht, schmeckt die Begierde und eine Stimme fragt ihn: „Woran denkst du, Hermann? Was geht in dir vor? Dein Mund ist so wässrig geworden.“ Hastig und voller innerer Unruhe rückt sich Hermann auf dem Stuhl zurecht, nimmt wieder eine gerade Haltung ein. „Möchten Sie sich etwas ausruhen?“, fragt die Ärztin, als würde sie in Hermanns unruhigen Körper hineinschauen können und seine Gedanken erraten. Er antwortet mit einem Räuspern: „Nein, danke. Mir fehlt nichts. Vielleicht muss ich nur tiefer atmen, Bauchatmung, ich muss durch das Zwerchfell atmen. Dann wird mir besser. Es ist etwas unbequem auf diesem Stuhl hier.“ Wer ahnt nicht angesichts einer solchen Antwort, dass Hermann dort in dem Arztzimmer sich lieber an einen anderen Ort wünscht, als auf dem Behandlungsstuhl solange sitzen zu müssen, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Die Züge seines Gesichtes haben sich verfinstert. Unsicherheit durchfährt ihn. Er flucht innerlich: Dieser verdammte Stuhl! Diese weichen Hände! Die sollen ablassen von meinem Hals.
Hermann erlebt in der Arztpraxis