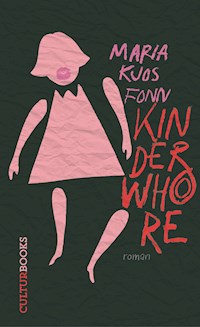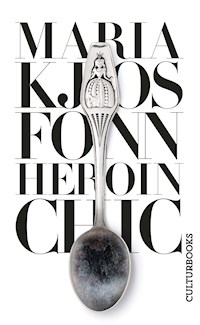
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Osloer Literaturpreis »Ein dunkel leuchtendes Meisterwerk.« Adresseavisen Elise ist in einem gut behüteten, bürgerlichen Elternhaus aufgewachsen. Es heißt, sie hat eine goldene Stimme und wird es als Sängerin weit bringen. Ihre Mutter findet, dass sie von innen heraus leuchtet. Eigentlich müsste sie glücklich sein. Doch da ist diese Leere in ihr, die sich nicht füllen lässt. Elise möchte sich schwerelos fühlen, keine Spuren hinterlassen. Sie probiert alles: Askese und Maßlosigkeit, von allem zu wenig, von allem zu viel. Und dann macht es klick: Die Drogen geben ihr genau das, was sie schon immer wollte – das Nichts. Sich zu betäuben, sich vollkommen zu verlieren. »Heroin Chic« ist die Geschichte eines Leidens, das von äußeren Umständen unbeeinflusst bleibt, ein Roman über ein Herausfallen aus der Gesellschaft ohne ersichtlichen Grund. »Maria Kjos Fonn hat die einzigartige Fähigkeit, schmerzhafte, schöne und wichtige Geschichten über Menschen zu erzählen, die im gesellschaftlichen Abseits stehen.« Verdens Gang »Eine kompromisslose und kraftvolle Darstellung von Rausch und Sucht.«. Morgenbladet »Kjos Fonn schreibt spektakulär gut.« Vårt Land »Ein Roman über das Unfassbare, das mitten zwischen uns existiert. Ein Buch, das jeder gelesen haben sollte.« Dagbladet »Der Autorin gelingt es meisterhaft, sowohl das Fürchterliche als auch das Schöne an der zerstörerischen Reise der begabten Elise zu zeigen, vom behüteten Elternhaus über die rücksichtslose Welt der Essstörung bis ins härteste Drogenmilieu – und den schwierigen Weg wieder hinaus.« Tara »Eine präzise, unsentimentale und glaubwürdige Darstellung von Elises Kampf mit und gegen die Sucht.« NRK »Dieser Roman wird niemanden unberührt lassen.« Adresseavisen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Deutschsprachige eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
© by Maria Kjos Fonn
First published by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2020
Published in agreement with Oslo Literary Agency
Die Übersetzung wurde mit finanzieller Unterstützung von NORLA publiziert.
Übersetzung: Gabriele Haefs
Umschlaggestaltung: Aina Griffin Umschlag: Cordula Schmidt Design, Hamburg
Erscheinungstermin: März, 2022
ISBN: 9-783-95988-217-0
Über das Buch
Elise ist in einem gut behüteten, musikbegeisterten Elternhaus aufgewachsen, in einem der besseren Viertel der Stadt. Es heißt, dass sie eine goldene Stimme hat, es als Sängerin weit bringen wird. Ihre Mutter sagt, dass sie von innen heraus leuchtet.
Eigentlich müsste sie glücklich sein. Doch da ist diese Leere in ihr, die sich nicht füllen lässt. Elise sehnt sich danach, zu verschwinden. Sich schwerelos zu fühlen, keine Spuren zu hinterlassen. Sie probiert alles: Askese und Maßlosigkeit, von allem zu wenig, von allem zu viel.
Und dann macht es klick: Die Drogen geben ihr genau das, was sie schon immer wollte – das Nichts. Sich zu betäuben, sich vollkommen zu verlieren.
»Heroin Chic« ist die Geschichte eines Leidens, das von äußeren Umständen unbeeinflusst bleibt, ein Roman über ein Rausfallen aus der Gesellschaft ohne ersichtlichen Grund.
»Ein dunkel leuchtendes Meisterwerk.« Adresseavisen
Über die Autorin
Maria Kjos Fonn, geboren 1990, lebt als freie Autorin in Oslo. »Heroin Chic« wurde als einer der wichtigsten norwegischen Romane des Jahres gelobt, gewann den Osloer Literaturpreis und stand auf der Shortlist des P2-Hörerpreises und des norwegischen Buchbloggerpreises. 2019 erschien ihr preisgekröntes Debüt »Kinderwhore« bei CulturBooks.
Über die Übersetzerin
Maria Kjos Fonn
Heroin Chic
Roman
Inhaltsverzeichnis
Take your silver spoon Dig your grave
Ich sitze mit Fremden im Kreis, hole einen Plastiklöffel hervor und schütte Pulverkaffee in eine Tasse. Braunes Pulver auf einem weißen Löffel. Plötzlich zittern meine Hände, als wäre das letzte Mal neun Stunden her und nicht neun Monate. Oder noch länger, seit ich bei Joakim auf dem Küchenstuhl saß und Handwerkerin war. Als ich alles wieder herrichtete. Der Löffel brannte in Schwarz und Blau, dünne Rinnen im Metall.
Ich sah gern die blaue Flamme an, wenn ich das Feuerzeug unter den Löffel hielt. Hörte gern, wie es kochte. Blubbernd, wie ein Primus. Ich brach ein Stück von einem Zigarettenfilter ab, nahm damit das überschüssige Wasser auf. Zog die Lösung in eine Spritze. Band mir den Riemen um den Arm. Eigentlich brauchte ich das nicht, die Adern standen schon von sich aus hervor.
Ich fand die Ader, stach die Nadel ein Stück hinein, ein Tropfen Blut trat aus. Dann drückte ich den Kolben langsam durch. Diese Bewegung, diese mechanische Fürsorge. Die Wirkung, nach und nach, nicht ruckhaft, eher gleitend. Ich war die, die fickte, und gleichzeitig die, die gefickt wurde. Ärztin und Patientin, Täterin und Opfer in einer Person.
Ein Knall wie bei einer Frontalkollision. Der Kopf, der durch die Windschutzscheibe bricht. In der Sekunde, in der du nicht weißt, ob du tot bist oder ob du nur übst, ist der Kopf leicht wie ein Airbag, du kippst vornüber, glaubst aber zurückzusinken, die Scherben kitzeln wie Federn an deinem Kopf und deinem Gesicht. Alles stimmt. Und dann öffnest du die Augen. Du sitzt noch immer auf einem Küchenstuhl, mit einigen schmutzigen Kaffeetassen auf dem Tisch, draußen ist vielleicht Oktober, oder Januar, es sieht grau aus, aber das Wetter betrügt niemanden. Du spürst, wie die Benommenheit von der Rückseite der Beine deinen Rücken hinaufwandert, kleine betäubende Pfeile am Rückgrat entlang. Alles ist warm und gut und ruhig. Wie klein zu sein und im Winter drinnen im Warmen eine Tasse Kakao zu trinken – die Kälte draußen geht dich nichts an.
TEIL I
Durch Enthaltsamkeit und die Arbeit an den zwölf Schritten der Narcotics Anonymous sind unsere Leben nützlich geworden. Ich sitze am Küchentisch, habe Kerzen angezündet, weil das beim Treffen jemand empfohlen hat, und lese die Website. Geistiges Wachstum. Und dabei ging es mir doch immer darum, weniger zu werden. Mich zu reduzieren auf fünf Gramm in einer Tüte. Aber die NA haben Tausenden anderen Menschen geholfen. Mit Gebeten im Kreis und Mantras und täglichen Reflexionen. Natürlich kann das auch bei mir funktionieren. Natürlich können Anrufe bei anderen manisch Cleanen, Treffen, bei denen die Anwesenden einen Keks für jedes verdrängte Jahr ihrer Kindheit verzehren, Schritte, auf denen ich jeden einzelnen Fehler untersuche, den ich seit meiner Geburt begangen habe, den Drang zu der Chemie ausgleichen, die mich innerhalb einer Sekunde von furchtbar auf fantastisch wechseln lässt, na klar.
Ich glaube, ich bin einer der Pechvögel, bei denen das Programm nicht funktioniert, sage ich zu Laura, meiner Mentorin, die bei den NA Sponsorin genannt wird, als wir über die verschiedenen Schritte reden.
»Don’t flatter yourself«, sagt sie und lächelt.
Hi! You’ve been clean for 9 months and one day and 16 seconds, steht in der Clean-Time-Counter-App. Ich sehe sie an, die Sekunden in der App vergehen, während ich draufstarre. Die Zeit fliegt. Ich sehe das Herbstlaub draußen, verwelkte und runzlige Blätter, wie die Hände alter Menschen, und ich denke, alles wird gut werden, ein Tag nach dem anderen, dreihundertfünfundsechzig Mal ein Tag nach dem anderen, malgenommen mit circa fünfzig, wenn ich ein normales Alter erreiche.
Wir sitzen bei den Narcotics Anonymous um einen Besprechungstisch, und die Verschreibung lautet: Worte raus und keine Pillen rein. »Teilen« nennen sie es. Ich wusste, wie man teilt. Eine Spritze, eine Rivotril durch vier, meinen Körper. Aber reden – das sind vergeudete Bewegungen mit dem Mund, mit dem man singen oder Liebe machen kann oder ihn für Pillen oder Alkohol oder Rauchen oder Nahrung oder Erbrechen benutzen, nicht, um noch mehr zu zerstören, indem man versucht, zu erklären, wie zerstört alles ist.
Hallo, ich heiße Elise, und ich bin drogenabhängig, sage ich. Ich war erwachsen, als ich zum ersten Mal Heroin ausprobiert habe. Es gab niemanden, der meine Grenzen niedergerissen hat. Sie waren einfach nicht da. Nichts war da.
Ich trage auch drinnen eine dicke Jacke. Ich will nicht, dass sie meinen Körper sehen. Als ich Drogen genommen habe, war ich so mager, dass etwas von mir abstrahlte, etwas Bedrohliches und Abstoßendes und – für die richtigen oder die falschen Menschen – etwas Verlockendes. Etwas, um das die meisten einen großen Bogen machen konnten. Um sich dann danach umzudrehen. Und sieh an, was jetzt? Farbe und Fleisch in den Wangen. Die mit mir im Kreis sitzen, glauben vielleicht, dass der Arzt mir einfach Sobril verschrieben hat und dass ich zu viel genommen habe, dass ich jahrelang von Arzt zu Arzt gewandert bin und Rezepte gesammelt habe. Ich will, dass sie es wissen. Dass es hart war und echt.
Mitten auf dem Tisch steht eine Schale mit Keksen, ich nehme einen. Er schmeckt trocken und nach Pappe. Ich nehme noch einen und noch einen.
Du musst ziemlich hoch oben gewesen sein, um im Keller eines Seniorenzentrums zu landen. Vom Himmel zu fallen und eine Bruchlandung auf erbaulicher Literatur hinzulegen, zwischen Keksen und Pulverkaffee. An der Wand hängt eine Liste mit den Aktivitäten der Woche: Briefmarken ausschneiden. Sturzvorbeugende Gymnastik. Einführung ins Internet.
Ein Typ redet darüber, wie selbstbezogen er war, als er Drogen genommen hat. Ich kapier nicht, was das mit mir zu tun hat. Ich war kein bisschen auf mich selbst bezogen. Sondern auf die Drogen.
Er hat einen Pferdeschwanz und sehnige Arme. Er erzählt, dass er im Jahr 2010 all sein Geld verbrannt hat, damit er sich keine Drogen damit kauft. Eine halbe Stunde später hat er einen Kumpel angerufen, um sich was zu leihen.
Er ist seit sieben Jahren clean.
Es ist ein bisschen wie das Nachglühen nach einer Feier. Böse Kindheitserinnerung, und der Kater steht schon vor der Tür.
Ich weiß nicht, wie viel Geld er verbrannt hat. Ich frage mich, ob es ein paar vereinzelte Lacher in einem Keller zehn Jahre später wert war.
Hab jetzt einmal die Woche einen Job als Kaffeekocherin, ich leiste Service, Dienst, als wäre es eine Andacht, eine Dose Pulverkaffee aus einem Schrank zu nehmen, ein wenig erbauliche Literatur auszulegen. Den Kasten mit den Schlüsselringen aufzuschließen, die die drogenfreien Monate angeben, wie Prämien, die Kinder beim Zahnarzt bekommen.
Ich presse den gelben Schlüsselring zusammen, bis meine Fingerknöchel weiß werden. Ich habe eine Liste aller Personen gemacht, die ich verletzt habe. Ist das so einfach? Beichten, dem Teufel widersagen, Buße tun. Als wäre das Problem etwas, das ich getan habe. Als ob zehn Schreibhefte ausreichten, um aufzuzählen, wie weit der Strich über den Rand gerutscht ist. Ich schreibe Mama und Papa auf. Und Joakim. Wie ich ihm die Pillen aus dem Mund gestohlen habe. Wie er zu etwas wurde, das ich in den Mund stecken konnte, nur, um es dann auszuspucken. Wie der Nachgeschmack noch immer vorhanden ist, bitter und süß.
Ich gieße mir vor dem Lesesaal der Musikhochschule ein Glas ein, nehme einen Schluck, gehe hinaus und sauge die kalte, klare Herbstluft ein. Meine Lunge ist nicht mehr überanstrengt und grau, sondern rosa, wie Babyhaut. Dasselbe gilt für mein Gesicht, die Pigmente sind wieder da. Das Skelett, das vorher in engem Kontakt zur Haut stand, ist jetzt warm vom Fleisch, und das Fleisch ist nicht mehr verdorben, sondern lebendig, fast jung. Mein Blick ist offener, ich sehe die Farben der Bäume und des Himmels, nicht nur den Weg vom Geldautomaten zu dem Typen an der Ecke in meine Hosentasche in meine Lunge.
Es kam eine Anfrage, ob ich ein Weihnachtsinterview für die Unizeitschrift machen kann, die gleiche Beicht-, Widersagens- und Heldinnengeschichte, die man schon kennt: Westendmädchen mit silberner Kehle, die den Löffel an beiden Enden angezündet hat, macht eine Ausbildung zur Musiktherapeutin, um Drogenabhängigen zu helfen.
Ich rede darüber, wie das Heroinrauchen meine Stimme ruiniert hat. Über den Weg hinaus. Darüber, wo der Weg hinaus dann hineingeführt hat. Ich sage, dass ich eine silberne Stimme hatte. Einen Sopran. Bis er in Silberpapier gewickelt wurde. Gesprungen ist. Risse bekam. Habe ich erwähnt, dass ich den Schuss auf einem Silberlöffel vorbereitet habe? Schreib das. Ihr könnt das Interview Das Mädchen mit den Schwefelhölzern nennen. Der Sänger von Hope Dealer, Joakim, hat ein Lied geschrieben, das so heißt.
Ich erzähle über mein drogenfreies Leben. Dass es ein dankbarer Zustand ist. Dass ich an einem Schaufenster vorbeigehen und ein Kleid für tausend Kronen sehen kann und dass ich diese Summe nicht mehr in Portionen und Gramm umrechne. Dass die Welt größer geworden ist als etwas, das auf einer Feinwaage Platz hat.
Das Interview erscheint zwei Wochen später mit der Überschrift: Ehemalige Kirchensängerin: Ich war heroinabhängig. Auf dem Foto sehe ich ein bisschen heruntergekommen aus. Aber ich bin eine Ex-Drogensüchtige. Eine Secondhandjacke. Ein bisschen abgenutzt, redesignt. Cool auf eine zerzauste Weise.
Habe mich selbst verkauft
für fünfzehn Minuten
ohne mich selbst
In der Mensa kommt eine andere Studentin zu mir, sie hat das Interview in der Unizeitschrift gelesen. Ihr Blick ist fast schon ehrfürchtig.
Dass du es wirklich geschafft hast, auszusteigen, sagt sie, das ist unglaublich beeindruckend.
Ich sehe sie an. Es wäre beeindruckender gewesen, gar nicht erst einzusteigen.
Ich träume von Rauchsignalen. Joakim sitzt da mit der Alufolie, und von der Folie steigen in kleinen Formationen ein Drachenkopf und ein Herz auf. Ich sehe die Formationen an, versuche, sie mit dem Mund einzufangen, wie ein Kind Frühlingsregen einfängt, aber sie lösen sich auf, fliegen aus dem Fenster.
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, schrieb Joakim.
Sie legt Feuer an Smack / Feuer und Crack / Ich sehe den Brand / in Kleinmädchenhand / Ein Veilchen mit Folie / Eine der Braven, Unruhigen / Spielt mit Streichhölzern / In die Mystik / Brennt bis zum Grund / ist Asche, doch der Mund / ist offen für die Flamme / zieht ein, verschluckt die Scham.Und meine Antwort:
Erst wollte ich dein Herz, deine Schenkel, deinen Kopf / dann die Lunge, die Adern, das Blut / Wollte dorthin, wo Lebende niemals hingehen / in jeden Abszess, jeden Fehlschuss, jede Wunde / Ich glaube an Aliens und an Gott / denn du bist eine Leinwand aus Haut / und dahinter fließt ein Gramm / sehn uns im Himmel oder in der Notaufnahme.Mein Körper und meine Pappkartons sind bei Sigurd, also wohne ich wohl bei ihm. Ein Zuhause ist etwas Gefährliches. Ich hinterlasse überall Beweise: Haare in der Haarbürste, Zahnpastareste an der Tube, Schokoladenpapier im Abfall. Wir wohnen in Majorstua, und er sagt, dass ich bald meine Kartons auspacken kann. Wir wohnen seit zwei Monaten zusammen.
Sigurd ist so einer, von dem Mama sich einmal vorgestellt hat, dass ich mit jemandem wie ihm enden würde. Und ich habe ihn gefunden, nachdem ich wieder ich selbst geworden bin, wie Mama sagt, und ich hab keinen Nerv, sie zu fragen, was das bedeutet. Ich serviere ihm einen Pfannkuchen, mache mir selbst auch einen, während er in die Zeitung schaut, ich denke an einen Typen bei den Meetings, der erzählt hat, dass er, als er für sich und seine cleane Frau ein Omelett zubereitete, einen Haschklumpen aus der Tasche zog und den Klumpen in die Pfanne fallen ließ.
Ich verurteile dich nicht wegen deiner Vergangenheit, sagt Sigurd, ohne aufzublicken.
Als ob ich gefragt hätte.
Ich esse den Pfannkuchen, und er legt die Zeitung weg. Er steht auf, nimmt meine Hand, sieht mich an.
Du bist so schön, sagt er.
Ich fange an, die Bratpfanne zu spülen. Er legt von hinten seine Arme um mich.
Ich will Kinder mit dir, sagt Sigurd.
Ich spüle weiter, die Bratpfanne muss ganz sauber sein.
Fast jede Nacht träume ich von Joakim. Es ist immer derselbe Traum. Er steht mitten auf der Straße, in einer löchrigen Jacke, dann sehe ich, dass er löchrig ist. Das Gesicht. Die Haut. Ich gehe auf ihn zu. Brauche nichts zu sagen, wir sehen einander nur an. Ich lege die Arme um ihn, kann Knochen und Knöchel spüren, dann werden sie weicher, zu weich, lose, und während ich dort stehe, scheint etwas zu zerbröseln, er rieselt aus meinen Armen und auf den Boden, wie Pulver.
Es ist mitten am Tag, und Nebel hängt über den Weihnachtsdekorationen auf der Karl Johan, als ich ihn tatsächlich entdecke. Er ist weit weg, aber ich sehe es an seinem Gang, das Stocken bei jedem Schritt, wie er die Zeit mit sich herumschleppt, als wäre er nicht nur ein Junkie, sondern auch ein Kind, das noch nicht richtig laufen gelernt hat. Er lebt. Na ja, sein Körper schlurft jedenfalls umher, sein Herz schlägt, sein Blut fließt durch die Adern.
Er kommt näher, aber dann ist er es doch nicht. Das Gesicht ist grau und wie mit einem Radiergummi ausgewischt, ein Körper, der vorüberschlurft, weitertreibt und verschwindet. Ich bleibe einfach stehen. Spüre ein Prickeln im Gesicht, wie Nadelstiche.
Afterburn nennt Laura das.
Eine Angst. Suffangst. Das kann mehrere Jahre anhalten.
Dass Joakim den Platz einnehmen konnte, den er in mir eingenommen hat, wo doch für niemanden besonders viel Platz war, lag vielleicht daran, dass seine Fingernägel nadelspitz waren. Sie bohrten sich unter die Haut, in die Eingeweide. Und weil seine Hände sich warm und weich um die Lunge legten, während sie vom Opiatrauch erfüllt wurde. Er ließ mein Herz nicht schneller schlagen, eher langsamer, seine Hände liebkosten mein zugedröhntes Herz.
Früher habe ich Cuba-Schokolade gekauft, um Rauchfolie zu haben, jetzt, um auf dem Weg zum Bus zwei Riegel davon zu essen. Sie haben ohnehin das Silberpapier abgeschafft, zu viele Junkies haben die Schokolade aus dem Kiosk geklaut. Rausch ist Rausch, und Schmerz ist Schmerz, wie man so sagt. Als ob du Junk und Junkfood in dieselbe Schublade stecken könntest. Als ob ich jetzt in derselben Schublade wäre wie damals. Meine Webpelzmäntel im Sommer, weil ich immer gefroren habe, die Adern zogen sich unter der Haut zusammen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich schwitze, rosa Gesicht, rosa Jacke. Im Bus drücke ich mich ans Fenster, aus Angst, dass alles aus mir herausquillt und die anderen trifft. Normalgewicht sagt der BMI-Rechner im Netz. Untergewicht Stufe 2 stand dort vor einem Jahr, als ich noch die volle Kontrolle hatte.
Die Overeaters Anonymous treffen sich im selben Raum wie die NA. Wir gehen auf dem Gang aneinander vorbei. Drogensüchtige, die Heroin durch braunen Zucker ersetzt haben, hinaus, Bulimikerinnen, die nach umfassenden Süßigkeitendiebstählen zu Strafen verknackt worden sind, herein.
Ich habe meine Handschuhe vergessen und gehe wieder hinein, als die Überfresser gerade mit ihrem Treffen anfangen. Ich bahne mir einen Weg durchs Fleisch zu dem Tisch, wo die Handschuhe liegen. Ich kann noch hören, wie der Moderator sagt, dass man essen muss, das sei anders als bei Drogen und Alkohol, und deshalb müsse man selbst definieren, was Enthaltsamkeit bedeutet.
Die Definition habe ich geschafft, als ich überhaupt noch etwas geschafft habe.
Sie sehen mich an, ich bin trotz allem nicht dick genug, und ich mache, dass ich wegkomme. Beinahe wäre ich auf einem Treffen der Overeaters Anonymous gelandet, sie haben mich kurz für eine von ihnen gehalten. Ich hoffe, ich kann wieder in eine gesunde Spur mit tausend Kalorien pro Tag finden.
Ich und mein Schlingen. Als wäre ich ein einziger großer Mund und sonst gar nichts. Als hätte ich nie aufgehört, ein Säugling zu sein, der an Mamas erschöpfter Brust nuckelt. Die Adern an Joakims Schwanz – es war am besten, wenn ich ihn schmecken, wenn ich ihn mir bis zum Herzen hinabbohren, wenn ich jeden Tropfen auflecken konnte. Versinken wie im Gebet, vereint mit einem Speichelfaden. Die Pillen wie die Perlen einer Reichen – nie genug, immer eine Schmuckschatulle oder eine Schachtel oder eine Schublade, in der mehr lag. Meine Stimme, die kam von innen, hätte ich sie losgelassen, ich hätte vielleicht alles losgelassen.
Sieh dir die Pupillen an, riesig und winzig klein. Die Fingerknöchel. Die Haut. Nur nicht das Vakuum zwischen den Lippen, ein schwarzes Loch, das alle Materie verschlingt.
Im Freakforum sagt jemand, dass man einen Schuss mit Salzwasser setzen kann. Ohne Stoff. Dass das eine Art milde Erleichterung bringt. Ich kaufe in der Apotheke Salzwasser und eine Spritze. Als ich das erste Mal eine Spritze gekauft habe, sah mich der Apotheker aus zusammengekniffenen Augen an. Dann, als die Spritze begann, mir Farbe und Fleisch aus dem Gesicht zu saugen, hätte ich genauso gut auch eine Packung Ibu kaufen können, ohne dass jemand reagierte. Jetzt ist da wieder dieser Blick. Ich lächle, es ist ja nicht so schlimm, wie er glaubt, oder in gewisser Weise ist es schlimmer. Wie der Typ, der sich einen naturgetreuen Wachsabguss seiner Ex machen ließ. Die Tüte schleudert beim Gehen hin und her, mir ist schlecht, als ob mein Körper glaubt, er wäre auf Entzug.
Als ich das Feuerzeug und einen leeren Löffel hervorziehe, entspanne ich mich bis tief in die Beine hinab. Es hat schon angefangen. Der Schuss beginnt nicht mit dem Schuss, er beginnt beim Laden der Pistole. Ich lasse ein Feuerzeug unter dem Löffel brennen, versuche mir vorzustellen, dass dort H aufkocht. Fülle die Spritze mit Wasser. Binde mir einen Riemen so fest um den Arm, dass sich die Ader endlich zu erkennen gibt. Als der Stich kommt, breitet es sich in mir aus.
Du siehst so gesund aus, sagt Mama, fast, wie bevor du krank wurdest.
Sie sieht mich mit einem prüfenden Lächeln an.
Wieso denn krank?
Nein, ich meine – richtig krank.
Ich nicke. Let go and let God.
Ich habe heute im Bus eine junge Drogensüchtige gesehen, sagt Mama. Sie war jung, ziemlich hübsch. Sah aus, als ob sie sich gerade einen Schuss gesetzt hätte. Sie setzte sich neben mich und aß gierig ein Rosinenbrötchen, und dabei sabberte sie. Sie ist mir fast in den Schoß gefallen.
Ich weiß, dass sie versucht, mir Angst zu machen, aber damals hätte ich niemals Rosinenbrötchen gegessen.
Wenn ich daran denke, wie du gelebt hast, sagt Mama, dann tut das so weh, dass ich damit fast nicht umgehen kann. Aber dann denke ich, dass es für dich viel schlimmer gewesen sein muss, als es für mich ist, daran zu denken, und dann wird es nur noch schlimmer.
Vielleicht war es für euch am schlimmsten, sage ich.
Wie soll das möglich gewesen sein, sagt Mama, du warst doch halb tot.
Eben, sage ich.
Mama will ins Weihnachtskonzert, eine Sopranistin, die sie kennt, singt in der Dreifaltigkeitskirche ein Solo. Ich kann zu nichts mehr Nein sagen, sie braucht mich jetzt, ich habe nicht nur – oder nicht einmal in erster Linie – Nein zu Drogen gesagt, sondern Ja zu einer Normalität, die so verkrampft ist, dass sie schon unnormal wird. Wir gehen los. Der Schnee liegt auf dem Boden wie zerfetzte Kleenex-Tücher. Wir gehen vorbei an Weihnachtslichtern und einem müden Typen mit einer Tasse, der Stille Nacht auf der Gitarre spielt, da erkenne ich einen Mann mit Kapuzenpullover. Er entdeckt mich auch, ich nehme Mamas Hand.
Komm, sage ich und ziehe Mama mit mir, laufe in ein Café, schließe uns auf der Toilette ein.
Schuldest du ihm Geld?, fragt Mama.
Ich habe keine Ahnung, was ich ihm schulde, sage ich.
Sie lässt sich zurücksinken, seufzt.
Gehen wir ins Konzert, sagt sie. Du siehst so reizend aus in dem blauen Kleid.
Eine Kirche zu betreten, ist, wie die Zeit zurückzudrehen bis damals, als ich zwanzig, fünfzehn, fünf Jahre alt war. Schon im Vorraum schrumpfen meine Brüste, bis nur noch ein flacher Resonanzkasten übrig ist. Im Kirchenschiff werden meine Hüften schmaler, und als ich die erste Reihe erreiche, gleich beim Chor, schaue ich hinab auf meine Hände, es sind Kleinmädchenhände.
Dann blinzle ich, und alles ist wieder normal, ich bin ich selbst. Elise, vierundzwanzig. Wer immer das sein mag.
Ach, lass die Stimme reifen. Lass sich alles in der Brust ausbreiten, Platz einnehmen, einen Leib füllen, ein Leben, einen Kirchenraum. Nicht von Knospe zu unreifer Frucht zu … Fäulnis übergehen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, / fürchte ich kein Unglück; / denn du bist bei mir, / dein Stecken und dein Stab trösten mich.
Denn du bist bei mir. Die Sopranistin singt mit zitternder Stimme. Mama presst meine Hand, ich presse zurück.
Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist weiß. Es steht abseits von blauen Flecken, weit weg von Abszessen an der Seite der Oberschenkel, geschwollenen Beulen und gelbem Eiter. Also, wenn du muskulär in die Arschbacke drückst und die Nadel nicht lang genug ist und der Stoff nicht bis ganz zum Muskel gelangt. Der röter und röter wird und am Ende voller Qual ist, und Qual ist etwas anderes als Schmerz, etwas ganz anderes.
Genug davon.
Zu Hause musste kein Blut unter den Teppich gekehrt werden. Keine Flecken, die nicht verschwanden. Keine Monster unter dem Bett. Am dichtesten dran war die Puppe mit dem Porzellankopf, Anna, die mit einer Spitzenhaube auf dem Klavier sitzt und mich mit leeren Glasaugen anstarrt. Sie sieht zugedröhnt aus. Ich hatte sie bei mir im Bett, als ich klein war. Vielleicht kam es ja daher.
Mama hat für uns Brötchen gebacken und Kaffee gekocht, ihre Hand ist ein bisschen unsicher, als sie mir die Tasse reicht. Als ob sie hier auf Entzug wäre, als ob ihr ein lebenswichtiges Medikament genommen würde, als ob alle Apotheken und Straßenecken geschlossen wären.
Sollen wir ein bisschen singen?, fragt sie.
Ich räuspere mich.
Versuche, meine Kehle wieder von Gesang handeln zu lassen und nicht von Gewalt. Innen und außen. Bulimie, Injektionsstiche. Hab diese ganze Geschichte erbrochen, und jetzt sind nur noch unsichtbare Silberfäden übrig, bereit, Menschen an das Geräusch zu binden, sie in mein Netz zu ziehen.
I’ve placed my cradle on yon hilly top
And aye as the wind blew my cradle did rock
Oh hush-a-by, Baby, o baw lily loo
And hee and baw, birdie, my bonnie wee doo.
Hie-o, wie-o what will I do wi’ ye?
Black’s the life that I lead wi’ ye
Many o’you, little for to gi’ye
Hie-o, wie-o, what will I do wi’ ye?
Deine Stimme erholt sich immer mehr, sagt Mama. Ich höre fast nicht, dass du älter bist. Ich meine, natürlich höre ich es, aber es ist kein so großer Unterschied zu deiner Teenagerzeit. Vielleicht ist das ja gerade das Gute daran, eine Art erwachsene Kinderstimme.
Ich sage nichts.
Ich hab solche Angst, dass du wieder verschwindest, sagt sie.
Ich bleibe hier. Ich habe aufgehört, sage ich und nehme ihre Hand.
Du bist jetzt in Sicherheit, Mama.
Die Narcotics Anonymous haben ein einfaches Programm für komplizierte Menschen, heißt es. Ich würde es eher ein kompliziertes Programm für einfache Menschen nennen. Meine Sponsorin, Laura, ist Australierin, sie geht zu den NA, seit sie achtzehn ist. Offenbar ist ihre ganze Familie hingegangen.