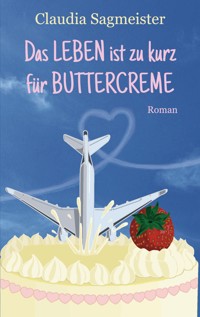Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Meisinger Krimi
- Sprache: Deutsch
Wie ein einziges großes Klassentreffen sollte das Fest der hiesigen Realschule ausfallen, doch nun ist der zukünftige Konrektor Lukas Stein tot. Als Maxi an den Tatort, den Wasserturm von Schnaipfing, gerufen wird, trifft sie auf überraschend viele bekannte Gesichter. Darunter auch auf ihren Kollegen, den Knogl, der möglicherweise ein paar Antworten auf verschiedene Fragen geben könnte. Doch er und seine Freunde verweigern hartnäckig jede Aussage zu den Geschehnissen der vergangenen Nacht. Fakt ist: Darüber, dass ihr ehemalige Lehrer tot ist, scheint hier niemand wirklich traurig zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Claudia Sagmeister, geboren 1972, lebt mit ihrer Familie in Niederbayern. Ihre Krimis über die unkonventionelle Kommissarin Maxi Meisinger landen regelmäßig auf der BoD-Bestsellerliste. 2024 zeigte sie ihr schriftstellerisches Können von einer neuen Seite mit dem Liebesroman:
»Das Leben ist zu kurz für Buttercreme.«
Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.
Handlung und Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Für Sandra, Christian
und meine Mädels vom
kleinen Klassentreffen!
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 1
Keine Ahnung, ob es Erwins Mundgeruch ist, der mich wach werden lässt, oder ob es das Klingeln des Telefons ist, vermutlich beides zugleich.
Ziemlich unausgeschlafen öffne ich meine Augen. Erwins Kopf liegt nur wenige Zentimeter von meinem entfernt auf dem Kopfkissen. »Boah, Erwin, du stinkst«, beschwere ich mich bei ihm und drehe mich weg. Ihn interessiert meine Meinung herzlich wenig. Ich greife angewidert nach dem Handy, das unablässig klingelnd auf dem Nachtkästchen liegt.
»Guten Morgen, Hafner«, gähne ich.
»Hab’ ich Sie geweckt, Meisinger?«
Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr, die ebenfalls am Nachttisch liegt. Es ist erst halb sieben Uhr morgens. Draußen geht gerade die Sonne auf. »Nein, ich bin schon seit Stunden auf den Beinen.«
Den ironischen Unterton nimmt er gar nicht wahr.
»Äh, ja, also … könnt ich vielleicht den Erwin einmal … ich meine, wie geht’s ihm denn?«
»Prächtig, er liegt neben mir im Bett, wenn Sie es genau wissen wollen.«
»Das hört sich gut an.« Der Chef klingt erleichtert.
»Würden S’ ihm vielleicht einmal den Hörer geben?«
»Erwin, für dich, der Chef. Dass mir keine Klagen kommen!«, mahne ich ihn und lege das Telefon neben den Hund aufs Kissen. Den Rest des Anrufs erspare ich mir.
»Hafner, ich gehe jetzt eine Viertelstunde ins Bad, dann leg’ ich auf!«, rufe ich laut, bevor ich das Zimmer verlasse.
Beinahe Halbzeit! Nur noch ein paar Wochen, denke ich erleichtert, während ich mich ausgiebig mit der Handbrause in meiner Badewanne abdusche. Normalerweise bin ich relativ zügig mit meiner Morgentoilette fertig, aber seit Erwin bei mir eingezogen ist – nur vorübergehend wohlgemerkt – lasse ich mir damit wesentlich mehr Zeit. Sie glauben ja gar nicht, was bei mir seit vierzehn Tagen abläuft. Aber ich denke, ich muss erst ein wenig weiter ausholen, damit Sie im Bilde sind.
Eigentlich hängt alles damit zusammen, dass der Hafner seit Jahren unter schrecklicher Migräne leidet. Und diese Attacken wurden in den letzten Monaten zunehmend schlimmer. Nicht nur, dass die Anfälle heftiger wurden, sie kamen auch in immer kürzeren Zeitabständen. Das ging so weit, dass sich mein Dienststellenleiter fast ausschließlich von Schmerztabletten ernährte und nur mehr wie ferngesteuert auf dem Revier herumlief. Arbeitstechnisch war er kaum mehr zu gebrauchen und seine Laune war ebenfalls dementsprechend schlecht. Irgendwann sprach dann sein Neurologe ein Machtwort und beantragte für ihn eine Kur. Entspannungsübungen, Stressbewältigung und das ganze Pipapo.
Wenn Sie mich fragen, ich an seiner Stelle hätte die schon lange in Anspruch genommen. Nicht aber der Hafner. Er hat sich gewunden und davor gedrückt, ich verstand überhaupt nicht wieso. Bis er eines schönen Tages endlich mit der Sprache herausrückte. Er hatte niemanden, der sich während seiner Abwesenheit um Erwin kümmern könnte. Der Knogl hätte das wirklich gerne übernommen, doch seine Lucita war strikt dagegen. Sie hasst Hunde wie die Pest, fast noch mehr als mich, falls das überhaupt möglich ist. Eine Tierpension kam für den Hafner nicht infrage und auch sonst fand sich niemand, der seinen Vierbeiner so lange bei sich aufnehmen wollte. Und als es dem Hafner eines Tages wieder einmal richtig dreckig ging, konnte ich dieses Elend nicht mehr länger mit ansehen und sagte schließlich, sein Hund dürfe so lange bei mir wohnen, bis er, also der Chef, wieder einigermaßen fit sei.
Der Hafner bekam ganz feuchte Augen. Das erste Mal vor Freude und Dankbarkeit und dann ein paar Wochen später noch einmal, beim Abschied von seinem geliebten Vierbeiner. Dabei waren es doch nur ein paar Wochen, die beide voneinander getrennt sein würden.
Ich hatte mir für diese Zeit schon einen kleinen Plan zurechtgelegt, wie ich den Alltag mit Hund bewältigen würde. Ich hatte sogar die Erlaubnis von Hafners Vertretung, dass Erwin für diese Zeit mit ins Büro kommen dürfe, weil ich befürchtete, dass er alleine in einer für ihn fremden Umgebung, sprich, bei mir zu Hause, ein Problem haben und Unfug treiben könnte.
Womit ich allerdings überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass der Hafner jeden Tag bei mir anrufen wird, und zwar zeitig am Morgen, egal ob Werk- oder Sonntag. Nicht mich, wohlgemerkt, sondern seinen stinkenden, alten Köter.
Sagen Sie das bitte nicht weiter. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Aber nicht daran, dass Erwin, so heißt der Hund, wie Sie vermutlich schon erraten haben, so eine faule Socke ist. Ich kenne wirklich keinen einzigen Hund, der so bewegungsunfreudig ist wie er. Mehrmals täglich versuche ich ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
Erwin passt das ganz und gar nicht, aber da muss er durch, der Gute. Und seine anderen Unarten gewöhne ich ihm auch noch ab. Ich bin wirklich kein Unmensch, aber wenn ich schon jemanden bei mir wohnen lasse, kann ich doch erwarten, dass er sich an meine Spielregeln hält, oder? Und die heißen nun einmal: Mein Bett gehört mir – ich bestimme, wer außer mir darin schlafen darf, und im Bad brauche ich meine Privatsphäre.
Beides funktioniert momentan – überhaupt nicht! Wie gesagt – wir arbeiten daran, auch, was Erwins Fitness betrifft, die bei seinem Einzug überhaupt nicht vorhanden war.
Mittlerweile bin ich geschniegelt und gebügelt und wandere zurück ins Schlafzimmer. Dort nehme ich dem Hund erst einmal mein Handy weg.
»Bis Morgen, Hafner«, rufe ich laut und drücke ihn weg.
Erwin schaut mir mit großen traurigen Augen dabei zu, wie ich in meine Jeans und ein frisches T-Shirt schlüpfe.
»Er kommt ja bald wieder heim«, tröste ich ihn. »Nur noch ein paar Wochen, Erwin, dann haben wir drei es geschafft.« Ich halte den Daumen hoch. Erwin bellt kurz, als habe er mich verstanden. In diesem Moment klingelt es am Festnetzanschluss im Erdgeschoss meines Hauses.
»Auf geht’s Erwin!«, rufe ich, »das ist die Mama.« Hoffentlich motiviert das den Hund, mit mir mitzukommen. Eilig sause ich nach unten.
»Guten Morgen, Mama.«
»Mädi, du musst sofort herkommen …«
In meiner hinteren Hosentasche klingelt mein Handy. Fast gleichzeitig beginnt Erwin auf dem oberen Treppenabsatz, wie verrückt zu bellen. Wahrscheinlich meint er, es ist der Hafner, der wieder anruft, was weiß ich. Jedenfalls herrscht plötzlich ein ziemlicher Krach um mich herum. Was mir die Mama sagen will, verstehe ich nicht mehr.
»Mama, ich kann nicht zu euch kommen. Ich muss zur Arbeit und du hörst, ja, was bei mir los ist. Wir telefonieren am Abend noch mal. Servus!«, schreie ich in den Hörer und lege auf. »Aus!«, brülle ich Erwin entgegen und nehme gleichzeitig das Gespräch auf der anderen Leitung an. Noch ehe ich meinen Namen nennen kann, überrollt mich ein Schwall schnell gesprochener Worte. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Verzweifelt brülle ich in den Hörer: »Stopp!« Das zeigt Wirkung, am anderen Ende herrscht Ruhe. Ich atme tief durch. »Wer spricht da und was ist passiert?«, erkundige ich mich ruhig. Ich atme tief durch.
»Lucita. Hier spricht Lucita Knogl.«
Ein ungutes Gefühl kriecht in mir hoch. Nicht etwa, weil ich die Lucita nicht mag und sie mich nicht, sondern weil mich die Lucita so dermaßen gefressen hat seit dieser dummen Kainzbauer-Geschichte, dass sie mich niemals freiwillig anrufen würde, wenn nicht etwas wirklich Schlimmes passiert wäre. Und das kann dann eigentlich nur meinen Kollegen, den Knogl, betreffen – ihren Mann. In allen anderen Fällen wäre er selbst in der Leitung, so viel ist sicher.
»Was ist passiert?«, frage ich nach. Meine Hand krampft sich fest um das Telefon. Der Knogl ist eine Seele von Mensch. Wir arbeiten nun schon seit fast zwei Jahren zusammen und teilen sogar das Büro miteinander. Er war von Anfang an nett und aufgeschlossen mir gegenüber, was man von meinem Chef nicht gerade behaupten kann. Der Knogl hat mich sofort mit allen wichtigen Leuten im Ort zusammengebracht und seit dem letzten Jahr ist er beinahe so etwas wie meine rechte Hand geworden.
Ich möchte bitte, dass das noch lange so bleibt, denn wir verstehen uns wirklich prächtig. Auch wenn er mich manchmal in den Wahnsinn treibt.
»Mein Mann ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen«, erklärt mir Lucita aufgeregt.
Meine Anspannung lässt nach, ich atme leicht auf.
Der Knogl hatte gestern so etwas Ähnliches wie ein großes Klassentreffen. Fünfzig Jahre Ritter-von-Pröll-Realschule Schnaipfing. Ein Riesenevent, zu dem jeder eingeladen war, der Rang und Namen besitzt oder jemals auf dieser Schule war, sei es als Schüler oder als Lehrer. Der Knogl hatte in den letzten Wochen von nichts anderem mehr geredet und wie sehr er sich darauf freue, den einen oder anderen aus seiner Schulzeit wieder zu treffen, denn ein Klassentreffen war seit seinem Abschluss dort nie zustande gekommen. Mit diesem Hintergrundwissen gehe ich davon aus, dass der Knogl im großen Freudentaumel des Wiedersehens schlichtweg mit seinen Spezln versumpft ist und deshalb auswärts schläft. Und genau das teile ich seiner Holden jetzt mit. Doch anstatt sich zu beruhigen, regt diese sich noch mehr auf.
»Mein Mann ist noch nie ohne triftigen Grund über Nacht weggeblieben«, echauffiert sie sich. »Wie können Sie nur so etwas von ihm denken. Juan«, sie nennt ihn so ‒ alle anderen sagen Karl zu ihm, »Juan hätte mir Bescheid gegeben, wenn er vorgehabt hätte, nicht heimzukommen. Er ist nämlich ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Was ich von Ihnen nicht behaupten kann.«
Mein Festnetz klingelt erneut. Was zum Teufel ist denn heute nur los? Ich versuche, sie zu unterbrechen. »Lucita, ich muss leider …« Es ist sinnlos.
»Meinem Mann muss etwas passiert sein. Sie müssen ihn suchen«, fordert sie vehement von mir.
»Ich muss ans andere Telefon«, sage ich mit Nachdruck. Erwin beginnt erneut zu bellen. Ich werde gleich wahnsinnig. Es ist noch nicht einmal sieben Uhr morgens und bei mir steppt bereits der Bär.
»Ich verlange von Ihnen …«
Während Lucita ihre Forderungen in den Hörer diktiert, hebe ich am Festnetz ab. Das Klingeln bringt mich sonst noch um den Verstand. »Mama, ich kann jetzt nicht!«, schreie ich gegen Erwins Gebell und Lucitas Toben an.
»Mädi, du musst …«
»Ich ruf’ zurück!«, plärre ich und lege wieder auf. Ihr Ärger ist mir sicher, aber nicht jetzt. Ich überlege, ob heute vielleicht Freitag, der Dreizehnte ist, aber wir haben Sonntag.
»Frau Knogl«, unterbreche ich Lucitas Redeschwall, von dem ich eh kaum etwas mitbekommen habe. »Sie warten jetzt bitte noch den Vormittag ab. Der Karl kommt sicher bald nach Hause. Oder fragen Sie doch bei seinen Freunden nach. Vielleicht wissen die, wo er steckt. Bestimmt hat er ein bisserl zu tief ins Glas geschaut und bei einem Spezl übernachtet, pflichtbewusst, wie er ist«, wiederhole ich ihre Worte. »Für eine Fahndung ist es jetzt eh noch viel zu früh.« Ohne ihre Antwort abzuwarten, beende ich auch dieses Gespräch, indem ich einfach auflege. Jetzt brauche ich erst einmal einen starken Kaffee, beschließe ich gestresst. Ich komme genau fünf Schritte in Richtung Küche, da vibriert mein Handy erneut. Ich vermute, dass es noch einmal Knogls Frau ist, doch die angezeigte Rufnummer ist eine andere als zuvor.
»Meisinger«, melde ich mich.
»Riedmüller, Stadtwerke Schnaipfing. Frau Kommissarin, wir haben da einen Toten im Wasserturm.«
»Okay. Wo genau?«
»Er liegt unten im Parterre auf dem Boden.«
»Bitte fassen Sie nichts an. Lassen Sie alles so, wie Sie es vorgefunden haben«, ordne ich an. »Wir kommen sofort.«
»Tja, Erwin«, wende ich mich an den Hund. »Das Frühstück müssen wir wohl heute ausfallen lassen. Oder besser gesagt, für mich fällt es aus. Da hast du Glück gehabt, statt einer morgendlichen Joggingrunde kannst du jetzt noch eine Weile schlafen, bis ich wieder zurück bin.«
Erwin gähnt gelangweilt, als habe er mich verstanden.
Ich fülle seinen Napf mit Wasser, stelle ihm eine Schale Trockenfutter hin und ermahne ihn, brav zu sein.
Dann informiere ich die SpuSi und mache mich auf den Weg zum Wasserturm. Wieder beschleicht mich ein ganz seltsames Gefühl. Der Knogl ist in der Nacht nicht nach Hause gekommen und der städtische Mitarbeiter hatte von einem Toten gesprochen, also handelt es sich um eine männliche Leiche.
Kapitel 2
Der Wasserturm steht am Stadtrand von Schnaipfing. Das sind von mir zu Hause doch ein paar Kilometer Entfernung, darum nehme ich mein Motorrad, um schneller vor Ort zu sein. Ich treffe sogar noch vor der SpuSi dort ein.
Am Ende der staubigen Zufahrtsstraße zum Turm steht ein Mann mit einer Zigarette im Mund. Ich vermute in ihm den städtischen Mitarbeiter.
Unweit des Eingangs stelle ich meine Maschine ab, nehme den Helm ab und ziehe meine Jacke aus. Beides lege ich auf den Sitz. Dann marschiere ich dem Mann entgegen, der mich zwar bei meinem Tun beobachtet, aber keinerlei Anstalten macht, auf mich zuzugehen.
»Guten Morgen. Meisinger«, stelle ich mich vor und strecke ihm die Hand entgegen. Vielleicht hat er mich nur nicht erkannt.
»Früchtl«, erwidert er nur knapp.
Ich blicke mich kurz um, doch sonst ist hier draußen niemand zu sehen. »Ich suche nach einem Herrn Riedmüller von den Stadtwerken«, sage ich und wende mich zur Tür.
»Der ist wohl drinnen, oder?«
Er hält mich zurück. »Da können S’ jetzt nicht hinein.« Unsicher kratzt er sich am Kopf. »Da gibt’s ein … technisches Problem, glaub’ ich.«
»Ja, ja, ich weiß“, beruhige ich ihn. »Deswegen bin ich ja da. Kripo Schnaipfing.«
Er atmet erleichtert auf. »Ja dann. Gehen S’ ruhig rein. Die anderen warten auch drinnen.«
Hä? Welche anderen? Ich lasse ein Nachfragen bleiben und drücke stattdessen die nur angelehnte Stahltür auf.
Die Leiche liegt wie auf dem Präsentierteller vor mir, ohne dass ich einen Schritt in das Gebäude setzen muss, und ihr Zustand, den ich aus der Distanz heraus bereits erahnen kann, deutet auf eine große Fallhöhe hin.
Ich gehe ein paar Schritte auf sie zu und blicke dabei in die Höhe.Die Sachlage scheint bereits klar zu sein. Ziemlich weit oben, es müssen wohl einige Stockwerke sein, wenn ich die vielen Treppen und Geländer betrachte, erkenne ich in der Decke eine kleine Aussparung, die nach einer geöffnete Luke aussieht. Das soll sich die SpuSi nachher genauer ansehen.
»Guten Morgen, Frau Meisinger«, ein groß gewachsener Herr in Anzughose und weißem Hemd mit dem Emblem der Stadt auf der Hemdtasche kommt auf mich zu. »Kurt Riedmüller«, er reicht mir die Hand. »Schön, dass Sie so schnell kommen konnten.«
»Na hören Sie mal, das ist ja wohl selbstverständlich«, erwidere ich. »Arbeitsunfall?«, erkundige ich mich mit einem Nicken zum Toten.
»Mitnichten«, widerspricht er sofort. »Ich weiß gar nicht, wer das ist, geschweige denn, wie der in meinen Turm gekommen ist.«
»Ihr Turm?«, hake ich belustigt nach. »Meines Wissens ist der nicht in privater Hand, sondern gehört der Stadt.«
Er revidiert auch sogleich. »So war es auch nicht gemeint. Natürlich gehört er nicht mir persönlich, aber ich bin für alles, was mit und um den Wasserturm herum zu tun hat, zuständig. Darum ist es in gewisser Weise mein Turm, weil es mein Aufgabengebiet betrifft.«
»Verstehe. Und Sie haben also keine Ahnung, wer da vor uns liegt?«, erkundige ich mich.
Ohne einen Blick auf den Toten zu werfen, schüttelt er den Kopf. »Da ist ja nicht einmal mehr ein Gesicht zu erkennen«, raunt er mir zu. »Und nur anhand der Statur …« Er schielt vorsichtig hinüber zur Leiche, wendet sich jedoch sofort angeekelt ab. »Entschuldigung. Ich kann gar nicht hinsehen, sonst wird mir sofort schlecht.«
»Sie hätten auch nicht hier drinnen auf mich warten müssen«, sage ich und füge scherzhaft hinzu: »Der läuft uns nicht mehr weg.«
»Es war ja auch nicht wegen des Toten«, gibt er zu, »sondern wegen der Damen. Die wollten partout nicht rausgehen.« Sein Blick wandert über meine Schulter hinüber zur Wand.
Ich wende mich um. Fassungslos rufe ich aus: »Das darf doch wohl nicht wahr sein!«
Auf blauen Klappstühlen sitzen, wie Zuschauer der ersten Reihe, die Mama, die Tante Rosa und eine mir unbekannte ältere Ordensschwester.
»Ich hab’ dir doch am Telefon g’sagt, du sollst sofort herkommen, Mädi!« Die Mama hat ganz relaxt ihre Beine übereinandergeschlagen. »Aber du hast ja einfach aufg’legt, ohne mir richtig zuzuhören. Selber schuld.«
»Was macht’s denn ihr da?«, fahre ich sie an.
»Den Wasserturm anschauen, was sonst?«, erklärt die Tante Rosa, als wäre das völlig normal frühmorgens am Sonntag.
»Um diese Uhrzeit?«
»Die Schwester Hermengildis wollt’ halt so gern einmal den Sonnenaufgang vom Turm aus sehen«, erklärt die Tante Rosa in ihrer gewohnt resoluten Art. »Darum sind wir schon in aller Herrgottsfrühe nach Schnaipfing gefahren. Danach wollten wir zur Frühmesse und im Anschluss hätten wir bei dir vorbeig‘schaut.«
»Bei mir?«, entfährt es mir entsetzt. »Warum denn das?«
»Weil die Hermengildis mit der Fanny befreundet war. Sie stammt nämlich auch aus Schnaipfing und jetzt lebt’s im Kloster in Michlbach. Von da kennen wir uns.« Sie tätschelt der Schwester beherzt den Oberschenkel. »Gell, Hermengildis«, schreit sie die Schwester an.
»Ja, also den Sonnenaufgang haben wir jetzt verpasst«, meldet sich nun auch die Ordensschwester zu Wort. »Fahren wir halt wieder heim, unverrichteter Dinge.« Schwerfällig erhebt sich die alte Dame von ihrem Sitzplatz.
»Tut mir leid, Frau …« Wie spricht man denn eine Ordensschwester richtig an? Wissen Sie das?
Die Mama hilft mir aus der Verlegenheit. »Sag ruhig Schwester Hermengildis. Des passt schon«, sagt die Mama laut.
Die Schwester nickt mir zu.
»Ja, dann – Schwester Hermengildis, Sie müssen leider noch dableiben. Sie gehören zu den Zeugen und ich muss Sie erst noch alle befragen. Vorher kann ich Sie nicht weglassen.«
Die Ordensfrau bleibt weiter stehen.
»Sie hört schlecht«, sagt die Mama zu mir und schreit die Schwester an: »Dableib’n müss’n wir noch, Hermengildis!«
Ergeben mit dem betagten Haupt nickend, setzt sich die Ordensfrau wieder hin.
Dafür regt sich jetzt die Mama fürchterlich auf. »Wovon sollen wir denn Zeugen sein, Mädi, hä? Dass da ein Toter liegt, oder was? Der war schon vor uns da. Da, an diesem Platz hat er gelegen, als wir reingekommen sind. Was willst denn da groß fragen, hä?«
»Dann hättet ihr den ja schon von der Tür aus sehen müssen, so wie ich. Warum seid’s denn dann überhaupt hineingegangen und habt nicht draußen auf mich gewartet?«
»Erstens haben wir nachg’schaut, ob er noch schnauft, und zweitens, glaubst du, wir stehen uns da draußen die Füß‘ in den Bauch, bis du kommst? Wirklich nicht. Wir sind nicht mehr die Jüngsten.«
»Habt ihr irgendwas angefasst?«, erkundige ich mich streng.
»Natürlich nicht!«, entgegnet die Mama in gleichem Ton.
Ich atme auf. »Trotzdem brauche ich eure Aussagen fürs Protokoll. Denkt schon mal nach, ob ihr was gesehen oder gehört habt oder ob euch sonst irgendwas aufgefallen ist.«
»Das sind vier Sätze. Die kannst du dir auch jetzt gleich notieren. Der Riedmüller hat uns die Tür aufg‘sperrt. Wir sind reingegangen. Der Tote lag schon da, mitten auf dem Boden, wo er jetzt auch liegt. Wir haben ihn nicht angerührt und außer uns war niemand zu sehen. Punkt.« Sie nimmt ihre Handtasche vom Schoß und steht schwungvoll auf. »So und jetzt pack ma‘s. Du weißt ja, wo wir wohnen. Auch wenn du dich herzlich selten bei uns blicken lässt. Ich frier’ mir doch da herinnen nicht den Arsch ab. Weißt’, wie kalt dass es da an der Wand ist!«
Auch die beiden anderen erheben sich langsam von ihren Plätzen.
»Hermengildis, möch’st du jetzt noch auf den Turm rauf oder fahren wir ein anderes Mal noch einmal her?«, schreit sie die Tante Rosa an. »Sie hört nicht mehr so gut«, erklärt sie mir, wie vorhin schon die Mama.
»Auf den Turm könnt ihr auf gar keinen Fall rauf«, bremse ich ihren Enthusiasmus ein.
»Die SpuSi muss erst noch alle Spuren sichern. Und von euch brauchen wir auch die Fingerabdrücke.«
Die Tante Rosa schaut mich verständnislos an »Zu was denn das?«
»Geh, Mädi, jetzt spinnst aber ein bisserl. Wie wenn wir was mit dem Toten da zu tun hätten.« Die Mama tippt sich vielsagend an die Stirn.
»Das ist mir schon klar. Die Fingerabdrücke dienen auch nur zum Abgleich. Wir wissen ja nicht, ob der Mann Selbstmord begangen hat, einen Unfall hatte oder ob es sich hier um Mord handelt. Sollte das der Fall sein, müssen wir eure Fingerabdrücke und die aller anderen Unbeteiligten von denen vom Täter unterscheiden können.«
Das leuchtet ihr ein.
»Das können wir aber auch bei uns auf der Dienststelle machen«, ergänze ich mit einem Blick auf die Älteste der drei, die mittlerweile etwas unruhig von einem Bein aufs andere tritt. »Dann müsstet ihr halt noch mal nach Schnaipfing fahren.«
Schwester Hermengildis flüstert Tante Rosa etwas zu.
»Sie müsste dringend auf’s Klo«, raunt mir die Tante Rosa zu. Hilfesuchend wende ich mich an den Riedmüller, der die Bitte ebenfalls gehört hat.
Bedauernd zuckt er die Schultern. »Tut mir sehr leid, aber eine Toilette haben wir hier nicht.«
»Gibt’s nicht«, schreit die Tante Rosa.
Wieder flüstert ihr die Schwester etwas zu.
»Ein Gebüsch tut’s auch!«, schreit die Tante Rosa den Riedmüller an. Anscheinend hat sie gerade vergessen, mit wem sie spricht.
Die Schwester nickt.
Nachdenklich schaut der Riedmüller wieder zu mir.
»Mei, hinterm Turm sind schon einige Stauden. Ich mein’, wir gehen da ja auch hin, wenn’s pressiert«, fügt er beinahe verlegen hinzu.
»Also gut«, stimme ich zu. »Aber bleibt bitte möglichst weit weg vom Turm, damit ihr keine Spuren zerstört, falls es welche draußen geben sollte.«
Während ich die Damen entlasse, fährt vor dem Gebäude die SpuSi vor.
»Du gönnst einem aber auch rein gar nix!«, grinst mich der Fonsi mit einer Anspielung auf seinen verpatzten Sonntag an.
Ich feixe zurück: »Du tust ja eh nur was, wenn ich dir Kundschaft bringe.«
Während sich die Kollegen drinnen an die Arbeit machen, gehe ich mit dem Riedmüller vor die Tür. Gemeinsam besehen wir uns das Türschloss. Es sind keinerlei Einbruchsspuren zu sehen. Ich schieße ein paar Fotos, dann wende ich mich mit weiteren Fragen an ihn.
»Wer hat denn alles Zugang zum Wasserturm oder vielmehr, wer besitzt einen Schlüssel dafür?«, frage ich und ziehe ein Notizbüchlein aus der Hosentasche. Den kleinen Bleistift hatte ich mir, aus Platzmangel, einfach in den struppigen Pferdeschwanz meiner Dreadlocks gesteckt. Äußerst praktisch.
»Eigentlich nur ich«, gibt er zu. Zweifelnd schaut er mich an. »Das macht mich jetzt verdächtig, oder?«, forscht er nach.
»Na ja, ein Vorteil ist es nicht gerade«, gebe ich zu.
»Ja so ein Scheißdreck!«, entfährt es ihm. Er hat sich aber sofort wieder im Griff. »Entschuldigung. Das ist mir jetzt so rausgerutscht.«
»Schon gut. Haben Sie den Schlüssel bei sich, oder wurde er Ihnen vielleicht entwendet?«
»Nein, der ist da. Sonst hätte ich den Damen ja gar nicht öffnen können.« Er greift in seine Hosentasche und zieht einen Schlüsselbund hervor. Mit geübtem Griff hat er auch sofort den passenden Schlüssel parat. »Sehen Sie, das ist er«, sagt er und hält ihn mir unter die Nase. Zur Bestätigung steckt er ihn gleich ins Türschloss und dreht ihn einmal herum. Der Riegel springt heraus und identifiziert ihn somit als den Richtigen.
»Tragen Sie den immer bei sich?«
»Sagen wir, fast immer«, erwidert Herr Riedmüller.
»Wenn ich arbeite, habe ich ihn immer an dieser Kette mit den anderen Schlüsseln, da kann er praktisch gar nicht verloren gehen, und wenn ich privat unterwegs bin, ist er zu Hause sicher verwahrt.«
»Aber dort könnte jederzeit jemand den Schlüssel an sich nehmen, oder?«, hake ich nach.
»Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber dagegen verbürge ich mich. Von meiner Familie fasst niemand den Schlüssel ohne meinen ausdrücklichen Auftrag an.«
Ich belasse es vorerst dabei. »Darf ich mal sehen?«, bitte ich und halte ihm auffordernd die Hand entgegen. Riedmüller nimmt den Bund von der Kette und reicht ihn mir.
Auf den ersten Blick wirken alle Schlüssel gleich. Dann erkenne ich doch ein paar Unterschiede. Einige Schlüssel besitzen Einkerbungen, andere nicht. Ich frage ihn danach und er erklärt mir bereitwillig, welches die Sicherheitsschlüssel für bestimmte Gebäude der Stadt sind. Dazu gehört auch der für den Wasserturm. Ein Wendeschlüssel mit verschiedenen Bohrungen, wie noch bei drei weiteren auch.
»Sie haben den Schlüssel ziemlich schnell gefunden, wobei diese vier für mich identisch aussehen«, sage ich und halte den Bund weiter auf der flachen Hand vor mich.
Riedmüller beginnt fast spitzbübisch zu grinsen. »Ein kleiner Trick«, sagt er, nimmt den Bund und hält mir den Schlüssel zum Turm etwas näher hin. Erst jetzt erkenne ich, was er meint. Die zweite Bohrung von oben wurde blau ausgemalt. Ich betrachte die anderen Wendeschlüssel nun genauer und erkenne auch an diesen, farbige Markierungen – rot, grün und braun.
»Wo schließen die anderen?«, erkundige ich mich.
»Rot ist für das Hauptgebäude der Stadtwerke, grün für alles, was das Freibad betrifft, und braun rund um die Kläranlage.«
»Wie sinnig«, stimme ich lachend zu.
»Mei, so geht’s halt schneller, wenn ich einen Schlüssel brauch‘«, gibt er zu.
Stimmen nähern sich und ich höre ganz deutlich die Mama vor sich hin schimpfen.
»Solche Saubären. Da soll’s einem nicht grausen. Pfui Teufel!«
»Was regst dich denn jetzt schon wieder auf?«, frage ich nach, als sie in mein Blickfeld kommt.
»Ja weil da hinten alles vollgepieselt ist. Fürchterlich.«
»Wo?«, hake ich nach.
»Gleich ums Eck.«
»Hab’ ich nicht gesagt, ihr sollt möglichst weit weg vom Turm gehen?«, schimpfe ich.
»Da muss man ja direkt vorbei, wenn man zu den Sträuchern will«, verteidigt sich die Mama.
Tante Rosa und die alte Klosterschwester nicken zustimmend.
»Erst hab’ ich mich g‘freut, weil da ein Eimer steht. Den nehmen wir her, hab’ ich mir gedacht. Dann muss sich die Hermengildis nicht so tief ins Gras hocken.«
»Ja pfui Teufel«, entfährt es nun auch mir.
Kurt Riedmüller grinst amüsiert von einer zur anderen.
»Geh, stell dich doch nicht so an. Im Mittelalter hat‘s auch nur ein Nachthaferl gegeben. Da war das ganz normal. Jedenfalls konnten wir den Eimer nicht nehmen, weil rundherum alles nass ist. Gelb und übelst stinkend – mehr sag’ ich nicht. Den Rest kannst’ dir selber ausmalen.«
»Schaut aus, als hätten s’ da ein Zielpieseln g’macht«, fügt die Tante Rosa trocken hinzu.
»Geh zu, wer macht denn so was?«, wiegle ich ungläubig ab, mache mich aber dennoch, gefolgt vom Riedmüller, auf den Weg, von dem die Damen gerade gekommen sind. Und richtig, wenige Meter um den Turm herum finden wir alles genau so vor, wie sie es beschrieben haben.
»Wo ist denn eigentlich dieser Herr Früchtl hingekommen und wer ist das überhaupt?« Mir fällt auf, dass ich den seit meiner Ankunft hier nicht mehr gesehen habe.
»Das ist unser Chauffeur«, sagt die Tante Rosa. »Der Hausmeister vom Kloster, der die Hermengildis und uns herg‘fahren hat. Wir haben ihn zum Kaffeetrinken g‘ schickt. Der wächst ja vor dem Turm fest, wenn er so lange auf uns warten muss.«
»Da, da!« Schwester Hermengildis deutet aufgeregt, den Blick starr in die Höhe gerichtet, mit ihrer Hand auf eine Stelle hoch oben am Turm.
Ich bin vom Sonnenlicht geblendet und muss erst meinen Standort ändern, um etwas sehen zu können.
»Ist das eine Hand?« Die sonst so hartgesottene Tante Rosa klingt entsetzt.
»Freilich ist das eine Hand!«, ruft nun auch die Mama aufgeregt.
Jetzt sehe ich es selbst. Zwischen den Geländerstäben auf der Aussichtsplattform ragt eindeutig eine Hand heraus. Jedenfalls sieht es von hier unten so aus.
Die Tante Rosa stößt mich in die Seite. »Sehen tut s’ noch gut, die Hermengildis.«
»Ihr bleibt hier, verstanden?«, ordne ich an. Dann fordere ich den Riedmüller auf, mir zu folgen, und sprinte in den Turm zurück.
»Du kannst die Leiche jetzt abholen lassen«, sagt der Fonsi, als er mich sieht. »Bringt’s ihn zu mir in die Pathologie.«
»Später!«, rufe ich zurück und haste zur Treppe.
»Komm mit! Ich brauch’ dich oben. Da liegt, so wie es aussieht, noch einer – auf der Plattform!«, füge ich hinzu, während ich bereits die Stufen hinaufsprinte. Auf der dritten Ebene muss ich allerdings kurz stehen bleiben, um Luft zu holen.
Es ist ziemlich schwül im Inneren des Turms, stelle ich fest. Auch der Riedmüller, der Fonsi und noch ein weiterer Kollege der Spurensicherung sind dankbar für die kurze Verschnaufpause. Außerdem befinden wir uns nun direkt unterhalb der Klappe, aus der der Tote gefallen oder gesprungen sein muss. Doch um sich dies näher anzusehen, ist gerade keine Zeit.
Weiter geht es, vorbei am Wasserbehälter, eine schmale, dunkle Betontreppe empor.
Ich drehe mich nach dem Stadtwerkemenschen um.
»Gibt`s denn hier nirgendwo einen Lichtschalter?« Es wird immer dunkler und die Stufen sind kaum mehr zu sehen, weswegen ich mein Handy zücke und darauf die Taschenlampe aktiviere.
»Der ist im Erdgeschoss«, ächzt Kurt Riedmüller »Ich hab’ in der Eile vergessen, draufzudrücken. Tut mir leid.«
Es ist sowieso egal, denn ich habe die letzte Ebene des Turms erreicht und stehe nun vor der Tür zur Plattform. Doch diese ist – oh Wunder ‒ verschlossen.
»Bin schon da«, schnauft der Riedmüller. Und tupft sich mit einem Stofftaschentuch den Schweiß von der Stirn.
Ich habe das Gefühl, er kollabiert gleich. Sein Gesicht ist puterrot.
»So oft steigen Sie wohl auch nicht hier rauf«, mutmaße ich.
Er schüttelt den Kopf. Dann holt er den Schlüssel hervor und schließt die Tür auf. Trotzdem lässt sie sich nicht öffnen. Der Riedmüller schaut mich überrascht an. »Was ist denn da los?« Wir versuchen es gemeinsam – ohne Erfolg.
»Probieren wir es von der anderen Seite«, beschließt er und geht hinüber zur gegenüberliegenden Tür. Diese lässt sich problemlos öffnen.
Riedmüller tritt zur Seite, um mir den Vortritt zu lassen, doch mir gefriert das Blut in den Adern.
Vor mir auf dem Boden liegt der Knogl.
Kapitel 3
Während ich zur Salzsäule erstarre, schiebt sich der Fonsi rasch an mir vorbei und eilt zu meinem Kollegen hinüber, der wie reglos am Boden der Plattform liegt. Ein Arm hängt zwischen den Geländersprossen. Mit geübtem Griff fasst er ihm an die Halsschlagader. »Er lebt«, sagt er und meine Anspannung lässt deutlich nach. Vorsichtig zieht er ihn ein wenig zur Seite und dreht den Knogl auf den Rücken. Der macht endlich verschlafen die Augen auf.
»Guten Morgen, Mausilein!«, nuschelt er verwaschen.
»Gibt’s schon Frühstück?«
Der Fonsi beginnt hellauf zu lachen. »Ja so ein Depp!«
Auch ich atme erleichtert auf und komme auf die beiden zu. »Kann es sein, dass du gestern ein bisserl viel gefeiert hast, Knogl?«
»Nicht so laut! Au, mein Kopf«, jammert der Knogl und erkundigt sich schlaftrunken: »Wo bin ich denn überhaupt?«, worüber der Fonsi nur ungläubig den Kopf schütteln kann.
»Auf der Aussichtsplattform vom Wasserturm. Kannst du mir mal sagen, wie du hierherkommst?«, frage ich ihn.
Der Knogl bläst die Backen auf. »Vage. Lass mir noch ein bisserl Zeit, ja?«
»Der braucht keinen Leichenwagen, sondern einen starken Kaffee, wenn du mich fragst«, sagt der Fonsi zu mir und steht auf. Dann zeigt er auf einen leeren Getränkekasten, der unweit vom Knogl am Boden steht. Von der Tür aus gesehen war er nicht sichtbar gewesen.
Der Knogl versucht, sich aufzurichten, was ihm aber nur mühsam gelingt. »Apropos Leichenwagen«, faselt er. »Wo sind denn die anderen?« Er lehnt sich sitzend mit dem Rücken an das Balkongeländer.
»Wen meinst du?«, frage ich.
»Der Amsel, der Wasner und der Gruftl?«
Der Fonsi dreht sich um und geht ein paar Meter um den Turm herum. »Ich glaub’ ich hab’s g’fund’n!«, hör’ ich ihn rufen. »Die sind im selben Zustand wie er.«
»Deinetwegen bin ich gerade um Jahre gealtert!«, werfe ich ihm vor, bin aber heilfroh, dass ihm, soweit erkennbar, nichts fehlt.
»So alt, wie ich mich fühl’ werden nur Schildkröten«, gähnt der Knogl und bringt mich damit zum Schmunzeln.
»Wie spät ist es denn überhaupt?«, erkundigt er sich und reibt sich den Schlaf aus den Augen.
»Kurz vor acht.«
Er zieht eine Grimasse. Wohl wissend, was ihn zu Hause erwarten wird. »Auweh!«
»Exakt«, stimme ich ihm zu. »Dein Mausilein hat heute Morgen schon zeitig bei mir angerufen und wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ich würde dir raten, dich schnellstens bei ihr zu melden.«
»War sie recht grantig?«, erkundigt er sich vorsichtig.
»Ich würde sagen, sie war sehr besorgt um dich«, beruhige ich ihn.
Das lässt ihn erleichtert aufschnaufen. »Dann wird’s schon nicht so schlimm werden, das Donnerwetter«, hofft er.
»Wie schon gesagt, melde dich bei ihr; und zwar schnell, bevor sie alles rebellisch macht«, empfehle ich ihm noch einmal eindringlich.
»Ah nein, fahren wir erst zum Standl. Ich brauch’ was in den Magen. Mir ist so dermaßen schlecht und außerdem hab’ ich einen ganz fiesen Geschmack im Mund. Ich brauche erst einen starken Kaffee, bevor ich mich daheim blicken lassen kann.«
»Erstens ist heute Sonntag, mein Lieber. Da hat das Standl geschlossen«, erinnere ich ihn, »und zweitens geht das nicht, denn im Parterre wartet Arbeit auf mich.«
Verständnislos blickt mich der Knogl an und wartet auf weitere Erklärungen.
»Da liegt ein Toter. Weswegen ich eigentlich hier bin. Du bist quasi nur ein Zufallsfund.«
»Schöner Mist«, meint der Knogl.
Ich bin mir aber nicht sicher, was genau er damit meint, das Standl oder den Toten.
»Wissen wir schon, wer es ist?«, erkundigt er sich.
»Nein, das wissen wir leider noch nicht. Nur, dass es ein Mann ist. Sein Gesicht ist nicht mehr ganz vorhanden. Er muss aus ziemlicher Höhe abgestürzt sein. Aber vielleicht haben die Kollegen von der SpuSi in der Zwischenzeit mehr herausgefunden«, sage ich. »Kann das sein, dass das auch ein Kumpel von dir ist?«
»Ich hoffe nicht. Wir waren, glaub’ ich, nur zu viert unterwegs. Geh leck!«, schnauft der Knogl. »Und was heißt das jetzt für uns?«
»Das weißt du selbst wohl am besten. Warum seid ihr denn überhaupt hier oben? Ich hab’ gedacht, du bist auf einem Klassentreffen.«
»War ich ja auch.« Er winkt ab. »Das ist eine längere Geschichte.« Wieder fährt er sich mit der Hand übers Gesicht. Dann versucht er aufzustehen. Ich helfe ihm dabei. »Maxi, müssen wir das jetzt und hier besprechen, oder könnten wir das auf den Nachmittag oder auf morgen verschieben? Ich bin echt durch und ich hab’ einen Mordsdurst. Ich brauch’ ganz dringend was zu trinken. Ich hab’ so einen Brand, dass ich g’rad den ganzen Wasserturm leersauf’n könnt‘.«
Ich nicke in die Richtung seiner Freunde.
»Und was ist mit denen? Wer sind die anderen, mit denen du hier oben bist, und könnten die eventuell mit unserem Toten etwas zu tun haben?«
»Für meine Spezln leg’ ich die Hand ins Feuer!«, sagt der Knogl.
»Da hat sich schon so mancher die Finger verbrannt«, erwidere ich skeptisch.
»Bei denen nicht«, beteuert der Knogl. »Das sind lauter ehrbare Leut‘. Der Amsel Peter von der gleichnamigen Brauerei, der Wasner Charlie von der Metzgerei und den Gruftl kennst ja eh«, zählt er sie der Reihe nach auf.
»In Ordnung.« Gemeinsam gehen wir zu den anderen Schnapsleichen. Anders kann man sie nicht benennen. Nachdem ich ihre Personalien aufgenommen habe und sie vom Knogl und mir über den Leichenfund im Parterre informiert wurden, machen wir uns gemeinsam auf den Abstieg. Vorsorglich bereite ich die Herren schon mal auf den unschönen Anblick vor, der sie unten erwartet.
»Ja richtig, du bist doch der Bestatter«, fällt dem Fonsi auf, der hinter dem Gruftl die Stufen hinabsteigt. »Dich hätten wir jetzt sowieso angerufen. Du kannst ihn dann gleich mitnehmen. Der muss zu mir in die Pathologie, Adresse ist bekannt.«
»Mein Auto hab’ ich aber nicht dabei und in der Hosentasche wird er nicht Platz haben«, reißt der Gruftl schon wieder Witze. »Spaß beiseite. Ich ruf’ von unten gleich meinen Mitarbeiter an. Der soll kommen. Ich warte so lange hier und helfe ihm beim Einladen.«
»Meinst, geht das?«, erkundigt sich der Fonsi argwöhnisch.
»Logisch. Ich bin doch ein Profi.«
Als wir zur letzten Stiege kommen, von der aus die Leiche nun deutlich zu sehen ist, wird die Gruppe immer langsamer.
Der Knogl dreht sich zu seinen Kumpels um und sieht einen nach dem anderen bedeutungsvoll an.
Ich kann die Szene gut beobachten, denn ich steige als Letzte die Stufen hinab, die bogenförmig an der Turmwand entlang ins Erdgeschoss führen.
Vornweg ist Kurt Riedmüller, der wieder den Blick vom Fundort abwendet.
Ich blicke in nachdenkliche Gesichter beim Wasner und beim Gruftl, erkenne ahnungsloses Schulterzucken beim Brauereichef. Mein untrüglicher Instinkt sagt mir, dass wir nun bald wissen werden, um wen es sich bei dem Toten handelt. Auch Kurt Riedmüller hat mittlerweile einen Blick mit den anderen gewechselt und wirkt nun nicht mehr ganz so unwissend, wie er mir zu Anfang weismachen wollte. Was zur Hölle wird hier gespielt? Am Ende der Treppe kommen die Männer zum Stehen. Beinahe wäre ich in Peter Amsel hineingelaufen. Gerade noch rechtzeitig kann ich mich am Treppengeländer festhalten.
»Was ist los?«, frage ich, nachdem sich keiner von der Stelle bewegt und niemand mehr ein Wort spricht.
Betretenes Schweigen, außer bei Peter Amsel, dessen Gesicht sich gelblich-grün verfärbt hat.
»Mir wird schlecht«, bringt er noch hervor, schiebt die anderen unsanft beiseite und stürzt durch die offene Turmtür ins Freie hinaus. Äußerst unschöne Töne sind von dort zu hören.
»Das ist er, oder?«, raunt der Wasner dem Knogl zu.
Der Knogl erwidert nichts, er schaut nur starr auf den Toten am Boden.
»Freilich ist er’s«, raunt der Wasner aufgebracht. Dann stößt der den Riedmüller an. »Jetzt sag’ halt du auch was. Das ist er doch. Karierte Hose, Janker, eindeutig ist er das
«Sie kennen den Toten?«, wende ich mich direkt an Charlie Wasner.
»Ja freilich. Das ist der Stein – die Sau!«
Ich zucke ob seines Gefühlsausbruchs ein wenig zusammen.
»Und die anderen wissen das auch. Karl! Günter! Jetzt sagt’s halt was! Kurt …«
Die Männer wechseln Blicke miteinander, keiner sagt etwas.
Wasner packt den Riedmüller aufgeregt am Arm. »Du warst doch auch ein Opfer vom Stein! Jetzt sag’ halt wenigstens du was!«
Ich blicke von einem zum anderen. Zuletzt bleibt mein Blick am Knogl hängen.
Der nickt schließlich. »Ja, der Charlie hat recht. Das kann eigentlich nur der Stein sein.«
»Und Sie haben ihn vorhin nicht sofort erkannt, so wie Ihr … Bekannter?«, wende ich mich an den Stadtwerke-Chef.
Er windet sich sichtlich. »Also … erkannt … Ich war mir da vorhin einfach nicht so ganz sicher … und ehe ich was Falsches sage, hab’ ich mir gedacht …«
»Schon gut, das klären wir später auf dem Revier.«
Ich will mich gerade bei Charlie Wasner erkundigen, weshalb er sich so über den Toten aufregt. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Die Aufregung wäre ganz normal, doch Wasner wirkt eher … positiv aufgeregt, nicht entsetzt. Das macht das Ganze so merkwürdig. Ich komme jedoch nicht dazu zu fragen, denn Peter Amsel steht in der Tür.
»Was ist denn los?«, erkundigt er sich und versucht tunlichst, den Blick auf den Toten zu vermeiden.
»Der Stein ist tot. Da liegt er – die Sau! Und der Kurt und die anderen tun so, als würden sie ihn nicht erkennen.«
In Peter Amsel kehrt Leben zurück. »Echt – der Stein – wirklich wahr?«, erkundigt auch er sich nun sehr interessiert.
Ich sehe dem Ganzen ungläubig zu.
Peter Amsel betritt den Turm nun ganz und anscheinend macht ihm der Anblick des Toten in der großen Blutlache jetzt überhaupt nichts mehr aus. Vielmehr entlockt es ihm ein beinahe entzücktes Grinsen und ich frage mich erneut, wer zur Hölle dieser verflixte Herr Stein war.
»Ja da schau her, der Stein – die Sau!«
Okay. Offensichtlich war der Mann kein Sympathieträger.
»Wir wissen jetzt endlich, um wen es sich bei dem Toten handelt« Von draußen kommt eine Kollegin der SpuSi herein, geht zu einer Kiste am Boden hinüber und entnimmt dieser mit behandschuhter Hand eine schwarze Geldbörse und einen Ausweis, beides sicher in durchsichtigen Plastiksäckchen verwahrt. »Lukas Stein …«
»Die Sau«, entfährt es mir ganz automatisch, doch ich korrigiere mich sofort. »Saubere Arbeit, Kollegin, aber die Herren hier konnten den Toten bereits anhand seiner Kleidung identifizieren.«
Die Herren grinsen breit. Einer wie der andere. Die Nachwehen ihres Saufgelages scheinen wie weggeblasen.
Sogar der Riedmüller schmunzelt still vor sich hin.
Ich räuspere mich. »Woher hast du den Geldbeutel?«
»Den hatte er ganz untypisch vorne in die Hosentasche gesteckt.«
»Ihr sichert die Fingerabdrücke«, ordne ich an.
Der Fonsi meldet sich wieder zu Wort. »Günter, hast du deinem Mitarbeiter schon Bescheid gegeben? Der Tote müsste jetzt langsam mal eingelagert werden.«
Entsetzt fährt der Gruftl hoch. »Der Stein? In meinem schönen Leichenwagen? Auf gar keinen Fall.«
»Hä?« Der Fonsi ist beinahe sprachlos. »Was heißt das?«
»Dass ich den Stein auf gar keinen Fall zu dir transportieren werde.«
»Ja und wer soll ihn dann abholen?«, erkundigt sich der Fonsi wie ein begossener Pudel.
»Das ist mir so was von Wurst. Von mir aus holt ihn die Viehverwertung ab, aber in meinem Leichenwagen wird der nie und nimmer transportiert, das sag ich dir!« Entschlossen verschränkt er die Arme vor der Brust. Einspruch ist zwecklos.
Der Fonsi bläst die Backen auf und pustet die Luft aus.
»Dann hoffe ich, dass dein Kollege die Fuhre übernimmt. Sonst haben wir ein ernsthaftes Problem«, meint er.
»Du weißt schon, dass du das nicht so einfach ablehnen kannst?«, erinnere ich ihn an seine Pflichten.
»Mein Auto ist kaputt!«, sagt der Gruftl. »Mein Mitarbeiter hat Grippe und ich noch zu viel Restalkohol vom Vortag. Ich kann unmöglich fahren, das wäre ja grob fahrlässig.«
Der Fonsi winkt genervt ab und geht telefonieren.
»Was ist jetzt mit uns, Mädi? Müssen wir immer noch dableib’n?«, erkundigt sich die Mama.
Oh je, die drei Damen habe ich in der ganzen Aufregung völlig vergessen. »Nein, ihr könnt jetzt heimfahren. Ich melde mich bei euch.«
»Was ist los?«, erkundigt sich die Klosterschwester.
»Heimfahren können wir!«, schreit die Tante Rosa.
»Ja die Hermengildis!«, schreit nun auch der Knogl und ehe ich mich’s versehe, umzingeln die vier Männer die alte Dame.
Nur der Riedmüller bleibt abseits stehen.
Ich komme mir langsam wie im Zirkus vor. Ehrlich, das können Sie mir glauben.
»Sie nicht?«, erkundige ich mich beim Riedmüller, der abseits stehen geblieben ist.
»Mich hat sie nie mögen«, gibt er zu. »Weil ich nie ein Ministrant war. Aber die anderen schon.«