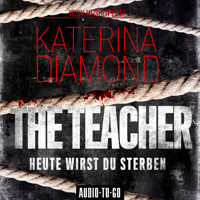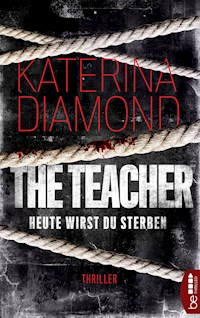
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: DS Imogen Grey
- Sprache: Deutsch
Der Top Ten Sunday Times-Bestseller
Der Direktor einer Eliteschule in Exeter wird erhängt in der Aula aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch dann sterben weitere Männer immer grausamere und brutalere Tode. DS Imogen Grey und DS Adrian Miles finden zunächst keine Verbindung zwischen den Toten. Aber nach und nach kommen die Ermittlerin und ihr Partner einem dunklen Geheimnis aus Korruption, Lügen und Missbrauch auf die Spur, das ein unvorstellbares Grauen offenbart ...
Dieser außergewöhnliche Fall voller Nervenkitzel bildet den Auftakt zu einer Reihe rund um das Ermittlerduo Grey und Miles.
EBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
»Ein raffinierter und fesselnder Plot mit vollkommen überraschenden Wendungen - Nervenkitzel garantiert. Dieses eindrucksvolle Debüt ist ein Page-Turner. Aber lesen Sie das Buch nicht vor dem Schlafengehen, wenn Sie eher zartbesaitet sind.« THE SUN
Platz 3 der meistverkaufen E-Books 2016 in UK.
LESERSTIMMEN:
"Bereits die Leseprobe hat mich überzeugt, der Rest des Buches enttäuscht definitiv nicht. Dem Leser wird eine nervenzerreissende Spannung ab der ersten Seite bis zum Schluss serviert. Von mir bekommt der Thriller eine 100%ige Leseempfehlung." (Schnelleser, Lesejury)
"Der fesselnde Schreibstil von Katerina Diamond hält die Spannungskurve bis zum Schluss auf sehr hohem Niveau. Ich konnte das Buch kaum zur Seite legen und die Bezeichnung "Pageturner" ist nicht übertrieben." (TKMLA, Lesejury)
"Ein wirklich gelungenes Werk der Autorin, das mir eine wahrhaft kurzweilige Lesezeit beschert hat. Ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen und werde die Autorin auf jeden Fall im Auge behalten, um zukünftige Bücher von ihr lesen zu können. Wer spannenden Nervenkitzel liebt, der macht bei diesem Buch mit Sicherheit keinen Fehler." (KARIN1966, Lesejury)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressum12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334Über dieses Buch
Er liebt die Angst in Deinen Augen …
Der Direktor einer Eliteschule in Exeter wird erhängt in der Aula aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch dann sterben weitere Männer immer grausamere und brutalere Tode. DS Imogen Grey und DS Adrian Miles finden zunächst keine Verbindung zwischen den Toten. Aber nach und nach kommen die Ermittlerin und ihr Partner einem dunklen Geheimnis aus Korruption, Lügen und Missbrauch auf die Spur, das ein unvorstellbares Grauen offenbart …
Dieser außergewöhnliche Fall voller Nervenkitzel bildet den Auftakt zu einer Reihe rund um das Ermittlerduo Grey und Miles.
»Ein raffinierter und fesselnder Plot mit vollkommen überraschenden Wendungen – Nervenkitzel garantiert. Dieses eindrucksvolle Debüt ist ein Page-Turner. Aber lesen Sie das Buch nicht vor dem Schlafengehen, wenn Sie eher zartbesaitet sind.« THE SUN
Über die Autorin
Katerina Diamond wurde 1977 in Weston geboren, wo ihre Eltern im griechischen Viertel ein Fish-and-Chips-Restaurant führten. Sie verbrachte ihre Kindheit in Griechenland. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie im Restaurant ihres Onkels und ging auf die Universität in Derby, wo sie ihren Ehemann kennenlernte, mit dem sie zwei Kinder hat. Heute lebt Katerina mit ihrer Familie an der Ostküste von Kent. Sie hat mehrere Drehbücher geschrieben und 2013 den Ramsgate’s-Got-Talent-Schreibwettbewerb gewonnen. Dies ist ihr erster Roman.
KATERINA DIAMOND
The Teacher
Heute wirst du sterben
THRILLER
Aus dem Englischen von Anna Wichmann
beTHRILLED
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment | Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Katerina Diamond
Titel der britischen Originalausgabe: »The Teacher«
Originalverlag: Avon, HarperCollinsPublishers, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Übersetzung: Anna Wichmann
Textredaktion: Natalie Röllig
Covergestaltung: © www.buersosued.de
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5373-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Der Direktor
Jeff Stone sah bei seiner Ansprache auf das Meer an bedrückten jungen Gesichtern hinab, wobei er den Blick hin und wieder über die Stahlträger des Atriums schweifen ließ. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er nicht, dass man ihn am nächsten Morgen dort erhängt auffinden würde.
Die Jungen mit ihren steifen weißen Hemdkragen und den rosigen Wangen starrten nach vorn, an Jeffrey vorbei und in die Leere hinter ihm, während sie darauf warteten, dass es endlich läutete. Alle waren immer begeistert, wenn eine Versammlung anstand, bis sie tatsächlich stattfand und man schmerzlich daran erinnert wurde, wie langweilig das Ganze eigentlich war. Diese Zeremonie war eine seltsame Mischung aus Arbeit und Freizeit und glich der Ruhe vor dem Sturm. Jeffrey hatte das Gefühl, das Ticken der Uhr wäre lauter als seine Stimme. Nach jedem Ticken und jeder Pause rechnete er damit, dass es läutete und er die apathischen Blicke der Schüler und Lehrer nicht länger ertragen musste. Alle versuchten interessiert zu wirken, scheiterten jedoch kläglich, und er konnte schon froh sein, dass nicht jeder im Publikum in der Nase bohrte. Jeffrey war immer erleichtert, wenn es endlich vorbei war und er nicht länger gezwungen wurde, Anekdoten zu erzählen, die keiner hören wollte, am wenigsten er selbst.
Den ersten Hinweis auf sein bevorstehendes Ableben erhielt Jeffrey, als er in sein Büro zurückkehrte und das Päckchen auf seinem Schreibtisch vorfand. Er riss das braune Packpapier vorsichtig auf, denn etwas an der Größe und dem Gewicht des Geschenks kam ihm vertraut vor, auch wenn er versucht hatte, diese Zeit zu verdrängen. Er wurde blass, als er den Inhalt ausgepackt hatte: Es war ein altes deutsches Buch. Natürlich wusste er, was das bedeutete. Schließlich kam das nicht aus heiterem Himmel, auch wenn er dieses Buch seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatte. Damals hatte er es verschenkt, und nun erschien es ihm wie ein Geist. Das Buch war eine Überraschung, nicht jedoch die unausgesprochene Botschaft, die sein Eintreffen übermittelte. Er wusste, dass das Ende nahte.
Doch er legte das Buch in eine Schreibtischschublade und beschloss, sich später damit zu beschäftigen. Er untersuchte das Packpapier, bemerkte die Handschrift, und schon stellten sich seine Nackenhärchen auf, denn nun war offensichtlich, dass jemand das Paket persönlich überbracht hatte. Warum jetzt? Was war am heutigen Tag anders? Was nicht bedeutete, dass dies kein guter Tag zum Sterben gewesen wäre, aber im Laufe der Jahre war Jeffrey davon ausgegangen, dass man ihn vergessen hatte. Dass er möglicherweise damit durchgekommen war. Jetzt wusste er, dass er sich geirrt hatte.
Er ging zum vermutlich letzten Mal durch die mit verzierten Wandpaneelen getäfelten Korridore, strich mit den Fingern über die Maserung der Eichenbretter, deren arabeske Schnitzereien nur noch ansatzweise zu erkennen waren. Die Churchill School for Boys war so lange Zeit seine Heimat gewesen. Nun fragte er sich, wer seinen Platz einnehmen würde. Dieses Gebäude war jahrhundertealt, von großer Bedeutung für die Geschichte der Stadt Exeter und eines der wenigen, die die Baedeker-Angriffe 1942 überstanden hatten, mit denen sich Hitler für die Bombardierung der Städte Lübeck und Rostock durch die Briten rächte. Bei diesem gezielten Angriff hatte die Luftwaffe die fünf schönsten Städte des Landes attackiert. Die Bevölkerung war dabei in unterirdischen Tunneln untergekommen, die ursprünglich gebaut worden waren, um die Stadt im Mittelalter mit Frischwasser zu versorgen. Heute bestand die Stadt aus einem Mischmasch aus wunderschönen alten Gebäuden an beiden Seiten der Straße, die geradlinig von Ost nach West führte, zwischen die große, hässliche, eckige Ziegelsteinhäuser gequetscht worden waren, um die von den Bomben verursachten Löcher zu stopfen.
Exeter war noch immer eine geschichtsträchtige Stadt, gleichzeitig aber auch voller unvergesslicher Erinnerungen an das Schreckliche, das diesem Land widerfahren war. Das galt jedoch nicht für dieses Gebäude, denn die Schule befand sich etwas abseits inmitten von Bäumen und wirkte wie ein Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Dichte smaragdgrüne Efeuranken, die im Sommerhalbjahr dick und grün wucherten, klammerten sich an die terrakottaroten Ziegelsteine, als wollten sie versuchen, diese zurück in den Boden zu zerren. Das war einer der Gründe, aus denen Jeffrey diesen Ort so sehr liebte; hier existierte das Traditionelle und Auserlesene zwischen all dem Hässlichen, und die Wahrheit war mit bloßem Auge zu erkennen. Dies war seine Schule, seit dem Augenblick, in dem er als Schüler durch das Tor getreten war und dieses überwältigende Zugehörigkeitsgefühl empfunden hatte. Ja, Jeffrey konnte sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben.
»Mr Stone?«
Er drehte sich um und sah Avery Phillips auf sich zukommen. Avery war der Schülersprecher, und seine ganze Haltung strahlte eine Selbstsicherheit aus, die man bei den jungen Akademikern an dieser Schule nur selten sah. Der Junge reichte Jeffrey einen Umschlag.
»Was ist das?«
»Das Geld von dem Wohltätigkeitslauf am letzten Wochenende, Sir. Wir haben über fünfhundert Pfund eingenommen.«
»Das ist ja großartig. Aber könntest du das Geld gleich zur Schulsekretärin bringen?«
»Ja, Sir.« Avery drehte sich um und wollte schon zurück durch den Flur eilen.
»Ach, Avery, komm doch kurz mit in mein Büro. Du könntest noch etwas für mich erledigen.« Jeffrey trat zur Seite, damit Avery an ihm vorbeigehen konnte.
Sie marschierten schnellen Schrittes durch den Korridor, und Jeffrey versuchte, sich auf Averys Hinterkopf zu konzentrieren und den Blick nicht zu seinen herrlich breiten Schultern oder noch tiefer wandern zu lassen. Er hatte schon zahlreiche verregnete Freitagnachmittage damit verbracht, Avery und seinen Freunden dabei zuzusehen, wie sie in ihren kurzen schwarzen Hosen durch den Schlamm liefen und mit einer erregenden Inbrunst aufeinander losgingen, die Jeffreys Träume des Nachts bestimmte. Er musste nur an diese Oberstufenschüler denken, und schon zog sich seine Brust vor Begierde zusammen, während sich andere Körperteile versteiften.
Avery blieb mit einem schiefen Lächeln vor der Bürotür stehen, sodass sich Jeffrey an ihm vorbeibeugen musste, um die Tür zu öffnen, bevor sie eintreten konnten. Jeffrey hatte schon häufiger den Eindruck gehabt, dass Avery gern Spielchen trieb. Der Junge ließ sich Jeffrey gegenüber in der wohl provokantesten Pose auf einen Stuhl fallen – die Beine gespreizt, wobei seine Oberschenkel die Hose beinahe zu sprengen schienen. Dabei hielt er den Kopf leicht gesenkt, und sein Blick bohrte sich direkt in Jeffreys Seele.
»Ich schreibe dir einen Passierschein, Avery, damit du den Campus verlassen und für mich diese Nachricht überbringen kannst.«
»Ja, Sir.« Averys Augen funkelten, und er zog beinahe verschwörerisch die Mundwinkel hoch, als wüsste er, dies müsse ihr Geheimnis bleiben.
»Es ist sehr wichtig, dass niemand etwas davon erfährt, egal, was passiert.«
»Selbstverständlich, Sir.« Avery beugte sich vor, ohne den Blickkontakt zu unterbrechen.
Jeffrey kritzelte »Er ist zurück« auf ein Blatt Papier, steckte es in einen Umschlag und schrieb den Namen »Stephen« darauf. Auf einem anderen Blatt notierte er die Adresse, dann reichte er beides dem Schüler.
»Geh sofort dorthin, und sprich mit niemandem darüber.« Jeffrey hielt inne und wartete darauf, dass Avery ging, doch der starrte ihn unentwegt an. »Oh!«, murmelte der Direktor, zog ein Bündel Geldscheine aus der Tasche und reichte sie dem Jungen, der ihn breit angrinste. »Ich kann mich doch auf deine Diskretion verlassen.«
»Natürlich, Sir.«
Jeffrey wusste, dass er Avery vertrauen konnte, denn der Junge konnte Geheimnisse für sich behalten. Er hatte die Gerüchte über die Erpressungen in den Schlafsälen gehört, bei denen es um eindeutige Fotos, Prüfungsbetrug und sogar Belastendes gegen Lehrer ging – wer mit wem schlief –, alles, womit man sich möglicherweise bessere Noten beschaffen konnte. Ja, Avery war ein sehr guter Schüler. Wäre dies nicht das Ende gewesen, hätte Jeffrey dem Jungen nie diese Nachricht gegeben, aber da es nun einmal so war und er die Konsequenzen nicht mehr fürchtete, hatte er seinen Teil getan.
Nachdem Avery gegangen war, schaute ihm Jeffrey durch das Bürofenster hinterher. Der Junge verließ das Schulgelände, und als er das Tor hinter sich schloss, nahm Jeffrey die Umgebung in Augenschein und blickte über den leeren Hof zu den bescheidenen Unterkünften hinüber. Einen kurzen Moment lang fragte er sich, wie viel Zeit ihm wohl noch blieb. Er überlegte, seine Frau anzurufen, aber was sollte er ihr sagen? Er griff nach dem Telefonhörer, starrte die Tasten einige Sekunden lang an und drückte die Null.
»Stellen Sie bitte heute keine Anrufe mehr durch, Elaine. Ich muss hier noch einen Berg wichtigen Papierkram erledigen.« Jeffrey lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und beobachtete durch das Fenster die Jungen, die draußen herumliefen. Im Laufe seiner Anstellung hatte sich nichts verändert; die Welt da draußen mochte anders sein, aber hier in den Mauern dieses Tributs an eine längst vergessene Zeit legte man auf beruhigende Weise weiterhin Wert auf bewährte Traditionen und Rituale.
* * *
Der Schultag verlief wie gewohnt langweilig – er arbeitete sich durch seine Unterlagen und versuchte, so viele Dinge wie möglich zum Abschluss zu bringen –, aber hin und wieder wanderten Jeffreys Gedanken doch zurück zu dem merkwürdigen Buch in seiner Schreibtischschublade. Er hatte immer sorgsam darauf geachtet, dass niemand etwas von seinen Neigungen erfuhr, schließlich war ihm bewusst, dass seine Karriere dann zu Ende gewesen wäre. Er liebte seinen Job, daher durfte niemand wissen, welche Gefühle diese Jungen in ihm hervorriefen. Jeffrey arbeitete hier schon seit fast dreißig Jahren, in denen es bisher keinen Ärger gegeben hatte.
Der Drang, das Schulgelände schnellstmöglich zu verlassen, wurde immer größer. In den Klassenzimmern war es zunehmend lauter geworden, und während der letzten Pause dröhnte der Lärm der Kinder, die sich normalerweise stets an die strengen Vorschriften hielten und leise waren, durch das Gebäude. Als die letzte Schulstunde endlich vorbei war, legte sich Stille über das Haupthaus, da sich die Internatsschüler in ihre Gemeinschaftsräume zurückzogen und die Tagesschüler die Busse bestiegen und nach Hause fuhren.
Er holte das Buch aus der Schublade und befühlte den Umschlag. Allein bei der Berührung kamen Erinnerungen in ihm hoch, als wäre es ein guter alter Freund. Sein Herz schlug schneller, während er mit den Fingern den Titel nachfuhr: Das Geschenk. Er schlug das Buch auf und fing an zu lesen; sein Deutsch war nicht mehr so gut wie früher, aber dafür kannte er den Inhalt. Als treuer Anhänger von Traditionen hatte Jeffrey das Buch aufgrund seiner geschichtlichen Bedeutung gekauft, wegen der darin enthaltenen Einblicke in seinen »Zustand« und der Lösungsansätze. Es wurde nicht mehr gedruckt und war daher nur noch schwer erhältlich. Jemand hatte sich sehr viel Mühe gemacht, um es zu beschaffen, und er wusste auch, wer. Früher war das Buch sein Gefährte gewesen – auf der Suche nach Antworten über sich und die Gründe dafür, warum er so war, warum er die Gesellschaft pubertierender Jungen bevorzugte und ihn sogar der Duft einer Frau kaltließ.
Der Sommerabend brach an, und Jeffrey klappte seinen Laptop auf. Er war davon überzeugt, dass er jetzt allein im Gebäude war und auch die Putzkolonne ihre Arbeit beendet hatte, daher schloss er sein Mobilgerät an, um nicht das Netzwerk der Schule benutzen zu müssen, und rief eine sichere Webseite für das Speichern von Fotos auf. Nachdem er sich erneut vergewissert hatte, dass in der Schule kein Ton mehr zu hören war, gab er sein Passwort ein. Unzählige Ordner erschienen auf dem Bildschirm, jeder mit einem anderen Jahr bezeichnet, und darin alphabetisch sortierte Unterordner, die Namen wie Jason, Marcus, Robert usw. trugen. Das waren Jeffreys Lieblinge. Er war keiner dieser Idioten, die Beweise auf ihrer Festplatte speicherten; nein, so dämlich war er nicht. Vielmehr zahlte er gutes Geld für diese Sicherheit im Darknet. Er klickte den ersten Ordner mit dem Namen »Daniel« an, doch der ließ sich nicht öffnen. Stattdessen wurde er aufgefordert, ein zweites Passwort einzugeben – das war ungewöhnlich. Jeffrey versuchte es panisch bei mehreren anderen Ordnern, doch er hatte nirgends Erfolg. Eigentlich hatte er nur vorgehabt, sie zu löschen, sie endgültig verschwinden zu lassen, aber jetzt hatte er keinen Zugriff darauf. Niemand wusste von diesen Fotos, nicht einmal die betroffenen Jungen. Wer hatte das herausgefunden und vor allem – wie?
Er bemerkte, dass er eine alte Melodie vor sich hin summte, und hörte damit auf, doch die Musik erklang dennoch aus einem anderen Teil des Gebäudes, sie drang leise und vertraut zu ihm herüber. Ihm wurde das Herz schwer, denn nun war offensichtlich, dass seine Zeit gekommen war. Mahler, dessen Musik sich bestenfalls als düster beschreiben ließ, glich in Jeffreys Ohren nun einer Totenglocke und schien ein Ende einzuläuten, das seit Jahrzehnten vorherbestimmt war.
Jeffrey öffnete die Bürotür, steckte den Kopf in den Flur und lauschte. Die Musik kam aus der Aula. Als er darauf zuging, wurde sie mit jedem Schritt lauter und misstönender. Er erinnerte sich noch sehr gut an die Symphonie; der heutige Tag war angefüllt mit Wehmut, wenngleich er sich gar nicht an diese Zeit zurücksehnen sollte, in der er so viel Schmerz verursacht hatte.
Dieses besondere Stück hatte damals für Jeffreys Zwecke genau die richtige Aufregung und Bedrohung übermittelt, daher empfand er es als Ironie, dass es das Letzte sein sollte, was er hörte.
Er öffnete die gläserne Doppeltür und kniff die Augen zusammen, da die Musik laut und schmerzhaft in seinen Ohren dröhnte. Auf der erhöhten Plattform am anderen Ende des großen Raums stand ein Stuhl, über dem eine Schlinge von der Decke baumelte. Links davon befand sich ein Tisch, der mit einem roten Samttuch bedeckt war, was beinahe zeremoniell wirkte. Darauf lag eine wunderschöne schwarze Holzkiste. Die Musik erstarb, doch seine Ohren klingelten weiter, während sie sich an die Stille anpassten.
»Hallo, alter Freund.« Eine Männerstimme, die er nicht erkannte, aber es war auch schon so lange her.
»Was willst du?«
»Hier geht es nicht um das, was ich will, sondern um das, was getan werden muss.«
»Warum nach all der Zeit ausgerechnet heute?« Jeffrey hatte Angst, sich umzudrehen, sich seinem Untergang zu stellen.
»Weißt du nicht mehr, was heute für ein Tag ist? Heute ist es achtzehn Jahre her. Vor achtzehn Jahren habe ich erkannt, was für ein Monster du bist.« Der Mann sprach langsam und entschlossen, und damit hatte er nicht gerechnet.
»Wenn du glaubst, ich würde mir die Schlinge selbst um den Hals legen, dann irrst du dich gewaltig.« Jeffrey blickte zu dem Seil hinauf.
»Ich denke es nicht nur, ich weiß es«, flüsterte der Mann entschieden, und Jeffrey begriff, dass es keine Bitte war.
»Du wirst mich schon dazu zwingen müssen, und dann gibt es Beweise, und alle Welt weiß, dass es kein Selbstmord war.« In Jeffreys Stimme schwang Panik mit, da er nach einem Ausweg suchte, und er fühlte sich mit jedem Wort noch erbärmlicher.
»Auf die eine oder andere Weise wirst du heute sterben. Mir wäre es lieber, wenn es nach Selbstmord aussieht, aber ich mache es auch gern auf die angenehmere Art.«
»Das würdest du nicht tun!«
»Und ob! Sei dir da ja nicht so sicher. Ich war dort, hast du das schon vergessen? Ich habe gesehen, was in dir schlummert. Ich habe das Kranke in dir gesehen.«
»Du könntest es niemandem sagen, denn wer würde dir mehr glauben als mir?«
»Deine Fotos sprechen für sich. Die Bilder, die du damals von mir gemacht hast, ebenso wie die all der Jungen seitdem. Wie ich sehe, hast du die versteckten Kameras in den Umkleiden verschwinden lassen. Hattest du Angst, jemand würde herausfinden, wie sehr du auf kleine Jungs stehst?«
»Woher wusstest du davon?«
»Ich habe dich beobachtet und einen Keylogger auf deinem Computer installiert. Dadurch wusste ich, welche Tasten du gedrückt und welche Webseiten du besucht hast, und ich kenne jedes Passwort und jede E-Mail. Außerdem habe ich ein VPN eingerichtet, ein privates Netzwerk, sodass ich seit mehreren Wochen Zugriff auf deinen Rechner hatte und ihn auch steuern konnte.«
Jeffrey ging langsam auf den Tisch zu. Ihm war klar, dass sich alles Mögliche in der Kiste befinden konnte, doch er vermutete, dass es sich nicht um etwas so Gnadenvolles wie eine Pistole handelte. Er konnte den Mann, der dicht hinter ihm stand, schon beinahe spüren und überlegte, ob er nach vorn stürzen, die Kiste packen und dem Mistkerl damit den Schädel einschlagen sollte. Aber was war, wenn er sich irrte und der Mann doch weiter entfernt war? Konnte Jeffrey ihn dann überhaupt treffen? Das Risiko war einfach zu groß.
»Ich habe nie einen von ihnen angerührt!«, flüsterte Jeffrey und merkte selbst, wie abartig schwach er sich anhörte.
»Bei Menschen wie dir ist das nur eine Frage der Zeit, Jeffrey. Du wirst es wieder tun, weil du einfach nicht anders kannst. Aber selbst wenn du es nicht tust, könntest du jederzeit an deinem Schreibtisch einem Herzinfarkt erliegen, und wenn man dein Büro ausräumt, würde man diesen USB-Stick finden. Ich habe die Bilder in den Ordnern gesehen. Ich weiß, wie du die Jungen ansiehst. Wie lange wird es noch dauern, bis dir das Anstarren nicht mehr reicht? Sobald man diese Dateien findet, werden sich die Leute selbst eine Meinung bilden.« Die Stimme klang völlig kalt und emotionslos, nicht im Geringsten spöttisch oder höhnisch. »Vergiss nicht, dass ich sehr gut weiß, wie gern du sie beobachtest.«
Jeffrey sog die Luft ein, als er eine Hand im Kreuz spürte, die langsam nach oben wanderte und ihn zärtlich zwischen den Schulterblättern streichelte. Er malte sich aus, wie sie seine nackte Haut berührte, während sie immer weiter nach oben glitt und schließlich die verschwitzten Härchen in seinem Nacken berührte. Sein Körper reagierte unwillkürlich auf diese wundervolle Liebkosung eines Mannes.
»Lass das!«
»Das hast du dir bestimmt unzählige Male erträumt, als ich noch jünger war und deinem Typ entsprach. Damals hättest du mich nicht davon abgehalten«, flüsterte ihm der Mann ins Ohr. »So magst du sie doch, oder nicht, Jeffrey? Tja, leider bin ich nicht mehr dieser Junge, sondern ein Mann.«
»Was ist in der Kiste?«, fragte Jeffrey schließlich, nachdem er wieder ausgeatmet hatte.
»Sieh ruhig rein. Ich weiß doch, dass du sehr gern die Wahl hast, daher lasse ich sie dir.«
Jeffrey verharrte mit der Hand über dem Deckel der Kiste, die handgeschnitzt und sehr wertvoll aussah. Sie bestand aus schwarzem Ebenholz, und in den Deckel war ein Bild eingeschnitzt, das er nicht erkennen konnte. Er bekam einen trockenen Mund, während er den Deckel hochklappte. Nur mit Mühe und Not gelang es ihm, aufrecht stehen zu bleiben, als er den Inhalt betrachtete, und er spürte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Der Raum schien sich um ihn herum zu drehen.
»Weißt du, was das ist?«
»Ja«, antwortete Jeffrey, auch wenn er seine Stimme nicht mehr hören konnte, da ihm das Herz bis zum Hals klopfte. Er blickte auf das birnenförmige Metallgerät hinab.
»Sie ist wunderschön, nicht wahr? Allein die Prägung und der Detailreichtum der Blätter sind atemberaubend«, sagte der Mann, der nun so dicht hinter Jeffrey stand, dass er den warmen Atem an seinem Ohr spürte. »Warum nimmst du sie nicht mal in die Hand?«
»Nein.«
Der Mann umklammerte seinen Nacken mit festem Griff und presste sich so gegen Jeffreys Rücken, dass es gleichzeitig erregend und beängstigend war. Er konnte einen ersten Blick auf seinen Widersacher werfen, als dieser eine Hand nach dem Instrument in der Kiste ausstreckte. Sie war groß und kräftig, und obwohl Jeffrey sie nicht wiedererkannte, war es dennoch wie eine Art Déjà-vu.
»Es gibt wirklich für jeden etwas. Ich fand, dass die Folterbirne perfekt zu dir passt. Als dieses Instrument erfunden wurde, war man der Ansicht, das Urteil müsse zum Verbrechen passen, und die Bestrafung sollte an dem Körperteil verübt werden, der gesündigt hatte.« Der Mann trat noch näher an Jeffrey heran, verstärkte den Griff an seinem Nacken und senkte die Stimme zu einem tiefen Flüstern. »Du bist ein Lügner und ein Sodomit … Wo soll ich sie deiner Meinung nach hinstecken?«
»Bitte …«, versuchte Jeffrey kläglich Einspruch zu erheben.
»Weißt du noch, wie diese Dinger funktionieren?« Der Mann ließ Jeffrey los, trat einen Schritt nach hinten und ging mit der Birne in der Hand auf und ab. »Wenn ich an dieser Schraube an einem Ende drehe, dehnt sie sich aus, bis sich der Umfang schließlich verdreifacht hat. Stellen wir uns mal vor, ich würde sie dir in den Mund stecken – gut, dafür müsste ich sie erst hineinbekommen. Vermutlich würde ich dir bei dem Versuch ein paar Zähne ausschlagen. Wenn sie sich dann ausdehnt, würdest du auch den Rest verlieren. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie schmerzhaft das ohne eine Betäubung ist.«
»Hör auf …«
»Irgendwann würde sie dir den Kiefer ausrenken, woraufhin eine Schwellung in deiner Kehle entsteht. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass das Ding sehr alt und wahrscheinlich mit Bakterien übersät ist. Bis deine Luftröhre zuschwillt, hättest du solche Schmerzen, dass du den Sauerstoffmangel nicht einmal mehr bemerkst. Es wird ein langsamer Tod, vermutlich wirst du ersticken, und deine lebenswichtigen Organe versagen nacheinander den Dienst. Du bekommst nur noch sehr wenig Sauerstoff, bleibst mehrere Minuten lang am Leben und erleidest höllische Qualen, sodass es dir wie eine Ewigkeit vorkommen wird.«
»Das reicht!«, protestierte Jeffrey mit zittriger Stimme. Er blickte auf seine geballten Fäuste hinab. Die Fingerknöchel waren vor Angst weiß angelaufen.
»So würde es aussehen, wenn ich sie dir in den Mund stecke … Du wirst wahrscheinlich nicht auf die andere Art sterben, auch wenn ich vermute, dass du es dir später wünschen wirst.«
»Wirst du die Fotos löschen, wenn ich es tue?« Jeffreys Herz raste, als er zu der Schlinge aufblickte. Er hatte begriffen, dass ihm keine andere Wahl blieb und dass dieses Ende schon seit langer Zeit unausweichlich gewesen war.
»Du kannst mir glauben, Jeffrey. Ich verspreche dir, dass ich alle Beweise vernichte, wenn du das für mich tust. Schließlich soll dein Tod nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. So viel bist du mir schuldig.«
Jeffrey stellte sich auf den Stuhl, wobei seine Schuhsohlen über das glatt polierte Holz rutschten. Sobald er sich erst einmal die Schlinge um den Hals gelegt hatte, brauchte er nur noch zwei Sekunden irrsinnigen Mut und die Entscheidung wäre getroffen.
»Ich kann es nicht tun.« Jeffreys Stimme brach, und ihm stiegen Tränen in die Augen, während etwas Warmes an seinem rechten Bein herunterlief und auf den Boden tropfte.
»Es wird in wenigen Sekunden vorüber sein. Du schaffst das, davon bin ich überzeugt.« Schwang da in der kalten Stimme ein wenig Wärme mit? »Hast du das nicht früher immer zu mir gesagt?«
Jeffrey holte tief Luft, als könnte das irgendetwas ändern. Der Stuhl wackelte ein wenig, und er hielt sich am Seil fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Endlich trat der Mann vor, sodass sie einander von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden. Er nahm die schwarze Kapuze ab und blickte dem Direktor stolz in die Augen, und das war das Letzte, was Jeffrey jemals sehen sollte. Jeffrey trat den Stuhl weg, und sackte nach unten. Eine Sekunde lang glaubte er schon, er könnte mit den Zehenspitzen den Boden erreichen, aber dann zappelte er verzweifelt mit den Füßen in der Luft, suchte nach Halt und fand doch keinen. Das Seil bohrte sich bei jeder Bewegung tiefer in seine Haut, aber er hatte keine andere Wahl, als sich weiter anzustrengen. Sein Körper klammerte sich an das Leben, ob er es nun wollte oder nicht. Dann kam die Dunkelheit, und während vor seinen Augen alles verschwamm, lächelte er.
2
Der Vater
Adrian Miles’ Wangen brannten rot ob der Hitze. Die Bettdecke klebte an ihm, als er sich vom Fenster mit der offenen Jalousie abwandte. Er erinnerte sich daran, warum er sie nicht geschlossen hatte, als er die Frau neben sich sah, die sich nun auch regte und die Augen aufschlug.
»Guten Morgen.« Sie lächelte. Er war froh, dass sie von der Sonne geblendet wurde und nicht sehen konnte, wie er sie verwirrt anstarrte, während er versuchte, sich an ihren Namen zu erinnern. »Ich hatte letzte Nacht sehr viel Spaß.«
»Ich auch«, log er. Es konnte durchaus sein, dass er sich amüsiert hatte, er ging sogar davon aus, aber ganz sicher war er sich da nicht.
Das Telefon klingelte, und Adrian war dankbar für die Ablenkung.
»Ich ziehe mich schon mal an«, sagte die Frau.
»Hallo?«, meldete er sich und beobachtete … Hannah? Anna? … wie sie vom Bett aufstand, nackt durch das Zimmer ging und dabei ihre Kleidungsstücke vom Boden aufhob. Er wusste nicht mehr genau, wann es ihm im Verlauf des vergangenen Abends gelungen war, sie abzuschleppen. Diese Situation war ihm allzu vertraut. Die fehlenden Erinnerungen, die namenlose, mehr oder weniger bekleidete Frau und die Erkenntnis, dass er beim nächsten Mal lieber mit zu ihr gehen sollte, damit er am nächsten Morgen nicht auch noch nett sein musste, sondern einfach verschwinden konnte. Das alles schoss ihm nicht zum ersten Mal durch den Kopf, aber abends war er dann immer viel zu betrunken, um noch so klar denken zu können.
»Du musst Tom heute nehmen, Adrian«, sagte Andrea gerade am anderen Ende der Leitung, und ihre Stimme klang so kalt und sachlich wie immer. Sie rief ihn nur an, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
»Ist er denn nicht in der Schule?«
»Die Schule hat heute geschlossen. Irgendetwas ist dort passiert. Tut mir leid, dass es so kurzfristig kommt, aber du musst dich heute um ihn kümmern.«
»Kann er nicht allein zu Hause bleiben?« Adrian stockte kurz, bevor er weitersprach, da er seiner Ex lieber nichts Genaueres über sein Leben erzählen wollte. Er konnte es nicht ausstehen, wenn er auf ihr Geheiß hin sofort zur Stelle sein musste, obwohl er wusste, dass er eigentlich keine andere Wahl hatte – zumindest nicht, wenn er demnächst noch häufiger Zeit mit seinem Sohn verbringen wollte. »Ich muss später noch arbeiten.«
»Nein, das kann er nicht. Er ist dreizehn, Adrian, und kann nicht den ganzen Tag allein bleiben. Du musst ihn mitnehmen; dann sitzt er eben bei dir rum. Kannst du dich verdammt noch mal nicht einfach um ihn kümmern?«
»Hey, du bist doch diejenige, die die Regeln macht, und ich befolge sie. Ich dachte, du wüsstest, wie wichtig der heutige Tag für mich ist …« Er versuchte, nicht gekränkt zu klingen, denn es brauchte nicht viel, um Andrea so wütend zu machen, dass sie ihm jeglichen Kontakt zu seinem Sohn verwehrte.
»Tu es für ihn, nicht für mich.«
»Darf ich deine Zahnbürste benutzen?«, rief die Frau, die in der Badezimmertür aufgetaucht war. Adrian zuckte zusammen, nickte dann und scheuchte sie mit einer Handbewegung weg, während er sich Andreas missbilligende Miene deutlich ausmalte. Obwohl sie Adrian nicht mehr begehrte, und das schon seit einer ganzen Zeit, schaffte sie es dennoch immer, ihm das Gefühl zu vermitteln, er würde sie irgendwie betrügen.
»Bist du nicht allein?«
»Ich bin in zehn Minuten bei dir.« Adrian legte auf und seufzte. Er ging zum Badezimmer, wo die Frau in Unterwäsche vor dem Waschbecken stand und sich mit seiner Zahnbürste die Zähne putzte. Sie grinste ihn im Spiegel mit Schaum vor dem Mund an. Er ignorierte die in ihm aufsteigende Erregung, als er den Blick an ihrem Körper entlangwandern ließ. Sie spuckte aus, und er seufzte noch einmal, bevor er ihr mitteilte: »Ich muss los. Du findest ja auch alleine raus.«
Er sah sich nach der saubersten Hose auf dem Boden um, wobei sein Blick auch auf sein Spiegelbild fiel. Auf seinem Rücken zeichneten sich Kratzspuren ab, und als er mit den Fingern über sein Kinn strich, musste er feststellen, dass seine Bartstoppeln schon ziemlich lang waren. Vermutlich wäre es besser, sich noch etwas frisch zu machen, bevor er zur Arbeit ging, aber er sah davon ab. Diese Trotzhaltung sorgte dafür, dass er sich nicht ganz so mies fühlte. Er zog sich das T-Shirt vom Vortag über den Kopf und nahm seinen Schlüsselbund vom Nachttisch.
* * *
Adrian ließ den Motor laufen und hupte. Als er sah, dass bei den Nachbarn die Gardinen wackelten, drückte er gleich noch einmal auf die Hupe, um aller Welt klarzumachen, dass Andrea nicht immer die Prinzessin von heute gewesen, sondern auch mal von ihrem hohen Ross gestiegen war. Obwohl die Fahrt gerade mal zehn Minuten gedauert hatte, kam es ihm vor, als wäre er in einer anderen Welt gelandet; und die drei anderen Ziffern der Postleitzahl schienen zu einem anderen Land zu gehören, in dem alle sauberer und glücklicher waren. Was nicht bedeuten sollte, dass er am unteren Ende der Stadt in einem Getto hauste. Dieses Viertel mit den Gebäuden aus der Regency-Zeit befand sich hoch über dem Stadtzentrum von Exeter, hinter dem Gefängnis und dem Rotlichtbezirk und in der Nähe der Universität. Alle Vorgärten sahen gut gepflegt aus, und die Blumen standen in voller Blüte. Die Haustüren waren alle frisch gestrichen und die Rasenflächen gemäht. Von jedem Haus aus hatte man einen guten Blick auf die kleinen Leute weiter unten. Es schien hier sogar sonniger zu sein. Das große weiße Haus reflektierte das Licht, das nicht von den endlosen grauen Reihenhäusern gebrochen wurde, die um sein winziges bescheidenes Heim auf der falschen Seite der Stadt herumstanden.
Tom kam mit eingezogenem Kopf auf den Wagen zumarschiert, und man konnte dem Jungen ansehen, dass er sich in seinem pubertierenden Körper nicht wohlfühlte. Er war doch noch ein Kind, aber Adrian war auch nur drei Jahre älter gewesen, als er Andrea geschwängert hatte, und daher konnte Adrian in letzter Zeit nicht anders, als Tom mit sich selbst zu vergleichen. Der Junge erinnerte ihn daran, wie er früher gewesen war, nur dass er nicht dieselben Fehler beging – jedenfalls hoffte Adrian das. Es heißt ja, Erstgeborene richten sich mehr nach dem Vater, doch das war in Adrians Fall nicht gerade ratsam, was ihn traurig machte.
Andrea stand in der Haustür und starrte Adrian mit finsterer Miene an. Sie trug ihr schickes Kostüm, in dem man sie für eine Anwältin oder etwas in der Art halten konnte, aber nein, sie arbeitete als persönliche Einkäuferin in einem teuren Modegeschäft, daher bedeutete es kaum das Ende der Welt, wenn sie sich mal einen halben Tag freinahm. Adrian hatte lange und hart darum kämpfen müssen, Zeit mit Tom verbringen zu dürfen, daher konnte er auch schlecht Nein sagen, wenn sie ihm den Jungen auf diese Art aufs Auge drückte, denn er wusste genau, dass sie das sonst gegen ihn verwenden würde – so war sie nun mal. Aber sie sah gut aus, wie sie es schon immer getan hatte und vermutlich immer tun würde. Widerstrebend ließ er den Blick über ihren wohlgeformten Körper gleiten. Es sah beinahe so aus, als hätte man sie in ihre Kleidung eingenäht, die perfekt und wie angegossen saß, ohne an der falschen Stelle Falten zu schlagen. Sie hatte ihr dichtes schwarzes Haar zu einem Knoten hochgesteckt, und in ihren Ohrläppchen glitzerten Diamantohrringe. Die Farbe ihrer Haut erinnerte an Vollmilchschokolade. Aufgrund ihres exotischen Aussehens wurde Andrea häufig für eine Inderin oder Latina gehalten, dabei war sie zur einen Hälfte Engländerin und zur anderen Irin. Adrian betrachtete ihre vollen roten Lippen, wandte den Blick dann aber schnell ab, bevor sie ihn dabei erwischen konnte.
»Ich hole ihn später ab«, teilte sie ihm mit und änderte den Tonfall. »Hab dich lieb, Schatz.«
»Tschüss, Mom.«
Tom stieg ein, und Adrian fuhr los. Das vertraute betretene Schweigen breitete sich im Wagen aus. Adrian hätte dieses Phänomen gern der Tatsache zugeschrieben, dass Tom ein Teenager war, aber er musste zugeben, dass es zwischen ihnen schon immer so gewesen war, jedes zweite Wochenende während der letzten sieben Jahre. Andrea hatte versucht, ihn ganz auszuschließen, doch ihr war nicht klar gewesen, wie beharrlich Adrian in diesem Fall sein würde. Er hatte sich in dem Augenblick, in dem er Tom das erste Mal gesehen hatte, in den Jungen verliebt und gab seitdem sein Bestes, um für Tom und Andrea zu sorgen, aber irgendwie schien es nie genug zu sein. Noch vor Toms zweitem Geburtstag war Andrea bereits wieder verheiratet, und sie und ihr neuer Partner hatten alles darangesetzt, Adrian den Kontakt zu seinem Sohn zu verwehren. Erst als Tom sechs Jahre alt gewesen war, hatte er das regelmäßige Besuchsrecht durchsetzen können, doch da war es bereits zu spät gewesen. Seitdem ließ sich Toms und Adrians Beziehung nur als angespannt bezeichnen.
»Wieso ist deine Schule heute geschlossen? Weißt du was darüber?«
»Ja, mein Kumpel Alex hat mir eine SMS geschickt«, antwortete Tom aufgeregt. »Sein Dad ist da Lehrer. Sie haben Mr Stone in der Aula gefunden, wo er sich erhängt hat, einfach so.«
»Kommt das überraschend?« Adrian wusste nicht viel über die Schule, auf die Tom ging; Andrea sagte nur immer, dass es die beste Schule der Gegend wäre, und aus diesem Grund wurde Tom auch dort angemeldet, Ende der Diskussion. Sie hatte Adrian ausdrücklich mitgeteilt, dass seine Meinung in dieser Angelegenheit bedeutungslos war, und somit hatte er ihr alle Schulangelegenheiten überlassen.
»Na, und ob!« Tom starrte seinen Vater an, als wäre er verrückt geworden. »Anscheinend ist die Polizei jetzt da.«
»Nein, ich meinte damit, ob er Depressionen oder Selbstmordtendenzen hatte oder etwas in der Art.«
»Es ging ihm nicht besonders gut, aber das kann man eigentlich über alle Lehrer sagen. Sie sind ziemlich verklemmt, weißt du?«
»Es gefällt dir da also noch immer nicht?«
»Es ist okay, aber auch ein bisschen protzig.«
»Viele andere Kinder hätten nichts dagegen, auf so eine protzige Schule zu gehen, Tom.« Allerdings dachte Adrian dasselbe über die Schule, und ohne seinen reichen Stiefvater wäre Tom auch nie dort hingekommen.
»Ich weiß«, murmelte Tom und sackte auf dem Beifahrersitz in sich zusammen.
Sie schwiegen sich erneut an, und Adrian schalt sich innerlich dafür, dass er wie ein typischer Vater klang. Eigentlich hatte er keine Ahnung, wie er mit Tom umgehen sollte. Sein einziger Anhaltspunkt war seine eigene Kindheit, und er wusste, dass sie nicht der Norm entsprochen hatte, daher hielt er sich meist an Variationen von Sprüchen, die er aus kitschigen Sitcoms kannte. Um die Stille zu vertreiben, schaltete er das Radio ein, und sobald er Toms Reaktion auf die Folkmusik mitbekam, wechselte er den Sender. Nachdem er einige Minuten an den Knöpfen herumgedreht hatte, gab er auf und schaltete es wieder aus, doch da kamen sie auch schon bei seinem Haus an.
Das Einzige, was Adrian richtig gemacht hatte, war sein Wohnzimmer. Tom spielte immer den Coolen, aber er freute sich jedes Mal darauf, sich an den Spielekonsolen seines Vaters austoben zu können. Adrian gab den Großteil seines Geldes für Dinge aus, die für die meisten Erwachsenen unter den Begriff Spielzeug fielen. Andrea hatte nie Unterhalt von ihm gefordert, da sie sich bereits kurz nach ihrer Trennung in einen viel älteren reichen Unternehmer verliebt hatte. Seit Toms Geburt hatte Adrian so einen Teil seines Gehalts in etwas für den Jungen investiert, allerdings nicht in irgendein Spielzeug, sondern in Sammlerstücke. Star Wars, Star Trek, DC oder Marvel, alles, was gefragt war, und eines Tages würde das alles Tom gehören, wenn er alt genug war und den Wert dieser Dinge zu schätzen wusste. Adrian musste jedes Jahr aufs Neue alles für die Versicherung fotografieren und auflisten, da die meisten Sachen unersetzlich, aber auch von großem Wert waren und er für den Fall, dass sein Haus abbrannte, abgesichert sein wollte. Die Wände seines Wohnzimmers waren voller Regale mit unangetasteten Packungen, und er hatte dem sechsjährigen Tom unzählige Male erklären müssen, warum er nicht mit dem ganzen tollen Spielzeug spielen durfte.
Tom ließ sich vor dem großen LED-Fernseher nieder und schaltete ihn ein, woraufhin die Surroundanlage anging und ihn von allen Seiten beschallte. Adrian wusste, dass der Fernseher zu groß für den Raum war, aber ihm war auch klar gewesen, dass er damit in der Achtung seines Sohnes steigen würde.
»Hast du Zombie Flesh Hunters 2 da?«
»Das Spiel ist ab achtzehn.«
»Alle meine Freunde spielen es, und sie sind jetzt garantiert alle online. Ich werde es Mum auch nicht verraten.«
»Du hast sowieso nur noch zwei Stunden, dann muss ich zur Arbeit«, erwiderte Adrian.
»Ach Scheiße!«
»Tom!«, brüllte Adrian, der selbst erstaunt über seinen Ausbruch war und erst einmal tief Luft holte. Sein Sohn starrte ihn mit großen Augen an. Kurz glaube er, den Geist seines Vaters hinter sich zu spüren, schüttelte diesen Eindruck jedoch schnell wieder ab. »Achte bitte auf deine Ausdrucksweise, Kumpel.«
»Ich bin nicht dein Kumpel«, zischte Tom.
Adrian öffnete die Schranktür und warf Tom das Spiel zu, der ihn leicht triumphierend angrinste. Dann verließ er das Wohnzimmer. Er konnte es nicht leiden, laut zu werden, aber noch schlimmer war es, wenn er das Gefühl hatte, ausgetrickst zu werden.
Alle Hinweise auf Adrians Übernachtungsgast waren aus dem Schlafzimmer verschwunden, und man erkannte nur daran, dass das Bett gemacht war und Adrians Kleidungsstücke im Wäschekorb und nicht mehr auf dem Boden lagen, dass sie überhaupt da gewesen war. Selbst das gab ihm schon das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Das als Bindungsangst zu beschreiben, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Bei Adrian grenzte es eher an eine Phobie. Nachdem Andrea ihn verlassen und seinen Sohn mitgenommen hatte, war er entschlossen gewesen, so etwas nie wieder zuzulassen, denn es hatte sich angefühlt, als wäre ihm das Herz aus dem Leib gerissen worden. Wer immer behauptet hatte, es wäre besser, geliebt und verloren zu haben, wusste ja nicht, was er da redete. Im Badezimmer sah Adrian erneut in den Spiegel. Er überprüfte, ob seine Augen noch immer blutunterlaufen waren. Es war sechs Monate her, seit er sich zuletzt auf dem Revier hatte blicken lassen, daher wäre es unklug, wieder zur Arbeit zu kommen und wie ein Alkoholiker auszusehen – vor allem, wenn man bedachte, wie er dort seinen Abgang gemacht hatte oder vielmehr rausgeworfen worden war. Gestern Abend hatte er jedoch etwas trinken müssen und dann auch noch eine Frau kennengelernt. Es war abgelaufen wie immer. Als er unter die Dusche ging, hörte er die entsetzlichen Schreie und die Schüsse aus dem Erdgeschoss, während er sich den Kater und die Überreste der vergangenen Nacht abwusch.
* * *
Adrian stand vor dem Polizeirevier und bereute es, mit dem Rauchen aufgehört zu haben. Er holte tief Luft und betrat dann mit Tom im Schlepptau das Gebäude.
»Hey, Tommy.« Denise Ferguson saß strahlend hinter ihrem Schreibtisch und vermied es offensichtlich, Adrian anzusehen. Er vermutete, dass dies nicht die einzige peinliche Begegnung an diesem Tag sein würde.
Als er die zweite Tür aufdrückte, bemerkte er sofort, dass sich die Lautstärke der Unterhaltungen veränderte und sich alle auf ihn konzentrierten. Da er die Blicke spürte, starrte er auf dem Weg zu seinem Schreibtisch stur den Boden an.
»Detective Miles?« Adrian hob den Kopf. Detective Chief Inspector Morris stand in der Tür seines Büros. »Würden Sie bitte mal herkommen?«
Adrian bedeutete Tom zu warten und begab sich ins Büro des DCIs. Tom zückte sein Handy, tippte darauf herum und hatte bereits die Kopfhörer auf, um ja nicht von den Kollegen seines Vaters belästigt zu werden. Morris schloss die Tür hinter Adrian, der froh war, das Großraumbüro kurz verlassen zu können. Da Morris ihn warmherzig anlächelte, bekam Adrian jedoch sofort ein mulmiges Gefühl im Bauch.
»DCI Morris«, sagte Adrian.
»Setzen Sie sich bitte.«
Adrian kam sich vor wie ein ungezogener Schuljunge, als er Platz nahm, denn man wurde schließlich nicht grundlos hierhergerufen, daher würde gleich ganz bestimmt eine ernste Unterhaltung folgen. Morris wirkte keinen Tag älter als vor fast zwanzig Jahren, als Adrian ihm zum ersten Mal begegnet war. Allerdings hatte er da auch schon das Aussehen eines Sechzigjährigen gehabt. Das lag vermutlich am Glatzkopf, denn einen Mann ohne Haare konnte man schwer einschätzen. Das hatte Adrian schon relativ früh nach einigen Zeugenbefragungen festgestellt; war ein Glatzkopf an etwas beteiligt, dann konnte man eine verlässliche Beschreibung vergessen, da alle Altersstufen von einem Teenager bis zu einem Rentner genannt wurden, je nachdem, wie gut die Sehkraft des jeweiligen Zeugen war.
»Sir.«
»Schön, dass Sie wieder da sind. Sie haben uns gefehlt.«
»Hören Sie, Sir, das, was passiert ist …«
»Soweit es mich betrifft, ist diese Sache vergeben und vergessen, Adrian. Manchmal geschehen Dinge, die nicht geschehen sollten, aber so ist das nun mal. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, und ich denke, die sechs Monate waren mehr als genug Zeit, damit Sie wieder einen klaren Kopf bekommen konnten. Immerhin ist die Angelegenheit jetzt auch offiziell abgeschlossen, und Sie werden beim nächsten Mal garantiert vorsichtiger sein, wenn Sie Beweise sichern.«
»So etwas wird nie wieder vorkommen, Sir«, versprach Adrian zerknirscht. »Und danke, dass Sie sich vor der Kommission für mich eingesetzt haben.«
»Sie haben Ihre Strafe verbüßt. Wir alle machen Fehler, und ich selbst habe mir im Laufe der Jahre auch schon einige geleistet.« Morris blickte auf, als jemand leise an die Glastür klopfte. »Ah, wo wir gerade von Fehlern reden.« Er holte tief Luft und winkte die Frau, die vor dem Büro stand, herein. »Kommen Sie nur!«
»DCI Morris? Ich bin Imogen Grey.«
»Ja, ich weiß, wer Sie sind. Perfektes Timing. Setzen Sie sich doch bitte, Detective Grey.«
Die ungepflegte Brünette ließ sich auf dem Stuhl neben Adrian nieder und fing sofort damit an, nervös an ihren Fingernägeln zu zupfen und auf der Unterlippe herumzukauen. Sie trug ein weites Sweatshirt und eine ausgebeulte Kampfhose. Kaum hatte sie sich gesetzt, schlug sie die Beine übereinander und drehte sich von Adrian weg, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen.
»Entschuldigen Sie meine Verspätung.«
»Detective Grey, ich möchte Ihnen Detective Miles vorstellen. Sie beide werden bis auf Weiteres zusammenarbeiten.«
»Was?«, warf Adrian ein. Sollte sie etwa dafür sorgen, dass er nicht erneut Mist baute?
»Mir ist klar, dass das nicht ideal ist, aber Grey wurde gerade von Plymouth hierher versetzt, und ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann und der ihr zeigt, wie der Hase hier läuft.«
»Wollen Sie mir etwa einen Babysitter verpassen?« Grey runzelte die Stirn. Adrian begriff, dass er nicht derjenige war, der hier überwacht werden sollte. Die Art, wie sie sofort in die Defensive ging und feindselig reagierte, verriet ihm, dass sie auch in Ungnade gefallen war.
»Großer Gott, zwei schmollende Teenager. Sie beide werden bestimmt hervorragend miteinander auskommen.« Morris stand auf und ging zur Tür. »Ich lasse Sie mal allein, damit Sie sich miteinander bekannt machen können.«
Sie drehte sich nicht zu Adrian um, sondern tat so, als würde sie sich für die stinknormalen Polizeiplakate an den Wänden interessieren. Er wusste, worauf sie wartete: Er sollte zuerst etwas sagen. Das war ein Spiel, sie wollte ihn manipulieren. Und es war kindisch. Das respektierte er.
»Tja, Sie müssen ja ganz schön Mist gebaut haben, dass man Sie mit mir zusammentut.« Adrian stand lachend auf. »Kommen Sie, dann führe ich Sie rum, und wir besorgen Ihnen einen Zugangscode.«
»Warum? Was haben Sie denn angestellt?« Zum ersten Mal überhaupt drehte sie sich zu ihm um, sodass er ihr Gesicht richtig sehen konnte. Ihre mit Sommersprossen übersäte Haut schälte sich an der Nase und den Wangen, da sie anscheinend sehr viel Zeit im Freien verbrachte, und ihre haselnussbraunen Augen waren von den längsten Wimpern eingerahmt, die er je gesehen hatte. Sie war ungeschminkt, und er konnte ihr Alter unmöglich schätzen, auch wenn ihre Kleidung eher zu einem fünfzehnjährigen Jungen gepasst hätte.
»Ich habe ein paar Beweise verlegt, sodass ein hiesiger Dealer, ein ziemlich großes Tier, davonkommen konnte. Das war kein sehr karrierefördernder Moment, das können Sie mir glauben.«
»Sind Sie immer so mitteilsam?« Greys Miene wurde sanfter, und sie grinste ihn frech an. Adrian vermutete, dass sie erleichtert war, weil er ebenfalls Mist gebaut hatte.
»Definitiv nicht. Aber da wir von jetzt an Partner sind, ist es mir lieber, wenn Sie es gleich aus meinem Mund hören, Grey.«
»Das ergibt Sinn.«
»Und, was haben Sie angestellt?« Adrian hielt ihr die Tür auf und merkte sofort, dass er einen Fehler gemacht hatte, da sie die Tür festhielt und ihm bedeutete, voranzugehen.
»Das geht Sie nichts an.« Sie zwinkerte ihm zu, und er rechnete beinahe damit, dass sie ihm auf den Hintern schlagen würde – und wenn er sich nicht ganz irrte, war ihr dieser Gedanke tatsächlich gekommen.
3
Die Präparatorin
Sie starrte in die glasigen Augen der toten Katze, deren glänzendes Fell sich immer noch ganz weich anfühlte. Während sie mit einem Finger seitlich über den harten Bauch des Tiers strich, stoben kleine Staubwolken auf. Sie klebte einen gelben Sticker auf das Tier, der für »Wiederherstellen« stand, denn der Katze musste ihre frühere Schönheit zurückgeben werden oder zumindest etwas, das so nah wie möglich an dieses Ideal herankam – so gut das bei etwas Totem, das einst lebendig gewesen war, eben ging. Abbey Lucas arbeitete jetzt seit fünf Jahren im Eden House Memorial Museum, und sie hatte sich nie einen der vier großen Ausstellungsräume angesehen, sich kaum mit einem der anderen Angestellten unterhalten und nie mit einem Besucher gesprochen. Sie blieb einfach hier im Archiv. Während der letzten fünf Jahre hatte sie sich durch die Abertausend ausgestopften Tiere gearbeitet, vom Känguru bis zum Schnabeltier, von einer gewöhnlichen Ziege bis zu diesem Paradebeispiel der Evolution, dem Gepard. Manchmal fragte sie sich, wieso sich niemand die Mühe machte, Kühe oder Schafe auszustopfen; aber vielleicht waren diese Tiere zu langweilig, als dass man dafür Geld ausgeben wollte. Dabei war Abbey immer der Ansicht gewesen, dass Kühe mit ihren traurigen braunen Augen wirklich schön aussahen.
Abbey lief durch die Lobby, in der reges Treiben herrschte. Momentan wurde hier alles neu gestaltet; das Museum war seit einigen Wochen aufgrund von Umbaumaßnahmen geschlossen. Es hatte nach dem Tod des letzten Direktors vor einigen Monaten eine hohe Geldsumme als Spende erhalten, die für eine Modernisierung genutzt wurde; und das war auch dringend nötig, denn sie hatten schon viele Jahre lang versucht, Geldmittel dafür zusammenzubekommen. Seit einiger Zeit waren nur noch vierzehn der insgesamt zweiunddreißig Ausstellungsräume für die Öffentlichkeit zugänglich, und der Großteil der kleineren Bereiche im ersten Stock hatte ganz geschlossen werden müssen. Vor etwa zwanzig Jahren gab es im Museum einen Großbrand, ausgelöst durch schlechte Verkabelungen und eine fehlerhafte Sicherung, und dabei wurde mehr als ein Viertel des Gebäudes schwer beschädigt. Da es den Besitzern nicht möglich war, sämtliche Reparaturen sofort durchzuführen, wurden einige Räume seitdem nur noch für Lagerzwecke verwendet. Das neogotische Museum, erbaut im achtzehnten Jahrhundert, beherbergte zahlreiche keltische und römische Artefakte, die in der Gegend gefunden worden waren. Ferner gab es hier eine große Auswahl an Tieren, Kleidungsstücken und Fossilien zu bewundern.
Glücklicherweise war der Schaden vor allem kosmetischer Natur. Die neue Wandfarbe hieß Zinnoberrot und erinnerte fast schon an ein strahlendes Orange. Abbey fand jedoch, dass sie an einen solchen Ort nicht passte, da sie zu grell und geschmacklos war. Das Rot stellte einen starken Kontrast zu dem tristen Grau dar, das während ihrer ganzen Zeit hier in allen Räumen zu sehen gewesen war. Nun hatte jeder Raum vom Innenarchitekten eine Hauptfarbe zugewiesen bekommen. Die Lobby hatte natürlich am beeindruckendsten auszusehen, daher glich der Eindruck, den man hier hatte, eher einem Ansturm auf alle Sinne.
»Abbey!«, rief Mr Lowestoft, der Direktor, und lächelte sie herzlich an. Er war ein freundlicher alter Mann und glich mit seiner runden Brille, den geröteten Wangen und der altertümlichen Fliege eher einer großväterlichen Figur. Abbey wurde stets ganz warm ums Herz, wenn sie ihn sah, und so war es schon von Anfang an gewesen. Er hatte sie hier nicht nur begrüßt, sondern ihr das Gefühl gegeben, als wäre sie hier zu Hause. Jedes Mal, wenn sie einander begrüßten, wirkte er, als würde er mit einem geliebten Familienmitglied sprechen. Mr Lowestoft war einer der wenigen Menschen auf der Welt, in deren Gegenwart sie sich wohlfühlte.
»Hallo, Mr Lowestoft.« Sie erwiderte sein Lächeln ebenso warmherzig und freute sich wirklich, ihn zu sehen. Seitdem bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war, kam er nicht mehr so häufig ins Museum. Allerdings hatte er es sich zum Ziel gesetzt, die Renovierungsarbeiten bis zum Abschluss zu bringen.
»Ich hatte gehofft, Sie hier zu treffen, Abbey. Was denken Sie? Gefällt es Ihnen?« Er strahlte förmlich vor Stolz.
»Es sieht unglaublich aus.« Sie brachte es nicht übers Herz, etwas anderes zu sagen.
»Die Universität hat angefragt, ob wir für einige Zeit einen der Doktoranden begleiten könnten, der seine Abschlussarbeit über Denkmalpflege oder etwas in der Art schreibt. Ich dachte mir, Sie wären doch am besten dafür geeignet, ihn zu betreuen.«
»Ich?« Sie wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Normalerweise arbeitete sie allein, und das war ihr auch lieber.
»Ach, und ich habe noch eine Überraschung für Sie! Kommen Sie!« Er ging zu einem großen Objekt, das unter einer Decke verborgen lag, und sie folgte ihm widerstrebend. Überraschungen konnte sie nicht ausstehen. Er zog die Decke herunter, und sie stand einem Samurai gegenüber, der eine grimassenhafte Maske trug und dessen starre Lederrüstung so stark poliert worden war, dass Abbey ihr Spiegelbild darin sah. »Ich habe nie verstanden, warum wir dieses gute Stück oben versteckt haben. Das ist eines meiner liebsten Exponate.«
Auf der Maske war ein böses Grinsen zu sehen, und an der Stelle, an der sich die Augen befinden müssten, klaffte ein schwarzes Loch. Die dämonischen roten Hörner, die aus dem Helm herauswuchsen, sahen rasiermesserscharf und bedrohlich aus. Sie hatte ganz vergessen, wie abscheulich das Gesicht dieses Kriegers wirkte. Es war Jahre her, dass sie ihn zuletzt gesehen hatte, da sie immer einen Umweg machte, um nicht an ihm vorbeigehen zu müssen. Sein Gesicht hatte von Anfang an unmenschlich auf sie gewirkt, und ihr war, als würde das schwarze Nichts sie anstarren. Sie machte unwillkürlich einen Schritt nach hinten. Ihre Panikattacke bekam sie gerade noch so in den Griff, aber sie wollte nur noch weg von hier.
»Er passt hier perfekt hin.« Sie ging noch etwas weiter weg und war völlig durcheinander.
»Geht es Ihnen gut, Abbey?«
»Ja, es geht mir gut. Ich muss nur mal auf die Toilette.«
Abbey stürzte in die nächste Damentoilette, die eigentlich den Besuchern vorbehalten war, spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und versuchte, ihre überhitzte Haut zu kühlen. Sie spürte, dass ihre Wangen brannten. Wie sie Überraschungen hasste!
Als sie wieder auf den leeren Korridor trat, schien die Stille im Museum ihre Einsamkeit nur noch zu verstärken. Es war nur etwas leise Musik zu hören, die aus einem anderen Teil des Gebäudes zu ihr herüberdrang. Sie ging um die Ecke und prallte mit dem Wachmann zusammen.
»Stressiger Tag?« Shane Cordon stand ihr im Weg. Ihm klebte das wasserstoffblonde Haar in der Stirn.
»Ja.« Sie versuchte, um ihn herumzugehen, doch er versperrte ihr erneut den Weg. Dieses Spielchen spielte er nur mit ihr, weil er wusste, dass sie sich darüber ärgerte. »Entschuldigen Sie, aber ich muss bei den Umräumarbeiten helfen. Wir haben nur noch ein paar Monate Zeit bis zur Wiedereröffnung. Müssten Sie nicht auch irgendwo anders sein?«
»Stört Sie das nicht, dass Sie den ganzen Tag nur tote Dinge anfassen?« Er saugte an seiner Unterlippe und blickte auf sie herab.
»Eigentlich nicht.« Sie wollte einen Bogen um ihn machen, doch er trat nur noch näher an sie heran. Sein Atem roch nach Zigarettenrauch und Alkohol, und sie standen inzwischen beinahe Nase an Nase. Das ist nur ein Spiel, er weiß überhaupt nichts,sagte sie sich immer wieder. Sie musste sich entscheiden, ob sie ihm in die Augen sehen oder den Blick abwenden und ihre Füße anstarren wollte. Letzteres wäre ihr zwar lieber gewesen, aber genau darauf legte er es an. Daher beschloss sie, ihn anzusehen und darauf zu hoffen, dass er die Dunkelheit hinter ihren Augen nicht bemerkte. Ihr war klar, dass er sie nur brüskieren wollte. Er übte das bisschen Macht aus, das er in dieser Welt besaß, und zwar bei jemandem, bei dem er wusste, er würde eine Reaktion bekommen. Dieses Spielchen trieb er vor allem mit Menschen, die schnell erröteten.
Sein Blick fiel auf ihre Brüste, die unter der olivgrünen Bluse verborgen waren. Sie versuchte, ganz flach zu atmen, um ihm nicht noch mehr zu gucken zu bieten. Dummerweise fehlte ihr der Sauerstoff jedoch, und sie hätte gern tief Luft geholt. Aber sie wollte lieber ohnmächtig werden, als ihm diese Genugtuung zu geben. Endlich machte er einen Schritt nach hinten, starrte sie jedoch weiterhin an.
»Schönen Tag noch.« Er grinste, umklammerte seinen Schlagstock und ließ einen Finger über das Griffende kreisen. Abbey stieß so langsam wie möglich die Luft aus. Dieser Kerl war echt ein Widerling, aber er versuchte immerhin nicht, diese Tatsache zu verschleiern. Bevor sie auch nur ganz eingeatmet hatte, war er bereits verschwunden. Sie huschte in ihre dunkle Ecke innerhalb des Museums zurück. Das waren jetzt wirklich genug Interaktionen für einen Vormittag gewesen.
Zum Mittagessen ging Abbey wie immer in die Museumskantine, wo sie stets am selben Tisch saß. Routine war sehr wichtig für sie, und das ging so weit, dass sie jeden Freitag ihren braunen Cordrock trug. Es brauchte nicht viel, um ihre Ängste hervorzurufen. Zum Glück war dies weder ein gut besuchtes noch ein beliebtes Museum; heutzutage schauten die Menschen im Internet nach, wenn sie etwas wissen wollten, und das war Abbey nur recht. Heute nahm sie ein Thunfischsandwich, da es freitags in der Kantine immer Fisch gab. Mr Lowestoft bestand auf der Einhaltung dieser religiösen Tradition als Erinnerung an eine Zeit, in der die Menschheit noch an Werte glaubte.
Abbey liebte ihren Job wirklich sehr und konnte sich keinen anderen für sich vorstellen. Ihr gefiel es, tagtäglich mit denselben Menschen zu arbeiten, und abgesehen von Shane waren sie alle nett und verständnisvoll. Außerdem mochte sie es, den Großteil des Tages allein zu sein und nur die Toten als Gesellschaft zu haben.
»Ist der Platz noch frei?«
Sie blickte zu dem Fremden auf und hatte noch einen vollen Mund, sodass sie erst kauen musste, bevor sie antworten konnte. Die Kantine war leer, und sie konnte wohl kaum behaupten, dass hier noch jemand saß. Wollte er nur den Stuhl haben, oder hatte er vor, sich zu ihr zu setzen?
»Ja«, presste sie schließlich hervor.
Er stellte sein Tablett neben ihres und lächelte sie an. Nachdem er seine Jacke ausgezogen und über die Rückenlehne gehängt hatte, nahm er Platz. Er war jung, schlank und hatte herunterhängendes schwarzes Haar. Abbey war klar, dass er älter sein musste als sie, aber sie konnte sein Alter nur schwer schätzen. Er wirkte exzentrisch und irgendwie anders. Das Bemerkenswerteste an ihm waren seine Augen, die grau und kalt wie Glaskugeln aussahen, sodass sich Abbey dazu zwingen musste, ihn nicht anzustarren.
»Ich bin Parker. Parker West.« Er reichte ihr über den Tisch hinweg die Hand. Sie wischte sich rasch die Finger am Rock ab, um die Überreste des Sandwichs zu beseitigen, bevor sie seine Hand schüttelte.
»Hallo.«
»Sind Sie Abigail Lucas?« Er lächelte erneut, und sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen – woher kannte er ihren Namen?
»Wer …«
»Ach, hat man Sie noch gar nicht informiert? Ich soll Ihnen im Archiv helfen. Ich habe einen Abschluss in archäologischer Zoologie und schreibe gerade meine Doktorarbeit«, sagte er und wirkte fast schon peinlich berührt.
»Ach ja, Mr Lowestoft hat so etwas erwähnt. Mir war nur nicht klar, dass Sie heute schon kommen würden.«
Sie hatte sich bereits ganz allein durch Australasien und Südamerika gearbeitet und jedes einzelne Tier katalogisiert sowie seinen Herkunftsort und Platz in der Nahrungskette festgehalten. Bisher war es allein ihr vorbehalten gewesen, über das Schicksal dieser Kreaturen zu bestimmen. Sie konnte ein Tier zur Wiederherstellung oder Zerstörung freigeben. Wann immer es möglich war, rettete sie die Tiere, auch wenn ihr das oftmals nutzlos vorkam. Erst etwas über zweihundert Tiere waren auf ihr Geheiß hin in den Verbrennungsofen gewandert. Die schlimmsten Fälle lagerten in der Nordostecke des Gebäudes, wo ein Loch im Dach viel zu lange unbemerkt geblieben war. Von diesen Ausstellungsstücken hatte sie kein einziges retten können, da sie zu stark verschimmelt oder verwest gewesen waren. Sie war sich jedoch nicht sicher, ob sie einem Fremden eine solche Verantwortung übertragen wollte.
»Er hat nur gesagt, dass Sie vielleicht Hilfe gebrauchen können. Dieses Museum besitzt eine Vielzahl an Spezies und Subspezies, das kann ein Mensch doch unmöglich in zwei Monaten schaffen, oder?«
»Ach, das geht schon«, erwiderte sie abwehrend und schalt sich innerlich dafür, wie sehr es nach einer Entschuldigung klang.
»Oh, keiner hat behauptet, dass Sie das nicht können. Ehrlich gesagt habe ich mich freiwillig gemeldet und werde nicht dafür bezahlt. Ich muss schließlich eine Arbeit schreiben, verstehen Sie, aber ich werde Sie nicht mit den Einzelheiten langweilen. Jedenfalls würden Sie mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie mir erlauben, Ihnen unter die Arme zu greifen. Möglicherweise kann ich Ihnen mit meinem Fachwissen bei der Identifikation helfen, da Sie mit der eigentlichen Restaurierung ja nicht befasst sind.«
»Wenn Sie meinen …«
»Es ist Ihre Entscheidung. Mein Schicksal liegt in Ihren Händen.« Sein Blick wirkte einerseits flehentlich, andererseits jedoch auch schelmisch, und sie hätte ihn beinahe angelächelt, aber so etwas passte einfach nicht zu ihr. Sie wusste ganz genau, dass Menschen oftmals nicht die waren, als die sie sich ausgaben. Es gab immer eine Lüge oder eine Maske.
»Hallo, Parker. Sie können mich Abbey nennen«, sagte sie nach einer Pause. Sie würde sich eben damit arrangieren müssen.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Abbey«, erwiderte er mit einem schiefen Grinsen. Seine Vorfreude auf die Arbeit war offensichtlich, da er sich beeilte, das Mittagessen zu beenden, als könnte er es kaum erwarten, all ihre toten Freunde kennenzulernen.
Sie dachte an die vielen Tiere, die sie bereits allein bearbeitet hatte, und beschloss, dass dies vielleicht doch nicht das Ende der Welt war. Es bedeutete auch nicht, dass Mr Lowestoft ihr nicht traute, sondern dass sie sich Zeit lassen konnte und sich keine so großen Sorgen wegen der Deadlines machen musste, die sie sich selbst gesetzt hatte. Die schwerste Entscheidung, die sie bisher hatte treffen müssen, drehte sich um eine kleine Kreatur, deren Identifikationsnummer von der Feuchtigkeit zerstört worden war. Sie hatte das Tier nicht erkannt und in keiner der Enzyklopädien finden können. Möglicherweise hatte man es in der falschen Abteilung aufbewahrt, aber Abbey konnte das Weibchen nicht retten, das offenbar erst kurz vor seinem Tod Junge zur Welt gebracht hatte, da die Zitzen noch vergrößert waren. Sie hatte sich gefragt, was diesem kleinen Tier zugestoßen war. Seine Wangen waren von Termiten zerfressen, doch seine Augen wirkten ganz ruhig. Als Abbey das kleine Loch in der Brust untersucht hatte, war eine Spinne herausgekrabbelt, und sie hatte das Tier vor Schreck fallen lassen, wobei der Kopf ganz zertrümmert wurde. Unter Tränen hatte Abbey den roten Sticker auf die Kreatur geklebt. Zu gern hätte sie gewusst, ob die Jungen dasselbe Schicksal erlitten oder überlebt hatten. Vielleicht hatten sie sich ja auch fortgepflanzt; diese Vorstellung gefiel ihr sehr.