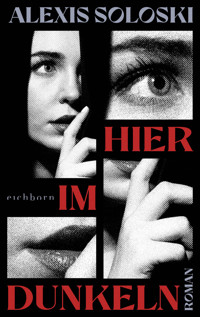
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vivian Parry, 32, ist Theaterkritikerin in New York, single, versnobt und berüchtigt für ihre gnadenlosen Verrisse. Nach einem Interview mit dem Wissenschaftler David Adler verschwindet dieser spurlos. Vivians professionelle Neugier ist geweckt und sie beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Doch angetrieben durch zu wenig Schlaf und zu viel zweifelhafte Selbstmedikation, verstrickt sie sich immer tiefer in ihre Rolle als Amateurdetektivin und verliert zusehends den Halt. Immer mysteriöser und bedrohlicher werden die Umstände, sie bekommt Drohbriefe und fühlt sich beobachtet - bis irgendwann sogar ihr Leben in Gefahr zu sein scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Vivian Parry, 32, ist Theaterkritikerin in New York, single, versnobt und berüchtigt für ihre gnadenlosen Verrisse. Nach einem Interview mit dem Wissenschaftler David Adler verschwindet dieser spurlos. Vivians professionelle Neugier ist geweckt und sie beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Doch angetrieben durch zu wenig Schlaf und zu viel zweifelhafte Selbstmedikation, verstrickt sie sich immer tiefer in ihre Rolle als Amateurdetektivin und verliert zusehends den Halt. Immer mysteriöser und bedrohlicher werden die Umstände, sie bekommt Drohbriefe und fühlt sich beobachtet - bis irgendwann sogar ihr Leben in Gefahr zu sein scheint.
Über die Autorin
Alexis Soloski ist preisgekrönte Theaterkritikerin der NEW YORK TIMES und frühere leitende Theaterkritikerin der VILLAGE VOICE. Sie hat gelehrt am Barnard College und an der Columbia University, wo sie ihren Doktortitel in Theaterwissenschaften erlangte. Sie lebt mit ihrer Familie in Brooklyn, HERE IN THE DARK ist ihr erster Roman
ALEXIS SOLOSKI
HIER
IM
DUNKELN
ROMAN
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon Christian Lux
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischen Originalausgabe:
»Here In the Dark«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Alexis Soloski
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich
bitte an: [email protected]
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining
bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Textstudio Eva Wagner
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotiv: © TREVILLION/Miguel Sobreira
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-6454-4
eichborn.de
luebbe.de
lesejury.de
Für Ada und Thom,»Mein Sonnenschein! Mein Frühjahr!«
Der Beruf des Kritikers ist seiner Natur nachtatsächlich grausam und erfordertfür seine effiziente Ausführungeine unmenschliche Person wie mich.
George Bernard Shaw
Kurzes Vorspiel
Tot spielen
Ich bin sieben Jahre alt. Ich trage ein blaues Samtkleid und schwarze Schnallenschuhe. Ich sitze, so still ich nur kann, in einem Sessel, der viel zu groß für mich ist. Im Dunkeln. Ich schaue zu.
Vor mir stürzt sich ein Mann mit einem Messer auf einen anderen. Blut breitet sich auf einem weißen Hemd aus, der Fleck entfaltet sich wie eine Blüte, während der Mann auf den Knien zusammensackt und zu Boden geht. Der erste Mann steht über ihm und lächelt dünn und schneidend. Dann richtet er sein Lächeln auf mich.
Ich kann nicht schlucken. Ich kriege keine Luft. Meine Fäuste umschließen die Armlehnen, meine Fingerknöchel sind weiß.
»Mach dir keine Sorgen«, sagt meine Mutter mit sanfter Stimme. »Er ist nicht tot. Schau, du kannst sehen, wie er atmet. Schau auf seinen Bauch: Er atmet ein und aus. Siehst du? Das ist nicht echt. Es ist nur ein Spiel. Aber du, du bist echt.« Sie löst behutsam eine meiner Hände, legt die ihre darüber und flüstert eine Litanei, die sie schon viele Male zuvor geflüstert hat. Ihr Kopf ist so nah an meinem, dass ihre Lippen mein Ohr berühren. »Das hier sind deine Finger«, sagt sie. »Das ist deine Hand, das deine Handfläche, das ist dein Handgelenk, dein Bauch …«
Diesmal aber kann ich sie nicht hören. Oder werde es nicht hören. Stattdessen starre ich auf das Hemd, das Blut, das Messer, das Lächeln. Ich weiß, dass der Mann als Nächstes mich angreifen wird. Ich stehe auf. Ich will wegrennen. Aber ich falle wieder in meinen übergroßen Sessel zurück.
Ich werde ohnmächtig.
Der Vorhang fällt. Der Vorhang hebt sich. Ein zweiter Akt, fünfundzwanzig Jahre später. Meine Mutter ist tot, und ich sitze nun sehr oft im Dunkeln. Ich sehe mir Messerstechereien, Erschießungen, Erdrosselungen an. Schlimmeres noch.
»Der Tod«, sagt die Herzogin von Malfi in einem Theaterstück, das ich sehr mag, »verfügt über zehntausend Türen, durch die Männer ihren Abgang finden.« Ich glaube ihr. Ich führe Buch darüber.
Während ich zusehe, schlucke ich. Ich atme. Meine Lunge leert sich, füllt sich, mein Bauch hebt und senkt sich. Inzwischen passen die Sitze zu meiner Größe. Ich trage weder Samtkleider noch Schnallenschuhe. Und ich werde zweifellos nicht mehr ohnmächtig.
Stattdessen sitze ich hier im Dunkeln und fahre mit meinem Stift geräuschlos über die Zeilen meines Notizbuchs. Ich habe gelernt, die Seiten mit minimalem Geräusch umzublättern. Ich habe gelernt, ohne Licht zu schreiben.
Ich bin aufmerksam. Ich bin kritisch. Ich bin wirklich fast glücklich.
Ich bin Theaterkritikerin geworden.
Was sonst?
1
Unterdrückte Nummer
Als an einem nasskalten Mittwoch im November mein Telefon klingelt, bin ich im Bad. Ich bin gerade zurück von der Bank, wo ich einen Scheck eingelöst habe – im Großformat auf dicker cremefarbener Pappe –, den ich vom Testamentsvollstrecker meiner Tante erhalten habe. Ich hatte sie seit Jahren nicht gesehen und nur selten über die obligatorischen Geburtstags- und Weihnachtsgrüße hinaus mit ihr korrespondiert. Der Tod kam pünktlich und ohne unnötiges Vorspiel zu ihr, was ihr sehr recht gewesen sein dürfte. Wenngleich sie für ihr Ableben womöglich einen angemesseneren und privateren Ort bevorzugt hätte als den Parkplatz eines Supermarkts an einem Spätnachmittag im Mai, kurz vorm Einsetzen des Feierabendverkehrs. Ein Herzinfarkt – Beleg dafür, dass sie ein Herz besessen hatte – soll, wie man mir sagte, ihren Körper in einer Weise umfallen lassen haben, dass sie dabei ihren Autoalarm auslöste. Der Lärm wird ihr nicht gefallen haben.
Ich hatte nicht damit gerechnet, etwas zu erben. Doch wie sich herausstellte, hatte sie ihr Erbe – ein kleines Sparkonto, eine noch kleinere Pension und die Einnahmen aus dem Verkauf ihres Hauses – zwischen mir und einem örtlichen Tierschutzverein aufgeteilt. Ihr waren Vögel stets lieber gewesen als Menschen, und das konnte ich ihr nicht verübeln. Auch wenn ich mir wirklich nichts aus Vögeln mache.
Ich brauche ihr Geld nicht. Es anzunehmen schien mir jedoch unkomplizierter als die Alternative. Und so hörte ich mit einem zurechtgemeißelten Lächeln dem Bankberater zu – einem verschwitzten weißen Mann mit rosigen Wangen und gestreifter Krawatte, von der ich unter Eid schwören würde, dass es eine Ansteckkrawatte war –, wie er mir mit einer Stimme wie ein undichter Wasserhahn einen Vortrag über Fonds und Bonds und Anlagezertifikate hielt.
»Einfach das, was am sichersten ist«, sagte ich ihm schließlich. Weil es nicht das war, was er hören wollte. Und weil ich bei manchen Dingen eben auf Nummer sicher gehe.
So fern mir meine Tante auch war – sie lebte in New Hampshire, was aus New Yorker Sicht gleichbedeutend mit einem Wohnsitz auf dem Mond ist –, so war sie doch die letzte Person überhaupt, die meine Mutter gekannt hatte, und die letzte Person, die wusste, wie ich vorher gewesen war. Ihr Tod hätte mir eine Einladung sein können, mich vollständiger in das kleine Leben zu vertiefen, das ich mir eingerichtet hatte, oder nun unbeschwert aus diesem heraus in ein neues, größeres zu treten. Endlich wirklich ganz zu leben. Und ein Teil von mir – das Sehnsüchtige, Wilde in mir – muss das wollen. Doch als mich die Nachricht von ihrem Tod erreichte, trat ich nirgendwohin und blieb stattdessen auf meinen gewohnten Wegen in ausgewählte Theater und dann zurück in meine Wohnung und gelegentlich in eine schummrige Bar, um etwas Abwechslung in die Szenerie zu bringen.
Der Testamentsvollstrecker hatte mir auch zwei vergilbte Fotoalben zugeschickt, in denen meine Tante und meine Mutter als Kinder und Jugendliche und junge Frauen zu sehen waren – mit langen Gliedern, mit Sommersprossen und lebendig. Ich blätterte sie einmal durch und schob sie dann in das höchstgelegene Regalbrett, wo sie bis heute liegen.
Wenn ich die Art Person wäre, die sich selbst ein ausgeprägtes emotionales Leben erlauben würde – also, tagsüber jedenfalls –, dann würde ich mich wohl einsam gefühlt haben, verwaist, verlassen. Stattdessen widmete ich mich meinem Notizblock und meinem Laptop wie nie zuvor. Ich schrieb und überarbeitete das Geschriebene, bis jeder Absatz glitzerte, leuchtend wie Diamanten und doppelt so scharf, was nur ein klein wenig schärfer war als gewohnt. Das ist Segen und Fluch der kritischen Grundhaltung, des ununterdrückbaren Impulses, die Wahrheit eines Kunstwerks wiederzugeben, ganz gleich, wen diese Wahrheit auch beleidigen mag. Diese Bühnen haben mich eingeladen. Sie wollten Kritik. Die Stücke hätten besser ausgearbeitet, besser konstruiert, überzeugender sein können. Sie waren es aber nicht. Also war ich nun hier, um ihnen die Kritik zu geben, um mit jedem cleveren Witz und jedem böse gesetzten Urteil der Position des Chefkritikers näher zu kommen.
Der Job war nun seit zwei Monaten vakant, seit Crispin »Crispy« Holt – Spross einer schwerreichen Bostoner Familie, der Princeton entflohen war, als er das erste Mal das Living Theatre (im Verbund mit hochpotentem LSD) ausprobiert und danach jahrzehntelang für das Magazin Kritiken verfasst hatte – endlich seinen Ruhestand verkündete. Der Flurfunk besagt, dass er sein ererbtes Vermögen in eine karibische Steueroase verschoben hat, wo er nun Flashbacks und den einen oder anderen Poolboy in tropischer Leichtigkeit genießen kann. Ich kann dieses Gerücht nicht bestätigen. Doch da ich als Frau keinen Stimmumfang von vier Oktaven erreichen kann, wurde ich von Crispy nie beachtet. Für meinen vorgesetzten Redakteur, Roger, war ich jedoch eine Art Protegé, und ein Mädchen aus der Gegend war von Vorteil und brachte mehr Clicks. Ich war mir sicher, dass er mich sofort für den Job vorschlagen würde. Stattdessen bringt er nun meine Kolumne mit jener von Caleb Jones, dem anderen Junior-Kritiker, im Wechsel. Caleb hat einen frisch gestempelten MFA-Abschluss in Theaterdramaturgie, ein blendendes Lächeln und das ästhetische Urteilsvermögen eines Wurstsalats. Ich hingegen habe einen unfassbar guten Geschmack. Und einen flotten, austeilenden Stil. Roger wird schon noch Vernunft annehmen. Irgendwann.
An diesem Morgen zeigte mir der Bankberater schließlich einen Stapel Papiere, und ich füllte aus und unterschrieb, füllte aus und unterschrieb, reichte ihm dann seinen Stift zurück (ich habe bessere zu Hause) und verschwand hinaus auf den Gehsteig, ging schließlich die fünf Stockwerke hinauf in meine Wohnung. Ich goss mir einen Drink ein, da meine Tante Alkohol nicht guthieß, und auch weil ich in letzter Zeit häufiger trank – das muss ich, denn die Pillen funktionieren nicht mehr so wie früher. Und dann ließ ich mir ein sehr heißes Bad ein, um irgendwas oder nichts mehr zu spüren oder beides zugleich, und ich lehnte den Kopf zurück, bis das Wasser meine Ohren füllte und die Stadt leise und weit entfernt schien.
Plötzlich aber geht mein Handy – der schrille Klingelton der Grundeinstellung, die ich einfach nie verändert habe –, es brummt, verstummt und erklingt erneut, sodass ich es selbst hier im Bad höre. Es ist eher selten, dass Scammer zwei Mal hintereinander anrufen. Möglicherweise ist es also Roger, sage ich zu mir selbst. Er hat vielleicht noch eine finale Nachfrage oder will ein Ansichtsexemplar durchgehen. Also steige ich aus der Wanne, um dranzugehen.
Tropfen fallen auf das Porzellan, während ich mich mit wackligen Beinen erhebe und mich an der Wand abstütze, bis mein Blutdruck sich wieder erholt hat und die schwarzroten Flecken vor den Augen verschwinden. In ein dünnes Handtuch gewickelt, hüpfe ich ins Wohnzimmer – ich wohne in einem Studio, es ist also eigentlich nur ein Zimmer – und greife nach dem Handy in meiner Tasche. Ich habe zwei Anrufe vom Magazin verpasst. Von der Hauptleitung, nicht von Rogers Durchwahl. Ich rufe zurück, und unser Rezeptionist Esteban geht dran.
»Vivian hier«, sage ich und senke meine Stimmlage, bis sie leicht nach Goth klingt. »Du hast angerufen?«
»Schönheit«, zwitschert er, »wo hast du denn gesteckt?«
»In meinem Anwesen. Ich streife in meinem samtenen Bademantel durch meine Gemächer und trauere darum, dass du für die Frauenwelt verloren bist.«
Er kichert in einer Höhe, die Kristallglas in Gefahr bringt. Er weiß, dass meine Wohnung zu klein für Gemächer ist. Er weiß auch, dass ich keinen samtenen Bademantel besitze.
»Arme Bebita«, sagt er. »Tja, vielleicht habe ich einen Trostpreis. Ein Mann ruft ständig für dich an. Sexy Stimme. Also, sehr sexy.«
»Du hast ihm doch wohl nicht meine Nummer gegeben?«, sage ich und ziehe das Handtuch fester zu.
»Tss, Bebita. Etwas Vertrauen, bitte. Ich habe es mit deiner E-Mail-Adresse versucht, aber er sagt, dass er unbedingt mit dir sprechen will.«
»Zehn zu eins, dass das ein PR-Typ ist.«
»Ein sexy PR-Typ.«
»Ist doch absurd. Unmöglich. Verstößt gegen jedes Naturgesetz.«
»Mag sein, Bebita. Aber das ist nun dein Problem.«
Er teilt mir den Namen des Mannes mit, David Adler, und gibt mir seine Telefonnummer, die ich mir lustlos in das nächstliegende Notizbuch schreibe, während meine tropfenden Haare das Blatt wie Tränen besprenkeln. Ich lächle mich durch »Danke« und »Bis bald« und lasse meine Gesichtszüge mit dem Ende des Telefonats erschlaffen.
Nachdem ich mich in meine Klamotten gefriemelt habe, fläze ich mich in den Sessel und balanciere den Laptop auf den Oberschenkeln. Ich suche in meinen E-Mails nach »David Adler« und wiederhole die Suche im Papierkorb. Ohne Erfolg. Er hat also nichts mit einem Stück oder Musical zu tun, das ich kürzlich rezensiert habe. Zumindest weiß ich von keinem. Also muss es sich um einen unerfahrenen Regisseur oder einen jungen PR-Angestellten halten, der mich dazu bringen will, irgendeine Inszenierung so weit off-Broadway zu rezensieren, dass keine U-Bahn dort nur ansatzweise haltmacht. Mein Desinteresse kennt somit keine Grenzen. Man kann in seinem Leben einfach nur eine bestimmte Anzahl gescheiterte Aufführungen ertragen, ohne zugrunde zu gehen.
Dennoch denke ich an das, was Roger immer sagt. Dass er es bevorzugen würde, wenn meine Rezensionen einfühlsamer wären, oder wenn schon nicht das, dann zumindest eine wärmere Beziehung zur künstlerischen Community an sich hätten. Er nennt es den »Lass die Zicke etwas weniger unterkühlt raushängen, geht das, Kiddo?«-Plan. Roger hat bereits ein Sensitivity-Training besucht. Ein Workshop, an dem ich nicht teilgenommen habe.
Wärme ist nicht meine Stärke. Was die reiche Farbpalette menschlicher Erfahrung angeht, lebe ich eher in den Grautönen. Aristoteles hat gesagt, dass Drama die Nachahmung einer Handlung sei. Ich bin, qua Notwendigkeit, eine Nachahmung meiner selbst – schneidendes Lächeln, beißender Witz, ein klaffender Abgrund, wo eine Frau sein sollte. Mehr als ein Jahrzehnt lang habe ich mir nur diese eine Rolle zugestanden, eine Nebenrolle: Vivian Parry, die Geißel der Schauspieler und Frau von Welt. Die spiele ich nicht sonderlich gut.
Außer wenn ich Theater schaue – also, gutes Theater. Wenn ich im Dunkeln bin, in sicherem Abstand zum Alltag, spüre ich alles – alle Wut, die Freude, Überraschungen. Bis die Saallichter des Theaters wieder aufleuchten und alles zerstören, bin ich lebendig. Dann kenne ich mich selbst. Ein immer wiederkehrender Traum geht so: Ich laufe am Times Square die Straßen entlang, und ich weiß die genaue Adresse des Theaters nicht mehr, bei dem ich erwartet werde, also laufe ich weiter, meistens im strömenden Regen, und ich werde nun schneller, da sich der Vorhang bald schon heben wird, laufe durchnässt weiter, noch einen Block rauf und runter, einfach voller Erwartung, mit einem Anspruch, ganz ohne Gegengift und entgrenzt.
Der Beruf des Theaterkritikers hat keine Wichtigkeit oder sonderliche Bedeutung. P.G. Wodehouse sagte über Kritiker: »Niemand mag sie, und das zu Recht, denn es sind Geschöpfe der Nacht.« Allerdings ist es das Einzige, in dem ich gut bin. Das Einzige, das ich ertragen kann. Und ich möchte es mit mehr Auswahl in dem ausführen, was ich mir ansehe und was nicht, mit mehr Raum dafür, Kunst über die Ohren und Augen und diese seltsame neuronale Gemengelage aufzunehmen und mir einen Sinn aus den Ergebnissen zu machen. Mit mehr Möglichkeiten, mich echt zu fühlen, und sei es nur für ein paar Stunden. Ich bin nun definitiv über dreißig, älter als meine Mutter war, als sie mich auf die Welt gebracht hat, und ich könnte eine Bestätigung gebrauchen, dass ich mein Leben nicht verschwendet habe. Dass ich recht damit hatte, mich überhaupt für ein Leben zu entscheiden. Eine Festanstellung wäre nicht schlecht. Wenn ich also jemanden anrufen muss, um einen Job zu bekommen, dann kriege ich das schon hin. Mit Rogers Rat im Hinterkopf tippe ich David Adlers Nummer und vertraue der Rufnummernunterdrückung, die ich aktiviert habe.
Er geht ran, noch bevor der erste Rufton verklungen ist.
»Hallo«, sage ich. »Vivian Parry hier. Sie wollten mit mir sprechen?«
David Adler ist kein PR-Mensch. Auch kein Regisseur. Er ist Student der Medienwissenschaften mit gehauchter Tenorstimme – eine Klarinette mit beschädigtem Rohrblatt –, die ich unwiderstehlich finde. Seine Abschlussarbeit, so erzählt er mir, beschäftigt sich mit Kritikern – mit ihren Einflüssen und ihren Präferenzen. Er sei sehr daran interessiert, einen Theaterkritiker mit aufzunehmen, besonders eine Theaterkritikerin, insbesondere eine jüngere, denn es gäbe ja noch immer zu wenig schreibende Frauen, nicht wahr? Er verfolge meine Arbeit seit Jahren, und ob ich mich bitte mit ihm treffen würde? Ob er mich bitte interviewen dürfe?
Ich höre das Barmen in seiner Stimme, die Bedürftigkeit schnürt ihm die Kehle zu. Es ist schmerzhaft. Abstoßend.
Wenn David Adler Wissenschaftler und kein Künstler ist, dann ist er nutzlos für mich. In dem Moment aber, da er hört, wie ich Luft hole, um abzulehnen, fügt er hinzu, dass er gerade eine Podiumsdiskussion bei der Performance-Presenters-Konferenz im Januar vorbereitet und dass er mich auch da gern dabeihätte. American Stage habe versprochen, Auszüge zu veröffentlichen.
Also schlucke ich meine Absage wie eine Epileptikerin herunter, die ihre eigene Zunge verschluckt.
Ein Interview und die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion, die mir Gelegenheit böten, meine Beziehung zur Kunst zu erklären, wodurch meine Strenge mit meiner Liebe zu dieser Kunstform verbunden wird, könnte Roger davon überzeugen, dass ich die richtige Frau für die Position bin.
So schlage ich also einen Termin am kommenden Dienstag vor. Er fragt mich nach einem Ort, und ich nenne ihm eine nahegelegene Patisserie, während ich meinen Mund zu einem Lächeln zwinge, damit die Worte weniger schroff klingen. Er braucht Material. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ich kenne diese Transaktion. Der Großteil des Feuilletons spiegelt sie ständig. Begeisterung und grundlegende menschliche Anständigkeit vorzutäuschen lässt sie weniger schäbig erscheinen. Ich beende das Gespräch so schnell wie möglich und kehre zu meinem Laptop zurück, um die Erfahrung der Inszenierung von gestern Abend – ein frühes Drama von Fornés – in Argumente, Anschaulichkeit und belastbare Behauptungen zu übersetzen.
Ohne dass ich es merke, verdunkelt sich der Tag, und als ich auf »Senden« klicke, bleibt kaum Zeit, auf meine Lippen etwas Dunkles und Mattes aufzutragen – billige Maskerade – und einen Umweg zum Laden an der Ecke zu machen, um einen Milchkaffee und eine Tüte gesalzene Kochbananenchips zu kaufen, mit denen ich schlürfend und knabbernd zum Zug eile. Dann geht es hinunter in die U-Bahn und wieder hinauf zu den Lichtern und Werbetafeln des Times Square – ein Ort, der so fake ist, dass er das Theater im Vergleich fast schon real wirken lässt.
Ich dränge mich an Touristen vorbei und weiche Karteninhabern aus, stürme auf das Theater zu, als würde ich ein Zielband durchstoßen, und bahne mir meinen Weg zu einer wartenden Gruppe von Presseagentinnen mit glänzenden Lippen, deren aufwendig geglättete Haare vom Dunst des Abends bereits wieder wellige Locken geformt haben. Eine der Frauen löst sich von der Gruppe und drückt mir einen Umschlag in die Hand. Ich grinse, um nicht zusammenzuzucken. Sie heißt Kerry. Oder vielleicht Sharon. Ich kann jede Shakespeare-Komödie in der Reihenfolge des ersten Folios benennen, aber diese Brünetten kann ich nicht auseinanderhalten.
»Nur diese einzelne Karte, ist das kor-rekt?«, sagt sie, wobei die letzte Silbe in Richtung Vordach hinaufsteigt.
»Kor-rekt!«, antworte ich.
Es gab eine Zeit, in der ich alle Stücke mit meiner Mutter sah, meine Hand über der Armlehne in ihrer, und danach ein Eis, bei dem wir alle Momente besprachen, die uns am besten gefallen hatten. Als ich klein war, schlief ich auf der Heimfahrt im Auto ein, und sie trug mich ins Bett, sodass ich nicht sagen konnte, wo die Vorstellung endete und wo mein Leben wieder einsetzte. In meinen Träumen stellte ich mir vor, wieder im Theater zu sein und alle Rollen zu spielen. Nun aber schauspielere ich nicht mehr. Nicht auf der Bühne. Inzwischen gehe ich immer allein.
»Ich habe Sie am Gang platziert, falls Sie fliehen müssen«, sagt die Presseagentin. Sie sieht aus, als würde sie mir gern zuzwinkern. Das aber gibt Krähenfüße.
»Sie kennen mich wirklich gut«, sage ich, wende mich zu den Türen und lasse das Lächeln hinter mir.
Ein Samtvorhang teilt sich, und ich werde an der Menge vorbeigelotst. Meine Tasche wird kontrolliert, mein Ticket gescannt. Der erste Platzanweiser reicht mir das Programmheft, dann schickt er mich den Gang hinunter zu einem zweiten Platzanweiser, der mich zu einem Platz führt, den ich selbst hätte finden können. Ich begrüße Kollegen – mit hochgezogenen Schultern und aufgeregt oder fröhlich und frech –, während sie an mir vorbeigehen und darüber plaudern, was sie alles so gesehen haben. Meine Aufmerksamkeit aber drängt immer wieder zur Bühne und zu den noch geschlossenen Vorhängen – in gespannter Erwartung.
Ich stehe mehrfach auf, setze mich wieder, lasse Spätankömmlinge ihre Plätze einnehmen, bevor ich mich mit Notizblock, Programmheft und Stift bereitsetze. Die Musik hört auf, die Lichter werden gedimmt, und bis auf gelegentliches Piepsen der ausgehenden Handys wird der Saal süß und stumm, und ich denke daran, wie viele tausend Nächte ich auf Tausenden von Sitzen auf diese Weise gesessen habe, verstummt und erwartungsvoll. Das Stück des Abends, aus der Glanzzeit der Karriere des Autors, Noël Coward, ruft meine Begeisterung nicht hervor, verdient sie auch nicht. Aber ich werde sie dennoch aufbringen, bis das Licht wieder angeht und ich mich wieder in meinen Körper zurückzwinge und den Gang, noch zwischen den Welten schwebend, hinaufstolpere. Nun aber ist es so weit – endlich! –, der Vorhang teilt sich. Mein Blick wird weich, meine Lippen öffnen sich. Ich bin weg. Ich bin zu Hause.
Der Rest der Woche vergeht so wie die meisten in einem Schwall von E-Mails, Vorschauen, Deadlines, Entwürfen und Überarbeitungen. Ein Pappbecher mit Kaffee weckt mich morgens, ein eiskalter Shot Wodka bringt mich abends ins Bett, und in den Stunden dazwischen lese oder schreibe ich oder gehe spazieren, bis der Nachmittag in die Nacht gekrochen ist und ich mich in etwas gerade so eben Präsentables kleiden kann und wieder ins Theater aufbreche, wieder und wieder und wieder. Die Wochenenden unterscheiden sich nicht von den Wochentagen. Aber Wochenenden fallen mir leichter. Durch die Matineen habe ich Gelegenheit, mich zweimal am Tag zu verlieren, und die Augenblicke, in denen ich vorgeben muss, eine Person zu sein, sind rarer gesät.
Am Sonntag fliehe ich aus einer Abendvorstellung – einer impotenten Sexkomödie –, als mich ein Presseagent, diesmal ein Mann, am Ausgang aufhält.
»Und?«, sagt er und saugt seine Wangen ein, was gleichermaßen Impertinenz wie die Assoziation an einen Fisch nahelegt. »Was denken Sie?«
Ich lasse mein Gesicht weit und leer wirken, eine fleischgewordene Steppe. »Nun, was kann man schon sagen?«, antworte ich.
Dann täusche ich vor, nach links zu gehen, schlage einen Haken nach rechts und nehme die Linie 2 nach Tribeca, um Justine bei einer Party im Loft irgendeines Malers zu treffen. Dessen Kunst besteht darin, Säure in verschiedenen Konzentrationen auf matte Metallplatten zu gießen, daher ist »Maler« nicht ganz das richtige Wort, und Tribeca fühlt sich ebenfalls immer etwas falsch an. Aber ich gehe trotzdem hin, da man Justine – wie Leute, die fürs Casting zuständig sind, und jene Männer, die bei Schlussverkäufen die Menge im Zaum halten müssen, am eigenen Leib gelernt haben – nur auf eigene Gefahr etwas abschlagen kann. An der Tür begrüßt uns der Künstler und bietet uns Kokain aus einem Fläschchen an einer Kette um seinen Hals an. Justine nimmt an und verdreht die Augen, während sie erst ein und dann ein zweites Mal von dem winzigen Löffel schnupft.
»Jetzt mal im Ernst: Weiß der nicht, dass die Achtziger vorbei sind?«, fragt sie, als wir unsere Mäntel auf einer Couch ablegen. »Und dass ich damals noch gar nicht geboren war?«
»Nun, er lebt in Tribeca«, erwidere ich.
Später, als die Party so ausgedünnt ist, dass sie fast schon transparent scheint, verschwindet sie mit ihm auf eine Schlafempore, wobei ihr schwarzes Haar wie ein Pendel schwingt, als sie die Leiter hinaufsteigt. Ich winke, obwohl sie mich nicht sehen kann, und verbringe noch ein paar Minuten damit, das zweite Glas erstklassigen Spätburgunder auszutrinken, das ich mir gegönnt habe. Dann fahre ich mit dem kreischenden Lastenaufzug hinunter zum Bürgersteig, der von frischem Regen besprenkelt ist. Ich biege in Richtung Canal Street ab und strecke meine Hand nach einem Taxi aus, während ich weiterlaufe und beobachte, wie die Straßenlaternen meine Finger natriumgelb und gespenstisch färben.
Ich höre jemanden hinter mir. Schuhe, die einen halben Takt nach meinem eigenen auf dem Kopfsteinpflaster klicken. Ich wirble herum, wobei mir meine Haare in die Augen wehen. Doch da ist niemand, nichts – nur Straße und Schatten und die rosa leuchtende, verlogene Verheißung des Lotterieschildes an der Ecke. Dann quietscht ein Taxi um die Ecke, seine Scheinwerfer blenden mich. Ich halte es an und nenne meine Adresse mit einer Stimme, die zu hoch, zu schnell ist. Mit geballten Fäusten und geschlossenen Augen zwinge ich mich, nicht aus dem Rückfenster zu starren, während es mich nach Hause bringt.
Am Montagabend – einem Tag, an dem die meisten Theater geschlossen sind – erklimmt Justine mit Absätzen, die noch schwindelerregender hoch sind als sonst, meine Treppe. Wir bestellen thailändisches Essen, und der Lieferant versucht, sich mit ihr in einer Art Lautsprache zu unterhalten.
»Tut mir leid«, sagt sie. »Meine Eltern haben mich verdammt falsch erzogen. Nur Englisch. Und Schulfranzösisch.« Trotzdem gibt sie ihm mehr Trinkgeld, als sie sich leisten kann, und wir stochern eine Weile in den Kartons herum, bevor ich das morgige Interview mit dem Doktoranden David Adler erwähne.
»Schau mal an, so berühmt bist du«, sagt sie. »Mamas kleine Spinnerin ist erwachsen geworden. Schau mal, siehst du die?« Sie gestikuliert mit einem Essstäbchen zu ihren Augen, die jetzt feucht sind. »Verdammte Freudentränen. Nun, zur Sache: Was ziehst du an?«
Ich zucke elegant mit den Schultern, um zu signalisieren, dass mir Kleidung als soziales Erkennungszeichen egal ist. Justine kocht vor Wut, wie es nur jemand kann, der es sich nicht nehmen lässt, Slingbacks anzuziehen, um eine Wohnung im fünften Stock ohne Aufzug zu erreichen.
»Ich kann es nicht glauben«, sagt sie und reißt eine letzte Schublade auf. »Du hast verdammt noch mal überhaupt keine Klamotten.«
Ich deute auf den Haufen, der jetzt meinen Boden bedeckt. »Mit Verlaub –«
»Die sind aber alt.« Sie wühlt sich in die Tiefen des Kleiderschranks und greift ein Paisley-Kleid hervor. »Vorsintflutlich.«
»Fass das nicht an«, sage ich und schlage ihre Hand weg. Sie weiß es eigentlich besser, als die Sachen meiner Mutter anzufassen.
Als Entschuldigung streift sie ihre eigenen schwarzen Cigarette Pants ab und wirft sie in meine Richtung.
»Brauchst du die nicht selbst für den Heimweg?«
»Hosen werden überbewertet. Zieh deine schwarzen Stiefel an, eine Bluse und das Hermès-ähnliche Tuch, das ich dir geschenkt habe«, sagt sie. »Und Mascara. Babe, hast du überhaupt Mascara?«
»Muss irgendwo sein.«
Justine sieht aus, als würde sie wieder anfangen zu weinen. Im Gegensatz zu mir kann sie im Handumdrehen Tränen hervorzaubern. Das habe ich schon beobachtet. Um sie zu trösten, grabe ich eine Flasche Bourbon hervor, die ich unter der Spüle versteckt habe, und schütte Justine mehrere Finger breit über Eis ein und mir selbst ein kleineres Glas, bevor ich mein Fenster ganz öffne und mich zu ihr auf die rostige Feuerleiter geselle. Sie holt einen Vape-Pen hervor, zieht ein und lässt den Rauch an den durchhängenden Stromleitungen und dem aus den Rissen im Beton sprießenden Efeu vorbeischweben.
»Dieses Interview«, hebt sie an, »worum soll es da gehen?«
»Um Kritiker, und wie man zu einem wird. Einflüsse, Herangehensweisen, Arbeitsstil, und wer mir so wehgetan hat, dass ich ein solches Leben gewählt habe.«
»Witzig«, sagt sie. »Nicht witzig. Also nichts Persönliches?« Sie zieht noch mal auf Lunge.
Ich mache eine Geste von Kopf bis Fuß. »Als ob ich Persönliches könnte. Hab gerade so eben eine Persönlichkeit.«
»Ich weiß, Babe. Du bist ein Hochsicherheitstrakt. Fort Knox mit Körbchengröße B.« Sie mustert meine Brust. »B minus. Aber echt jetzt …«
Einen Moment lang lässt sie ihre Maske fallen, die Maske, die inzwischen wahrer ist als ihr Gesicht, und jemand Jüngeres und Unsichereres blickt mich an. »Glaubst du nicht, dass er dich nach …?« Und ich kann sehen, wie sie nach dem Wort ringt. Was mir ein flaues Gefühl gibt. Das tut sie sonst nie.
»Dass er mich nach früher fragen wird?«, frage ich und versuche beiläufig zu klingen, aber es kommt abgehackt heraus.
»Ja«, sagt sie. »Das macht er bestimmt.«
»Wie könnte er? Das ist ja alles nicht wirklich öffentlich zugänglich. Und ich benutze diesen Namen nicht mehr. Woher sollte er wissen, was er fragen soll? Außerdem«, sage ich und mache eine Pause, um zu schlucken und das Gesicht zu verziehen, »bin ich aus den gesammelten Werken von Dorothy Parker und mithilfe einer Schuhschachtel voller Playbills aus dem Nichts formvollendet erschienen. Das weißt du doch.«
»Ja. Aber du weißt schon noch, was Faulkner über die Vergangenheit gesagt hat?«
»Dass sie nicht tot ist? Dass sie nicht einmal vergangen ist? Natürlich. Es steht in seinem einzigen Theaterstück.«
»Es ist nur so, dass es mir in letzter Zeit durch den Kopf geht«, sagt sie. Dann atmet sie durch zusammengepresste Lippen aus und schaut auf den Beton unter ihren Füßen. »Ich weiß nicht mal, warum. Und ich mache mir Sorgen um dich, okay?«
In Anbetracht der Tatsache, dass eine von uns in den letzten zehn Jahren fast zweimal an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt wäre und diese Person nicht ich bin, scheint ihre Sorge einigermaßen deplatziert. »Mir geht’s gut. Erste Sahne. Ich bin das verdammte Stockfoto, das einem Google serviert, wenn man joie de vivre eingibt.« Ich deute auf ihr leeres Glas. »Wo wir gerade davon reden, unser bestes Ich zu leben, willst du noch eins?«
Als ich zur Feuerleiter zurückkehre, ist sie mit ihrem Handy beschäftigt und sieht mir nicht in die Augen.
»Wie geht’s dem bösen Doktor?«, frage ich und baumle mit den Beinen in die Leere.
Der böse Doktor ist ein Internist, den sie in einem Underground-Supper-Club in Bushwick kennengelernt hat. Sie begannen ein Gespräch und tranken selbstgemachten Absinth, und am Ende des Abends schrieb er seine Telefonnummer auf einen Rezeptblock. »Ich bekomme echt tolle Proben«, sagte er. Vielleicht benutzt er den Spruch bei allen. Bei Justine hat er funktioniert.
»Es geht ihm gut«, sagt sie und verstaut ihr Handy in ihrer Umhängetasche. »Also, er ist uncool und fast vierzig und hegt ein paar dämliche, überkommene Vorstellungen darüber, ob ich mit anderen Leuten schlafen sollte, Vorstellungen also, die ich ganz klar ignoriere, aber im Grunde geht es ihm gut. Übrigens schwört er auch auf dieses percocetartige Zeug, das angeblich vielleicht nicht ganz so abhängig macht und weniger gesellschaftszersetzend sein soll, und er hat mir ein paar Packungen zugesteckt.«
»Und?«
»Wie ein Chor aus Engeln mit trockenen Mündern, Babe.«
»Magst du teilen?«, frage ich. Aber das war unnötig.
Sie zieht eine silberne Schachtel aus ihrer Tasche, legt mir eine gelbe Tablette auf die Zunge und hebt mir ihr Glas an die Lippen. Ich lehne mich an sie, und sie lehnt sich an mich zurück, mit ihrem Duft nach Adlerholz und Rauch und gezuckerten Mandeln, und innerhalb von Minuten spüre ich, wie es einsetzt. Ein Sicherheitsvorhang schiebt sich zwischen die Welt und mir. Als es sich mit dem Bourbon verbindet, fühle ich mich schläfrig und warm und verlangsamt. Dann spüre ich gar nichts mehr.
Ich muss mich selbst ins Bett gebracht haben, denn ich erwache unter meiner Decke in einem angemessenen Entkleidungszustand. Mein Kopf hämmert wie ein Lautsprecher mit zu laut aufgedrehten Bässen. Eine anhaltende Angst, wie dieses klebrige Gefühl, in ein Spinnennetz gelaufen zu sein, verrät mir, dass ich meinen üblichen Albtraum hatte. Obwohl ich manchmal auch andere Träume habe. Süßere. Träume, dass ich wieder auf der Bühne stehe, eingehüllt in das Licht der Scheinwerfer. Geliebt. Berühmt.
Ich lasse Wasser in meine Hände laufen, schlucke ein paar Aspirin, wickle mich in meinen Mantel und torkle zum Laden an der Ecke. Kehre mit einem großen, schwappenden Kaffee zurück. Ich lege mich wieder ins Bett, den Laptop vor mir, und lese über eine dänische Theaterregisseurin, die ich diese Woche interviewen soll, kopiere mir Stellen und füge alles halbwegs Nützliche aus bisher erschienenen Presseartikeln über sie zusammen.
In einem Moment der Muße suche ich nach David Adler. Die Suchmaschine liefert mehr als eine Million Treffer. Ich scrolle durch Anwälte, Marketingexperten, einen Schriftsteller und einen Elektriker. Nirgends ein Akademiker. Was zwar seltsam erscheint, aber auch nicht übermäßig seltsam. Vielleicht benutzt er eine ungewöhnliche Schreibweise oder verabscheut soziale Medien – ein Abscheu, den ich mit ihm teile.
Um zwanzig vor zwei fahre ich mir mit einer Bürste durch die Haare und streiche etwas Coty-Creme – ein weiteres Erbe meiner Mutter, vorbehalten für ganz besondere Anlässe – über die Lippen. Den Mascara kann ich wie üblich nicht finden. Ich entriegele das dreifache Bolzenschloss, das meine Tür sichert, verschließe sie wieder und steige die Treppen hinunter, hinaus auf die novemberliche Straße, und ducke mich unter kahlen Bäumen hindurch.
Als ich die Patisserie erreiche, stelle ich mich in die Schlange, bis eine Hand meine Schulter ergreift und im Ton jenes Klarinettentenors sagt: »Vivian?«
Ich drehe mich ruckartig um, die Hand zur Verteidigung erhoben, und sehe einen Mann, etwa in meinem Alter oder vielleicht ein paar Jahre jünger, in einen blauen Parka gehüllt. Dunkles Haar fällt in Locken über eine blasse Stirn, über die Ränder seiner Hornbrille und entlang langer Koteletten. Er lächelt mich an, zögernd, hoffnungsvoll, mit einem Mund, der zu breit für sein Gesicht scheint.
»Sind Sie David?«, frage ich und weiche leicht zurück. »Wie haben Sie mich erkannt?«
»Nun, auf der Website des Magazins ist ein Foto. Und außerdem habe ich ein Bild von Ihnen von den Critics’ Circle Theatre Awards letztes Jahr gefunden.«
Ich weiß, welches Bild er meint: mein kleines Fuchsgesicht, halb von der Kamera abgewandt, die grauen Augen im Blitzlicht rot geworden, wie ein Geschöpf der Nacht, das vom Licht überrascht wurde. Ich habe immer vorgehabt, meinen Namen irgendwie zu enttaggen.
»Verstehe«, sage ich. »Sollen wir bestellen?«
Ich bestelle einen Macchiato und ein Stück Quiche. David schiebt sich vor mich, deutet auf ein Schokoladencroissant, bezahlt alles mit einem zerknitterten Zwanzig-Dollar-Schein und wirft das Wechselgeld in ein Glas mit der Aufschrift »Hilfe, Geisteswissenschaftler!«.
Während ich auf das Getränk warte, sucht er einen Tisch aus und setzt sich auf den Stuhl, der zur Tür zeigt, was üblicherweise mein Schachzug ist. Ich fühle mich wohler, wenn ich meinen Fluchtweg kenne. Aus einem abgewetzten Leinenbeutel holt er ein Notizbuch, einen Stift mit abgekauter Kappe und einen Mini-Kassettenrekorder – ein Gerät, das ich bisher nur in Secondhandläden gesehen habe. Als ich ihm gegenübersitze, bemerkt er, wie ich das Gerät beobachte.
»Eine Zeit lang habe ich digital gearbeitet«, sagt er mit einem leichten Achselzucken. »Aber ich habe festgestellt, dass ich die Aura vermisst habe, die von einem solchen Artefakt ausgeht.«
Akademiker. So unprätentiös. Wenn man bedenkt, dass Justine mir dafür extra ihre Hose geopfert hat. Ich hatte gedacht, es würde zumindest ein paar Minuten dauern, bis ich meine Entscheidung, mich mit ihm zu treffen, bereue. Ich habe mich geirrt. Er drückt auf einen Knopf, ein rotes Licht geht an, und das Band dreht sich über seine Spulen. Dann öffnet er sein Notizbuch und schirmt die Seite mit der Hand ab – eine Technik, die ich auch anwende. Es liegt etwas in dieser gespiegelten Geste – oder vielleicht ist es das Wissen, dass ich am falschen Ende des Tisches sitze oder dass ich diejenige sein sollte, die Fragen stellt –, aber mir wird für einen Moment schwindlig, und ich muss die Tasse absetzen, damit ich den Macchiato nicht verschütte.
Die Podiumsdiskussion, rufe ich mir in Erinnerung. Der Artikel. Ich atme tief durch und bereite mich vor, eine Persona anzunehmen, die warm, geistreich und freundlich ist, wie eine weniger offensichtlich alkoholkranke Dorothy Parker, eine sanftere Variante meiner üblichen Verhaltensmuster. Eine Stunde lang kann ich die durchaus spielen.
»Okay«, sage ich. »Also, was wollen Sie und Ihr Doktorvater unbedingt wissen?«
»Richtig«, sagt er und greift zum Stift. »Genau. Und danke. Wirklich. Sie haben keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet, für meine Recherche.« Etwas in seiner Stimme hat sich verändert, ist schärfer geworden, wie eine Gitarrensaite, die eine Umdrehung zu stark gespannt wurde. Er muss nervös sein. Ich muss ihn nervös machen.
»Ich habe gerade erst begonnen, diese Interviews zu führen, und ich schiebe vorweg, dass es mir leidtut, wenn diese Fragen nicht die relevantesten sind oder noch nicht bestmöglich sortiert sind. Ich versuche noch herauszufinden, wie das mit den menschlichen Forschungsobjekten funktioniert. Seien Sie also nachsichtig mit mir, okay?« Er lächelt so breit, dass ich sein Zahnfleisch sehen kann.
»Nachsichtig?«, sage ich. »Aber na klar.«
»Okay, großartig. Fangen wir an. Als Erstes natürlich: Wie sind Sie Kritikerin geworden?«, fragt er.
Ich habe diese Geschichte schon oft genug erzählt. Also gebe ich ihm die einstudierte Rede, das kalkulierte Schulterzucken, das wohlüberlegte Lachen. Ich erzähle ihm, wie ich am College Theaterwissenschaft studiert habe und dann, direkt nach meinem Abschluss, in die Stadt gezogen bin, wo ich gerade genug als Korrekturleserin juristischer Texte verdiente, um mir eine Einzimmerwohnung mit einem Zweiplattenherd und einer winzigen Badewanne leisten zu können. Damals habe ich kaum Theater gesehen. Abgesehen von gelegentlichen Restkarten an der Abendkasse konnte ich es mir nicht leisten. Im Februar dieses ersten Jahres hörte meine Tante von einer Freundin, dass das Magazin nach Faktenprüfern suchte. Ich ging hin, machte den Test, und sie stellten mich ein. Ein paar Monate später sprach mich Roger Walsh in der Küche der Redaktion direkt an. Chefkritiker Crispin Holt sei krank, und seine üblichen Vertretungen anlässlich des bevorstehenden Labor Days verreist, und es würde eine David-Mamet-Premiere stattfinden, die sich nicht von selbst rezensieren könne, obwohl ich mir vollkommen sicher bin, dass David Mamet das lieber gewesen wäre.
»Roger hatte von irgendwem gehört, dass ich Theaterwissenschaften studiert habe«, erzähle ich David Adler. »Vielleicht war da auch einfach was in meinem Blick? Dieser Schaden? Jedenfalls fragte mich Roger, ob ich hingehen wollte. Und das wollte ich. Sogar zu David Mamet. Und ich war entweder zu grün hinter den Ohren oder halt tollkühn, aber im Anschluss schrieb ich genau, was ich von der Aufführung hielt, und das ging sogar ein wenig viral. Was einen weiteren Auftrag nach sich zog und dann noch einen weiteren, und im Herbst war ich also Junior-Kritikerin. Der Rest« – und hier mache ich eine Pause und deute eine Geste an, die sagen soll und so weiter und so weiter – »ist niemandes Vorstellung von Geschichte.«
»Und das sind Sie dann geblieben?«, fragt er.
Ein Stich – ein Spinnenbiss –, ob er es nun so meint oder nicht. Denn mit zweiundzwanzig Jahren fühlte sich die Position der Junior-Kritikerin irgendwie noch zu früh an. Mit siebenundzwanzig war sie noch recht beeindruckend. Mit zweiunddreißig ist die Blüte des Ganzen wie bei einem Strauß Rosen in der Garderobe einer Inszenierung, die kurz nach ihrer Premiere gecancelt wurde, irgendwie welk.
»Aber klar«, sage ich. »Ich lebe noch immer in der Wohnung mit dem Zweiplattenherd und werde ganz aufgeregt, wann immer eine Sophokles-Wiederaufnahme ansteht. Offensichtlich habe ich Angst vor Veränderungen.«
»Wirklich?«, sagt er und starrt mich durch seine Brille an, deren Gläser nicht entspiegelt sind.
Die Frage fühlt sich zu sehr nach einer an, die ein Therapeut stellen könnte. Eine, die mir mehrere Therapeuten gestellt haben. Also wische ich sie beiseite. »Entweder das oder die Tatsache, dass es verschwindend wenige Jobs für junge Frauen mit einer starken Meinung über Gertrude Stein gibt.«
»Ha«, sagt er. Kein richtiges Lachen. Nur die ausgesprochene Silbe. Als der Klang verklingt, bemerke ich, dass er sein Croissant weniger gegessen als vielmehr Schicht für Schicht dekonstruiert hat, eine Häutung in Schichten. Er fährt fort: »Sie sagten, Sie haben Theater studiert?«
»Ja«, sage ich. »Meine Abschlussarbeit drehte sich um Metatheater. Also das Stück im Stück. Ich konnte wohl nicht genug davon bekommen.«
»Vielleicht irre ich mich, aber sind Sie nicht mal Schauspielerin gewesen?«
Ich bemühe mich, meine Stimme leichtfüßig zu halten – eine Wolke, Milchschaum. »Durchaus, ja. Als Kind. In Schulaufführungen. Bei den wenigen Musicals, die eine schräge Altstimme wie meine erforderten. Laientheater.«
»Am College dann aber nicht mehr?« Er hat sich nun näher zu mir gelehnt. Zu nah.
»Oh, ein bisschen auch noch am College«, sage ich. Mein Herz schlägt jetzt schneller. Das ist es, worüber Justine sich Sorgen gemacht hat. Was ich so beiläufig abgetan habe. Ich wähle meine Worte sorgfältig und versuche, ihn von der Vergangenheit abzulenken, zurück in die Gegenwart. »Und je weniger Worte darüber verloren werden, desto besser. Ich war nicht sonderlich gut. Aber dass ich es üben konnte, hilft mir heute beim Rezensieren. Man muss wissen, wie schwer es ist, Theater zu machen – das Unvorgesehene, die kollektive Anstrengung –, um mit Verständnis und Mitgefühl darüber schreiben zu können. Daher finde ich diese Erfahrung recht nützlich.«
»Mitgefühl?«, sagt er und zieht eine Augenbraue hoch. »Ist das ein entscheidender Faktor für Sie? Klingt sehr nett. Aber noch mal zu Ihrer Zeit als Schauspielerin. Dazu habe ich das hier gefunden.« Er blättert eine Seite in seinem Notizbuch um und faltet ein Blatt Papier auseinander, und obwohl ich es seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen habe, erkenne ich es sofort. Es ist der Ausdruck eines Artikels aus der Studentenzeitung meines Colleges, eine Rezension über die Hamlet-Inszenierung, die wir in meinem dritten Jahr dort aufgeführt haben.
»Das sind doch Sie, oder?«
Es ist sinnlos, es zu leugnen. Ich sehe mein Bild neben dem Text. Das Mädchen auf dem Schwarz-Weiß-Foto sieht jünger aus, klar. Sie ist blasser, dünner, mit tiefen Höhlen unter den Augen. Dennoch besteht da eine deutliche Ähnlichkeit.
»Wie haben Sie das gefunden?«, frage ich.
»Ich bin Doktorand«, sagt er. »Recherche hat man uns eingeimpft. Ist es okay, wenn ich einen Abschnitt vorlese?«, fragt er und wartet meine Antwort nicht ab. »Hier ist es«, sagt er. »›Nicht einmal im Tod wirkt Beatrice Parry, Theaterstudentin im dritten Jahr, lebendig.‹ Recht harsch. Und ich schätze, Sie nannten sich damals Beatrice? Wie auch immer, würden Sie dieser Beschreibung zustimmen?«
Das würde ich wohl. Ich würde zustimmen, dass ich damals nicht lebendig wirkte und dass ich seitdem nicht lebendig gewesen bin. Aber ich gestatte mir nie, mich an die verheerende Zeit dieser Proben und die leeren weißen Tage vor und nach der Premiere zu erinnern.
Meine Stresshormone sind jetzt voll da – mein Atem ist verkürzt, das Blut singt. Und ich möchte weglaufen – eine Ausrede vorbringen oder ihn schlicht ohne eine zurücklassen, zurück durch die Tür schlüpfen und mich Minuten später neben dem zischenden Heizkörper in meiner Wohnung oder an der Bar im polnischen Lokal um die Ecke wiederfinden, meinen täglichen Wodka früher stürzen und mich ans Vergessen machen.
Aber ich richte mich auf. Der Job. Roger. Das Podium. Ich halte meinem Gegenüber ein Lächeln entgegen, als stünden wir uns in einem Duell gegenüber. Ich bleibe.
»Ob ich dem zustimme?«, sage ich möglichst tonlos. »Natürlich. Es gibt einen Grund, warum ich meinen Schwerpunkt auf die Theaterkritik verlegt habe. Ich war nie eine sonderlich gute Schauspielerin.«
Das ist nicht ganz richtig.
Es stimmt eigentlich gar nicht.
Aber es ist die Lüge, die ich mir selbst erzähle, acht Vorstellungen die Woche.
»Jetzt wissen Sie also, warum ich Kritikerin geworden bin«, sage ich. Mein Lächeln hat sich verbreitert, jeder einzelne Zahn eine unechte Perle. »Ich hab’s als Künstlerin nicht geschafft. Erwischt! Aber sosehr ich es auch genieße, den Schauplatz meiner größten Misserfolge erneut aufzusuchen, wollten Sie mit mir nicht über meine aktuelle Arbeit sprechen? Meine Einflüsse und Methoden?«
»Ihre Einflüsse. Ihre Methoden«, sagt er. »Ja, Vivian. Lassen Sie uns darüber reden. Es lag mir fern, über Sie urteilen zu wollen. Ich hoffe, das wissen Sie. Ich wollte nur den richtigen Kontext herstellen. Wahrscheinlich ist es gut, dass Sie sich früh umorientiert haben. Nicht jeder ist für das Rampenlicht gemacht.« Er hebt die Hand, um sich die Haare aus der Stirn zu streichen, wobei Flocken aus Blätterteig zu Boden schweben, und für einen Moment blitzt seine Brille nicht auf, und ich sehe etwas hinter den Gläsern – etwas, das weniger nach Nervosität und mehr nach Erregung oder Begeisterung aussieht. Ist es wirklich möglich, dass er so etwas wegen einer Abschlussarbeit, wegen einer Kontextualisierung empfindet? Doch dann fällt das Haar wieder zurück.
Also erzähle ich ihm, wie ich auswähle, was ich rezensiere, wie viel Recherche ich vorher und nachher betreibe, ob ich jemals meine Meinung über ein Stück geändert habe. (Einmal ist das vorgekommen, erzähle ich ihm, bei einer Tragödie von Edward Albee.) Ich biete ihm auch ein paar heitere Anekdoten an – der Moment, als die Trophäenfrau eines Wall-Street-Bankers ihren Trinkbecher mit Chardonnay verschüttete und alle meine Notizen ruinierte; der Moment, als mich ein Schauspieler aus einem Musical, das ich verrissen hatte, in einer Bar in die Enge trieb und ich buchstäblich zur Hintertür ins Freie kriechen musste. Ich liste ihm meine Lieblingsautoren auf, und dann, als würde ich ihn in ein Geheimnis einweihen, jene, die ich am wenigsten mag.
Er rückt seinen Stuhl nach vorn. »Aber die Theaterautoren, von denen Sie sprechen, also die, die Sie lieben, die sind alle seit mindestens einem Jahrhundert tot«, sagt er. »Es tut mir leid, und ich will Sie nicht beleidigen, aber wie können Sie neue Werke kritisieren, wenn Sie die nicht mal mögen?«
»Ich mag sie schon. Es ist nicht meine Schuld, wenn es in den letzten ein oder zwei Jahren niemandem gelungen ist, etwas so Gutes wie Die Gespenstersonate zu schaffen.«
»Aber was ist mit neuen Formen? Was ist mit wirklich experimenteller Arbeit? Ich denke da an einen Essay, den Sie vor ein paar Monaten geschrieben haben. Darin sagen Sie, dass das Avantgarde-Theater im Grunde tot sei.«
»Nun, das ist es im Grunde auch«, sage ich ihm. »Jahrhundertelang gab es Regeln und Normen, die man übertreten konnte. Früher – also ganz früher – war sogar das Hinzufügen eines zweiten Schauspielers eine vollkommen wilde Vorgehensweise. Aber wenn man erst einmal Figur und Handlung und Ort und Zeit und Kleidung abgeschafft hat, was bleibt dann noch, um sich nach vorn zu positionieren? Es gibt keine Avantgarde mehr, schon seit Jahrzehnten nicht mehr.«
»Wirklich? Nichts? In Ihrer ganzen Lebenszeit nicht?«
»Wirklich«, sage ich. »Nichts.«
»Aber der Essay, den Sie geschrieben haben, der muss doch einen Auslöser gehabt haben, oder?«, fragt er, und seine Stimme hebt sich wie ein Blechinstrument.
»Ja. Vermutlich. Aber ich sehe sehr viele Stücke. Lassen Sie mich nachdenken.« Ich schließe für einen Moment die Augen und zwinge mich dann, sie wieder zu öffnen. »Okay. Richtig. Anlass war ein allzu konstruiertes Stück in der alten Synagoge in der Eldridge Street. Das Werk eines Kollektivs. Sehr überkandidelt.«
»Ich habe diese Rezension gelesen. Es war ein partizipatives Stück, und Sie schrieben, dass Sie sich weigerten, daran zu partizipieren. War das dem Werk gegenüber fair?«
»Ich habe insofern partizipiert, als ich zugeschaut und zugehört habe. Ich habe Raum und Atemluft mit ihnen geteilt. Das sollte genügen. Haben Sie es gesehen, David?«, frage ich.
»Ja«, sagt er.
Und ich glaube ihm. Denn als er antwortet, wird etwas in ihm weich, faltet sich auf. Sein Gesicht nimmt einen fast heiligen Ausdruck an, und ich frage mich, ob ich so aussehe, wenn ich in meinem Plüschsitz im Dunkeln sitze, hingerissen von einer Vorstellung.
»Und Sie haben partizipiert?«, frage ich. »Sie haben sich dem Ihnen zugeteilten Schauspieler anvertraut?«
»Natürlich«, sagt er. »Warum haben Sie es nicht getan?«
»Weil ich die Kritikerin bin«, sage ich, während meine Stressreaktion wieder aufwallt. »Nicht das Subjekt. Worum auch immer es in der Inszenierung geht, es geht nicht um mich.«
Das Café fühlt sich plötzlich weit entfernt an, die Distanz über den Tisch hinweg ist immens. Ich bemerke, als würde ich mich von außen betrachten, dass meine Zähne zu klappern begonnen haben, dass ich sie zusammendrücken muss, um das Klappern zu stoppen. Ich mag die Richtung nicht, die dieses Gespräch genommen hat. Wie ich als Schauspielerin versagt habe. Wie ich als Kritikerin versagt habe. David Adlers Anwurf, dass es mir an der Eignung mangelt, die einzige Aufgabe auszuführen, die mir zuverlässig das Gefühl gibt, Mensch zu sein. Ich habe die Community für diesen Nachmittag gewiss genug unterstützt.
»Vielen Dank«, sage ich und schicke mich an, aufzustehen. Ich strebe dem Finale entgegen, also wieder voller Charme. Ein wandelndes, vierblättriges Kleeblatt. Ein endloser Regenbogen. »Es ist sehr nett, dass Sie sich die Zeit nehmen für all das. Ich weiß, wir sind nicht sonderlich auf den Aspekt der ›Kritikerin‹, der ›weiblichen Zuschauerin‹ eingegangen. Aber ist es nicht langweilig, diese Dinge binär zu betrachten? Wir haben uns nun eingehend unterhalten. Und Sie haben wirklich ausgezeichnet recherchiert! Ich bin sicher, Sie haben jetzt alles, was Sie brauchen.«
»Oh, okay«, sagt er. »Sind Sie sicher? Denn vielleicht …«
»Nein«, sage ich. »Danke«, sage ich und betone die Worte überdeutlich, während ich nach meinem Mantel greife. »Ich habe wie immer eine Deadline, also muss ich jetzt wirklich gehen.«
»Okay«, sagt er, schaltet das Aufnahmegerät aus und packt seine Tasche. »Natürlich. Kein Problem. Ich rufe Sie an, wenn ich die Details für die Podiumsdiskussion habe.«
»E-Mail ist mir lieber.«
»Dann per E-Mail«, sagt er.
»Sie haben meine Adresse?«
»Natürlich. Und Sie haben recht, Vivian. Danke. Ich habe alles, was ich brauche.«
Dann steht er auf und greift nach meiner Hand in einer Art Abschiedskrampf, der einen eiskalten Schauder meinen Arm hinauf- und hinunterwandern lässt. Und in diesem Moment beobachte ich mehrere Dinge.
Die Augen hinter seiner Brille sind tiefbraun, fast schwarz. Wie Zwillingstümpel. Die dunkelsten, die ich je gesehen habe. Und hinter diesen Augen blitzt etwas auf, etwas Kühles und Scharfes, unnachgiebig wie eine Dolchspitze. Die Angst, dieses flackernde Lächeln, sie sind verschwunden. Er sieht mich. Er sieht mich wirklich. So wie ich bin. Nicht so, wie ich vorgebe zu sein. Als ich in dieses Gesicht blicke, so nah an meinem eigenen, wird mir noch etwas anderes klar: David Adler hat die ganze Zeit geschauspielert. Auch er gibt vor, eine Person zu sein. Und er ist gut darin. Besser als ich.
»Wiedersehen, Vivian«, sagt er. »Wir sehen uns.«
Ehe ich mich’s versehe, ist meine Hand frei, ich kippe fast gegen den Tisch, und er ist zur Tür hinaus, geht schnell in Richtung Avenue A, stößt beinahe mit einem Mann zusammen – muskelbepackt wie ein auf dem Kopf stehendes Dreieck und mit einer roten Baseballkappe –, und dann geht er weiter, oder nein: Er läuft jetzt über die Straße und in das trostlose Grün des Tompkins Square Parks. Dann ist er aus meinem Blickfeld verschwunden.
2
Anderweitig beschäftigt
Zwei Wochen später, am Montag nach Thanksgiving, schaue ich im Büro vorbei, um einen Artikel für die Vorschau auf die Kunstveranstaltungen des Winters fertigzustellen. Es ist ein vielversprechendes Zeichen, dass Roger mich und nicht Caleb gebeten hat, den Theaterbeitrag zu schreiben. Jedenfalls rede ich mir das ein. Ich bahne mir meinen Weg durch das Labyrinth des Großraumbüros, bis ich Rogers weißhaarigen Kopf ausmachen kann und sehe, wie er ein Pastrami-Sandwich verschlingt, das doppelt so breit ist wie sein offener Mund. Er schluckt und bedeutet mir, mich zu setzen.
»Was hältst du von meiner brillanten Artikelidee, die Rockettes zu fragen, was sie unter diesen knappen Outfits tragen?«, fragt er und tupft sich den Senf ab. »Sicher kann ich eine Extraseite für die dazugehörige Bildstrecke bekommen. Okay, ist ja gut. Kannst dir den feministischen Todesblick sparen. Wir setzen Radio City dieses Jahr aus. Sonst noch was?«
Ich hole mein Notizbuch hervor. »Was hältst du von einem Beitrag über Spezialeffekte in den Inszenierungen der Saison? Wie Techniker Nebel und Eis in überhitzten Theatern erzeugen und womit sie diese Gerätschaften betanken, die es so aussehen lassen, als würde es schneien.«
»Was wäre, wenn wir eine spärlich bekleidete Rockette in besagtem Schnee spielen lassen würden? Hey, aua! Ich schätze, diese Insubordination ist das Ergebnis davon, dass wir euch Frauen Lesen und Schreiben beigebracht haben. Aber klar, mach nur. Und es gibt eine enge Deadline dafür, habe ich das erwähnt? Unsere Chefredakteurin hat sie in ihrer unendlichen Weisheit von ihrem Feriendomizil in East Hampton aus um eine Woche vorverlegt. Also tipp schnell, ja?« Er lehnt sich in seinem angeblich ergonomischen Stuhl zurück und steckt die Daumen unter seine Hosenträger. »Wie war dein Thanksgiving, Kiddo?«
»Habe Kung-Pao-Garnelen gegessen. The Amityville Horror gestreamt. Das Original. Ich dachte, das würde mich darüber hinwegtrösten, dass ich kein Zuhause habe, das ich besuchen könnte.«
»Kannst du diese Trauriges-Waisenkind-Nummer mal abstellen? Wie oft habe ich dich schon zu uns eingeladen? Du weißt, dass Cheryl es liebt, dich da zu haben. Apropos …« Er beugt sich vor, öffnet den Minikühlschrank, den er unter seinem Schreibtisch stehen hat, und holt eine in Folie verpackte Schachtel heraus. »Da sind ein paar Stücke Pekannusskuchen und ein Apfel-Crumble. Cheryl hat sich gemerkt, dass du eine angestammte Abneigung gegen Kürbis hast.«
»Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag«, sage ich. »Es ist bloß, dass er nie so schmeckt wie der meiner Mutter.«
»Bissig wie eine Schlange, was? Ich weiß, ich weiß, sag’s nicht, ich weiß, dass du deshalb all die Seitenaufrufe einheimst. Aber kannst du nicht auch mal irgendwas genießen? Oder zumindest so tun? Wann hast du zuletzt eine Inszenierung gesehen, die dir wirklich gefallen hat?«
»Das war 1606. King Lear am Hof. Die letzte Szene macht mich immer noch fertig.«
»Sehr clever. Aber mit dem letzten Beitrag hast du dir aus der Community noch mehr wütende Kommentare eingefangen.«
»Die Community könnte ja mal bessere Stücke auf die Bühne bringen«, sage ich. »Aber ich versuch’s ja, Roger. Auf jede erdenkliche Weise, die meine Integrität nicht kompromittiert. Da ist diese Podiumsdiskussion, die ich erwähnt habe. Und wo wir gerade davon sprechen …« Ich will gerade ansetzen, ihn danach zu fragen, wann er sich in der Sache der Position des Chefkritikers entscheiden wird, als Roger einfällt, dass er ein Redaktionstreffen hat, und wie ein mittelgroßer Stier, der in Pamplona übel vom Kurs abkommt, in Richtung Konferenzraum losstürmt.
»Ich brauche deine Theaterwetter-Geschichte gleich am Montag früh«, sagt er über seine Schulter. »Vierzehnhundert Wörter. Schick heute Abend ein Memo an die Bildredaktion. Und versuch, es etwas lockerer anzugehen. Lockerer. Okay, Kiddo?«
Er ist weg, bevor ich auch nur ansetzen kann, ihn aufzuhalten. Und ich bleibe allein zurück.
Als ich das Büro verlasse, versperrt mir Esteban den Weg. Er trägt einen kurzen goldenen Kimono über dunklen Jeans und mehr Lidschatten, als ich es je wagen würde. Er küsst mich auf beide Wangen, fährt mir dann mit der Hand durch die Haare und saugt die Luft durch seine zusammengebissenen Zähne ein.
»Tsts, Bebita, wann gehst du endlich zu dem Stylisten, den ich dir empfohlen habe?«
»Gar nicht. Mittagessen? Ramen?«
»Kann nicht. Diese Schlampe Trish tut wieder so, als sei sie krank, und niemand ist da, um die Telefone zu bewachen. Aber ich wollte dich gerade anrufen. Ein Mädchen hat hier angerufen, die war vollkommen aufgelöst. Also richtig durch … Als bräuchte sie ein Beruhigungsmittel für Elefanten … Gestern schon.«
»Brauchen wir das nicht alle?«
»Sie sagte, sie muss mit dir reden, meine Schöne.«





























