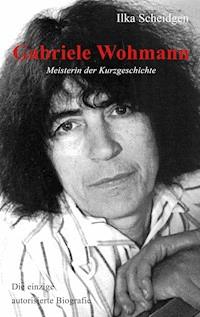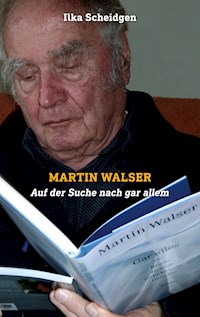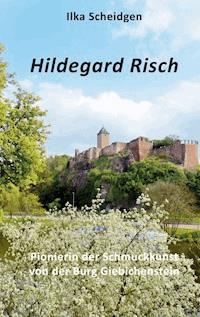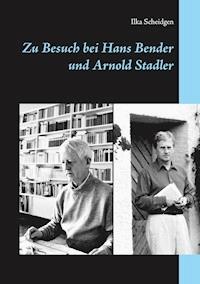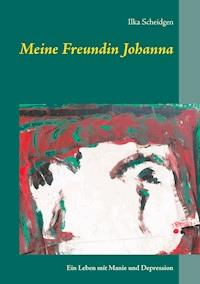Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kaufmann, Ernst
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine umfassende Biografie der bedeutendsten deutsch-jüdischen Dichterin. Die Autorin, Ilka Scheidgen, war mit Hilde Domin (27.07.1909–22.02.2006) viele Jahre lang bekannt und hat sie bei Lesungen, Vorträgen und den wichtigsten Preisverleihungen begleitet. Für das Buch hat sie zahlreiche Gespräche mit Hilde Domin geführt. So ist ein äußerst lebendiges Bild der Dichterin entstanden. Eine beeindruckende und bewegende Lebensgeschichte und ein wichtiges Buch nicht nur für Freunde Hilde Domins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ilka Scheidgen
Hilde Domin
Dichterin des Dennoch
Kaufmann Verlag
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
1. Auflage 2011, unveränderter Nachdruck
© 2006 Verlag Ernst Kaufmann, Lahr
Dieses Buch ist in der vorliegenden Form in Text und Bild urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags Ernst Kaufmann unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Nachdrucke, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Stefan Heß, Ehrenkirchen unter Verwendung eines Fotos von Hilde Domin. Fotografin Isolde Ohlbaum, München
© aller Fotos im Anhang by Ilka Scheidgen
Druck und Bindung: CPi Books, Ulm
ISBN 978-3-7806-3119-0
ISBN 978-3-7806-9201-6 (EPUB)
ISBN 978-3-7806-9202-3 (KINDLE)
Vorwort
Das vorliegende Werk basiert auf dem Quellenstudium von Hilde Domins Werken sowie auf zahlreichen im Laufe von fast zwanzig Jahren geführten Gesprächen.
Über Gedichte sind wir uns begegnet und haben miteinander korrespondiert, bevor mich Hilde Domin zu sich nach Heidelberg einlud. Für meine eigene Lyrik gab sie mir wertvolle Ratschläge. So entstand im Laufe der Jahre eine freundschaftliche Beziehung, die durch viele gemeinsame Gespräche intensiviert und lebendig gehalten wurde.
Ich konnte Hilde Domin außerdem bei zahlreichen Lesungen, Vorträgen und bei den wichtigsten Preisverleihungen persönlich erleben.
In Zeitungen und Zeitschriften konnte ich während der vergangenen Jahre viele Essays und Porträts über Hilde Domin, diese größte lebende deutsche Dichterin jüdischer Herkunft, veröffentlichen. Es ist mir eine besondere Freude, hier nun einen Gesamtüberblick über ihr Leben und Werk vorlegen zu können.
Herzlich danke ich Frau Hilde Domin für ihre Offenheit und das Vertrauen, das sie mir während unserer vielen Gespräche entgegengebracht hat, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.
Zu meinem großen Bedauern starb Hilde Domin am 22. Februar 2006, kurz vor Erscheinen des Buches.
Kall-Urft, im Juni 2006
Ilka Scheidgen
Kindheit und Jugend in Köln
Hilde Domin und ich haben uns in ihrer Wohnung verabredet – der Wohnung mit dem herrlichen Blick auf die Heidelberger Altstadt und den Neckar. Wir sitzen wie schon oft zuvor in der gemütlichen Ecke ihres Wohnzimmers mit den Gartenstühlen. Auf dem Tisch stapeln sich Bücher, die sie geschickt bekommen hat. Sie räumt sie zur Seite und holt aus der Küche Tee und Kuchen. Wie immer ist sie eine liebenswerte Gastgeberin.
Wir werden über ihr Leben reden, ihre Erfahrungen und natürlich über ihre Dichtung. Hilde Domin erzählt anschaulich und temperamentvoll, und ich spüre, wie ihr vieles, über das sie mir berichtet, noch ganz lebendig vor Augen steht.
H
ilde Domin wurde am 27. Juli 1909 als Hilde Löwenstein in Köln geboren. Ihr Vater Eugen Löwenstein war promovierter Jurist und stammte aus einer angesehenen Düsseldorfer Juristenfamilie. Die Mutter Paula Löwenstein, geborene Trier, kam aus Frankfurt am Main. Sie hatte Gesang und Klavier studiert. Allerdings übte sie ihren künstlerischen Beruf nicht aus, sondern widmete sich, wie es zu jener Zeit in den meisten Fällen üblich war, ihrer Familie. Ein einziges Mal sei sie in der Oper in Frankfurt als „Mignon“ aufgetreten. Später konnte sie ihr künstlerisches Talent nur noch bei Hauskonzerten ausleben.
Hilde war das erstgeborene Kind. Ihr Bruder „Johnny“ wurde 1912 geboren. Hilde betont, dass sie eine glückliche Kindheit hatten. Es mangelte ihnen an nichts. Sie hatten genügend Spielsachen und konnten ihren Lesehunger nach Herzenslust in der Bibliothek des Vaters stillen, was besonders Hilde ausgiebig tat.
Selbstverständlich gab es auch Dienstmädchen. Das Essen wurde aufgetragen, wenn der Vater in der Mittagspause die Klingel bediente. Und um die Kinder kümmerte sich neben der Mutter ein Kindermädchen.
„Wenn ich mich an unsere Wohnung in Köln erinnere, in der ich ja geboren wurde“, erzählt Hilde Domin, „so kommt es mir vor, als sei sie aus einer ›temps perdu‹, ganz wie bei Proust, gewesen. Die Möbel waren aus dunkler Eiche, es gab kostbare Silberbestecke, die aber nur zu offiziellen Anlässen benutzt wurden. An den Decken hatte die Wohnung Jugendstilstuck. Das Speisezimmer war mit Eiche getäfelt und besaß zum Hof ein bunt eingelegtes Fenster. Aber am meisten liebten mein Bruder und ich die beiden kleinen Balkons und den langen Flur, auf dem man Rollschuh laufen konnte.“
Der Salon war Schauplatz von festlichen Einladungen und Konzerten, bei denen die Mutter, aber auch andere Sänger und Sängerinnen und Pianisten auftraten, während die kleine Hilde die Damen in langen Abendkleidern und Herren in Smoking oder Frack von der Küche aus beobachtete.
An Wochenenden oder in den Ferien fuhr die Familie zum Wandern oft in die Eifel. Dort durfte Hilde als Kind sogar Ziegen hüten und Kühe melken. Für Tiere jeder Größe und jeder Art hatte sie immer viel übrig.
„Wir durften im Kinderzimmer auch selbst Tiere halten“, erzählt sie. „Katzen, eine Taube, einen Papagei, Kaninchen, die dann im Sommer auf die kleinen Balkons ausquartiert wurden und sich meistens nach einer gewissen Zeit ›sozusagen selbst abschafften‹, indem der Vater sie den Kindern des Bürovorstehers schenkte, weil der am Rande von Köln wohnte und einen kleinen Garten besaß.“
Hilde durfte Freunde und Freundinnen mit nach Hause bringen. Sie durfte ins Theater, ins Museum und ins Schwimmbad. Sie durfte sogar manchmal mit dem Vater ins Gericht gehen. Besonders beeindruckt sei sie von einem Prozess gewesen, bei dem ihr Vater einen Unschuldigen verteidigte, der der Brandstiftung angeklagt war. Um den Verhandlungen beiwohnen zu können, schwänzte sie die Schule. Und sie bestärkte und ermunterte den Vater darin, diesem Mandanten durch alle Instanzen zu seinem Recht zu verhelfen.
„Ich sehe den Vater noch, wie er am Abend nach einer Gerichtsverhandlung krank im Bett lag, krank vor Aufregung, weil er Drohbriefe erhielt, und wie meine Mutter dafür war, es aufzugeben – aber er konnte mich einfach nicht enttäuschen, und hätte es unsere gesamte Existenz gekostet“, beschreibt sie in dem Aufsatz „Mein Vater. Wie ich ihn erinnere“ diese Geschichte. Der Vater reichte ein Gnadengesuch ein und erwirkte für seinen Mandanten den Freispruch. Dieser Mann sei dann einer der ersten gewesen, der nach 1933 aufhörte, den Vater – als jüdischen Rechtsanwalt – zu grüßen.
Damals, als man begann, jüdische Rechtsanwälte auf erniedrigende Weise auf Müllwagen durch Köln zu fahren, entschloss sich der Vater zur ersten und einzigen „ungesetzlichen“ Tat in seinem Leben: Die Eltern fuhren mit der Straßenbahn bis zur belgischen Grenze, machten einen kleinen Spaziergang hinüber – das war nicht verboten – und draußen waren sie. Es war der Beginn ihrer Flucht, die sie nach England führte.
Das Mobiliar wurde von einem Spediteur nach Holland gebracht und dort eingelagert. Doch die kostbaren Möbel aus schwarzer Eiche, das wertvolle Porzellan, das Silber und auch viele wertvolle Bücher gingen im Laufe des Krieges, wie Hilde mir erzählt, „still und leise“ verloren.
Aber sie scheint darüber nicht verärgert oder traurig zu sein. „Ich hänge nicht an Gegenständen“, sagt sie schlicht. Während ihres Unterwegsseins hat sie das „Haben“ verlernt, „als hätte ich nicht mehr die Hände zum Haben“, wie sie einmal schreibt. Was für die meisten Menschen, die nie ihre Heimat, ihr Zuhause verloren haben, ganz selbstverständlich ist, nämlich etwas zu besitzen, ist ihr noch immer nicht zur Normalität geworden.
„Hier dieser Teppich, wo wir gerade sitzen, ist eigentlich das einzige Stück aus meiner Kinderzeit, das über den Krieg und unsere Odyssee durch die vielen Länder und Kontinente gerettet wurde“, sagt sie lächelnd.
Was ihr aber nie verloren ging in den schwierigen Jahren ihres Exils, war dieses unerschütterliche Vertrauen in das Leben und in die Menschen, dieses Urvertrauen, das sie in ihrem Elternhaus erworben hat. Es half ihr, die Schrecken des vorigen Jahrhunderts zu überstehen, und ließ in ihr die „Dennoch-Hoffnung“ wachsen und reifen. Es war das Selbstverständliche, die bedingungslose Annahme, die sie von den Eltern erfuhr, die es ihr immer wieder ermöglichten, gegen den Strom zu schwimmen und sich zwischen alle Stühle zu setzen. „Ich durfte alles“, sagt sie zu mir in unserem Gespräch, „ich durfte sogar die Wahrheit sagen. Wunderbar!“
Den Band „Gesammelte Essays“, der 1992 erschien, widmete Hilde Domin ihren Eltern: „Für meine Eltern, die mich ausrüsteten, das Leben in diesem Jahrhundert zu überstehen.“ Mit Dankbarkeit gedenkt sie im Vorwort ihrer Eltern, „die mich für ein leichteres Leben auszurüsten meinten und doch mit allem versehen haben, was mir ermöglichte, die Verfolgung, die immer neue Entwurzelung, mit Mut und Zuversicht zu überstehen.“
Derart ausgerüstet wurde sie zur Apologetin des Vertrauens, gegen Hass und Verfügbarkeit, Mitläufertum und Inhumanität. Weil sie in ihrer Kindheit nie lügen musste, rief sie später in ihren Gedichten, bei Vorträgen, Lesungen und Diskussionen dazu auf, die Dinge und Vorkommnisse „wahrhaftig“, das heißt mit ihrem richtigen Namen zu benennen. In dem Gedichtband „Ich will dich“ schreibt sie über den chinesischen Philosophen Konfuzius:
Nichts weiter sagt er
ist vonnöten
Nennt das Runde rund
und das Eckige eckig.
„Das Hauptwort in meinen Lebensberichten“, so sagt sie, „ist: Vertrauen. Sich erneuerndes Vertrauen. Widerständiges Vertrauen. Dennoch-Vertrauen.“
Als wir uns über ihre Geburtsstadt Köln unterhalten, beginnt Hilde, mir äußerst lebhaft ihre Erinnerungen an ihre, wie sie sie selbst bezeichnet, „mythische“ Stadt Köln zu erzählen.
„Ja, natürlich, Köln spielt für mich eine große Rolle, weil es die Stadt meiner Kindheit ist, weil ich dort eine glückliche Kindheit verlebt habe und auch, weil ich die Stadt verlassen musste.“
Noch immer ergreife sie eine enorme Erregung, wenn sie von Heidelberg nach Köln fahre. Aber besonders stark sei diese Erregung gewesen, als sie bei ihrer Rückkehr aus dem 22-jährigen Exil im Jahre 1954 ihr Elternhaus zum ersten Male wiedersah.
Hilde Domin hat ein einziges Gedicht über Köln geschrieben. Mehr musste es wohl nicht sein, weil sie darin – eine Meisterin in der Verknappung – alles gesagt hat, was ihr wesentlich ist zu diesem Thema:
Köln
Die versunkene Stadt
für mich
allein
versunken.
Ich schwimme
in diesen Straßen.
Andere gehn.
Die alten Häuser
haben neue große Türen
aus Glas.
Die Toten und ich
wir schwimmen
durch die neuen Türen
unserer alten Häuser.
Dieses Gedicht erschien in ihrem dritten, dem 1964 veröffentlichten Gedichtband mit dem Titel „Hier“, also erst zehn Jahre nach ihrer Rückkehr. Man spürt als Leser oder Zuhörer noch die Vereinsamung, das Getrenntsein von den „anderen“, für die die Stadt nicht versunken ist bzw. für die nicht zwei verschiedene Städte simultan existieren, nämlich die gestrige „versunkene“ und die heutige. Die Vergangenheit scheint zum Greifen nah und ist doch nicht mehr erreichbar, symbolisiert durch das Glas in den Türen.
Nicht nur ihr eigenes Schicksal reflektierend, gelingt es Hilde Domin in diesem Gedicht, exemplarisch die Situation derer einzufangen und auszudrücken, die ihre Heimat verlassen mussten, die zurückkehrten oder auch nie mehr zurückkehren konnten, weil sie in der Fremde blieben oder im Krieg und in den Vernichtungslagern umkamen. Und ihnen, den Toten, begegnet sie hier, macht sie lebendig im Erinnern und gibt sie damit der Wirklichkeit zurück.
Ein früheres Gedicht mit dem Titel „Rückkehr“, im zweiten Gedichtband „Rückkehr der Schiffe“ veröffentlicht, thematisiert eine ganz ähnliche Erfahrung:
Meine Füße wunderten sich
daß neben ihnen Füße gingen
die sich nicht wunderten.
…
Am Haus meiner Kindheit blühte
im Februar
der Mandelbaum.
Ich hatte geträumt,
er werde blühen.
Tatsächlich habe bei ihrem ersten Besuch in ihrer Heimatstadt Köln dieser Mandelbaum noch gestanden. Man kann sich ihre Freude darüber vorstellen, einen lieben Gefährten aus Kindertagen wieder zu sehen.
„Heute stehen an dem Platz, wo der Mandelbaum blühte, Mülltonnen“, sagt Hilde Domin mit ein bisschen Wehmut, aber doch auch mit dem ihr eigenen Schuss Realitätssinn, der sie nie sentimental werden lässt.
„Ja, vieles hat sich verändert“, erzählt sie weiter. „Die Riehler Straße hatte zu meiner Zeit große Bäume in der Mitte zwischen den Fahrbahnen und darunter eine wunderbare Fußgängerzone. Natürlich war auch der Gehweg viel breiter vor den Häusern und auf dem Gartentörchen konnten mein Bruder und ich hin und her schwingen.“
Heute gibt es auf der Riehler Straße nur noch einen schmalen Grünstreifen, gerade breit genug, um Halt zu machen beim Überqueren der breiten Straße mit ihrem dreispurig vorüberrauschenden Verkehr. Das Gartentörchen existiert nicht mehr. Aber immerhin noch das Haus ihrer Geburt und Kindheit in der Riehler Straße 23. Sogar die alte Haustür ist noch vorhanden. Auch die Fassade des im historistischen Stil erbauten Hauses hat unbeschadet den Krieg überstanden. Nur die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden zerbombt. Heute befindet sich an der Ecke Sedanstraße eine Tankstelle.
Vorhanden ist auch noch das Oberlandesgericht, nicht weit entfernt von Hilde Domins Geburtshaus, in dem der Vater als Rechtsanwalt des öfteren bei Prozessen tätig war – er führte vorwiegend Zivilprozesse – und zu denen ihn die kleine Hilde manchmal begleiten durfte.
„Meine Kindheit in Köln“, erinnert sie sich, „wurde zu einem großen Teil von meinem Vater mitgeprägt. Aber damals waren die Väter ja anders als heute. Heute nehmen sie ihre Kinder auf den Arm und benehmen sich so, wie sich damals die Mütter benommen haben. Bei uns ging der Vater mit uns schwimmen vor der Schule. Wunderbar! Im Rhein waren Schwimmanstalten. Der Rhein, sagte man, war damals sauber. Aber natürlich ist das nicht bewiesen“, fügt sie pragmatisch hinzu. „Dann traf man den Vater an der Ecke Hansaring – er hatte seine Kanzlei am Hansaring/Ecke Bismarckstraße – ging zusammen nach Hause, wo man gemeinsam aß und er noch eine halbe Stunde schlafen konnte. Es gab viele aufregende Sachen, die wir zusammen mit dem Vater erlebt haben. Aber für mich war das Aufregendste, als mein Vater mich bei Kriegsausbruch – da waren wir in England – weinend in den Arm nahm und sagte: ›Wir können dir nicht helfen. Ich kann nichts für dich tun!‹ Also, dass mein Vater mich umarmte, das war für mich fast aufregender als der Kriegsausbruch.“
Einen Augenblick schweigt sie, als erlebe sie diesen außergewöhnlichen Augenblick noch einmal. Dann fährt sie fort:
„Es war einfach ein distanzierteres Verhältnis zum Vater, das man damals hatte. Aber ich konnte mit meinem schier unstillbaren Wissensdurst immer zu ihm kommen. Auf den gemeinsamen Wegen – der Vater zu seiner Kanzlei, ich zur Schule oder auf dem Weg zurück nach Hause – stellte ich ihm all die Fragen, die mir auf dem Herzen lagen, diskutierte mit ihm über meine Schulaufsätze, und er erzählte mir von seinen Rechtsfällen, für die ich mich sehr interessierte.“
Noch einmal komme ich auf das Haus in der Riehler Straße zu sprechen, in dem Hilde Domin zwanzig Jahre lang wohnte, von ihrem Geburtsjahr 1909 bis zu ihrem Auszug zum Studium 1929. Ich erzähle ihr, dass ich das Haus besucht habe, im Treppenhaus den vergoldeten Ornamentalstuck, abgesetzt mit grünem Marmor, gesehen habe, sogar einen Blick habe werfen können in eine der Wohnungen mit ihren hohen schönen Räumen mit Stuckdecken. Ich kann mir jetzt ein bisschen das Lebensgefühl der Zeit vorstellen, als das aufgeweckte, quirlige, lern- und wissbegierige Mädchen Hilde dort lebte.
Und sofort beginnen bei Hilde Domin die Erinnerungen wieder lebendig hervorzusprudeln. „Ja, wir hatten eine geräumige Wohnung mit zehn oder elf Zimmern. Es gab ein Esszimmer, ein so genanntes Herrenzimmer, einen langen Flur, auf dem ich mit meinem Bruder Rollschuh fuhr oder Holländer, natürlich ein Kinderzimmer, das Schlafzimmer der Eltern und den so genannten Salon, der nur zu offiziellen Anlässen benutzt wurde und in dem der Flügel meiner Mutter stand.“
Sie erinnert sich, dass sie unter diesem Flügel saß, während die Mutter Klavier spielte. Sie selbst habe zwar auch Klavierunterricht bekommen, erzählt sie, weil es damals für Mädchen so üblich war, aber sie habe nie so rechte Freude daran gehabt.
„Wichtiger war mir das Lesen“, sagt sie. Und da konnte sie sich reichlich bedienen aus der Bibliothek, dem mit Glasfenstern versehenen Bücherschrank aus schwarzem Eichenholz, der niemals verschlossen war. Oft habe sie noch nachts unter der Bettdecke weiter gelesen, wenn ein Buch sie fesselte.
Die Wohnung hatte selbstverständlich eine Zentralheizung und im Wohnzimmer zusätzlich einen Kamin, der allerdings kein echter Kamin war, sondern einer mit Holzscheiten und Gasröhren, aus denen ein dekoratives Feuer züngelte. Hinter dem Bronzegitter mit Jugendstilschleifen verschwand einmal ihr Meerschweinchen und ließ sich erst nach Tagen wieder blicken.
Ich frage Hilde Domin nach Erinnerungen an ihre Schulzeit. Lernen sei ihr immer leicht gefallen, erzählt sie.
„Vielleicht“, so meint sie jetzt in der Rückschau, „war ich für meine Lehrer keine ganz einfache Schülerin, weil ich immer schon alles im Voraus gelesen hatte.“
Hilde Domin besuchte das Humanistische Mädchengymnasium Merlo-Mevissen, das sich in der Altstadt befand. Aufsätze schrieb sie gerne.
„Man machte ja damals noch Dispositionen für Aufsätze, und die schrieb ich manchmal für die halbe Klasse“, erinnert sie sich. Ein Ereignis fällt ihr ein, das ihr beim Erzählen lebhaft vor Augen zu stehen scheint: „Einmal habe ich als Schülerin in der Lengfeld’schen Buchhandlung ein Buch von James Joyce kaufen wollen. Das muss die Buchhändlerin wohl stutzig gemacht haben. Jedenfalls rief sie bei meinen Eltern an, um zu fragen, ob das in Ordnung sei, weil sie der Ansicht war, diese Lektüre sei doch wohl nichts für ›Kinder‹.“ Hilde Domin schmunzelt und ergänzt ihre Erinnerung: „Das war damals doch relativ anders!“
Und dann erinnert sie sich besonders an ihr Abitur. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, in Geschichte über „Paneuropa“ zu schreiben, ein Gedanke, der sie ungeheuer faszinierte, nicht aber den Schulrat, der prüfte.
„Und der hat mir dann meine Abiturnote verdorben. Ich machte seinetwegen nur mit einer Zwei statt mit einer Eins das Abitur. Und ich war so wütend darüber, dass ich mein schönes Seidenkleid zerriss!“ Wer Hilde Domin kennt und weiß, wie energisch sie sich für etwas einsetzt, glaubt ihr diese Geschichte sofort.
„Ich war ganz für Paneuropa. Und der Schulrat war ganz dagegen!“
Die Ideen eines vereinten Europa von Graf von Coudenhove-Kalergi – er hatte die Paneuropa-Bewegung 1923 in Wien begründet –, die damals ungeheuer modern waren, gefielen Hilde Domin außerordentlich gut, so dass sie sich gar nicht vorstellen konnte, dass jemand so gänzlich dagegen sein konnte.
Am 21. September 1914 wurde der Vater, der zu diesem Zeitpunkt bereits 43 Jahre alt war, zum Kriegsdienst eingezogen. Für seine Verdienste im ersten Weltkrieg wurde er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Doch die Kriegsjahre scheinen den großbürgerlichen Lebensstil der Familie Löwenstein nicht sehr durcheinander gebracht zu haben. Bis auf den Umstand, dass der „Salon“ vorübergehend als Vorratskammer für die Würste diente, die der Vater heimschickte. Und dass danach für eine kurze Zeit ein englischer Unteroffizier in den zur Straße gehenden Zimmern einquartiert war. Hilde Domin erinnert sich vor allem noch daran, dass der Vater „herrliche bunte Postkarten aus Belgien“ geschickt hat, die sie in große Fotoalben klebte. Auch später wurde vom Krieg nie gesprochen. Dafür viel von der Demokratie. Und von der Weimarer Republik, die der Vater für den Idealstaat hielt.
Eugen Löwenstein, so erlebte ihn seine Tochter Hilde, war ein äußerst rechtschaffener, korrekter Mann, der in seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt mit Arbeitsschwerpunkt auf Zivilrecht niemals einen Fall übernahm, den er nicht für vertretenswert hielt. Seiner genauen Schriftsätze wegen war er bei den Richtern am Oberlandesgericht sehr geschätzt.
„Mein Vater zwang mich zu nichts“, erinnert sich Hilde Domin. „Im Gegenteil: Er ermunterte und bestärkte mich.“
Wenn man bedenkt, dass Familien zur Zeit von Hilde Domins Kindheit überwiegend von patriarchalischen Grundmustern geprägt waren, mit wenig Freiheit und Entwicklungsmöglichkeiten für eigene Gefühle und Lebensvorstellungen, wo Erziehung meistens in Form von Geboten und Strafen stattfand, so kann man ermessen, wie prägend für ihr ganzes Leben die großzügige Haltung ihrer Eltern war.
„Ich musste nicht mit ihm (dem Vater) spazieren gehen, ich durfte es. Ich durfte schwimmen gehen, ich durfte mit ihm ins Gericht. Ich durfte mit ihm ins Theater. Ich durfte wegfahren nach Heidelberg, zum Studium, und ich durfte studieren, was ich wollte. Jura, wie mein Vater, natürlich. Und dann durfte ich die Jura aufgeben und Volkswirtschaft und Soziologie studieren, Wissenschaften, die die Welt ›verändern‹.“
So beschreibt Hilde Domin die vom Vater gewährte Freiheit in ihrem Aufsatz „Mein Vater. Wie ich ihn erinnere“.
Sie hat sich in ihrer Kindheit und Jugend nicht verbiegen müssen. Das natürliche Bedürfnis jeden Kindes nach Zuwendung und Bestätigung, nach Erprobung eigener Erfahrungen und Grenzen und nach Ausleben eigenständiger Gefühle wurde von den Eltern in ausreichendem Maße gewährleistet. Die Grundsteine für eine seelische Gesundheit wie Vertrauen, Dankbarkeit, Mut, Ehrlichkeit, die im Leben von Hilde Domin noch ganz entscheidende Schlüsselfunktionen einnehmen sollten, sind in ihrem Elternhaus gelegt worden.
„In meinem Elternhaus habe ich das Urvertrauen bekommen“, sagt sie in unserem Gespräch, „das man als Kind bekommt oder nie. Und außerdem eine durch und durch demokratische Erziehung.“
Das Temperament eines „enfant terrible“, das gewesen zu sein sie behauptet, hat sie anscheinend von der Mutter geerbt. Jedenfalls sagt sie einmal, dass die Mutter „des Bombenwerfens fähig“ gewesen sei und auch schon mal – im Gegensatz zum Vater – zu Ungerechtigkeit. Dennoch vermittelte sie sowohl ihrer Tochter als auch dem Sohn das Gefühl, jeder von ihnen sei ihr Lieblingskind.
Hilde Domin erinnert sich, dass sie ein zartes, von den Eltern behütetes, wenn nicht gar verzärteltes Kind gewesen ist. Als sie begann, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, fuhr die Mutter anfänglich mit der Straßenbahn neben ihrer Tochter her, aus lauter Sorge, dass ihr etwas passieren könne.
Eugen Löwenstein unterstützte seine Frau in allem, was sie tat. Er bewunderte sie und sagte das auch ganz offen.
So hat Hilde Domin ein harmonisches Elternhaus erfahren, ein gutes, tragfähiges und vertrauensvolles Zusammenleben der Eheleute, was sicher nicht unwesentlich zu ihrem eigenen Lebensmodell der Zweisamkeit mit ihrem Ehemann Erwin Walter Palm beigetragen hat, mit dem sie 56 Jahre lang glücklich verheiratet war.
„Sie waren untrennbar“, sagt sie in der Erinnerung. „Alles haben sie gemeinsam getan und entschieden, wobei es oft die Mutter war, die mit ihrer Fantasie und ihrem Temperament die Impulse gab.“
Die großbürgerliche, großräumige Wohnung in der Riehlerstraße 23 in Köln war und blieb für Hilde Domin das einzige wirkliche Zuhause. Alle späteren Wohnungen bezeichnet sie als „Fluchtwohnungen“.
So passt es ins Bild, dass sie in ihrem einzigen Roman „Das zweite Paradies“, den sie kurz nach der Rückkehr nach Deutschland nach über 22-jährigem Exil schrieb und den sie als „Rückkehrerroman“ bezeichnet, auf den Zusammenhang von Zuhause und Kindheit hinweist. Sie verwendet als Motto ein Zitat von Ernst Bloch: „Was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“
Über das Zuhause, das fraglose, in der Kindheit, schreibt Hilde Domin in „Das zweite Paradies“:
„Das Zuhause hat einem nicht weh zu tun wie ein hohler Zahn. Das Zuhause ist da, und man fühlt es nicht. Wenn man es erst fühlt und betastet, wenn man es erst in die Hand nimmt wie eine zerbrechliche Kostbarkeit, die gleich hinfallen kann – die auch vielleicht schon einmal geleimt wurde –, ist es mit dem Zuhause vorbei. Es ist etwas, was man abgenommen bekommt. Wenn man Glück hat, bekommt man es wieder, aber es ist zu viel Erstaunen dabei, als dass es ganz wirklich wäre. Als müsse man dauernd ›ich atme‹ denken. Das Atmen wäre dann kein Genuss. Das Trauma macht überempfindlich für die Freude.“
Hilde Domin hat diesen Roman ihrer Mutter gewidmet mit den Versen:
Mein Julilaub,
mein Windschutz,
meine Mutter.
Ihrem Andenken
Es mag erstaunen, dass es außer dieser einen Widmung für die Mutter, der Widmung ihres Essaybandes für beide Eltern und einem einzigen Widmungsgedicht für den Vater nur wenige Gedichte von Hilde Domin gibt, die sich mit diesen unvergessenen liebsten Menschen befassen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass, solange die Selbstverständlichkeit ihrer Präsenz, ihres Für-sie-Daseins gegeben war, Hilde Domin noch gar nicht die Dichterin Hilde Domin war, sondern noch Hilde Löwenstein und später, nach ihrer Heirat, Hilde Palm.
Der Tod ihrer Mutter stürzte Hilde Palm in eine tiefe Krise, die sie an den Rand eines Selbstmords brachte. Über die näheren Umstände berichtet sie mir Folgendes: „Meine Mutter war 1947 aus den USA nach Deutschland zurückgekehrt zu meinem Bruder, der in Oberammergau lebte. Sie war amerikanische Staatsbürgerin geworden. Damals gab es ein Gesetz in Deutschland, dass Ex-Exilanten, die wieder in ihrer Heimat leben, der Pass nach fünf Jahren abgenommen wurde. Das hatte meine Mutter nicht gewusst und auch mein Bruder nicht bedacht. Der Verlust des amerikanischen Passes versetzte meiner Mutter einen schweren Schock. Sie wurde zuckerkrank. Ich erfuhr, dass meine Mutter sehr krank war und wollte ihr helfen, mit ihr in die Schweiz fahren, um sie zu beruhigen. Ich besorgte mir einen Ersatzpass für die Überfahrt. Aber ich hatte nicht genug Geld für die Reise, so dass ich Freunde um Geld bitten musste.“
Als das Geld endlich kam, war es zu spät. Die Todesnachricht und das nötige Geld für die Reise kamen am selben Tag. „Meine Mutter starb, ohne dass ich sie noch einmal wieder sah. Aus Aufregung über den Verlust des Passes ist sie gestorben.“
Die Lebenskrise, in die Hilde Palm dadurch geriet, war die Geburtsstunde der Dichterin Hilde Domin. Das Schreiben rettete ihr das Leben. Die Eltern waren beide tot, als Hilde Domin Gedichte zu schreiben begann. Ein Gedicht über die Mutter spricht in einer scheinbar grausamen Sprache, aus der man die Verzweiflung über die Sinnlosigkeit von Geborenwerden und Sterben herauszuhören meint.
Geburtstage
Sie ist tot
heute ist ihr Geburtstag
das ist der Tag an dem sie
in diesem Dreieck
zwischen den Beinen ihrer Mutter
herausgewürgt wurde
sie
die mich herausgewürgt hat
zwischen ihren Beinen
*
sie ist Asche
*
Immer denke ich
an die Geburt eines Rehs
wie es die Beine auf den Boden setzte
Ich habe niemand ins Licht gezwängt
nur Worte
Worte drehen nicht den Kopf
sie stehen auf
sofort
und gehen
Dieses „Herauswürgen“ und „ins Licht zwängen“ als Beschreibung für einen Geburtsvorgang ist das, wogegen man sich unwillkürlich sträubt. Und doch gibt es die Gemütsverfassung der Dichterin zum Zeitpunkt des Schreibens sehr unmissverständlich wieder. Es ist auch interessant, dass in diesem Gedicht die Verbindung geschaffen wird zwischen dem Tod der Mutter und der „Geburt“ der Worte, die anders als ein neugeborenes Kind, sich sofort von ihrer „Mutter“ lösen und fortgehen. Über diesen Gedanken werden wir noch hören im Zusammenhang mit theoretischen Überlegungen zur Lyrik von Hilde Domin.
Eine ähnliche Verbindung zwischen „Sterben“ und „Wort“ besteht auch in dem einzigen Widmungsgedicht für den Vater.
Exil
meinem Vater
Der sterbende Mund
müht sich
um das richtig gesprochene
Wort
einer fremden
Sprache.
In diesem Gedicht kommt der Aspekt des In-der-Fremde-Seins hinzu, ausgedrückt durch das Titel gebende Wort „Exil“ und die „fremde Sprache“. Wie wichtig aber für die Dichterin die „Sprache“ und das „Wort“ sind, zeigt sich daran, dass sie diesen beiden Wörtern in dem sowieso auf Äußerste verknappten Gedicht als einzige eine eigene Zeile einräumt.
In ihrem Bericht „Unter Akrobaten und Vögeln“ beschreibt Hilde Domin ihre „Geburt“ als Dichterin folgendermaßen: „Ich, H.D. bin erstaunlich jung. Ich kam erst 1951 auf die Welt. Weinend, wie jeder in diese Welt kommt. Es war nicht in Deutschland, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist… Meine Eltern waren tot, als ich auf die Welt kam. Meine Mutter war wenige Wochen zuvor gestorben.“
Ich frage Hilde Domin nach ihrem Bruder, über den man aus ihren biografischen Aufzeichnungen nicht viel erfährt. Er war zweieinhalb Jahre jünger als sie. Die Geschwister haben sich gut miteinander verstanden. Im Kinderzimmer hielten sie gemeinsam ihre Tiere, besaßen ein Aquarium und ein Terrarium und veranstalteten Wettrennen auf ihren Schaukelpferden. Im Esszimmer wurde der Tisch ausgezogen zum gemeinsamen Pingpong-Spiel. Hilde erinnert sich, dass sie eine Zeit lang täglich im Herrenzimmer tanzten. Der Bruder machte kein Abitur, sondern verließ die Schule mit dem so genannten Einjährigen.
„Mein Bruder hatte keine Lust zu studieren“, erzählt mir Hilde Domin. „Er wäre gerne Tänzer geworden. Aber damals wurde man nicht Tänzer als Sohn eines Anwalts. Komiker, so etwas hätte er gerne gemacht. Stattdessen musste er in den Handel gehen. Ein Bruder meines Vaters hatte eine kleine Fabrik, eine Lederwarenfabrik, und die sollte er übernehmen, weil der Onkel kinderlos war. Man sagte ihm, er müsse sich darauf einrichten, die Fabrik zu übernehmen, worauf er gar keine Lust hatte. Er wurde also Verkäufer“, fährt sie fort, „aber durch Hitler kam dann ja alles weg, und er ging nach Frankreich. Nachdem er dort die Arbeitserlaubnis verlor, ging er in die Vereinigten Staaten, wo er zuerst auch als Verkäufer arbeitete. Dann wurde er von der Armee requiriert. Er ist Amerikaner geworden.“
Dieser Umstand, dass der Bruder in den USA lebte, sollte sich noch als segensreich erweisen. Nachdem die Eltern 1933 Nazi-Deutschland verließen und über Belgien und Frankreich nach England emigrierten, erhielten sie 1940 ein Visum für Amerika, was damals ohne die Hilfe des Bruders sehr schwierig gewesen wäre, es sei denn, man hätte sehr viel Geld gehabt. Aber das hatten sie ja nicht, das meiste Vermögen hatten sie durch die Machtergreifung Hitlers verloren, so dass sie auch in England auf die Unterstützung einer Schwester von Paula Löwenstein, die nach England geheiratet hatte, angewiesen waren.
Zum Geburtsjahr ihres Bruders, 1912, gibt es eine Anekdote: „Ich habe mir ja sein Geburtsjahr sozusagen ausgeliehen“, sagt sie halb verschmitzt, halb ernst, und ergänzt sofort, „das hat mir mein Bruder leider übel genommen. Es war doch so, dass mein erster Gedichtband 1959 erschien, und da wäre ich schon fünfzig Jahre alt gewesen. Und da hat mir jemand vom Verlag empfohlen, mich einfach etwas jünger auszugeben. Also nahm ich das Geburtsjahr meines Bruders 1912.“
Dieses Geburtsjahr steht noch in vielen Büchern, auch in Lexika. Erst an ihrem 90. Geburtstag hat Hilde Domin ihr „kleines Geheimnis“ gelüftet und ihr wahres Geburtsjahr 1909 öffentlich gemacht. „Leider hat es mein Bruder nicht mehr erlebt. Er ist ein Jahr zuvor gestorben“, sagt sie mit Bedauern.