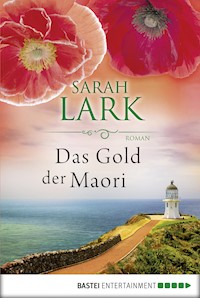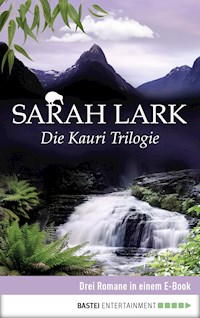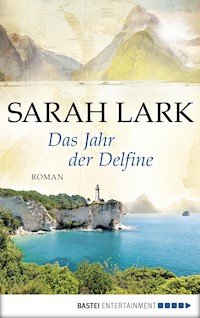15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Mary Ann wächst im Waisenhaus in New York auf. Niemand weiß, dass sie die Tochter der verstorbenen Haily Hard ist. Sie hat nur eine Fotografie ihrer Mutter, doch sie kennt deren Namen nicht ...
Ailis ist überglücklich, als sie 1903 in Boston das Angebot erhält, in einer Sternwarte in Südafrika zu arbeiten. Johannesburg ist eine lebendige Stadt, aber der Zweite Burenkrieg hat tiefe Spuren hinterlassen. Für Ailis kommt es zum Schlimmsten, als in Brickfields die Beulenpest ausbricht ...
Donella konstruiert mit ihrem Mann Heißluftballons und Luftschiffe. Als der Erste Weltkrieg wütet, reist sie als Mechanikerin und Flugausbilderin der amerikanischen Einheit Lafayette Escadrille nach Frankreich ...
Fesselnder Roman über ein junges Jahrhundert, in dem alle Träume möglich sind, aber auch viel Leid über die Menschen kommt
Die packende Fortsetzung der Himmelsstürmerinnen-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 827
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Die junge Mary Ann wächst im Waisenhaus in New York auf. Niemand weiß, dass sie die Tochter der verstorbenen Haily Hard ist. Sie hat nur eine Fotografie ihrer Mutter, doch sie kennt deren Namen nicht …
Ailis ist überglücklich, als sie 1903 das Angebot erhält, in einer Sternwarte in Südafrika zu arbeiten. Johannesburg ist eine lebendige Stadt, aber der Zweite Burenkrieg hat tiefe Spuren hinterlassen. Für Ailis kommt es zum Schlimmsten, als in Brickfield die Beulenpest ausbricht …
Donella konstruiert mit ihrem Mann Heißluftballons und Luftschiffe. Als der Erste Weltkrieg wütet, reist sie als Mechanikerin und Flugausbilderin der amerikanischen Einheit Lafayette Escadrille nach Frankreich …
ÜBER DIE AUTORIN
Sarah Lark, geboren 1958, wurde mit ihren fesselnden Neuseeland- und Karibikromanen zur Bestsellerautorin, deren Bücher in über 20 Ländern erscheinen. Neben ihren fulminanten Auswanderer- und Generationensagas überzeugt sie mit mitreißenden Romanen über Liebe und Familiengeheimnisse. Sarah Lark ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin, die in Spanien lebt. Dort führt sie einen Schutzhof für Pferde und engagiert sich für Tiere.
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright © 2024 by,Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Heike Brillmann-Ede
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Umschlagmotiv: © Adobe Firefly; © Lemaris/Shutterstock;
AXpop/Shutterstock; Triff/Shutterstock; intueri/Shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-6105-5
luebbe.de
lesejury.de
Himmelfahrt
New YorkLebanon (Missouri)BostonKansas CityOld Lane Manor1899–1902
KAPITEL 1
Endlich allein gelassen, nutzte der Junge die Gelegenheit, sich gründlich in den Räumen des Heims umzusehen. Nicht, dass es im Waisenhaus der Sisters of Mercy in New York viel zu entdecken gab. Tatsächlich hatte er die meisten Räume bereits kennengelernt, seit die Polizei ihn gestern hergebracht hatte: das Büro der Oberin, die ihn streng gemustert und examiniert hatte, das Bad, zu dem er als Erstes verdonnert worden war, und dann eine Kleiderkammer, in der abgelegte, aber saubere Kleidungsstücke auf Neuankömmlinge warteten. Eine der Nonnen hatte ihm zwei Hosen, Hemden und Pullover zugeteilt, dazu Unterwäsche, Socken und Schuhe, die einigermaßen passten. Mitgebracht hatte er nur das, was er am Leibe trug – die Schwester hatte über die Lumpen die Nase gerümpft und sie sofort weggeworfen. Im Speisesaal hatte er dann eine dünne Suppe gelöffelt und Brot mit Margarine in sich hineingestopft, bis er nicht mehr konnte. Am Morgen gab es eine Art Porridge und Milch.
Das Essen hier war nicht sehr einfallsreich, doch man musste nicht hungern. Der Junge hatte das durchaus positiv registriert. Man hatte ihm dann ein Bett im Jungenschlafsaal zugewiesen, zwischen zwei anderen etwa Zwölfjährigen – Kurt und Joe. Die zwei hatten jedoch ebenso wenig mit ihm geredet wie die anderen Kinder. Für die Waisen hatte es gestern und heute Morgen nur ein Thema gegeben: das Sommerfest, das heute im Garten des Heims steigen sollte. Der Junge hatte schnell gemerkt, dass es dabei nicht in erster Linie um sommerliche Vergnügungen ging, sondern um handfeste Lebensentscheidungen: Die Kinder sollten zwanglos mit Menschen von draußen zusammengebracht werden, die vielleicht Interesse daran zeigen könnten, eines zu adoptieren. Für die älteren Zöglinge mochte sich auch ein Lehrherr finden oder ein Haushalt, in dem sie in Stellung gegeben werden konnten. Es war also wichtig für alle, sich gut zu präsentieren. Den ganzen Vormittag hatten die Kinder und Schwestern Stände auf dem Rasen aufgebaut, an denen Kuchen und Bastelarbeiten der Kinder verkauft werden sollten. An anderen Stationen wurden Würstchen gebraten und Spiele angeboten. Die älteren Zöglinge standen diesen Ständen vor und sollten dabei zeigen, wie zuverlässig, höflich und anstellig sie waren. Die Kleineren sollten nur an der Hand jeweils einer Nonne über das Festgelände spazieren, lächeln und brav sein. Die Schulschwestern hatten zudem Lieder mit ihnen einstudiert, die sie im Chor singen sollten. Alle sahen ihrem Auftritt mit Spannung entgegen – nur für den Neuen gab es natürlich noch keine Aufgaben. Und die Schwestern hatten es auch zu riskant gefunden, ihn einfach frei über den kleinen Markt streifen zu lassen. Schließlich hatte man ihn gerade gestern erst beim fachmännischen Taschendiebstahl auf dem Times Square erwischt – weshalb er jetzt hier war und nicht mehr in der dreckigen Wohnung, die sein Hehler den jungen Dieben unter den Straßenkindern zur Verfügung stellte.
Nachdem alle anderen im Garten waren, inspizierte der Junge jetzt erst mal die Schulzimmer. Es gab vier davon, in denen die Nonnen ihre sechs- bis dreizehnjährigen Zöglinge unterrichteten. Wenn sie danach noch im Heim blieben, machten sie sich in der Küche, im Garten oder bei der Kinderpflege nützlich, die meisten gingen in Stellung, oder die Schwestern fanden einen Lehrherrn für sie. Theoretisch, so hatte die Oberin ihm gestern stolz erklärt, wurde es ihnen sogar ermöglicht, die Highschool zu besuchen, wenn sie sich als besonders fleißig und klug erwiesen. Der Junge hatte das kommentarlos zur Kenntnis genommen. Für ihn kam es ohnehin nicht infrage. Er hatte bislang nie eine Schule besucht, und obwohl er trotzdem gut rechnen gelernt hatte, war mit seinen Kenntnissen im Lesen und Schreiben kein Staat zu machen. Im ersten Schulzimmer hing ein Plakat mit einem Alphabet an der Wand, und er hätte nur wenige Buchstaben benennen können. Die Rechentabelle daneben sagte ihm deutlich mehr.
Ansonsten waren die Schulzimmer eher langweilig – Bilder gab es kaum, den Wandschmuck bildeten aufgeschriebene Sprüche, von denen er kaum ein Wort entziffern konnte.
Der Junge ging also weiter Richtung Speisesaal, davor lag das Spielzimmer, wie ihm eine der Nonnen gestern verraten hatte. Heute stand die Tür des Raums offen, und er sah, dass es ein helles Zimmer war. Durch hohe, fast bis zum Boden reichende Fenster kam Sonnenlicht herein – das Sommerfest hätte bei keinem besseren Wetter stattfinden können. Der Junge ließ die Blicke über den Raum schweifen, der groß, aber schmucklos war. Ein paar Tische und Kinderstühle standen ordentlich aufgeräumt an der Seite, in Regalen lagerte Spielzeug, das durchweg schon bessere Tage gesehen hatte. Es musste sich um Spenden von den Eltern reicher Kinder handeln, die der Ansicht waren, dass Waisen auch mit Eisenbahnen ohne Räder und abgeliebten Plüschtieren ohne Fell und Ohren spielen mochten. Doch dann stellte der Junge fest, dass er nicht allein war. Vor einem der hohen Fenster stand ein kleines Mädchen. Zierlich, blond, das Haar zu braven Zöpfen geflochten, denen jedoch ein paar Flechten entwischt waren. Sie umspielten nun das sehnsüchtig dem Garten zugewandte Gesicht der Kleinen wie Engelshaar.
»Hallo!« Der Junge rief sie an, um sie nicht zu erschrecken, woraufhin sie sich zu ihm umwandte. Er blickte in große kastanienbraune Augen, sah in ein herzförmiges Gesicht mit einer kleinen Nase und himbeerroten Lippen, die sich jetzt zu einem lieblichen Lächeln verzogen. Das Kind war ungewöhnlich hübsch, es sah fast aus wie eine der Echthaarpuppen mit sanften Zügen und eleganten Kleidern, die in den Schaufenstern der Spielzeugläden am Times Square standen. Warum war sie nicht unten bei den anderen und wurde adoptionswilligen Menschen vorgestellt? Bestimmt hätte sich sofort jemand in dieses Mädchen verliebt.
»Was hast du ausgefressen?«, fragte er.
Die Kleine musterte ihn mit gerunzelter Stirn. Sie wirkte fast etwas beleidigt, wahrscheinlich stellte sie nur sehr selten etwas an.
»Gar nichts!«, antwortete sie denn auch leicht empört. »Warum fragst du?«
»Na ja, weil du hier allein bist und nicht da unten. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Strafe …« Er trat neben sie und warf einen Blick auf das rege Treiben im Garten. Es wurde gelacht, gesungen, und alle Zöglinge des Heims gaben ihr Bestes, um potenzielle Eltern zu beeindrucken. Ein noch sehr kleines Mädchen saß auf dem Arm eines der Besucher.
»Jeannie«, sagte das Mädchen. »Ich hoffe, sie wird adoptiert! Sie ist noch so klein. Die Kleinen nehmen sie am ehesten.«
»Und du?«, fragte der Junge. »Wie heißt du übrigens? Ich heiße Horace, Horace Timber, aber alle nennen mich Hoss.«
»Mary Ann«, stellte das Mädchen sich vor. »Alle nennen mich Mary Ann.« Sie lächelte. »Und was hast du ausgefressen, Hoss?«
Hoss grinste. Er hätte jetzt ein Geständnis bezüglich der Taschendiebstähle ablegen können, beschloss aber, seine Vergangenheit vorerst ruhen zu lassen »Gar nichts«, behauptete er. »Ich bin nur erst seit gestern da. Bist du auch neu?« Das wäre eine Erklärung.
Mary Ann schüttelte den Kopf. »Nein. Ich bin schon immer hier. Ich kann nicht adoptiert werden. Für mich … wird bezahlt.« Es klang wie eine Mischung aus Stolz und Enttäuschung.
»Bezahlt? Wie Miete oder so? Jemand gibt den Nonnen Geld dafür, dass sie dich hierbehalten?« Von so etwas hatte Hoss noch nie gehört, obwohl natürlich auch er und die anderen Straßenkinder dem alten Edward Geld dafür geben mussten, dass er sie bei sich schlafen ließ. »Wer zahlt denn für dich?«
»Meine Mami«, erklärte Mary Ann, und ihr Gesicht verzog sich zu einem überirdischen Lächeln. »Das sagt jedenfalls Schwester Katherine.«
Hoss fand es immer noch sonderbar. »Und wo ist deine Mami? Wenn ihr doch etwas an dir liegt, warum holt sie dich nicht zu sich?«
Mary Ann hob unglücklich die Schultern. »Sie kann nicht«, meinte sie. »Sie ist im Himmel.«
Hoss musste sich zusammennehmen, um sich nicht an die Stirn zu tippen oder, noch schlimmer für das Mädchen, das so fest an seine Geschichte glaubte, in Gelächter auszubrechen.
»Es regnet also jeden Monat Geld für dich vom Himmel?«, fragte er.
Mary Ann verzog das Gesicht. »Ich glaube nicht. Es kommt eher von einer Bank oder so. Aber Schwester Katherine sagt, meine Mami schickt es. Obwohl sie im Himmel ist … Ich kann das beweisen! Willst du sie sehen?«
Hoss begann, sich langsam zu fragen, ob seine niedliche neue Bekanntschaft vielleicht deshalb versteckt gehalten wurde, weil sie nicht alle Tassen im Schrank hatte.
»Komm!«, sagte das Mädchen energisch und nahm seine Hand. Mary Ann war viel kleiner als er und sicher erheblich jünger. Er schätzte sie auf etwa acht Jahre. Nun zog sie ihn mit sich in Richtung des Mädchenschlafsaals, auf dessen Betreten für ihn sicher schwere Strafen standen. Aber er war neugierig – und Mary Anns Bett war zum Glück nicht allzu weit vom Eingang entfernt. Es war ordentlich gemacht, und alles war aufgeräumt. Persönliche Gegenstände schienen die Mädchen ebenso wenig zu besitzen wie die Jungen. Allerdings hing über einem der Betten eine hübsch gerahmte Fotografie – Hoss hielt den Atem an, als Mary Ann aufs Bett kletterte und sie herunterholte, damit er sie besser sehen konnte.
»Das ist meine Mami!«, erklärte sie. »Auf dem Weg in den Himmel.«
Tatsächlich zeigte das Bild eine außergewöhnlich schöne Frau, gekleidet in ein weißes Kleid, auf dem Kopf einen Hut, von dem aus Schleier sie umspielten. Sie stand in einer Art fein geschwungener Barke, die wiederum an einem Fesselballon hing. Er trug sie in den Nachthimmel. Mary Ann hatte nicht gelogen – jemand hatte diese Frau buchstäblich bei einer Himmelfahrt fotografiert. Grundsätzlich konnte sie also noch am Leben sein.
»Hilf mir mal, es wieder aufzuhängen«, bat Mary Ann, nachdem sie das Bild gemeinschaftlich andächtig bewundert hatten.
Hoss brachte es sorgfältig zurück an seinen Platz.
»Deine Mutter ist also gar nicht tot?«, fragte er dann. An sich war das nicht verwunderlich. Auch Hoss’ eigene Eltern waren seines Wissens noch bei bester Gesundheit. Er war aus ihrer Wohnung in Brooklyn geflohen, als es ihm mit dem Trinken, Zanken und täglichen Prügeln zu viel wurde. Schon sein Vater hatte ihn zum Stehlen auf die Straße geschickt – und ihm dann sein gesamtes Diebesgut abgenommen, um es in Gin umzusetzen. Irgendwann befand Hoss, dass er mehr zu essen haben würde, wenn er sich auf eigene Beine stellte. Viele andere der hier untergebrachten Waisenkinder dürften ebenfalls noch Familie haben. Er hatte gehört, dass oft Babys vor dem Waisenhaus ausgesetzt wurden, die einfach nicht erwünscht waren.
»Doch«, sagte Mary Ann traurig, »sie ist … abgestürzt. Sonst hätte sie mich bestimmt irgendwann geholt, meint Schwester Katherine. Und sie denkt an mich, im Himmel, und sorgt für mich.«
Hoss fragte sich, ob derjenige, der wohl immer noch im Namen ihrer Familie für sie zahlte, ihr damit nicht einen Bärendienst erwies. Mary Ann wäre sicher schon als Kleinkind adoptiert worden, hätte man sie den interessierten Familien nicht vorenthalten.
»Und warum hat sie dich überhaupt erst ins Waisenhaus gebracht?«, fragte Hoss.
Mary Ann zuckte mit den Schultern. »Ich wurde hier geboren«, sagte sie.
KAPITEL 2
»Sie sagten, es seien keine Zahlungen für Mary Ann eingegangen?«, fragte die Oberin, Mutter Iseult. Schwester Katherine, ihre Assistentin, der auch die Buchhaltung des Waisenhauses oblag, nickte.
»Schon seit zwei Monaten«, präzisierte sie. »Und ja, ich habe natürlich Erkundigungen eingezogen. Diskret, wie Sie gewünscht haben, Mutter …«
Alles, was das Mädchen Mary Ann anging, wurde im Haus der Sisters of Mercy diskret behandelt. Schließlich hatte ihre Mutter klare Anweisungen gegeben, als sie ihre Tochter in der Obhut der Nonnen zurückließ. Sie würde zweihundert Dollar im Monat an Pflegegeld zahlen – sofern die Mutter absolutes Stillschweigen über Mary Ann und ihre Abstammung bewahren würde. Zwischen Schwester Katherine und ihrer Oberin hatte es deshalb schon vor acht Jahren Unstimmigkeiten gegeben, nachdem Mary Anns Mutter gestorben war. Die Schwestern hatten damals herausgefunden, dass es noch Verwandte gab, doch Mutter Iseult hatte ihr Versprechen nicht brechen wollen. Zweihundert Dollar im Monat waren zudem viel Geld, und Mutter Iseult hatte erfreut festgestellt, dass die regelmäßige Spende auch nach dem Ableben von Haily Hard weiter überwiesen wurde.
»Und? Was sagte die Bank?«, fragte sie jetzt ungeduldig.
Schwester Katherine hob die Schultern. »Das Konto ist leer«, erklärte sie. »Was kein Wunder ist, es hat acht Jahre lang niemand etwas eingezahlt. Das Vermögen von Mary Anns Mutter ist aufgebraucht. Weitere Zahlungen werden nicht erfolgen.«
Mutter Iseults Mund verzog sich zu einem Strich.
»Ärgerlich!«, meinte sie. »Wenn wir das eher gewusst hätten … vielleicht hätte sich auf dem Sommerfest jemand für sie gefunden.«
Das Sommerfest, auf dem Mary Ann und Hoss einander kennengelernt hatten, war inzwischen zwei Monate her. Für das Heim war es kein großer Erfolg gewesen, nur drei Kleinkinder hatten neue Eltern gefunden und zwei Jungs eine Lehrstelle. Für die Verwaltung des Waisenhauses war dies ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie alle anderen vergleichbaren Institutionen platzte das Heim der Sisters of Mercy aus allen Nähten. Mit über hundertzwanzig Zöglingen war es überbelegt – und immer noch wurden neue Kinder gebracht. New York, der Sehnsuchtsort für unzählige Einwandererfamilien aus aller Welt, brachte nicht jedem Glück. Die wenigsten Neubürger wurden reich, viele verdienten nicht mehr als in ihren Ursprungsländern, doch dort hatten sie meist Familien gehabt, die ihnen halfen zu überleben. Jetzt sahen sie oft keine andere Möglichkeit mehr, als ihre Kinder auszusetzen, zum Stehlen auf die Straße zu schicken oder gleich selbst ins Heim zu geben. Staatliche Unterstützung für die Familien gab es nicht in nennenswertem Maße, und so trennten die Mütter sich eher von ihren Kindern, als sie verhungern zu lassen.
»Wie entwickelt sie sich denn so?«, fragte die Oberin. »Unsere Mary Ann. Kann man sie nicht bald in Stellung schicken?« Junge Mädchen wurden oft als Hausmädchen vermittelt.
»Mutter Iseult! Sie ist acht!«, empörte sich Schwester Katherine. Sie liebte Mary Ann, seit sie damals bei ihrer Geburt hatte helfen dürfen. Das kam selten vor – obwohl sie eine Ausbildung zur Geburtshelferin hatte, wurde sie meist im Verwaltungsbereich des Kranken- und Waisenhauses eingesetzt. Krankenpflege lernten alle Mitglieder des Ordens – auf Buchhaltung verstanden sich nur wenige. Da Mary Anns Mutter allerdings sehr bestimmte Wünsche in Bezug auf ihre Hebammen und deren Ausbildung gehabt hatte, war in ihrem Fall Schwester Katherine zum Einsatz gekommen – und hatte sich sofort in das hübsche Baby verliebt. »Und sie ist sehr klug! Sehr brav zudem, gut in der Schule – wir hofften eigentlich, sie mal zur Highschool schicken zu können. Vielleicht … vielleicht hätte sie danach ja in Erwägung gezogen, dem Orden beizutreten.«
»Wozu wir sie aber noch mindestens weitere acht Jahre durchfüttern müssten«, sagte die Mutter und seufzte.
»Aber sie macht sich jetzt schon nützlich!«, behauptete Schwester Katherine. »Sie hat einen etwas älteren Freund, einen Jungen … Hoss.«
»Horace Timber? Der kleine Taschendieb?«, fragte die Oberin. »Seltsame Gesellschaft für ein angeblich so kluges und braves Kind. Sieht eher aus, als käme sie da nach ihrer liederlichen Mutter!«
Schwester Katherine schüttelte den Kopf. »Aber nein, das ist ganz unschuldig. Und Hoss ist eigentlich ein netter kleiner Kerl. Er behandelt sie wie eine kleine Schwester. Und sie … na ja, er hatte wohl nie die Schule besucht, bevor er herkam, und nun hilft sie ihm bei den Schularbeiten. Es ist ganz rührend, wie sie ihm alles erklärt – und wie er sich von ihr herumkommandieren lässt. Dabei ist er sehr durchsetzungsfähig. Wir mussten ihn in der Schule zurückstufen, weil er im Lesen und Schreiben längst noch nicht auf dem Stand seines Alters ist, und wenn so etwas passiert, fangen die anderen Kinder ja meistens damit an, den Schüler zu hänseln. Bei Hoss wagt das niemand, und er beschützt auch Mary Ann.«
»Dann ist es ja schade, dass sie sich sehr bald trennen müssen«, meinte Mutter Iseult. »Es tut mir leid, Schwester Katherine, aber uns wird nichts anderes übrig bleiben. Wir schicken ihn und die anderen Jungs über zehn mit dem nächsten Zug in den Westen …«
»Ein Orphan Train? Schon wieder?« Schwester Katherine erschrak. »Aber Mutter Oberin … wir … wir schicken die Kinder mit diesen Waisenzügen ins Ungewisse. Von denen, die wir beim letzten Mal mitgeschickt haben, haben wir nie wieder etwas gehört!«
Orphan Train Movement nannte sich eine Bewegung, doch für viele engagierte Sozialarbeiter war es eher ein höchst fragwürdiges Experiment. Die Idee dahinter war, heimatlose Kinder aus Ballungsräumen wie New York und Boston in die neu erschlossenen Bundesstaaten im Westen zu schicken, wo sie Aufnahme bei gottesfürchtigen Farmerfamilien finden sollten. Charles Loring Brace, der Begründer der Children’s Aid Society, die den Transport der Kinder organisierte, war fest davon überzeugt, die Pionier-Familien im ländlichen Amerika würden die Waisen begeistert aufnehmen, wie ihre eigenen Kinder christlich erziehen und glückliche Menschen aus ihnen machen. Zum Teil behielt er damit recht, doch oft betrachteten die Farmerfamilien die Kinder nur als billige Arbeitskräfte – die Oberin hatte ihre Gründe dafür, hauptsächlich ältere Jungs wegzuschicken. Sie waren wesentlich begehrter als eher pflegebedürftige, jüngere Kinder. Zudem kontrollierte niemand, wie die Jugendlichen in ihren neuen Familien behandelt wurden. Ihre Auswahl war willkürlich, wer immer wollte, konnte ein Kind zu sich nehmen. Oft verlor sich die Spur dieser Kinder irgendwo in den Weiten des Westens.
»Nun seien Sie mal nicht so melodramatisch, Schwester!«, tadelte die Oberin ihre Assistentin. »Das letzte Mal haben wir zehn Jungs zwischen zehn und vierzehn mitgeschickt und drei Mädchen zwischen zwölf und dreizehn. Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass die Ihnen Briefe schreiben? Ich denke jedenfalls, für viele unserer Zöglinge sind die Kinderverschickungen eine gute Sache. Gerade für Früchtchen wie diesen Hoss …«
»Mary Ann wird ihn vermissen«, meinte Schwester Katherine.
Die Oberin zuckte mit den Schultern. »Wenn die zwei so aneinander hängen … von mir aus spricht nichts dagegen, sie mitzuschicken …«
Schwester Katherine war empört, doch sie konnte auch nicht umhin, Verständnis für die Verzweiflung der Mutter Oberin aufzubringen. Das Kinderheim der Sisters of Mercy war für sechzig bis maximal hundert Kinder konzipiert, für so viel mehr Zöglinge hatte es weder Platz noch ausreichend Mittel. Und nun fielen auch noch Mary Anns zweihundert Dollar weg.
»Passen wir auf, wir machen es so, Schwester Katherine«, entwickelte die Mutter jetzt eine neue Idee. »Wir verschicken auch die Mädchen über zwölf, und jedem von ihnen geben wir ein Patenkind mit, eins von den unter Fünfjährigen.« Die jüngsten Kinder fanden stets schnell Adoptiveltern, aber gut geführte Heime scheuten davor zurück, sie allein in die Fremde zu schicken. In den Zügen kamen auf dreißig bis vierzig Kinder maximal drei erwachsene Betreuer. »Das Mädchen kann ein Auge auf das Kind halten und es trösten – die Kinder kennen einander ja.«
Schwester Katherine musste zugeben, dass dies nicht die schlechteste Lösung war. Die älteren Mädchen wurden immer dazu angehalten, sich um die Kleinsten zu kümmern, und die meisten machten es gern. Wie es allerdings auf beide Teile wirken würde, wenn man sie nach Ankunft des Zuges voneinander trennte, malte sie sich lieber nicht aus.
»Und Mary Ann?«, fragte sie zweifelnd.
Die Oberin nickte. »Und Mary Ann.«
»Ich soll jetzt doch adoptiert werden.« Mary Ann berichtete Hoss die Neuigkeit, als sie sich beim Abendessen trafen. Vorher hatte Hoss mit anderen Jungen im Garten geholfen – und Zeit für ein Ballspiel hatte sich auch noch gefunden. Mutter Iseult tat dem Jungen unrecht, wenn sie ihm unterstellte, sich nach seinem Leben auf den Straßen der Stadt zurückzusehnen. Tatsächlich gefiel es Hoss durchaus im Waisenhaus, auch wenn die Schule ihm schwerfiel. Aber er mochte seine kleine Freundin Mary Ann und kam auch mit den meisten anderen Zöglingen gut aus. Die Arbeiten, zu denen der Hausmeister die Jungen anhielt, verrichtete er bereitwillig und zuverlässig. Mitunter langweilte er sich ein wenig, doch er musste nicht frieren und wurde satt. Vorerst reichte ihm das. Und heute hatte er die Nachricht erhalten, dass die Zukunft durchaus noch Aufregenderes für ihn bereithalten mochte …
»So?«, fragte er jetzt erst einmal, bevor er mit seinen eigenen Neuigkeiten herauskam. »Wer hat das bestimmt? Deine Mami?« Es klang zweifelnd wie immer, wenn Mary Ann davon sprach, dass ihre Mutter vom Himmel aus über sie wachte.
»Der liebe Gott, glaube ich«, meinte das Mädchen. »Schwester Katherine sagt, dass er eine Familie für mich ausgewählt hat. Aber nicht hier. In … in … Miss…«
»Missouri«, sagte Hoss, und in seiner Stimme schwangen Verachtung und Bitterkeit mit. »Mary Ann, sie setzen dich in den Orphan Train! Dabei dachte ich … also mir macht es nichts aus und den anderen Jungs auch nicht. Wir probieren es da mal, im Wilden Westen, und wenn’s nicht passt, dann reißen wir aus. Aber du … ich hab da ein paar Dinge gehört …«
Die Kinderverschickungen waren unter den Straßenkindern von New York kein Geheimnis. Fast jeder wusste von Mädchen oder Jungen, die praktisch von der Straße weg aufs Land geschickt worden waren. Manche von ihnen tauchten später wieder auf und erzählten von schrecklichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, denen sie so schnell wie möglich entflohen waren. Nun waren diese Kinder es gewohnt, sich durchzuschlagen. Aber Mary Ann …
»Du bist dafür noch viel zu klein!«, erklärte er jetzt, ohne näher darauf einzugehen, was den Kindern passieren konnte.
Mary Ann schüttelte wichtig den Kopf.
»Bin ich nicht!«, rief sie. »Jeannie und Billie und Jim und die Zwillinge sind noch viel jünger als ich. Und sie haben auch kein Mädchen ausgesucht, das auf mich aufpasst. Ich könnte das schon alles allein, meint Schwester Katherine. Ich bin ein großes und kluges Mädchen.«
Hoss seufzte. »Ich werde auf dich aufpassen«, bemerkte er. »Ich bin auch im Orphan Train.«
Die Zeit vor der Abreise war aufregend für die betroffenen Kinder. Später hörten sie, dass die Zöglinge anderer Heime von einem Tag auf den anderen von ihrer Verschickung informiert worden waren, die Sisters of Mercy bemühten sich dagegen, ihren Kindern Mut zu machen und sie so gut wie möglich auf das vorzubereiten, was da auf sie zukam. Mary Ann berichtete Hoss strahlend, dass sie zum Abschied zum ersten Mal in ihrem Leben ein Kleid erhalten hatte, das nicht aus einer Kleiderspende stammte. Die Children’s Aid Society pflegte alle Kinder vor der Abreise neu auszustaffieren. Außerdem erhielt jedes von ihnen eine Bibel – und Mary Ann packte natürlich auch das Bild von ihrer Mutter ein, als sie ihre kleine Reisetasche füllte. Schwester Katherine half ihr dabei und musste sich anstrengen, nicht zu weinen, als sie das kleine Mädchen schließlich auf den Lastwagen steigen sah, der die Kinder zum Bahnhof brachte.
Mary Ann wurde der Abschied jetzt erst richtig bewusst – und obwohl es verboten war, umarmte sie zum ersten Mal die Schwester, die in all den Jahren ihre einzige wirkliche Vertraute gewesen war. Mit niemand anderem außer Schwester Katherine hatte sie über ihre Mutter sprechen können. Und jetzt …
»Meine Mami wacht aber doch immer noch über mich, oder?«, vergewisserte sie sich beim Abschied. »Man kann doch vom Himmel aus sehen bis Miss… Missouri?«
Schwester Katherine versicherte ihr, dass man vom Himmel aus die ganze Erde im Blick hatte, trotzdem liefen dem Mädchen die Tränen über die Wangen, als der Wagen abfuhr. Auf dem Bahnsteig wurde es nicht besser. Hier war niemand, der die Kinder wie sonst bei Ausflügen in Gruppen einteilte und sie anwies, einander an der Hand zu halten. Stattdessen liefen Jungen und Mädchen durcheinander, einige stritten, die Jungs taten selbstsicher, und die Mädchen klammerten sich, so es sie gab, an mitreisende Freundinnen. Die wenigen Betreuerinnen hatten mit den Kleinkindern genug zu tun. Jeannie und die anderen Jüngsten aus dem Sisters of Mercy wollten am liebsten getragen werden, was wieder ihren Patinnen auf die Nerven ging. Es wurde geschimpft und geweint, und als der Zug schließlich einfuhr, mischten sich auch Rufe des Erschreckens in den Lärm auf dem Bahnsteig. Viele der Kinder hatten noch nie eine Lokomotive gesehen und fürchteten sich nun vor dem schnaubenden, kreischenden Monstrum.
Auch Mary Ann schluchzte, als eine Mitarbeiterin der Children’s Aid Society sie sanft, aber entschlossen auf die Plattform und in den Zug schob. Dann jedoch schloss sich Hoss’ Hand tröstend um die ihre.
»Keine Angst!«, sagte der Junge. »Ich bin ja da.«
Vor den Kindern lag eine Reise von über tausend Meilen, als der Zug sich endlich in Bewegung setzte. Hoss zog Mary Ann auf eine der harten Holzbänke und erkämpfte ihr einen Fensterplatz. Das erwies sich als hilfreich, denn die Aussicht aus dem Zug bot schnell Ablenkung von ihrem Kummer. Das Mädchen war nie aus New York herausgekommen. Die seltenen Ausflüge des Kinderheims hatten meist in den Central Park geführt, mitunter in ein Kindertheater, das die Zöglinge zu einer Vorstellung eingeladen hatte, und manchmal war ein Kind auch von einer Nonne zu einem Facharzt begleitet worden. Dann hatte man den Bus genommen. Doch bislang hatte Mary Anns ganze Welt aus Straßen und zum Teil sehr hohen Häusern bestanden, die selbst die Bäume im Park überragten. Jetzt war sie starr vor Staunen, als das Häusermeer nach wenigen Stunden einer ländlichen Idylle wich. Es war Herbst, das Laub der Bäume erstrahlte in allen Farben. Die Wiesen waren noch grün, und zum ersten Mal sah sie Kühe und Pferde auf der Weide.
»Ist das so in Missouri?«, fragte sie Hoss, der das nicht wusste. Auch er hatte die Stadt nie verlassen, und den meisten anderen Kindern ging es ähnlich. Während die Jüngsten bald vor Erschöpfung einschliefen, starrten die anderen wie gebannt auf die Landschaften, die sich vor den Zugfenstern zeigten. Alle paar Stunden kamen die Begleiter der Kinder vorbei, verteilten Brote und heißen Tee und stellten sich halbwegs geduldig den Fragen ihrer Schützlinge. Der Zug durchquerte Pennsylvania, und sie sahen Fördertürme, Minenbauten und Fabriken, bis die Nacht hereinbrach und nur noch gelegentlich Lichter von Orten oder einzeln liegenden Höfen durch die Fenster schienen. Die Sonne ging dann auf über den Bergen und Seen von Ohio, und Mary Ann war wie verzaubert von der klaren Luft und den Felsformationen, die sich im Wasser der Seen spiegelten. Sie begann, sich auf ihr neues Leben zu freuen, und fragte sich, wie es sich wohl anfühlte, wenn ein Hund um einen herumtanzte, wie sie es bei einem Jungen auf einem Bauernhof beobachtete, und wie es war, eine Katze zu streicheln. Sie sollte auf einer Farm wohnen, hatte Schwester Katherine gesagt. Sicher gab es dort Tiere …
Eine weitere Nacht verging, und inzwischen wurden die älteren Kinder ungeduldig und die jüngeren quengelig. Die sanitären Einrichtungen im Zug waren nicht mehr sauber, und es roch streng. Eigentlich wollten alle nur noch aussteigen. Mary Ann schlief, überwältigt von all den Eindrücken, eng an Hoss geschmiegt. Als sie erwachte, fuhren sie durch Wälder, ab und zu wurde ein Fluss sichtbar, und mitunter war auch Farmland erschlossen.
»Missouri!«, rief Hoss, der schon länger wach war. Die Betreuer hatten den Kindern gemeldet, dass die Grenze überschritten worden war. »Aber ein paar Stunden fahren wir noch, der Staat ist groß. Der Ort, wo wir hinsollen, heißt Lebanon. Ich hab da noch nie was von gehört, aber das heißt natürlich nichts.«
Der Bahnhof von Lebanon glich all den anderen Kleinstadt-Bahnhöfen, die sie in den letzten Tagen durchfahren hatten. Hinter den Gebäuden sah man Hügel, doch um den Ort herum war die Landschaft eher flach. In den letzten Stunden waren viele Felder und Weiden zu sehen gewesen. Nun starrten die Kinder auf den Bahnsteig, wo ein paar Leute warteten. Mary Ann schaute neugierig nach ihnen aus. Ob die neuen Eltern unter ihnen waren, die der liebe Gott ihr hatte schicken wollen?
Inzwischen erhoben sich auch die Betreuer der Kinder aus New York, und jeder von ihnen gesellte sich einem der drei Waggons zu, in denen die Kinder die Reise verbracht hatten.
»So, wir sind angekommen«, erklärte die ältere Frau, die für Hoss’ und Mary Anns Waggon zuständig war. »Die Leute da sind Honoratioren des Ortes, die gekommen sind, um euch willkommen zu heißen. Also zeigt ihnen gleich, wie gut ihr euch benehmen könnt! Kein Drängeln beim Aussteigen, kein Zanken, kein Weinen. Ihr verlasst gesittet den Zug, und dann folgt ihr den Herrschaften zu eurer Unterkunft. Vielleicht werdet ihr heute schon Familien zugeteilt, vielleicht auch erst morgen. Wir klären das gleich. Jetzt erst einmal Ruhe und Ordnung, verstanden?«
Die aufgeregten, übermüdeten Kinder hatten allenfalls die Hälfte verstanden, aber die Betreuer passten auf, dass es wirklich zu keinem Drängeln und Schubsen kam. Trotzdem fühlten sich die Kleinsten, die von ihren Patinnen nicht getragen wurden, zwischen den anderen eingeengt und weinten. Mary Ann klammerte sich an Hoss’ Hand. Sie wusste, dass sie tapfer sein sollte, hatte inzwischen aber begonnen, sich zu fürchten. Was würde werden, wenn man sie einer anderen Familie zuteilte als den Jungen – und was hieß zuteilen überhaupt? Sie hielt sich mit einer Hand an ihrer Tasche und mit der anderen an Hoss fest, als sie auf den Bahnsteig stolperte. Hier baute sich ein wichtig aussehender Mann mit Zylinder vor den Kindern auf, die nach der langen Fahrt ein ziemlich klägliches Grüppchen bildeten.
»Willkommen in Lebanon!«, rief er ihnen zu. »Mein Name ist William Lancaster, ich bin der stellvertretende Bürgermeister und Sheriff von Lebanon. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, und hoffen, dass ihr unser noch junges Gemeinwesen bereichern werdet. Solltet ihr euch der Freundlichkeit, mit der ihr hier aufgenommen werdet, allerdings nicht als würdig erweisen, so habe ich keine Skrupel, euch zurückzuschicken. Ich weiß, dass viele von euch in New York nur knapp dem Gefängnis entronnen sind.«
Er bedachte ein Kind nach dem anderen mit strengen Blicken.
»Folgt uns jetzt erst mal zur Baptistenkirche«, sprach er schließlich weiter. »Die hat den größten Gemeinderaum. Ihr werdet dort den Farmern und Geschäftsleuten, die sich für euch interessieren, vorgestellt. Einige von ihnen werden heute schon ihre Auswahl treffen, ansonsten kommen morgen Leute aus größerer Entfernung hierher. Also keine Angst, wenn ihr heute noch nicht ausgewählt werdet – morgen finden alle ein neues Zuhause. Und jetzt kommt, es sind ein paar Schritte zu gehen.«
Bis auf einige Jungen wirkten alle Kinder eingeschüchtert nach der Rede des Sheriffs, und auf dem Weg zur Kirche wurde fast nicht gesprochen. Der Sheriff und die anderen Männer, die das Begrüßungskomitee gebildet hatten, führten sie über eine breite, nicht gepflasterte Straße, die auf beiden Seiten von Gebäuden gesäumt war. Die meisten davon waren zweistöckig. Unten gab es Läden oder Handwerksbetriebe, darüber wohnten wohl die Betreiber. Jetzt, um die Mittagszeit, war nicht viel los auf der Straße, aber die wenigen Leute, die zu Fuß oder zu Pferd unterwegs waren – es schien hier mehr Pferdefuhrwerke zu geben als Automobile –, blickten den Kindern neugierig nach.
KAPITEL 3
Die Kirche lag etwas außerhalb des Ortes. Um dort hinzukommen, musste eine Brücke über einen lebhaften kleinen Bach überquert werden, und hier war es auch gleich wieder grün, der Weg wurde von Bäumen und Gärten gesäumt. Die Baptistenkirche erwies sich als gepflegtes, weiß gestrichenes Gebäude. Der zuständige Reverend begrüßte den Sheriff und stimmte ein Gebet an, um die Ankunft der Kinder in seinem Gotteshaus zu segnen. Mary Ann kannte den Gebettext nicht, sie war katholisch erzogen, aber sie war sowieso zu aufgeregt – und gleichzeitig zu müde –, um die Unterschiede wirklich mitzubekommen.
Der Sheriff führte die Kinder in den Gemeinderaum, der wirklich recht groß war und an einem Ende eine Art Bühne aufwies. Ein paar Frauen erwarteten die Kinder mit einem großen Kessel Eintopf und Brot. Nach der langen Fahrt, auf der es nur Brote gegeben hatte, waren die meisten hungrig, stellten sich jedoch artig an, um ihre Portion in Empfang zu nehmen. Zum Essen setzten sie sich auf den Boden. An Tische und Stühle hatte keiner gedacht.
»Ihr könnt euch dann da oben einrichten«, sagte eine der Frauen und zeigte auf die Bühne. »Da können euch alle gut sehen. Und falls sich jemand waschen will …« Sie rümpfte ein wenig die Nase, die Kinder mussten nach der endlosen Fahrt ziemlich streng riechen. »… draußen ist ein Brunnen. Warmes Wasser können wir nicht bieten, aber es ist ja nicht kalt.«
Die Mädchen, denen die Sisters of Mercy die Kleinkinder anvertraut hatten, kannten ihre Aufgabe. Sie waren angewiesen worden, ihre Zöglinge sauber zu halten, und auch Mary Ann folgte ihnen zum Brunnen. Das Wasser war eisig, doch im Waisenhaus hatte es auch keinen besonderen Komfort gegeben. Nur zum wöchentlichen Bad war das Wasser angewärmt worden. Also wusch sie sich erschauernd Gesicht, Arme und Hände und fuhr auch mit einem Lappen über ihren Körper unter dem Kleid, wie die Nonnen es sie gelehrt hatten. Im Waisenhaus hatten die Mädchen sich niemals ganz ausziehen dürfen. Sogar im Bad behielten sie ein Hemdchen an.
Den Jungen war eine Pferdetränke zum Waschen genannt worden, und Hoss hatte ebenfalls die Gelegenheit genutzt, sich frisch zu machen.
»Die Leute werden uns nicht wollen, wenn wir stinken wie die Tiere«, bemerkte er. »Die haben schließlich die Wahl. Du solltest dir auch die Haare kämmen.«
Mary Ann wirkte hilflos. Sie wusste, dass ihre Zöpfe unordentlich wirkten, während der Reise hatten sich Strähnen gelöst, und die Schleifen waren verrutscht. Ganz allein konnte sie sich das Haar allerdings nicht flechten, die Mädchen hatten das stets gegenseitig füreinander getan. Jetzt hatten die älteren Mädchen jedoch genug mit den Kleinkindern zu tun. Sie spielte mit den halb gelösten Zöpfen.
»Mach sie erst mal ganz auf«, ermutigte Hoss sie. »Und kämm die Haare durch.«
Er blickte fast ehrfürchtig, als sie seiner Anweisung folgte. Das Ergebnis war atemberaubend. Mary Anns ohnehin hübsches Gesicht wurde nun umspielt von seidigen weizenblonden Locken, die ihr weit über den Rücken fielen. Ihre Züge wirkten weicher – im Heim waren die Zöpfe immer sehr straff geflochten worden, es hatte ausgesehen, als zöge man dem Mädchen die Gesichtshaut nach hinten. Jetzt jedoch schien Mary Anns Gesicht gelöst, und ihre hohe Stirn kam ebenso zur Wirkung wie die großen braunen Augen.
»Lass es so«, sagte Hoss heiser. »Die Leute werden sich um dich reißen!«
»Du siehst aber auch gut aus«, meinte Mary Ann, schon um ihn aufzubauen. Dabei hatte sie nicht unrecht. Hoss hatte braunes, lockiges Haar, er wirkte reif für sein Alter, doch nicht hinterhältig und schlau wie andere frühere Straßenkinder, denen der Kampf ums Überleben ins Gesicht geschrieben war. Hoss’ Gesicht wies kaum noch kindliche Rundungen auf, es war klar geschnitten, seine grünen Augen standen weit auseinander. Nach zwei Monaten ordentlicher Ernährung war er nicht mehr mager. Er war größer und wirkte kräftiger als die meisten seiner Altersgenossen.
Inzwischen waren die ersten Interessenten für die Waisenkinder im Gemeindesaal eingetroffen. Die meisten waren einfach gekleidet, die Männer trugen Denimhosen und Stiefel oder Arbeitsschuhe, karierte oder einfarbige Hemden und Leder- oder Wolljacken. Die Kleider der Frauen waren länger und weniger bunt als die der Frauen, die Mary Ann beim Sommerfest im Garten des Heims beobachtet hatte. Sie trugen meist keine Jacken, sondern gestrickte Tücher um die Schultern. Ihr Haar war durchweg aufgesteckt, und Mary Ann schämte sich plötzlich ihrer offen herabhängenden Locken. Sie wollte gerade nach einem Band suchen, um sie wenigstens im Nacken zusammenzufassen, als sie hörte, wie ein Mann zu einer Frau unter den Dörflern etwas sagte.
»Was für ein hübsches kleines Mädchen!«
Die Frau reagierte nicht darauf, eher wirkte der Blick auf ihren Mann etwas strafend, doch Mary Ann entschied sich, ihr Haar zu lassen, wie es war.
Die Betreuer der Waisen wiesen sie jetzt an, sich auf der Bühne so aufzustellen, dass jeder sie gut sehen konnte.
»Wenn jemand Fragen an euch hat, werdet ihr sie höflich beantworten!«, befahl die Frau aus Mary Anns Waggon. Zu den Haaren des Mädchens bemerkte sie nichts. Dennoch war es unangenehm, sich so zur Schau stellen zu müssen. Ein paar der Kinder zappelten unruhig herum, die Kleinen mussten festgehalten werden, um sich nicht hinter den Älteren zu verstecken.
»Du da!« Ein Mann wandte sich an einen der ältesten Jungen. »Hast du Erfahrung mit Vieh?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Bin aus Brooklyn, Mister. Da gibt’s zwar auch ’ne Menge Schweine, aber …«
Ein paar Kinder kicherten, beim Publikum kam der Scherz des Jungen nicht gut an.
»Und du?«, fragte der Mann und richtete sich jetzt an Hoss.
Der schluckte. »Hab schon mal das Pferd vom Trödler geputzt, Sir«, gab er dann so höflich Auskunft, wie die Schwestern im Waisenhaus es ihm eingetrichtert hatten. »Und angespannt. Sonst nichts.«
»Zeig mal deine Muskeln!«
Der Mann hatte keine Hemmungen, aufs Podium zu klettern und Hoss’ Bizeps zu befühlen.
»Taugst nicht zum Schmied«, beurteilte er ihn dann. »Nicht genug Kraft. Dagegen der Frechdachs von eben …« Der Mann ging weiter zu dem kräftigen Jungen, der keine Großtiererfahrung aufzuweisen hatte. Der Fremde schien sich durchaus zuzutrauen, ihn zu zähmen.
»Schau mal, Bobs, was für ein reizendes kleines Mädchen …«
Bei diesen Worten fiel Mary Anns Blick auf ein Paar, das die Reihe der Kinder abschritt. Der Mann wirkte vierschrötig, stark und kritisch, die Frau hatte eine schrille Stimme, lebhafte Mimik und graubraunes Haar, das sich wohl nicht gern zur Hochfrisur bändigen ließ. Ihre Nase war etwas spitz, die Augen waren wach und jetzt ganz offensichtlich interessiert auf Mary Ann gerichtet.
»Wie heißt du denn, Kleines?«, erkundigte sie sich.
Mary Ann knickste und nannte ihren Namen. »Madam«, setzte sie dann noch hinzu. Die Frau lächelte geschmeichelt.
»Iris, wir wollten einen kräftigen Jungen«, bemerkte der Mann. »Wie den da neben dem Mädel …«
Hoss schien zu überlegen, und auch Mary Ann zog ihre Schlüsse. Vielleicht würden diese Leute sie beide mitnehmen! Sie wusste nur nicht, ob sie das wirklich wollte. Weder der Mann noch die Frau sahen so aus, wie sie sich ihre von Gott gesandten, neuen Eltern vorstellte. Hoss war nicht so wählerisch.
»Horace Timber mein Name, Sir!«, stellte er sich ungefragt vor. »Und ich bin sehr kräftig.« Geduldig ließ er zu, wie auch dieser Mann seine Muskulatur einer Prüfung unterzog.
»Mund auf!«, befahl er dann.
»Nun hör aber auf, Waver, das ist doch hier kein Sklavenmarkt!« Der Sheriff griff ein, bevor Hoss’ eventueller Vater auch noch sein Gebiss untersuchte. »Du siehst doch, der Junge ist gesund, und benehmen kann er sich auch.«
»Und meine Schwester ist sehr hübsch und klug und brav«, begann Hoss nun, auch Mary Ann anzupreisen. Dem Mädchen blieb dabei fast das Herz stehen. Wie konnte er sie als seine Schwester ausgeben? Schließlich hatten sie völlig andere Nachnamen und sahen einander auch nicht ähnlich. Hoss schob sie trotzdem nach vorn.
»Wir wollen einen Jungen«, wiederholte der Mann, den der Sheriff mit Waver angesprochen hatte. »Der ein bisschen hilft auf der Farm.«
»Aber das kleine Mädchen … Ist es Kitty nicht wie aus dem Gesicht geschnitten! Als … als wäre sie zurück …« Die Frau klang jetzt fast etwas weinerlich. »Und Ann Marie ist auch ein schöner Name.«
»Mary Ann.« Die Berichtigung rutschte Mary Ann heraus, und sie errötete sofort. »Aber Sie können mich nennen, wie Sie möchten, Madam …«
Die Frau lächelte ihr seltsam und fast verschwörerisch zu. »Du müsstest mich dann aber Mami nennen.«
Der zu ihr gehörige Mann verdrehte die Augen. Mary Ann biss sich auf die Lippen.
Um sie herum interessierten sich die Leute vor allem für die jüngsten Kinder. Eine Frau fragte die kleine Jeannie, ob sie etwas für sie singen könnte. Jeannie war so eingeschüchtert, dass sie weinte. Ihr Patenmädchen Louise war freundlich und geistesgegenwärtig genug, um an ihrer statt ein Kinderlied anzustimmen, was wenigstens Jeannies Tränen trocknete.
»Und du, Mary Ann?«, fragte Mrs. Waver jetzt richtig. Mary Ann war trotzdem erschrocken. »Kitty hatte eine so schöne Stimme …«
»Singen?«, fragte Mary Ann.
Hoss stieß sie an. »Nun mach schon!«
Mary Ann hatte noch nie allein auf einer Bühne gesungen. Verzweifelt versuchte sie, sich zu erinnern, welche Lieder sie in der Kirche gelernt hatte. Das Ave-Maria? Oder das Vaterunser – My Lord’s Prayer? Sie entschied sich schließlich für Letzteres und sang mit eher dünner Stimme.
»Wie süß! Bobs, sie ist so entzückend! Bitte, ich möchte sie haben! Sag doch Ja! Wir nehmen einfach beide, den Jungen und das kleine Mädchen! Stell dir nur vor, wie es an Weihnachten sein wird! Ich kann sie als Engel verkleiden, und sie kann in der Kirche singen! Bobs!!!« Mrs. Wavers Stimme klang bittend, und ihr Mann schien seinen Widerstand aufzugeben. Inzwischen hatten die beiden aber auch schon die Aufmerksamkeit aller sonstiger Anwesender geweckt. Mrs. Waver war das erkennbar egal, Mr. Waver schien es peinlich zu sein.
»Nehmen Sie einfach uns beide, Sir!«, bat Hoss. »Ich werde ein guter Arbeiter sein. Und Mary Ann ein guter … äh … Engel.«
Der Sheriff brach in Gelächter aus. »Du bist richtig, Junge! Und nun gib deinem Herzen schon einen Stoß, Waver! Nach dem, was Iris mitgemacht hat. Und wer möchte denn nicht der Daddy von einem so herzigen kleinen Ding sein?«
Der Haussegen bei den Wavers hing bereits schief, als sie eine Stunde später mit ihrem Pferdewagen aus Lebanon heraus in Richtung ihrer Farm fuhren. Bei Übernahme der Papiere hatte Bob Waver natürlich herausgefunden, dass Hoss bezüglich seiner Verwandtschaft mit Mary Ann gelogen hatte. Eigentlich wollte er daraufhin sofort von der Aufnahme der Kinder zurücktreten, aber Mrs. Waver bestand darauf dabeizubleiben, den Jungen jedoch gleich nach der Ankunft in ihrem Haus für die Lüge abzustrafen. Entsprechend angespannt war die Atmosphäre auf dem Fuhrwerk, das über unbefestigte Straßen durch eine abwechslungsreiche Landschaft rollte. Entlang des Weges fanden sich Wälder und Ackerflächen, und eigentlich hätte es eine schöne Fahrt sein können, zumal die Pferde lebhaft vorwärtsgingen. Doch Mary Ann fürchtete sich, Mr. Waver übte sich in bedrohlichem Schweigen, und Hoss sah der Bestrafung voller Angst entgegen, bemühte sich jedoch um einen unbeteiligten Ausdruck. Auf die Wavers, die seine Art nicht kannten, musste er verstockt wirken. Lediglich Mrs. Waver bemühte sich um ein Gespräch, wobei sie sich allein an Mary Ann wandte.
»Du warst also im Waisenhaus. War es sehr schlimm, Kleines?«, fragte sie mitfühlend.
Mary Ann schüttelte den Kopf. »Nein, Mrs. Waver, danke, Mrs. Waver …« Sie wusste nicht, wofür sie sich jetzt konkret bedankte, aber Schwester Katherine hatte ihr empfohlen, ihre möglichen neuen Eltern möglichst oft ihrer Dankbarkeit zu versichern.
»Mami!«, berichtigte Mrs. Waver. »Ich bin jetzt deine Mutter, Liebes. Du kannst Mami zu mir sagen.«
Mary Ann gab keine Antwort. Mami – das war die wunderschöne Frau in dem silbernen Ballon auf dem Weg zum Himmel. Allem in ihr widerstrebte es, diesen Namen für die magere, etwas vogelartige Frau mit den scharfen Augen und dem seltsam graubraunen Schopf zu verwenden.
»Weißt du denn etwas über deine richtigen Eltern?«, fragte Mrs. Waver. »Deinen Vater?«
»Den kenne ich nicht, M…«
Mrs. Waver sprach zum Glück schon weiter, bevor sie sich für eine Anrede entscheiden konnte.
»Und deine Mutter, Mary Ann?«
»Die ist im Himmel …« Mary Ann dachte an das Foto in ihrer Reisetasche.
»Armes Kind!«, sagte Mrs. Waver mitfühlend. »Wie lange warst du denn im Heim?«
»Schon immer«, gab Mary Ann Auskunft und setzte nach kurzer Überlegung noch ein »Mutter« hinzu.
»Mami!«, beharrte Mrs. Waver. »Schau mal, hier beginnt unser Land.«
Die Farm der Wavers war nicht eingezäunt, nur die Weiden für die Tiere wiesen ordentliche weiße Holzzäune auf. Der Zufahrtsweg führte an Äckern und Wiesen vorbei und war von Bäumen gesäumt. Über den Hügeln im Hintergrund ging eben die Sonne unter und tauchte den Himmel in die verschiedensten Töne von Rot und Gold. Es war sehr schön, Mary Ann hatte so etwas nie zuvor gesehen.
»Und da ist die Farm!«
Das Farmhaus war nicht groß, wirkte jedoch anheimelnd. Es bestand aus Holz, war weiß gestrichen und mit einem roten Satteldach versehen. Daneben gab es Ställe und eine Scheune. Ein struppiger Hund tauchte aus seiner Hütte auf und bellte schwanzwedelnd, um seine Besitzer zu begrüßen.
»Vorsicht, Blueboy!«, wehrte Mrs. Waver ihn ab, als er auch an Mary Ann hochspringen wollte. »Fass ihn nicht an, Mary Ann, womöglich hat er Flöhe!«
Mr. Waver schnaubte beleidigt. Der Hund schmiegte sich an Hoss, als der ihn streichelte.
»Komm mit und hilf mir ausspannen!«, wies Mr. Waver den Jungen an.
Mrs. Waver holte einen Korb mit Einkäufen vom Wagen und ging mit Mary Ann direkt ins Haus. Es war gänzlich anders als die großen Häuser in New York. Die Haustür öffnete sich nicht zu einem Vestibül, sondern zu einem engen Korridor, in dem man feuchte Mäntel und Jacken lassen konnte und auch die Schuhe und Stiefel auszog. Mary Ann trug feste Schuhe und musste sich etwas anstrengen, die Schnürsenkel zu lösen, zumal die Schuhe neu waren. Auf Strümpfen folgte sie dann Mrs. Waver ins Haus und gelangte gleich in eine Art Wohnküche, beherrscht von einem Esstisch mit mehreren Stühlen, dazu natürlich ein Herd, eine Arbeitsplatte und ein Spülbecken. Regale und Schränke dienten zur Aufnahme von Töpfen und Pfannen und irdenem Geschirr.
»Ich mache uns erst mal etwas zu essen«, meinte Mrs. Waver, während Mary Ann die restliche Einrichtung betrachtete. Sie bestand aus zwei Schaukelstühlen vor einem offenen Kamin und einer Art Schreibtisch mit einem Stuhl davor. Eine Treppe führte in den oberen Stock, eine Hintertür öffnete sich zu einer Veranda. Im Sommer spielte sich das Leben sicher eher dort ab als drinnen.
»Oder willst du zuerst dein Zimmer sehen?«, fragte Mrs. Waver eifrig. »Das möchtest du sicher! Du hast ein wunderschönes Zimmer!«
Mary Ann wunderte sich – und fühlte sich unwohl. Die Wavers hatten einen Jungen adoptieren wollen. Nahm sie nun also Hoss sein Zimmer weg?
Artig folgte sie Mrs. Waver über die Stiege, wo von einem Korridor aus zwei Türen abgingen. Eine davon öffnete ihre neue Pflegemutter eifrig – und Mary Ann wurde sofort klar, dass dieser Raum niemals für einen halbwüchsigen Jungen bestimmt gewesen war. Es ähnelte eher einem Babyzimmer – einen der Schränke hätte Mary Ann sogar als Wickelkommode bezeichnet. Der andere war ein hübscher gelb-blau gestrichener Kleiderschrank. Neben einem Gitterbett stand wieder ein Schaukelstuhl, abgedeckt mit einem bunten Quilt, wahrscheinlich von der Hausherrin selbst genäht. Ein solcher diente auch als Tagesdecke in dem Bettchen …
Aber Mrs. Waver konnte doch nicht wirklich glauben, Mary Ann könnte in dem kleinen Kinderbett schlafen!
Der Frau schien das jetzt erst aufzufallen. »Oh ja«, sagte sie zerstreut. »Du bist natürlich gewachsen … aber das macht nichts, Bobs wird dir morgen ein neues Bett zimmern, solange … wenn ich vielleicht die Matratze herausnehme und auf den Boden lege … und drumherum ein paar Decken …«
»Wem … wem gehört denn das Zimmer, Mutter?«, fragte Mary Ann leise. Es musste eine frühere Bewohnerin gegeben haben.
»Mami!«, beharrte Mrs. Waver und rieb sich die Stirn, bevor sie Erklärungen abgab. »Das war das Zimmer von meiner Kitty. Aber sie ist … sie ist gestorben …« Ihre Hand fuhr über ihre Augen, doch dann lächelte sie wieder und sah Mary Ann an. »Dafür hat mir der Herr jetzt dich geschickt.« Sie bekreuzigte sich. »Du wirst sie ersetzen. Sie war genauso blond wie du, so hübsch …« Ihr Blick schien sich nach innen zu richten.
Mary Ann spürte, wie sich eine Last auf ihre Seele legte. Sie hatte gleich gewusst, dass etwas seltsam war … Mrs. Waver hatte sich nicht in Mary Ann verliebt, sondern in das Bild ihrer verstorbenen Tochter.
»Nun komm«, sagte sie jetzt. »Wir müssen etwas zu essen auf den Tisch bekommen, sonst wird Bobs ungeduldig. Und dann wird die Strafe für den Jungen härter ausfallen …«
Mary Ann schluckte. Über die Sache mit dem Zimmer hatte sie Hoss’ Bestrafung ganz vergessen, doch jetzt empfand sie wieder eine vage Furcht. Im Waisenhaus war die Ankündigung von Strafe in aller Regel gleich auf das Vergehen gefolgt, und meist war sie sofort vollstreckt worden. Dabei hatte man sich nicht allzu sehr davor fürchten müssen. Die Sisters of Mercy hatten ihre Zöglinge praktisch nie geschlagen. Häufiger hatten sie in der Ecke stehen, zusätzliche Arbeitsaufgaben erledigen oder ohne Abendessen ins Bett gehen müssen. Mary Ann war all das nie passiert. Doch jetzt lag so etwas wie Gewalt in der Luft.
Sie atmete auf, als sie unten in der Küche einen unversehrten Hoss vorfand, der sich eben in der Spüle die Hände wusch. Die Kinder wechselten kurze Blicke. Dann halfen sie beim Tischdecken, wie Mrs. Waver befahl, und gleich darauf war zumindest Hoss mit den neuen Pflegeeltern vorerst versöhnt. Das Essen, das Mrs. Waver auffuhr, übertraf alles, was er je an Lebensmitteln gesehen hatte. Auf dem Tisch standen Platten mit Wurst und Käse, eingelegte Kürbisse und Gurken sowie ein Fässchen Butter, sicher selbst geschlagen. Mrs. Waver briet zudem Eier, gab Schinken dazu und schnitt einen großen Laib Brot auf. Sie füllte Gläser mit Milch und Eistee – für Mr. Waver gab es einen Krug Bier. Hoss konnte sich an alldem kaum sattsehen, doch bevor er zugreifen durfte, musste natürlich ein Tischgebet gesprochen werden.
»Wir gehen übrigens nicht in die Baptistenkirche«, erklärte Mrs. Waver danach. »Wir sind Methodisten. Du wirst die Sonntagsschule besuchen, Mary Ann, dann lernst du die Gemeinde besser kennen …«
Mary Ann sagten die verschiedenen Glaubensrichtungen nichts, sie hatte nie von einer anderen Kirche gehört als der katholischen. Hoss war gar nicht zur Kirche gegangen – außer gelegentlich, um die Gottesdienstbesucher zu bestehlen. Dabei hatte er sich einige Grundlagen der Liturgie gemerkt, um nicht negativ aufzufallen.
»Habt ihr im Heim gebetet?«, fragte Mrs. Waver.
Mary Ann nickte. »Ganz viel«, sagte sie ehrlich.
»Und du trägst Jesus in deinem Herzen?«, wollte ihre Pflegemutter wissen.
Mary Ann erinnerte sich an ein entsprechendes Kindergebet und nickte erneut. Inzwischen war ihr Mund auch zu voll, um zu sprechen. Bis der Tisch gedeckt worden war, hatte sie keinen Hunger gehabt, nun war das Essen einfach zu verlockend. Hoss stopfte sich hemmungslos voll. Er schien die bevorstehende Bestrafung vergessen zu haben, Mr. Waver hatte ihn wohl nicht noch einmal daran erinnert.
Die Sache kam allerdings wieder zur Sprache, als alle satt waren und Mr. Waver ein Dankgebet sprach.
»Doch nun, Herr«, führte er aus, als Mary Ann eigentlich schon annahm, er sei fertig, »habe ich noch eine unschöne Pflicht zu erfüllen, der ich mich dennoch in deinem Namen aufrichtig widme. Du hast uns heute zwei Kinder geschickt, mit der Aufgabe, sie zu ordentlichen Christenmenschen zu erziehen – doch eines von ihnen hat sich gleich bei ihrer Ankunft einer Sünde schuldig gemacht. Einer schweren Sünde, der Sünde des falsch Zeugnisredens. Der Knabe Horace kam als Lügner in unser Haus, doch ich verspreche dir, er wird geläutert werden. Horace, steh auf! Gestehst du, dass du gelogen hast?«
Hoss kam der Aufforderung nach. »Ich hab’s aber nicht so gemeint«, entschuldigte er sich. »Ich wollte nur Mary Ann nicht verlassen. Ich hatte ihr versprochen, auf sie aufzupassen.«
»Auf sie aufzupassen?«, donnerte Mr. Waver. »Wovor meintest du denn sie beschützen zu müssen? Wie ist überhaupt euer Verhältnis zueinander? Du hegst nicht etwa unzüchtige Gedanken bezüglich dieses Kindes?«
»Er ist so was wie mein Bruder«, kam Mary Ann ihm zu Hilfe. »Er …«
»Versündige du dich nicht auch noch!«, fuhr Waver sie an. »Der Junge und du, ihr seid nicht verwandt. Und ihr werdet euch von nun an voneinander fernhalten. Doch jetzt …« Er löste seinen Gürtel, den eine schwere silberne Schnalle zierte. »Mach den Rücken frei, Horace, auf dass ich dich züchtige!«
Hoss warf einen entsetzten Blick auf die Schnalle. Wenn er damit zuschlug …
»Nein!« Mary Ann warf sich zwischen ihn und den Mann. »Nein, bitte, bitte, das dürfen Sie nicht … darfst du nicht, Vater Waver. Bitte lass ihn in Ruhe, er kann doch um Verzeihung bitten und beichten!« Bei den Schwestern war das eine sichere Methode gewesen, Vergebung zu erlangen. Man musste dazu allerdings zunächst die heilige Kommunion gefeiert haben, was bei Mary Ann bislang nicht der Fall war.
»Er wird noch um Verzeihung flehen!«, erklärte Waver und schlug einmal versuchsweise mit dem Gürtel in die Luft.
»Nein, Sie werden ihm wehtun, bitte, bitte, nicht so schrecklich wehtun!« Mary Ann flehte jetzt schon, während Hoss stoisch blieb, obwohl Angst in seinen Augen stand.
Und dann schnellte der Gürtel wirklich auf seinen ungeschützten Rücken herab und hinterließ einen roten Striemen, der sofort aufplatzte, wo die Schnalle getroffen hatte.
Mary Ann war außer sich, als sie das Blut sah. Aber vielleicht konnte ja ihre neue Mutter etwas tun …
»Bitte! Bitte, Mutter!« Sie blickte in Mrs. Wavers versteinertes Gesicht. Die Züchtigung mochte der Frau nicht gefallen, doch sie schien sich nicht einmischen zu wollen.
Mary Ann griff zu einem letzten Strohhalm. Sie lief zu Mrs. Waver, ergriff ihre Hand und verbarg ihr Gesicht verzweifelt in den Falten ihrer Schürze.
»Mami!«, flehte sie.
Mrs. Waver schob sie sanft von sich. Dann wandte sie sich an ihren Gatten. »Bobs, ich denke, das reicht. Schließlich ist es das erste Mal, dass er sich etwas zuschulden kommen lässt, und wie Mary Ann schon sagt, er hat es nur gut gemeint. Womöglich wirkte ja sogar Gott durch ihn …«
Robert Waver ließ den Gürtel sinken.
»Na schön«, sagte er unwillig. »Wollen wir es darauf beruhen lassen. Geh nun zu Bett, Junge, bete und gestehe dem Herrn deine Sünden. Morgen um vier sind wir im Stall. Die Kühe wollen gemolken werden. Und sündige hinfort nicht mehr!«
Letzteres klang so wichtig wie die Worte des Pfarrers in der Kirche, doch Mary Ann war nicht beeindruckt, sondern nur erleichtert.
Hoss zog sein Hemd wieder an, wünschte allgemein artig Gute Nacht und ging dann nach draußen – anscheinend hatte man ihm im Stall eine Schlafstelle angewiesen.
»Danke«, flüsterte er, als er an Mary Ann vorbeikam. Er wusste nicht, wie viel sie seine Rettung gekostet hatte.
Mary Ann verbrachte die Nacht auf Kitty Wavers für sie viel zu kleiner Matratze, hielt das Bild ihrer Mutter an sich gedrückt und weinte sich in den Schlaf.
KAPITEL 4
»Und so möchte ich denn mit der etwas persönlichen Bemerkung schließen, dass Gasnebel und Doppelsterne zu den faszinierendsten Erscheinungen im Weltraum zählen, und besonders Erstere zählen für mich zu den schönsten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier ein paar neue Einblicke in die Abbildung dieser Phänomene durch die Astrofotografie und ihre Auswertung mittels Spektralanalyse ermöglichen. – Vielen Dank, Miss Peak-Juston, für die Bedienung des Projektors. Es ist wirklich hilfreich, einen Vortrag mit Bildern auflockern zu können und damit die Erklärungen nachvollziehbarer zu machen. Und zu guter Letzt kann ich nicht unerwähnt lassen, dass all die Phänomene, die ich hier vorgestellt habe, von mir oder meinen Mitarbeiterinnen bei den Harvard Computers analysiert worden sind. Hier haben das Auge und die Rechenleistung von Frauen gewirkt – und Sie werden nicht leugnen wollen, dass unsere Astronominnen ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen. Nochmals meinen besonderen Dank an Professor Edward Pickering, der unsere Abteilung ins Leben gerufen hat und uns all unsere wissenschaftlichen Vorstöße ermöglicht!«
Ailis Hay stand auf und applaudierte ihrem Mentor, einem inzwischen weißhaarigen Mann, dessen ovales Gesicht immer noch von einem Backenbart und wachen, freundlichen Augen beherrscht wurde. Ihre Freundin und Lebensgefährtin Molly Peak-Juston verdrehte dabei ein wenig die Augen. Sie fand es überflüssig, dass Ailis den Professor immer noch in jedem ihrer Vorträge erwähnte, obwohl sie es inzwischen selbst zu großem Bekanntheitsgrad im Bereich der Astronomie und der Spektralanalyse gebracht hatte. Sie hatte bei der Auswertung von Fotoplatten Hunderte von neuen Sternen entdeckt, dabei viele Doppelsterne und vor allem ihren gemeinsamen Liebling, den sogenannten Eichhörnchennebel im Orionbild.
Ailis war eine außergewöhnlich begabte Mathematikerin, und schon in ihrer Kindheit in Schottland hatte der Sternenhimmel sie fasziniert. Ihr größter Wunsch, nach erfolgtem Abschluss der renommierten schottischen Mädchenschule St. Leonhards Astronomie studieren zu dürfen, hatte sich jedoch nicht erfüllt. Ihre Eltern hatten sie aus familienpolitischen Gründen mit dem jungen Adligen Cuthbert Hay vermählt, mit dem sie dann in die USA auswanderte. Es war Glück im Unglück, dass es sie nach Boston verschlug, wo Cuthbert sich zunächst als Fotograf versuchte, bevor er – mit Ailis’ Mitgift – ein Theater, die Boston Music Hall, erwarb. Kurz darauf verließ er seine schwangere Frau, und Ailis musste sehen, wie sie sich und ihr Kind allein durchbrachte. Professor Pickering erwies sich dabei als ihre Rettung. Er stellte sie zunächst als Haushälterin, dann als Sekretärin ein, und inzwischen leitete sie die Analyseabteilung der Harvard Computers und das Archiv mit vielen Tausend fotografischen Platten.
Ihre Dankbarkeit kannte deshalb keine Grenzen.
Allerdings war Ailis auch selbstbewusst genug, um den weitergehenden Applaus für ihren Vortrag auf sich selbst zu beziehen und freudig anzunehmen. Sie hatte sich lange hinter dunkler Kleidung und langweiligen Frisuren und Hüten versteckt, um bloß nicht den Eindruck zu erwecken, sie verdanke ihre Karriere ihrer zur Schau gestellten Weiblichkeit. Tatsächlich war eher das Gegenteil der Fall, wie jeder wusste, der die Welt der Wissenschaft auch nur ein wenig kannte. Frauen hatten es schwer, sich durchzusetzen und in leitende Stellungen zu gelangen. Auch Molly, eine der wenigen Frauen, die Astronomie studiert hatten, verdankte ihre Stellung allein Edward Pickering, der sie gefördert und bei der Erstellung seines spektakulären Sternenkatalogs hinzugezogen hatte.
Wenn Ailis jetzt die Blicke über ihr Publikum schweifen ließ, so erkannte sie unter den Teilnehmern der Tagung nur ein oder zwei weibliche Gesichter – obendrein alles sogenannte Harvard Computers, die nur deshalb die Möglichkeit hatten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, weil sie in Boston stattfand. Die Reisekosten zu entfernten Tagungsorten – Astronomen trafen sich in allen möglichen Städten der Welt – wurden von der Universität allenfalls dann übernommen, wenn eine Frau bereits über einen gewissen Berühmtheitsgrad verfügte, wie Ailis und Molly.
»Du warst großartig!«, erklärte Molly, als der Applaus langsam abflaute und der Saal sich zu leeren begann. Sie musste noch ihren Projektor einpacken und nutzte die Zeit wie immer zu einer kleinen Reflexion von Ailis’ Vortrag. »Wirklich, du wirst immer besser. Du redest mitreißend, deine Stimme ist nicht mehr gepresst wie früher, und man hört dir an, wie viel Spaß es dir macht, die Sterne zu erforschen. Wir sollten solche Vorträge an Mädchenschulen halten. Dann würden sich vielleicht mehr Mädchen für Mathematik und Astronomie interessieren.«
Molly war feministisch engagiert und setzte sich für Frauenrechte und Mädchenbildung ein, wo immer es ihr möglich war. Ailis unterstützte sie dabei, doch wenn sie ehrlich war, hatte sie abgesehen von der Erforschung des Weltraums nicht viele Interessen. Sie liebte ihren Sohn Nicolas, den alle Copper nannten aufgrund der vom Vater geerbten roten Haare, aber weitere Kinder hatte sie nie gewollt. Bei Molly sah das anders aus. Sie hätte gern Kinder gehabt, dabei stand ihr aber die Liebe zu Frauen im Wege. Molly hatte von Jugend an gewusst, dass sie mit einer Frau zusammen sein wollte, Ailis hatte das erst nach der Trennung von Cuthbert entdeckt. Molly und sie führten seit vielen Jahren eine glückliche Beziehung.
»Ich kann Ihrer Mitarbeiterin da nur recht geben«, sagte plötzlich eine Männerstimme. Während die Frauen redeten, war ein weißhaariger, kräftiger Mann aufs Podium gekommen. Er hatte ein einnehmendes Lächeln in einem kantigen Gesicht, und sein Haar umspielte es ungezähmt. »Gestatten, mein Name ist Robert Ivans. Ich bin ein Landsmann von Ihnen, Mrs. Hay. Und ein Bewunderer.«